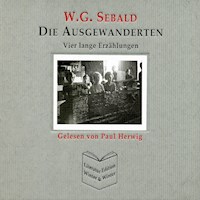Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Das Vermächtnis eines großen Erzählers: Im Mittelpunkt stehen Teile von W. G. Sebalds unvollendetem Prosawerk, an dem er in den letzten Monaten seines Lebens arbeitete. Außerdem enthält der Band eine Zusammenstellung von Essays zur Literatur, die noch einmal Sebalds Vorlieben dokumentieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 297
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Das Vermächtnis eines großen Erzählers: Im Mittelpunkt stehen Teile von W. G. Sebalds unvollendetem Prosawerk, an dem er in den letzten Monaten seines Lebens arbeitete. Außerdem enthält der Band eine Zusammenstellung von Essays zur Literatur, die noch einmal Sebalds Vorlieben dokumentieren.
W. G. Sebald
Campo Santo
Herausgegeben von Sven Meyer
Carl Hanser Verlag
Prosa
Kleine Exkursion nach Ajaccio
Im September vergangenen Jahres, während eines zweiwöchigen Ferienaufenthalts auf der Insel Korsika, bin ich einmal mit einem blauen Linienbus die Westküste hinab nach Ajaccio gefahren, um mich in dieser Stadt, von der ich nichts wußte, außer daß der Kaiser Napoleon in ihr auf die Welt gekommen ist, ein wenig umzusehen. Es war ein schöner, strahlender Tag, die Zweige der Palmen auf der Place Maréchal-Foch bewegten sich leicht in einer vom Meer hereinkommenden Brise, im Hafen lag wie ein großer Eisberg ein schneeweißes Kreuzfahrerschiff, und ich wanderte in dem Gefühl, daß ich frei sei und ledig, in den Gassen herum, betrat hier und da einen der dunklen, stollenartigen Hauseingänge, las mit einer gewissen Andacht die Namen der fremden Bewohner auf den blechernen Briefkästen und versuchte mir vorzustellen, wie es wohl wäre, wenn ich in einer dieser steinernen Burgen wohnte, bis an mein Lebensende mit nichts beschäftigt als dem Studium der vergangenen und der vergehenden Zeit. Weil aber keiner von uns wirklich still nur für sich sein kann und wir alle immer etwas mehr oder weniger Sinnvolles vorhaben müssen, wurde das in mir aufgetauchte Wunschbild von ein paar letzten, an keinerlei Verpflichtung gebundenen Jahren bald schon verdrängt von dem Bedürfnis, den Nachmittag irgendwie auszufüllen, und also fand ich mich, kaum daß ich wußte, wie, in der Eingangshalle des Musée Fesch mit Notizbuch und Bleistift und einem Billett in der Hand.
Joseph Fesch war, wie ich später in meinem alten Guide Bleu nachlas, der Sohn einer späten zweiten Ehe der Mutter Letizia Bonapartes mit einem in genuesischen Diensten stehenden Schweizer Offizier gewesen und somit ein Stiefonkel Napoleons. Zu Beginn seiner ekklesiastischen Karriere versah er ein unbedeutendes Kirchenamt in Ajaccio. Nachdem er aber von seinem Neffen zum Erzbischof von Lyon und Generalbevollmächtigten am Heiligen Stuhl ernannt worden war, entwickelte er sich zu einem der unersättlichsten Kunstsammler seiner Zeit, einer Zeit, in der der Markt im wahrsten Sinne des Wortes überflutet war mit Gemälden und Artefakten, die während der Revolution aus Kirchen, Klöstern und Schlössern geholt, den Emigrés abgenommen und bei der Plünderung der holländischen und italienischen Städte erbeutet wurden.
Fesch beabsichtigte nichts weniger, als mit seiner privaten Sammlung den gesamten Verlauf der europäischen Kunstgeschichte zu dokumentieren. Es ist nicht genau bekannt, wie viele Bilder er tatsächlich besaß, aber es sollen an die dreißigtausend gewesen sein. Unter dem, was nach seinem 1838 erfolgten Tod und nach diversen Winkelzügen des mit der Testamentsvollstreckung beauftragten Joseph Bonaparte in das eigens in Ajaccio gebaute Museum gelangte, befinden sich eine Madonna von Cosimo Tura, Botticellis Jungfrau unter einer Girlande, Pier Francesco Cittadinis Stilleben mit türkischem Teppich, Spadinos Gartenfrüchte mit Papagei, Tizians Porträt des jungen Manns mit dem Handschuh und andere wundervolle Gemälde.
Am schönsten von allen dünkte mich an jenem Nachmittag ein Bild von Pietro Paolini, der in Lucca gelebt und gearbeitet hat im siebzehnten Jahrhundert. Es zeigt vor einem tiefschwarzen, nur gegen die linke Seite in ein sehr dunkles Braun übergehenden Hintergrund eine vielleicht dreißigjährige Frau. Sie hat große, schwermütige Augen und trägt ein nachtfarbenes, von dem sie umgebenden Dunkel nicht einmal ahnungsweise sich abhebendes, also eigentlich unsichtbares und dennoch mit jeder Falte und Verwerfung des Stoffes gegenwärtiges Kleid. Um ihren Hals liegt eine Kette von Perlen. Mit dem rechten Arm umfaßt sie schützend ihre kleine Tochter, die, seitwärts, zum Bildrand gewendet, vor ihr steht, dem Betrachter aber ihr ernstes Gesicht, auf dem eben erst die Tränen getrocknet scheinen, zukehrt in einer Art stummer Herausforderung. Das Mädchen hat ein ziegelrotes Kleid an, und rot gekleidet ist auch die kaum drei Zoll große Soldatenpuppe, die sie uns entgegenhält, sei es zur Erinnerung an ihren ins Feld gezogenen Vater, sei es zur Abwehr unseres bösen Blicks. Lange habe ich vor diesem Doppelporträt gestanden und in ihm, wie ich damals glaubte, das ganze unergründliche Unglück des Lebens aufgehoben gesehen.
Vor dem Verlassen des Museums bin ich noch in das Souterrain hinuntergegangen, wo eine Sammlung napoleonischer Memorabilien und Devotionalien ausgestellt ist. Es gibt dort mit Napoleonköpfen und Initialen verzierte Brieföffner, Petschafte, Federmesser, Tabaks- und Schnupftabaksdosen, Miniaturen der gesamten Verwandtschaft und der Mehrzahl der Nachgeborenen, Schattenrisse und Biskuitmedaillons, ein mit einer ägyptischen Szene bemaltes Straußenei, bunte Fayenceteller, Porzellantassen, Gipsbüsten, Alabasterfiguren, eine Bronze von Bonaparte zuoberst auf einem Dromedar und, unter einem beinahe mannshohen Glassturz, einen frackartigen, mit roten Bordüren und zwölf Messingknöpfen versehenen, von den Motten abgefressenen Uniformrock — l’habit d’un colonel des Chasseurs de la Garde, que porta Napoléon Ier.
Außerdem sind zu sehen zahlreiche aus Speckstein und Elfenbein geschnittene Skulpturen des Kaisers, die ihn zeigen in den bekannten Posen und die, von zirka zehn Zentimeter angefangen, immer winziger werden, bis fast nichts mehr zu sehen ist als ein blindes Fleckchen Weiß, der erlöschende Fluchtpunkt vielleicht der Menschheitsgeschichte. Eine dieser diminutiven Figuren stellt den abgedankten Napoleon dar sur le rocher de l’île de Sainte-Hélène. Er sitzt, kaum mehr als erbsengroß, in Mantel und Dreispitz rittlings auf einem Sesselchen, das plaziert ist auf dem Gipfel eines tatsächlich von der Insel des Exils stammenden Tuffsteinbrockens, und blickt mit gefurchter Braue hinaus in die Ferne. Wohl ist es ihm dort, mitten im öden Atlantik, gewiß nicht gewesen, und er wird sie vermißt haben, die Aufregung seines vergangenen Lebens, zumal selbst auf die wenigen Getreuen, die ihn in seiner Einsamkeit noch umgaben, anscheinend kein rechter Verlaß gewesen ist.
So zumindest konnte man das schließen aus einem am Tag meines Besuchs im Musée Fesch im Corse-Matin erschienenen Artikel, in dem ein gewisser Professor René Maury behauptete, eine in den Laboratorien des FBI durchgeführte Untersuchung einiger Haupthaare des Kaisers habe zweifelsfrei ergeben, que Napoléon a lentement été empoisonné à l’arsenic à Sainte-Hélène, entre 1817 et 1821, par l’un de ses compagnons d’exil, le comte de Montholon, sur l’instigation de sa femme Albine que était devenue la maîtresse de l’empereur et s’est trouvée enceinte de lui. Ich weiß nicht recht, was man von solchen Geschichten halten soll. Der Napoleonmythos hat ja die erstaunlichsten, stets auf unumstößliche Tatsachen sich berufenden Geschichten hervorgebracht. So erzählt Kafka beispielsweise, daß er am 11. November 1911 auf einer Conférence zum Thema La Légende de Napoléon im Rudolphinum gewesen sei und daß dort ein gewisser Richepin, ein starker Fünfziger mit Taille und einer steif herumwirbelnden und zugleich fest an den Schädel geklebten Daudetfrisur, unter anderem behauptet habe, das Grab Napoleons sei früher jedes Jahr einmal geöffnet worden, damit die vorbeidefilierenden Invaliden den einbalsamierten Kaiser anschauen konnten. Da aber sein Gesicht schon ziemlich aufgedunsen und grünlich gewesen sei, habe man später den Brauch des alljährlichen Graböffnens abgeschafft. Richepin selbst, so Kafka, sah den toten Kaiser aber noch auf dem Arm seines Großonkels, der in Afrika gedient hatte und für den der Kommandant das Grab eigens aufmachen ließ. Im übrigen sei die Conférence, so heißt es in der Eintragung Kafkas weiter, zum Abschluß gebracht worden mit dem Schwur des Vortragenden, daß noch in tausend Jahren jedes Stäubchen seines Leichnams, falls es Bewußtsein hätte, bereit sein würde, dem Ruf Napoleons zu folgen.
Nachdem ich das Museum des Kardinals Fesch verlassen hatte, saß ich eine Zeitlang auf einer steinernen Bank auf der Place Letizia, die eigentlich nur ein kleiner, zwischen hohen Häusern gelegener Baumgarten ist, wo Eukalyptus und Oleander, Fächerpalmen und Lorbeer und Myrten eine Oase bilden inmitten der Stadt. Der Garten ist durch ein eisernes Gitter getrennt von der Gasse, auf deren anderer Seite die geweißelte Front der Casa Bonaparte emporragt. Die Fahne der Republik hing über dem Tor, durch das in einem ziemlich stetigen Strom die Besucher aus und ein gingen. Holländer und Deutsche, Belgier und Franzosen, Österreicher und Italiener und einmal eine ganze Gruppe sehr vornehmer alter Japaner. Die meisten von ihnen hatten sich wieder verlaufen, und der Nachmittag neigte sich bereits seinem Ende zu, als ich endlich das Haus betrat. Die dämmrige Vorhalle war verlassen. Auch der Platz an der Kasse schien leer. Erst als ich unmittelbar vor dem Tresen stand und gerade meine Hand ausstreckte nach einer der dort ausgestellten Ansichtskarten, sah ich, daß hinter dem Tresen in einem schwarzledernen zurückgekippten Bürosessel eine jüngere Frau saß, ja, beinahe hätte man sagen können, lag.
Man mußte förmlich über den Tresenrand zu ihr hinunterschauen, und dieses Hinunterschauen auf die wahrscheinlich nur vom vielen Stehen ausruhende und vielleicht ein wenig eingeschlummerte Kassiererin der Casa Bonaparte war einer jener seltsam zerdehnten Augenblicke, an die man sich Jahre später noch manchmal erinnert. Als die Kassiererin sich erhob, zeigte es sich, daß sie eine Dame war von sehr stattlichem Format. Man konnte sie sich vorstellen auf einer Opernbühne, wie sie, erschöpft vom Drama ihres Lebens, lasciate mi morir oder sonst eine letzte Arie singt. Weit eigenartiger aber als das Divamäßige ihrer Erscheinung war ihre erst auf den zweiten Blick deutlich werdende, dann freilich umso verblüffendere Ähnlichkeit mit dem Franzosenkaiser, in dessen Geburtshaus sie als Türhüterin amtierte.
Sie hatte dasselbe rundliche Gesicht, dieselben großen, stark hervortretenden Augen, dasselbe in spitz zulaufenden Fransen ihr in die Stirn fallende falbe Haar. Als sie mir mein Eintrittsbillett aushändigte und merkte, daß ich meine Augen nicht von ihr abwenden konnte, lächelte sie mich nachsichtig an und sagte mit einer geradezu verführerischen Stimme, der Rundgang durch das Haus beginne im zweiten Stock. Ich stieg die schwarze Marmortreppe hinauf und war nicht wenig verwundert, als mich an ihrem oberen Absatz eine weitere Dame empfing, die anscheinend gleichfalls der napoleonischen Linie entstammte beziehungsweise irgendwie mich erinnerte an Masséna oder Mack oder sonst einen jener legendären französischen Feldherren, wahrscheinlich weil ich mir diese von jeher als ein Geschlecht von zwergenhaften Heroen vorgestellt hatte.
Die Dame nämlich, die mich oben an der Treppe erwartete, war von auffallender untersetzter Statur, ein Erscheinungsbild, das noch akzentuiert wurde durch ihren kurzen Hals und sehr kurze, kaum bis zu den Hüften ihr reichende Arme. Überdies trug sie die Farben der Trikolore, einen blauen Rock, eine weiße Bluse und einen roten, die Mitte ihres Leibes umspannenden Gürtel, dessen mächtige, messingglänzende Schnalle etwas ausgesprochen Militärisches an sich hatte. Als ich die obersten Stufen erreicht hatte, trat die Marschallin mit einer Halbwendung beiseite und sagte: Bonjour Monsieur, auch sie mit einem leicht ironischen Lächeln, mit dem sie mir, wie ich meinte, bedeutete, daß sie weit mehr wisse, als ich jemals zu erahnen vermöchte. Einigermaßen konsterniert von der mir unerklärlichen Begegnung mit diesen beiden diskreten Botschafterinnen aus der Vergangenheit, wanderte ich eine Weile planlos in den Zimmern herum, ging in den ersten Stock hinunter und kam wieder in den zweiten herauf. Erst nach und nach reimten sich mir die Einrichtungsgegenstände und Ausstellungsstücke zusammen.
Insgesamt war alles noch so, wie Flaubert es in seinem korsischen Reisetagebuch beschrieben hatte: eher bescheidene Räume, ausgestattet im Geschmack der Republik, ein paar Lüster und Spiegel aus Venezianer Glas, inzwischen fleckig geworden und blind; sanftes Halbdunkel, denn wie damals, als Flaubert hier gewesen war, standen jetzt zwar die Flügel der hohen Fenster weit offen, doch die dunkelgrünen Jalousieläden hatte man zugemacht. In weißen Leiterstreifen lag das Sonnenlicht auf dem Eichenparkett. Es war, als sei seither keine Stunde vergangen. Von den von Flaubert erwähnten Dingen fehlte bloß der kaiserliche Umhang mit den goldenen Bienen, den er seinerzeit aus dem Chiaroscuro hervorleuchten sah. Still lagen in den Vitrinen Familiendokumente, ausgefertigt in schön geschwungenen Buchstaben, die beiden Jagdflinten Carlo Bonapartes, ein paar Pistolen und ein Florett.
An den Wänden hingen Kameen und andere Miniaturen, eine Reihe kolorierter Stahlstiche der Schlachten von Friedland, Marengo und Austerlitz sowie, in einem schweren mit Blattgold belegten Rahmen, ein Stammbaum der Familie Bonaparte, vor dem ich zuletzt stehenblieb. Gegen einen himmelblauen Hintergrund ragte aus brauner Erde eine riesige Eiche empor, an deren Ästen und Zweigen weiße, aus Papier ausgeschnittene und mit den Namen und Lebensdaten sämtlicher Mitglieder des kaiserlichen Hauses und der späteren Napoleoniden beschriftete Wölkchen hingen. Alle waren sie hier versammelt, der König von Neapel, der König von Rom und der König von Westphalen, Marianne Elisa, Maria Annunciata und Marie Pauline, das frohsinnigste und schönste der sieben Geschwister, der arme Herzog von Reichsstadt, der Vogelforscher und Ichthyologe Charles Lucien, Plon-Plon, der Sohn von Jérôme und Mathilde Letizia, seine Tochter, der dritte Napoleon, der mit dem gezwirbelten Schnurrbart, die Bonapartes von Baltimore und viele andere mehr.
Ohne daß ich es gemerkt hätte, war die Marschallin Ney, veranlaßt vielleicht von meiner spürbaren Ergriffenheit vor diesem genealogischen Kunstwerk, neben mich getreten und sagte, in ehrfürchtigem Flüsterton, diese création unique sei gegen Ende des letzten Jahrhunderts angefertigt worden von der Tochter eines Notars und großen Napoleonverehrers in Corte. Die mit einigen Faltern verzierten Blätter und Blütenstände am unteren Bildrand, sagte die Marschallin, seien echte getrocknete Pflanzen aus dem maquis, Steinrosen, Myrten und Rosmarin, und der dunkle, gewundene Stamm, der sich reliefartig von dem blauen Grund abhob, sei geflochten aus dem eigenen Haar des Mädchens, das, sei es aus Liebe zum Kaiser, sei es aus Liebe zu ihrem Vater, endlose Stunden über ihrer Arbeit zugebracht haben müsse.
Ich nickte andächtig zu dieser Erklärung und blieb eine ganze Zeitlang noch stehen, eh ich mich abwandte und aus dem Zimmer ging, hinab in den ersten Stock, in dem die Familie Bonaparte seit ihrer Ankunft in Ajaccio gewohnt hatte. Carlo Bonaparte, der Vater Napoleons, der Sekretär Pasquale Paolis gewesen war, hatte sich nach den von den Patrioten in ihrem ungleichen Kampf mit den französischen Truppen erlittenen Niederlage von Corte sicherheitshalber in die Küstenstadt begeben. Zusammen mit Letizia, die zu jener Zeit mit Napoleon schwanger war, zog er durch die wüsten Berge und Schluchten des inneren Landes, und ich denke mir, daß die beiden winzigen Personen auf ihren Mauleseln inmitten des überwältigenden Panoramas oder allein in finsterer Nacht bei einem Lagerfeuerchen sitzend, ausgeschaut haben müssen wie Maria und Joseph auf einer der vielen überlieferten Darstellungen der Flucht nach Ägypten. Jedenfalls erklärt diese dramatische Reise, wenn es denn etwas auf sich hat mit der Theorie von der pränatalen Erfahrung, manches am Charakter des späteren Kaisers, nicht zuletzt die Tatsache, daß er alles stets mit einer gewissen Überstürzung erledigte, beispielsweise bereits das Geschäft seiner eigenen Geburt, bei der er sich dermaßen nach vorn drängte, daß Letizia nicht mehr das Kindbett erreichte und ihn auf einem Sofa im sogenannten gelben Zimmer auf die Welt bringen mußte.
Eingedenk möglicherweise dieser denkwürdigen, den Beginn seiner Laufbahn markierenden Umstände hat Napoleon später eine aus Elfenbein geschnitzte Weihnachtskrippe von ziemlich zweifelhaftem Geschmack, die heute noch in der Casa Bonaparte zu sehen ist, seiner verehrten Mama zum Geschenk gemacht. Freilich hatten weder Letizia noch Carlo während der siebziger und achtziger Jahre, als man an das neue Regime sich akkomodierte, geträumt, daß die Kinder, die mit ihnen tagtäglich um den Eßtisch saßen, einmal aufsteigen sollten in den Rang von Königen und Königinnen und daß ausgerechnet der händelsüchtigste von ihnen, der in den Gassen des Quartiers ständig in Streitereien verwickelte Ribulione, einmal die Krone eines riesigen, fast über ganz Europa sich ausdehnenden Reiches tragen würde.
Aber was wissen wir schon im voraus vom Verlauf der Geschichte, der sich entwickelt nach irgendeinem, von keiner Logik zu entschlüsselnden Gesetz, bewegt und in seiner Richtung verändert oft im entscheidenden Moment von unwägbaren Winzigkeiten, durch einen kaum spürbaren Luftzug, durch ein zur Erde sinkendes Blatt oder durch einen von einem Auge zum anderen quer durch eine Menschenversammlung gehenden Blick. Nicht einmal in der Rückschau können wir erkennen, wie es wirklich vordem gewesen und zu diesem oder jenem Weltereignis gekommen ist. Die genaueste Wissenschaft von der Vergangenheit reicht kaum näher an die von keiner Vorstellungskraft zu erfassende Wahrheit heran als, beispielsweise, eine so aberwitzige Behauptung wie die, die mir einmal vorgetragen wurde von einem in der belgischen Hauptstadt lebenden, seit Jahrzehnten mit der Napoleonforschung befaßten Dilettanten namens Alfonse Huyghens, der zufolge sämtliche von dem Franzosenkaiser in den europäischen Ländern und Reichen bewirkten Umwälzungen auf nichts anderes zurückzuführen waren als auf dessen Farbenblindheit, die ihn Rot nicht unterscheiden ließ von Grün. Je mehr das Blut floß auf dem Schlachtfeld, so sagte der belgische Napoleonforscher zu mir, desto frischer schien ihm das Gras zu sprießen.
In den Abendstunden spazierte ich den Cours Napoléon hinunter und saß dann zwei Stunden in einem kleinen Restaurant unweit der Gare Maritime mit Blick auf das weiße Kreuzfahrerschiff. Beim Kaffee studierte ich die Anzeigen in der Lokalzeitung und überlegte mir, ob ich ins Kino gehen sollte. Ich gehe ja mit Vorliebe in fremden Städten ins Kino. Aber Judge Dread im Empire, USS Alabama im Bonaparte und L’amour à tout prix im Laetitia schienen mir nicht das Rechte für das Ende dieses Tags. So war ich gegen zehn Uhr wieder in dem Hotel, in dem ich am späten Vormittag mich einquartiert hatte. Ich machte die Fenster weit auf und schaute hinaus über die Dächer der Stadt. Der Verkehr rauschte noch in den Straßen, doch dann war es auf einmal ganz still, ein paar Sekunden lang bloß, bis, offenbar nur ein paar Straßen weiter, eine der in Korsika ja nicht selten hochgehenden Bomben mit einem kurzen, trockenen Schlag explodierte. Ich legte mich nieder und schlief bald schon ein, den Klang der Sirenen und Martinshörner im Ohr.
Campo Santo
Mein erster Weg am Tag nach meiner Ankunft in Piana führte mich aus dem Ort hinaus auf der in haarsträubenden Kurven, Kehren und Serpentinen bald schon steil abfallenden Straße, die über beinahe lotrechte, von grünem Buschwald dicht überwachsene Felsabbrüche hinabgeht bis auf den Grund einer mehrere hundert Meter tiefen, in die Bucht von Ficajola sich öffnenden Schlucht. Dort drunten, wo bis in die Nachkriegszeit eine vielleicht zwölf Köpfe zählende Gemeinde von Fischern in wüst zusammengemauerten, mit Wellblech gedeckten, heute teilweise mit Brettern vernagelten Behausungen lebte, habe ich neben einigen anderen aus Marseille, München oder Mailand hierhergekommenen Badegästen, die sich mit ihrem Proviant und diversen praktischen Ausrüstungsgegenständen paarweise oder in Familiengruppen in möglichst gleichmäßigem Abstand voneinander installiert hatten, den halben Nachmittag verbracht und bin lang, ohne mich zu rühren, bei dem kleinen Bach gelegen, dessen quecksilbriges Wasser selbst jetzt, am Ende des Sommers, ohne Unterlaß und mit jenem sprichwörtlichen, aus irgendeiner Vorzeit mir vertrauten Gemurmel über die letzten Granitstufen der Talsohle herablief, um lautlos auf dem Strand seinen Geist aufzugeben und zu versickern. Ich habe den Uferschwalben zugeschaut, die in erstaunlich großer Zahl hoch droben um die feuerfarbenen Klippen kreisten, von der lichten Seite hineinsegelten in den Schatten und aus dem Schatten hervorschossen ins Licht, und einmal an diesem für mich von einem Gefühl der Befreiung erfüllten, in eine jede Richtung grenzenlos mir erscheinenden Nachmittag, bin ich auch hinausgeschwommen auf das Meer, mit einer ungeheuren Leichtigkeit, sehr weit hinaus, ja so weit, daß ich dachte, ich könnte mich nun einfach forttreiben lassen, bis in den Abend hinein und bis in die Nacht. Sowie ich aber dann, jenem seltsamen Instinkt gehorchend, der einen ans Leben bindet, doch umdrehte und wieder zuhielt auf das aus der Entfernung einem fremden Kontinent gleichende Land, da machte das Schwimmen mir Zug um Zug größere Mühe, und zwar nicht, als arbeitete ich gegen die Strömung, die mich bisher getragen hatte; nein, ich glaubte vielmehr, es ginge, wenn man das bei einer Wasserfläche so sagen kann, stetig weiter bergauf. Der Prospekt, den ich vor Augen hatte, schien aus seinem Rahmen gekippt, neigte sich mir, in sich selber schwankend und wabernd, mit dem oberen Rand um einige Grade entgegen und rückte am unteren Rand im gleichen Maß von mir fort. Dabei war es mir manchmal, als handle es sich bei dem, was so bedrohlich vor mir aufragte, nicht um einen Ausschnitt aus der wirklichen Welt, sondern um ein nach außen gekehrtes, von schwarzblauen Flecken unterlaufenes Abbild einer unüberwindlich gewordenen inneren Schwäche. Schwerer noch als das Erreichen des Ufers war später der Aufstieg über die Serpentinenstraße und die kaum begangenen Pfade, die hier und da in direkter Linie eine Schleife mit der nächsten verbinden. Obschon ich nur langsam und ganz gleichmäßig einen Fuß vor den anderen setzte, lief mir, in der an den Felswänden sich stauenden Hitze des Nachmittags, nach kurzer Zeit schon der Schweiß von der Stirn und pochte das Blut mir im Hals wie einer der mitten in der Bewegung vor Angst erstarrten Echsen, die überall an meinem Weg saßen. Gut eineinhalb Stunden brauchte ich, bis ich wieder droben auf der Höhe von Piana war und gleich einem, der die Kunst der Levitation beherrscht, sozusagen schwerelos dahingehen konnte zwischen den äußersten Häusern und Gärten und entlang der Mauer, hinter der das Stück Land liegt, auf welchem die Bewohner des Orts ihre Toten begraben. Es war, wie es sich erwies, als ich eintrat durch das in den Angeln kreischende eiserne Tor, ein ziemlich verwahrloster Platz von der in Frankreich nicht seltenen Art, wo man eher den Eindruck hat eines von der Kommune verwalteten, für den profanen Abraum der menschlichen Gesellschaft bestimmten Areals als den eines Vorhofs des ewigen Lebens. Von den Gräbern, die sich in unordentlichen, immer wieder abbrechenden oder um eine halbe Stufe versetzten Reihen quer über den dürren Abhang ziehen, sind viele bereits in den Boden gesunken und teilweise von solchen, die später dazukamen, überlagert. Unsicher und mit jener gewissen Scheu, die man auch heute noch davor hat, den Toten zu nahe zu treten, stieg ich über zerborstene Sockel und Umrandungen, verschobene Grabplatten, zerfallenes Mauerwerk, ein aus seiner Halterung gefallenes, von Rostblattern entstelltes Kruzifix, ein bleiernes Urnengefäß, eine Engelshand — stumme Bruchstücke einer vor Jahren aufgelassenen Stadt, und nirgends ein Strauch oder ein Baum, der seinen Schatten ausbreitete, keine Thujen oder Zypressen, wie sie sonst auf südländischen Friedhöfen oft gepflanzt werden, sei es zum Trost oder zur Trauer. Auf den ersten Blick glaubte ich wirklich, es gäbe auf dem Totenfeld von Piana zur Erinnerung an die, wie wir immer gehofft haben, über unser eigenes Ende weit hinausreichende Natur nur mehr die künstlichen, von den französischen Beerdigungsinstituten offenbar mit Vorliebe an ihre Kundschaft gelieferten violetten, mauve- und rosafarbenen Blumen aus Seide oder aus Nylonchiffon, aus bunt bemaltem Porzellan oder aus Draht und Blech, die weniger ein Zeichen fortwährender Zuneigung zu sein scheinen als so etwas wie ein, aller gegenteiligen Versicherungen zum Trotz, zuletzt doch noch an den Tag gekommener Beweis dafür, daß wir unseren Toten von der vielfältigen Schönheit des Lebens nichts bieten als den billigsten Ersatz. Erst wie ich genauer mich umsah, fiel mir das Unkraut auf, die Saatwicken, der Quendel, der kriechende Klee, die Schafgarben und Kamillen, der Goldhafer und der Wachtelweizen und viele andere mir unbekannte Gräser, die um die Steine herum zusammengewachsen waren zu richtigen Herbarien und Miniaturlandschaften, halb grün noch und halb schon vertrocknet und ungleich schöner, so dachte ich mir, als der von den deutschen Friedhofsgärtnern verkaufte, meist aus vollkommen gleichförmigen Erikastauden, Zwergkoniferen und Stiefmütterchen bestehende, in strikt geometrischer Anordnung in makellose, rußschwarze Erde gesetzte sogenannte Grabschmuck, der mir aus meiner jetzt so weit schon zurückliegenden Kindheit und Jugend im Voralpenland noch in unlieber Erinnerung ist. Auf dem Gottesacker von Piana aber blickte zwischen den mageren Blütenstengeln, Halmen und Ähren da und dort einer der teuren Toten hervor aus einem jener ovalen, von einem feinen Goldrand eingefaßten Sepiaporträts, die man in den romanischen Ländern bis in die sechziger Jahre hinein an den Grabmälern angebracht hat: ein blonder Husar im Uniformrock mit hochgeschlossenem Kragen, ein an ihrem neunzehnten Geburtstag verstorbenes Mädchen, das Gesicht beinahe ausgelöscht vom Licht und vom Regen, ein kurzhalsiger Mensch mit dickem Krawattenknopf, Kolonialdienstbeamter in Oran bis 1958, ein kleiner Soldat, das Schiffchen schief auf dem Kopf, der schwer verwundet nach Hause zurückgekehrt war von der zwecklosen Verteidigung der Dschungelfestung von Dien Bien Puh. An manchen Stellen umrankt das Unkraut schon die Votivtäfelchen aus poliertem Marmor, die auf den neueren Gräbern stehen und von denen die Mehrzahl nur die knappe Aufschrift Regrets oder Regrets éternels trägt in sauber geschwungenen, von einer Kinderhand, könnte man meinen, aus einer Schreibvorlage kopierten Buchstaben. Regrets éternels — wie fast alle Formeln, in denen wir unser Mitgefühl mit den vor uns Dahingegangenen zum Ausdruck bringen, ist auch dieses nicht ohne Zweideutigkeit, denn nicht nur beschränkt sich die Kundgebung der ewig währenden Untröstlichkeit der Hinterbliebenen auf das absolute Minimum, sondern sie wirkt, wenn man es richtig bedenkt, fast wie ein den Toten nachgesandtes Schuldbekenntnis, wie eine halbherzige Bitte um Nachsicht an diejenigen, die man vor der Zeit unter die Erde gebracht hat. Frei von jeglicher Zweideutigkeit und klar dünkten mich nur die Namen der Verstorbenen selber, von denen nicht wenige sowohl in ihrer Bedeutung als auch in ihrem Klang so vollendet waren, als seien die, die vordem sie getragen hatten, schon zu ihren Lebzeiten Heilige gewesen oder bloß zu einem kurzen Gastspiel weilende Boten aus einer fernen, von unserer besseren Sehnsucht ersonnenen Welt. Und doch sind auch sie, die sich Gregorio Grimaldi, Angelina Bonavita, Natale Nicoli, Santo Santini, Serafino Fontana oder Archangelo Casabianca schrieben, in Wahrheit gewiß nicht gefeit gewesen gegen die menschliche Bosheit, nicht gegen die eigene und nicht gegen die der andern. Auffallend an der erst beim Herumgehen zwischen den Gräbern allmählich sich erschließenden Einteilung des Friedhofs von Piana war im übrigen, daß die Toten im allgemeinen zwar nach ihrer Clanzugehörigkeit bestattet wurden und also die Ceccaldi zu den Ceccaldi und die Quilichini zu den Quilichini zu liegen kamen, daß aber diese alte, auf nicht viel mehr als ein Dutzend Namen gegründete Ordnung seit längerem bereits zurückweichen mußte vor der des modernen Zivillebens, in dem jeder für sich allein steht und zuletzt auch nur für sich und seine nächsten Anverwandten einen Platz zugewiesen bekommt, der so akkurat wie möglich dem Maß seines Vermögens oder dem Grad seiner Armut entspricht. Wenn auch in den kleinen Gemeinden Korsikas nirgends von einem mit ostentativen Grabbauten prunkenden Reichtum die Rede sein kann, so gibt es doch, selbst auf einem Friedhof wie dem von Piana, ein paar mit Giebeln versehene Totenhäuser, in denen die Bessergestellten die ihnen angemessene letzte Unterkunft fanden. Die nächstniedrige gesellschaftliche Stufe repräsentieren dann sarkophagartige Kästen, die je nach dem Besitzstand der in ihnen Beigesetzten aus Granit- oder Betonplatten zusammengefügt sind. Bei den Gräbern noch geringerer Toter liegen die Steinplatten direkt auf dem Boden. Diejenigen, deren Mittel auch eine solche Grababdeckung übersteigt, müssen sich begnügen mit türkis- oder rosafarbenen, von einer schmalen Einfassung zusammengehaltenem Kies, und die ganzen Armen haben nur ein in der bloßen Erde steckendes blechernes oder gar aus einem Brunnenrohr recht und schlecht zusammengeschweißtes, vielleicht mit Ofenbronze gestrichenes oder mit einer goldenen Kordel umwickeltes Kreuz. Auf diese Weise spiegelt auch der Friedhof von Piana, einem Ort, an dem es bis vor kurzem eigentlich nur mehr oder weniger Arme gegeben hat, nicht anders als die Nekropolen in unseren großen Städten die von der ungleichen Verteilung des irdischen Besitztums geprägte gesellschaftliche Hierarchie in ihren sämtlichen Gradationen. Die mächtigsten Steine werden in der Regel über die Gräber der Reichsten gerollt, denn von ihnen ist am ehesten zu befürchten, daß sie ihren Nachfahren das Erbe nicht gönnen und daß sie trachten könnten, was sie eingebüßt haben, sich wiederzuholen. Die gewaltigen Blöcke, die man sicherheitshalber aufrichtet über ihnen, sind natürlich, mit selbstbetrügerischer List, getarnt als Monumente tiefer Verehrung. Bezeichnenderweise ist ein derartiger Aufwand nicht nötig beim Ableben eines unserer minderen Brüder, der vielleicht zur Stunde seines Todes mehr nicht sein eigen nennt als den Anzug, in dem man ihn begräbt, so dachte ich mir, wie ich, von der obersten Reihe aus, hinwegschaute über das Gräberfeld von Piana und die silbrigen Kronen der Olivenbäume jenseits der Mauer auf den von weit drunten heraufleuchtenden Golf von Porto. Was mich besonderes wunder nahm, damals auf dieser Raststatt der Toten, war die Tatsache, daß auch nicht eine der Grabinschriften weiter zurückdatierte als sechzig oder siebzig Jahre. Den Grund dafür fand ich einige Monate später in einer den merkwürdigen korsischen Verhältnissen, den Blutfehden und dem Banditenwesen gewidmeten, in vieler Hinsicht für mich vorbildlichen Studie von Stephen Wilson, einem meiner hiesigen Kollegen, der das umfangreiche, in mehrjähriger Forschungsarbeit von ihm zusammengetragene Material dem Leser mit der denkbar größten Sorgfalt, Klarheit und Zurückhaltung präsentiert.
Der Mangel an irgendwelchen selbst auf den Anfang unseres Jahrhunderts nur zurückgehenden Todesdaten war nicht, wie ich zunächst vermutet hatte, der inzwischen ja durchaus üblichen Praxis einer sukzessiven Auflassung der Gräber zuzuschreiben, noch ließ er sich damit erklären, daß es in Piana vordem anderwärts einen Beisetzungsort gegeben hatte, sondern es lag seine Ursache vielmehr einfach darin, daß Friedhöfe in Korsika überhaupt erst um die Mitte des letzten Jahrhunderts auf amtliche Anordnung hin eingerichtet und auch danach von der Bevölkerung lange nicht angenommen wurden. In einem Bericht aus dem Jahr 1893 heißt es zum Beispiel, daß den städtischen Friedhof von Ajaccio niemand benutzte als die armen Leute und die Luterani genannten Protestanten. Allem Anschein nach waren die Hinterbliebenen nicht willens oder wagten es nicht, einen Toten, der irgendein Stück Boden sein eigen nannte, fortzutragen von seinem angestammten Besitz. Die in Korsika Jahrhunderte hindurch übliche Bestattung auf dem von den Vorvätern ererbten Land glich einem die Unveräußerlichkeit dieses Landes betreffenden Kontrakt, der von Generation zu Generation stillschweigend erneuert wurde zwischen jedem Verstorbenen und seiner Nachkommenschaft. Überall, da paese a paese, stößt man darum auf kleine Leichenhäuser, Totenkammern und Mausoleen, hier unter einem Kastanienbaum, dort in einem licht- und schattenbewegten Olivenhain, mitten in einem Kürbisbeet, in einem Haferfeld oder an einem von feingefiedertem, gelbgrünem Dillkraut überwachsenen Hang. An solchen nicht selten besonders schönen und einen guten Überblick über das Territorium der Familie, das Dorf und das weitere Gelände gewährenden Plätzen waren die Verstorbenen sozusagen ständig bei sich, waren nicht verbannt ins Exil und konnten nach wie vor wachen über die Grenzen ihres Gebiets. In einer mir jetzt nicht mehr erinnerlichen Quelle habe ich auch gelesen, daß von den alten korsischen Frauen manche die Gewohnheit hatten, am Feierabend hinauszugehen zu den Wohnungen der Toten, um dort auf sie zu horchen und mit ihnen sich zu beratschlagen über die Nutzung des Landes und sonstige die rechte Lebensführung betreffende Fragen. Diejenigen, die keinerlei Grundbesitz hatten — Hirten, Tagelöhner, italienische Landarbeiter und sonstige Hungerleider —, wurden lange Zeit, wenn sie gestorben waren, einfach in einen Sack eingenäht und in einen Schacht hinuntergeworfen, den man mit einem Deckel verschloß. Ein solches Gemeinschaftsgrab, in dem die Leichen wahrscheinlich wie Kraut und Rüben durcheinanderlagen, hieß arca und war mancherorts auch ein tür- und fensterloses steinernes Haus, in dessen Innenraum man die Toten hinabstieß durch eine Luke im Dach, welche man erreichte über eine an der Außenmauer hinaufführende Stiege. Und im Campodonico bei Orezza wurden, wie Stephen Wilson berichtet, die Landlosen einfach in einen Tobel hinuntergeschmissen, eine Praxis, die nach Auskunft des 1952 im Alter von fünfundachtzig Jahren verstorbenen Banditen Muzzarettu selbst zu seiner Zeit in Grossa noch üblich war. Keineswegs aber läßt dieser gleichfalls von der Verteilung des Besitzes und der gesellschaftlichen Ordnung diktierte Brauch auf eine Geringschätzung oder Mißachtung der ärmeren Toten schließen. Soweit es die Mittel erlaubten, wurden auch ihnen die Zeichen der Ehrfurcht entgegengebracht. Grundsätzlich waren die korsischen Trauerrituale überaus elaborat und hatten einen hochdramatischen Charakter. Türen und Läden des vom Unglück heimgesuchten Hauses wurden zugemacht, bisweilen sogar schwarz die ganze Fassade gestrichen. Der gewaschene und frisch eingekleidete, beziehungsweise, in dem nicht seltenen Fall eines gewaltsamen Todes, der in seinem blutbefleckten Zustand belassene Leichnam wurde aufgebahrt im besten Zimmer, das meist weniger ein für den Gebrauch der Lebenden bestimmter Wohnraum als die Domäne der verstorbenen Mitglieder der Familie, der sogenannten antichi oder antinati war. Dort hingen an den Wänden seit der Einführung der Photographie, die ja im Grunde nichts anderes ist als die Materialisierung gespenstischer Erscheinungen vermittels einer sehr fragwürdigen Zauberkunst, die Bilder der Eltern und Großeltern und näherer und fernerer Verwandter, die, obwohl oder weil sie sich nicht mehr am Leben befanden, als die wahren Häupter des Stammes galten. Unter ihrem unbestechlichen Blick fand die Totenwache statt, bei der die sonst zum Schweigen verurteilten Frauen die führenden Rollen übernahmen, die ganze Nacht hindurch ihre Klagen sangen und schrien und, insbesondere wenn es sich um einen Ermordeten handelte, wie die Furien der Vorzeit das Haar sich rauften und das Angesicht sich zerkratzten, allem Anschein nach vollkommen außer sich vor blindem Zorn und Schmerz, während die Männer draußen im finsteren Hausgang und auf der Stiege standen und mit den Kolben ihrer Gewehre auf den Fußboden klopften. Stephen Wilson weist darauf hin, daß Augenzeugen, die im neunzehnten Jahrhundert und bis hinein in die Zeit zwischen den letzten zwei Kriegen solchen Totenwachen beiwohnten, es bemerkenswert gefunden hätten, wie die Klageweiber sich einerseits in tranceartige Zustände hineinsteigerten, vom Schwindel ergriffen wurden und in Ohnmacht fielen, andererseits jedoch durchaus nicht den Eindruck erweckten, als seien sie überwältigt von wahrer Emotion. Manche Berichterstatter, so Stephen Wilson, sprechen sogar von einer auffälligen Gefühllosigkeit oder Starre, in welcher die Sängerin, ungeachtet ihrer in den höchsten Stimmlagen konvulsivisch sich überschlagenden Passion, nicht eine einzige Träne vergießt. In Anbetracht solcher anscheinend eisigen Selbstkontrolle neigten einige Kommentatoren dazu, in den Klagegesängen der voceratrici eine vom Herkommen vorgeschriebene, hohle Veranstaltung zu sehen, eine Auffassung, zu der auch die Beobachtung stimmte, daß allein zum Zusammenbringen eines Klagechors ein beträchtliches Maß von praktischer Vorbereitung und, beim Singen selber, von rationalem Dirigismus vonnöten war. In Wahrheit freilich besteht kein Widerspruch zwischen dieser Art von Berechnung und einer echten, tatsächlich bis an den Rand der Selbstauflösung gehenden Verzweiflung, denn das Schwanken zwischen dem einem Erstickungsanfall gleichenden Ausdruck zutiefst empfundener Seelenschmerzen und einer auf ästhetische Modulationen bedachten, geradezu durchtriebenen, um nicht zu sagen abgefeimten Manipulation des Publikums, vor dem wir unsere Leiden ausstellen, ist ja, auf sämtlichen Stufen der Zivilisation, das wohl bezeichnendste Merkmal unserer verstörten, an sich selber irre gewordenen Art. In der anthropologischen Literatur, bei Frazer, Huizinga, Eliade, Lévi-Strauss und Bilz wird mehrfach beschrieben, wie die Mitglieder früher Stammeskulturen, wenn sie ihre Initiations- oder Opferrituale zelebrierten, in einer unterschwellig immer mitlaufenden Form der Selbstwahrnehmung ein sehr genaues Bewußtsein hatten davon, daß ihr zwanghafter, stets mit Verletzung und Verstümmelung verbundener Extremismus im Grunde nichts anderes war als pure, bisweilen allerdings bis auf den Punkt des Todes gehende Schauspielerei. Auch in schweren psychischen Schüben befangene Menschen haben irgendwo in ihrem innersten Herzen eine deutliche Ahnung, daß sie auftreten in einem ihnen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Leib geschriebenen Stück. Im übrigen unterschied sich die pathologische, von völligem Zusammenbruch und äußerster Selbstkontrolle zugleich bestimmte Verfassung der korsischen voceratrici wahrscheinlich nur unwesentlich von derjenigen der Somnambulen, die auf den Bühnen der bürgerlichen Opernhäuser seit gut zweihundert Jahren Abend für Abend verfallen in genauestens einstudierte Paroxysmen der Hysterie. Doch wie dem auch gewesen sein mag, auf die Totenklage in dem dunklen, nur vom Licht einer einzigen Kerze durchflackerten Haus der Verstorbenen folgte der Leichenschmaus. Der Aufwand, den die Hinterbliebenen zur Wahrung ihrer Ehre und zu der des Toten bei diesem oft mehrere Tage dauernden Mahl treiben mußten, war so groß, daß er eine Familie in den Ruin stürzen konnte, wenn das Unglück es wollte, daß, etwa im Verlauf einer Blutfehde, mehrere Todesfälle oder tödliche Anschläge kurz hintereinander passierten. Fünf Jahre und länger, beim Tod eines Ehegatten das ganze restliche Leben hindurch, wurde Trauer getragen. Kein Wunder also, daß das hochgeschlossene schwarze Kleid mit dem schwarzen Kopftuch und der schwarze Manchesteranzug bis weit in das zwanzigste Jahrhundert hinein die korsische Nationaltracht zu sein schien. Nach Berichten früherer Reisender ging von den schwarzen, überall in den Gassen der Ortschaften und Städte und draußen am Land gegenwärtigen Gestalten eine Aura der Schwermut aus, die sich, sogar an den strahlendsten Tagen, wie ein Schatten über die grüne Blattwelt der Insel legte und erinnerte an die Bilder Poussins, zum Beispiel an das Massaker der Unschuldigen oder den Tod des Germanicus