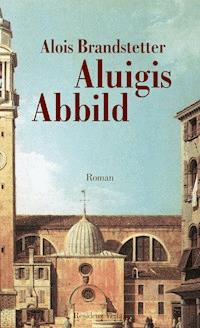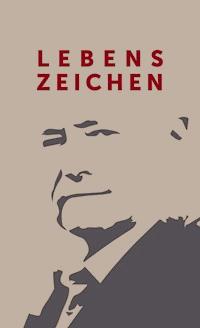Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Residenz
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine junge Frau hat Liebeskummer, sie sucht Rat - ausgerechnet bei Immanuel Kant, dem großen Denker und Hagestolz. Im August 1791 schreibt Maria von Herbert aus Klagenfurt einen Brief an Immanuel Kant nach Königsberg. Sie bittet den alternden Junggesellen inständig um Trost und Rat - sie hat Liebeskummer. Das ist historisch belegt. Kants junger, redseliger Assistent antwortet ihr im Auftrag des großen Meisters und er geht dabei freilich vor allem auf Probleme ein, die die junge Frau gar nicht plagen. Das ist brandstetterisch belegt. Aus der "Menschenkunde in pragmatischer Hinsicht" sinniert er über allerlei Sonderbares, Absonderliches und Kurioses. Etwa über die Frage, ob man Kant bewundern kann, wenn man Goethe bewundert (und umgekehrt). Oder die Vorstellungen des Philosophen vom "schönen Geschlecht", das ihm wohl gefällt, das ihn aber nicht weiter interessiert. Und nicht zuletzt über die Frage, die zumindest uns alle betrifft: Wie werde ich meinen Liebeskummer los? Alois Brandstetters "Einbriefroman" ist launig und nachdenklich, gewitzt und klug, voller Spott und voller Weisheit. Dieses Buch ist Trost und Rat, vor allem aber ein großes Vergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alois Brandstetter
Cant läßt grüßen
Roman
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografischeDaten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
www.residenzverlag.at
© 2009 Residenz Verlagim Niederösterreichischen PressehausDruck- und Verlagsgesellschaft mbHSt. Pölten – Salzburg – Wien
Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten.Keine unerlaubte Vervielfältigung!
ISBN ePub:978-3-7017-4302-5
ISBN Printausgabe:978-3-7017-1526-8
LeseanleitungCant läßt grüßen
Im August 1791 schreibt ein Mädchen aus Klagenfurt in Liebeskummer einen Brief an den 68jährigen Zölibatär Immanuel Kant nach Königsberg und bittet ihn inständig um Rat und Hilfe. Sie heißt Maria von Herbert und ist die Tochter eines Kärntner Bleiweißfabrikanten, eines Vaters von 32 Kindern, und Schwester von Franz Paul von Herbert, eines Schiller-Freundes und Mentors eines »Herbertkreises«, der weitab von Weimar und Königsberg in Klagenfurt das Licht der Aufklärung entzündet und die Verehrung von Goethe und Schiller fördert. Kant hat auf den Brief des Edelfräuleins hin einen Antwortbrief entworfen, der im Roman zitiert und interpretiert wird. Er dürfte aber so nicht abgeschickt und überbracht worden sein. Das jedenfalls läßt ein zweiter Brief der Freiin von Herbert an Kant vom Jänner 1793 vermuten. Sie kündigt darin einen Besuch in Königsberg an. Spricht sie den Philosophen im ersten Brief noch als »Großer Kant« wie ihren Gott an, so im zweiten Brief zwei Jahre später natürlicher und intimer: »Lieber Ehrenwerther Herr«! Faktum ist, daß sich die unglückliche Maria am 23. Mai 1803 umgebracht hat, ein Jahr vor Kants Tod 1804. Sie ging nahe der Hollenburg in die Drau (nicht in die Donau, wie ortsunkundige Kant-Biographen manchmal schreiben).
Vor dem Hintergrund dieser und vieler anderer historischer Fakten schreibt in diesem »Einbriefroman« ein »Amanuensis« Kants, ein junger Assistent des emeritierten Professors, »im Auftrage desselben« einen langen, fiktiven Brief an Maria von Herbert. Er beruft sich dabei nicht nur auf mündliche Mitteilungen und Mandate seines Herrn, sondern auch auf dessen Werke, vor allem die Menschenkunde (»Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«). Und er interpretiert auch den erwähnten Briefentwurf Kants. So kommt viel Tiefsinniges aus der »Menschenkunde« und aus der »Metaphysik der Sitten« zur Sprache, aber auch Sonderbares, ja Absonderliches und Kurioses, gerade auch was Kants Vorstellungen vom »schönen Geschlecht« betrifft, über die sich vor Brandstetter schon Johann Wolfgang von Goethe in einer Rezension lustig gemacht hat. Kant seinerseits (im Roman Cant) will das Mädchen Maria durch seinen Sekretär von aller Schwärmerei für die Poesie und Goethe (im Roman Göthe) kurieren.
Ein Amanuensis ist, wörtlich übersetzt, einer, der einem Professor »zur Hand geht«. Der hier den langen Traktat an die Klagenfurterin Herbert schreibt, ist offensichtlich ein junger, altkluger, anstelliger, fleißiger, beflissener und redseliger Privatsekretär, Kants Eckermann sozusagen. Er ordnet im Auftrag der Universität dem Emeritus das Archiv in dessen Haus in der Prinzessinstraße. So kennt er das Hauswesen des verehrten Philosophen aus der Nähe (wie auch Kants berühmt-berüchtigter Diener Martin Lampe, der hier selbstverständlich nicht fehlen darf). Die Geschichte spielt im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts, als Napoleon Europa und auch Kärnten heimsuchte, nimmt sich aber einige anachronistische Freiheiten. Offensichtlich schreibt der »Wortführer« an seinem Brief auch noch, als sich die Probleme längst biologisch gegeben haben … Und es fehlt auch nicht an kühnen Anspielungen auf die Gegenwart, wenn etwa der »Sturm und Drang«-Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz nicht unähnlich einem Angehörigen der 68er-Generation des 20. Jahrhunderts agiert und spricht. Kant schreibt also hier nicht »manu propria« (mit eigener Hand), vielmehr: Cant läßt grüßen. Einige Kühnheiten legen den Verdacht nahe, daß der lange Brief gar nicht von einem Amanuensis in Königsberg, sondern von einem Emeritus der Universität Klagenfurt geschrieben wurde. Doktorspiele eines Philisters?
Denken, Gedenken und Andenken
Zur Erinnerung an Prof. Rudolf Malter (1937–1994), den Präsidenten der Deutschen Kant-Gesellschaft, meinen Freund aus Saarbrücker Tagen, der mich auf die Briefe Maria von Herberts an Kant aufmerksam machte, dem ich so viel Denkwürdiges verdanke!
»Denen Lesern zu Gefallen, die die deutschen Academien nicht kennen, muß ich den Ausdruck Amanuensis erklären. Es sind gewöhnlicherweise Bauernsöhne, die den Professoren anfänglich die Füße bedienen, nach und nach aber durch den Einfluß der Atmosphäre, in der sie sich mit ihren Herren herumdrehen, einen solchen Antheil ihres Geistes erhalten, daß sie sie zu ihrer Hand abrichten können, die Gelder für die Collegien einzusammeln und, wenn einer von den bekannten Gesichtern in den Hörsälen, wo sie gemeinhin nur die Stühle einreichen, wenn Fremde kommen, zu fehlen anfängt, so lange auf die Spur zu gehen, bis sie den Räuber entdeckt haben, der ihn ihrer Schule abspenstig gemacht hat. Alsdann wird alles angewandt, ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen, Briefe an die Seinigen, bisweilen auch anonyme Briefe von verborgener Freundeshand, Erinnerungen am schwarzen Brette und in den Programmen, und, wenn nichts verschlägt, bey der nächsten erhaschten Veranlassung, eine Citation durch die Hand des unermüdeten Pedellen.« (Jakob Michael Reinhold Lenz, »Der Landprediger«)
Amanuensis, is, m. – ein Sklave, den man als Schreibgehülfe gebrauchte, ein Schreiber, Secretär (Karl Ernst Georges, »Ausführliches lateinisch-deutsches Handwörterbuch«)
Gott zum Gruße, sehr verehrtes Fräulein, Freiin Maria von Herbert in Clagenfurth! Im Namen Immanuel Cants, dem zu dienen ich als Amanuensis die academische Ehre habe, darf ich Euch in Beantwortung Eurer Briefe sein besonderes Wohlwollen übermitteln! Von den Beschwerden des Alters heimgesucht und niedergedrückt, bittet er, ihm nachzusehen, daß er nicht manu propria (mit eigener Hand) respondiren kann, sondern und vielmehr sich meiner als seines adjutanten Amanuensis bedienet, um das hernach Folgende in seinem Sinne und Auftrage mittheilen zu lassen. So darf ich als authorisirter Secretär wie folgt festhalten und ausführen:
Nach dem ersten Briefe nun, den Ihr, werthes Fräulein Maria von Herbert, im August des Jahres 1791 aus Clagenfurth im Lande Kärnthen, an meinen Herrn, den Herrn Professor Immanuel Cant, nach hier in Königsberg ins östliche Ostpreußen, zu richten die Güte – und Kühnheit – hattet, war mein Herr nicht aufgelegt zu antworten oder auch durch meine Wenigkeit, seinen Secretär und Amanuensis, correspondiren und repliciren zu lassen. Ihn erreichen täglich ähnliche Billetten, in denen Leser seiner philosophischen Schriften ihren Beyfall kund thun und mit Complimenten nicht geizen. Mancher Brief hat den im Grunde todernsten Mann auch schon schmunzeln lassen und zu launigen Bemerkungen etwa dieser Art verleitet und verführt: Wenn der Kutscher R. aus Buxtehude applaudirt, dann wird es mit meiner Critik der practischen Vernunft wohl seine Richtigkeit haben. Oder: Mamsell F. aus Husum ist auch unserer Meinung hinsichtlich des Categorischen Imperativs, so wird er denn allgemeines Gesetz werden können. Einmal quittirte er das überschwengliche Lob eines Freigeistes, seiner bürgerlichen Profession nach aber unfreien Domesticen und Lacaien, Lacaien, Botengehers oder Dieners, über den Erweis der Unmöglichkeit, die Existenz Gottes zu beweisen, den Nachweis der Unmöglichkeit der scholastischen Gottesbeweise also, mit einem Sarcasm, der mir immer und ewig in Erinnerung bleiben wird: So hat einer aufgehört, an Gott, und angefangen, an Cant zu glauben! Ein anderes Mal stöhnte er: Muß ich denn nun auch das Schicksal des Johann Sebastian Bach theilen! Das aber sagte er, weil er öfters schon jenes Bonmot (Gutwort) eines Musikbegeisterten vernommen und im Ohre hatte: Ob ich an Gott glaube, weiß ich nicht, an Bach aber glaube ich gewißlich! Wäre es nicht besser, mit Bach an Gott zu glauben?, sagte er einmal.
Als Euren »Gott« bezeichnet übrigens auch Ihr, werthes Fräulein Maria von Herbert, meinen Meister, schon im ersten Briefe, was dem Herrn Professor kein geringes Mißvergnügen bereithet hat. Die Wahrheit ist den Menschen zuzumuthen, deshalb will ich mit der Mittheilung nicht hinter dem Berge halten, daß er den ersten Satz Eures Briefes zu wiederholten Malen als Beyspiel für fehl geleitete Devotion bey Tische und im Gespräche mit Freunden, anfangs ablesend, später aber bereits aus auswendiger Kenntnis citirte und hören ließ: »Großer Cant, zu dir rufe ich wie ein Gläubiger zu seinem Gotte um Hülfe, um Trost, oder um Bescheid zum Tode …« Ja, einer der Gründe, nicht zu erwidern und auch nicht erwidern zu lassen, mag gerade darin, in jener schwärmerischen Devotion nämlich, gelegen seyn. In seiner »Anthropologie« (Menschenkunde) rechnet er die Enthusiasten ja nicht bloß zu den »Unsinnigen«, sondern zu den »Wahnsinnigen«. Sie sind schlimmer oder schlimmer daran als die »Phantasten«, die bloß wachend träumen und die er mit »Grillenfänger«, in Klammern gesetzt, in die deutsche Hauptsprache übersetzet. In einem ähnlichen Falle von übertriebener Höchstachtung und Divinirung (Vergötterung) hat mein Herr denn auch einmal, weniger zu Scherzen als zu Ungnade aufgelegt, brummend gesagt: Verwechselt mich nun schon wieder ein einfältiges Frauenzimmer mit dem Dreifaltigen.
Von »Adoration« (Anbetung) spricht freilich schon im Jahre 1784 in einem Briefe an meinen Herrn der durchaus achtbare Professor der Beredsamkeit Christian Gottfried Schütz aus Jena, die ihn bey der Lectüre der »Critik der reinen Vernunft« erfaßt habe. »Bey deren Lectüre ich Sie gerne hätte adoriren mögen.« Adoriren heißet aber in unserer deutschen Hauptsprache »Anbethen«! So sehr meinem Herrn dies auch mißfallen hat, hat er sich von dem Genannten immerhin einladen lassen, als Recensent an einer von ihm und anderen gegründeten Zeitschrift mitzuwirken. Vergleiche seiner »Critik« mit der »Heilichen Schrift« und der »Bibel« mußte Cant auch sonst öfter über sich ergehen lassen. Gefreut hat ihn dies sicher nicht!
Nach Eurem neuerlichen, zweyten Briefe hat Cant indessen geruhet, den ersten wieder- und nachzulesen, über jene und andere kleinere Entgleisungen hinwegzusehen, und mich mit einer Antwort an Euch beauftragt, nicht ohne mir genaueste Ordres (Vorschreibungen) über den Inhalt dieses Antwortbriefes aufzulegen. Ihr verdient eine Antwort, sagte der Herr Professor, wenn diese Euch auch nicht konveniren (entgegenkommen) und gefallen mag. Er sey kein Schmeichler und darum dürfe auch mein Schreiben nicht schmeichelhaft seyn! Cant lasse grüßen, obligirte (verpflichtete) er mich zu schreiben, und in seinem Sinne und aus der Kenntnis seiner in seinen Schriften festgelegten Weltanschauung Euch zu rathen, wie Ihr Euch aus Eurem Dilemma befreien und erlösen könnt, woran ihm sehr gelegen sey. Dies möge ich Euch ausrichten und Euch aufrichten. Helfen werde mir dabey ein Concept (Entwurf) einer Antwort von seiner Hand, dessen zu bedienen er mir großzügig concedirte (zubilligte). Es sey nun seit jenem Entwurfe, mit dem er inzwischen unzufrieden sey, einige Zeit verstrichen, die ihn alt und zittrig hinterlassen habe, sodaß er nun nicht mehr gerne »manu propria« (mit der eigenen Hand) schreibe, sondern gern »ab amanuense« (von einem Handlanger) Gebrauch mache. Bitte erklären Sie mich dem bedürftigen und unbedarften Mädchen, sagte Cant. Zu seinem Briefentwurfe Näheres später.
Versöhnlich gestimmt hat ihn an Eurem Schreiben vor allem, daß Ihr weiter um nichts als seinen Rath bittet, aber nicht die geringste Unverschämtheit wie etwa andere Briefschreiber und Bittsteller zeiget. Die meisten Briefe, die mein Herr erhält, sind nämlich Bettelbriefe, deren Schreiber nach den Laudes (Lobgesänge) alsbald um Beneficien (Vergünstigungen, Wohlthaten) in Gestalt von Naturalien (Lebensmittel) beziehungsweise Geld bitten. Viele Briefeschreiber wollen weniger einen Rath als einen Rabatt! Von solchen Briefen sagt mein Herr denn gerne, ich möge sie an seine Arbeitgeberin, die Zarin aller Russen und Reußen, nach St. Petersburg weiterleiten … Manchmal sagt er auch, dieser oder jener Bittsteller sey für den Peterspfenning vorzusehen, was dem Obigen ironischer Weise gleichkömmt. Nicht immer freilich sind die Dreistigkeiten in den Briefen von dieser Plumpheit, ja sie sind manchmal gar nicht als solche erkennbar, sondern von einer merkwürdigen Subtilität und Raffinesse, auch Delicatesse. Ich darf als Beyspiel für die raffinirtere Sorte etwa einen Brief erwähnen, in welchem neulich eine der drei Blutes verwandten Töchter seines leiblichen Bruders Johann Heinrich, der eines geistlichen Pastorenamtes in Altrahden, einer kleinen Gemeinde zwischen Riga und Mitau, waltet, ihn nach allerlei verwandtschaftlichen Artigkeiten ziemlich oder eigentlich unziemlich keck um die Übersendung einer Locke seines grauen Haupthaares ersucht hat, welche sie wie eine heiliche Reliquie in Ehren zu halten versprach. Ich darf citiren: »Eine Locke von Ihren ehrwürdigen grauen Haaren hätten wir doch sehr gerne, die würden wir in Ringe fassen lassen und uns so fest einbilden, wir hätten unsern Onkel bey uns.« Möge sie tausendmal meine Nichte seyn, erboste sich mein Herr, so werde ich diesem albernen Ansinnen doch in keinem Falle nachkommen! Es sey zum Haareraufen und man könnte sich den Bart ausreißen, rief er aus, was sich die Menschen einbildeten. Er ist freilich bartlos! Für Bartträger empfindet er keine besondere Sympathie. Man soll sein Geschlecht nicht im Gesichte demonstriren (vorweisen). Wäre er, sagte mein Herr, allen ähnlichen Nachfragen nach Haarlocken, die nicht nur von Verwandten an ihn gerichtet wurden, nachgekommen, so hätte er sich um sein gänzliches Haupthaar, welches unter seiner Perücke an sich nur noch spärlich wachse, bringen müssen, ja die Natur hätte in seinem Falle ganz und gar nicht ausgereicht, alle diese sonderbaren Wünsche zu erfüllen. Auf welche Haare aber hätte er zurückgreifen sollen! Verwandtschaft, schon gar nahe Blutsverwandtschaft, mag einen solchen Wunsch nach einem intimen Geschenke wie einer Locke oder Tolle allenfalls als angebracht oder doch verständlich erscheinen lassen, wenn auch alle Reliquienverehrung einem verständigen und aufgeklärten Menschen schlecht ansteht, ähnliche Zumuthungen aber nach persönlichen Andenken von Außenstehenden sind nicht auszustehen und als widerwärtig abzulehnen. So hatte eine Correspondentin aus Pommerland effectiv die Dreistigkeit, mit Hinweis auf Cants altersbedingte Kahlhäuptigkeit, von der sie erfahren habe, wie die Natur auch die größten Menschen nicht schone und der Geist letztlich nicht im Stande sey, »den Körper zu bauen«, wie der Dichter und Cant-Verehrer Friedrich Schiller sich auszudrücken beliebt habe, ihn um eine Devotionslocke »gleich welcher Provenienz« zu bitten. Mit einem Wortspiele nannte mein Herr den grassierenden Tollenkult »toll«, das heißt verrückt und »unappetitlich«! Er hätte große Lust, jenes zudringliche Frauenzimmer mit einem Büschel Roßhaare von einem Pferdeschwanze, das sein Diener Martin Lampe leicht zu besorgen wüßte, zur Närrin zu halten und abzustrafen, sagte er damals, sich entrüstend und auch belustigend. So ärgerlich er aber ursprünglich, als ich als sein Secretarius und Amanuensis jenen Brief mit dem haarigen Wunsche ihm zur Kenntnis brachte und wegen seines schlechten Gesichtes vorlas, auch war, so aufgeräumt und heiter war er schließlich beym Gedanken an jenen Streich und Possen, den er der guten Frau zu spielen imaginirte (einbildete). Natürlich wäre mein verehrter Herr als der allergrößte Moralist unseres Saeculums (Zeitalters) niemals zu einer derartigen That und Boshaftigkeit geschritten. Es ereignete sich alles nur im imaginären und virtuellen Raume der Phantasie (Annahme) … Vieles ist bey meinem Herrn, dem großen Philosophen, eben nur gedacht. Der Norddeutsche in Cant meldet sich auch gern mit dem volkssprachlichen »Denkste!«. Auch »im Geiste« höre ich ihn oft sagen, wenn er von Unwirklichem spricht.
Ich thue dieser seiner Schalkhaftigkeit in der Rede auch deshalb Erwähnung, weil meinem Herrn Cant immer wieder Misanthropie, oder, wie es in einem Briefe von Johann Georg Hamann an Johann Gottfried Herder aus dem Jahre 1784 heißt, »Übelaufgeräumtheit« nachgesagt wird. Oft aber ist er sehr aufgeräumt, wie eben auch damals. Er ist kein Griesgram und Miesepeter, wie oft in ungerechter Weise behauptet wird!
Seine Aversion gegen Reliquienverehrung ist freilich ernst und groß. Hierin ist er, der Aufklärer und Freigeist, doch zugleich ganz Protestant und Lutheraner. Nicht nur einmal hörte ich ihn Martin Luthers Spottsprüche aus dessen Tischreden über die »Federn des Heilichen Geistes« und die »drei Tropfen Milch aus Marias Mutterbrust« citiren. Er thut dies indessen auch bey seinen Tischgesellschaften nur, wenn er keine altgläubigen und frommen Catholiken unter seinen Gästen weiß, was freilich an und für sich sehr selten ist, weil sich solche kaum so weit in den Norden nach Königsberg verirren. Ist indessen Carl Leonhard Reinhold, jener Mann aus dem Süden, aus Wien, bey ihm, der sich inzwischen als sein größter Verehrer und als Propagandist der reinen Lehre Cants an den Universitäten in Jena und Kiel bewiesen hat, so thun sich beide in ihrem Spotte, Anticlericalism (Priesterherrschaftkritik) und Antipapism (Papstfeindschaft) keinen Zwang an, was freilich insofern merkwürdig oder auch wieder verständlich ist, als Reinhold, heute mit einer Tochter des Dichters Christoph Martin Wieland verheurathet und zum evangelischen Glauben convertirt, eigentlich geweihter catholischer Priester ist und als Jesuit und später Barnabit begonnen hat, bevor er aus dem Kloster St. Michael in Wien entsprungen und nach Weimar geflohen ist. Dort ist er in bedauerlicher Weise vom Pfarrer zum Pfarrerfresser geworden. Wer dächte da nicht an einen Aphorism (Kurzwort) des Göttinger Professors Georg Christoph Lichtenberg: Die schärfsten Critiker der Elche waren früher selber welche!
Ich gestehe freimüthig, daß mir Herr Reinhold, trotz seiner Verdienste, die er sich mit seinen »Briefen über die cantische Philosophie« in der von ihm und seinem Schwiegervater Christoph Martin Wieland herausgegebenen Zeitschrift »Teutscher Merkur« erworben hat, nicht nur antipathetisch (zuwider) oder, wie man heute auch sagt, »unsympathisch« ist, sondern in hohem Maaße auch unheimlich. Zwar huldige ich auch der Aufklärung, halte aber als getaufter Christ der catholischen Confession daran fest, daß einer, der die Priesterweihe empfangen, ein Sacrament gespendet bekommen hat, das einen »Character indelebilis«, wie die Theologen das nennen, bewirkt und erzeugt. Ich glaube voraussetzen zu dürfen, daß Ihr als Edelfräulein in Clagenfurth eine gute Schulbildung auch in den Humaniora und alten Sprachen Latein, Griechisch und Hebräisch genossen habt, sey es in einer öffentlichen Schule oder, was wahrscheinlicher ist, durch Hofmeister und Privatlehrer. Nur für den Fall, daß Ihr aus welchem Grunde immer im Lateinischen incompetent (unzuständig) seyd, füge ich eine Glossation des Wortes indelebilis an, wie ich auch gern aus propädeutischen (erzieherischen) Gründen bey Fremdwörtern eine Erklärung in Klammern anfüge, wie Ihr schon bemerkt haben werdet. Ich thue dies ganz im Sinne der »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht«, wo der Lehrer Cant die lateinischen oder griechischen Fachwörter zum besseren Verständnisse und zur Erklärung der Tradition und Herkunft stets auf die deutschen Ausdrücke und Übersetzungen folgen läßt. Dazu habe ich das ausdrückliche Placet (Billigung, eigentlich Gefallen) meines Herrn, der sagte: Amanuense, machen Sie es wie ich! Dies thue ich also aus Vorsicht und Sicherheit, bitte Euch aber daran keinen Anstoß zu nehmen und einfach darüber hinwegzulesen, wenn Ihr der Explication (Erklärung) nicht bedürftig seyd! In diesen Glossen meldet sich der zukünftige Lehrer in mir, der zu werden ich nach meiner Zeit als Amanuensis die Absicht habe! Vielleicht ist mein Unterricht doch nicht ganz unwillkommen und nutzlos. Über die Fehlerhaftigkeit und die merkwürdige Mangelhaftigkeit Eures Schreibens in orthographischer Hinsicht haben wir uns denn doch ein wenig verwundert, dies möchte ich nicht verschweigen. Ich führe dieselben auf Eure Aufregung zurück, die Euch beym Gedanken an Euren Adressaten wie ein Schwindel erfaßt haben mag! Cant!
Es steckt in dem erwähnten Eigenschaftsworte indelebilis das Zeitwort delere, welches »zerstören« bedeutet. Delebilis also heißt »zerstörbar«, indelebilis aber ist verneint und bedeutet dem entsprechend »nicht zerstörbar« oder auch »unabdingbar«. Es drückt dieses Wort also etwas absolut (losgelöst) Definitives (Endgültiges) aus. Character indelebilis: Einmal Priester, immer Priester! Was Reinhold betrifft, so hat er die eine oder andere ungute Eigenschaft, die man wie eine Berufskrankheit an Clericern (Geistlichen) öfters wahrnehmen muß, ohne daß hier der ganze Berufsstand denuncirt (abgemeldet) werden soll, nicht nur beybehalten, sondern sogar noch intensivirt (verdichtet), das gewisse pfäffisch Devote, das Hingebungsvolle nämlich, das nun nach den Heilichen oder dem Heilichen in Cant seinen Adressaten gefunden hat. Bey Reinhold ist an die Stelle der Heilichenverehrung, an die Stelle der Marienverehrung die Cantverehrung getreten. (Ihr, liebes Fräulein handelt freilich ähnlich, indem Ihr meinen Herrn als Nothhelfer, als den achten nach den sieben canonisirten Nothhelfern zu betrachten scheinet!) Reinhold nun läßt auch keine anderen Philosophen neben seinem Idol (abgöttisches Trugbild) gelten. Auch Fichte existirt nicht. Und wie er, Reinhold, leiden auch andere an Idolatrie (Götzendienst). Nie und nimmer aber wollte mein Herr den Platz des unbeweisbaren und unbewiesenen Gottes einnehmen, der durch ihn sozusagen frei gemacht wurde. Wer sich für Gott hält, ist ein Götze, so Cant. Mit der Behauptung von indelebilitas (Unzerstörbarkeit) ist er nicht nur im obigen Sinne des Weihesacramentes sehr vorsichtig und sparsam. Nichts ist unzerstörbar, sagte er einmal. Alles geht der Auslöschung entgegen. Diese nihilistische Ansicht ist mir freilich unerträglich, für einen solchen kohlschwarzen Pessimismus sind wir, Ihr, Fräulein von Herbert, und ich, zu jung. Die Jugend, sagte einmal ein Dichter, glaubt nicht an die Unsterblichkeit, sie ist unsterblich!
Leider muß ich auch Euch, verehrtes Fräulein von Herbert, das Wort Gott, das Ihr auf meinen Herrn anwendet, verweisen. Ich versichere Euch als sein Amanuensis, der ich nun seit zwey Jahren in seiner unmittelbaren Nähe lebe und in seinem Hause im Auftrage der Universität und im Solde der Stadt Königsberg sein Archiv ordne, er, Cant, ist nicht Gott! Er ist nicht allgegenwärtig, allgütig und allwissend, wie unser Catechism den Höchsten attribuirt (kennzeichnet). Ich will mich von Critik und schon gar von Spott über meinen alternden Herrn frei halten und distanciren. Aber ich thue ihm sicher nicht unrecht und sage nichts Unrechtes, wenn ich fest stelle, daß er gegenwärtig schon oft abwesend wirkt, daß seine vielgerühmte Güte sich vermindert und eine gewisse Schroffheit zunimmt und daß er vieles vergißt und Alltägliches nicht mehr weiß. Vielleicht weiß er, »wo Gott wohnt«, aber seine Strümpfe findet er oft nicht. Dazu und zu so vielem bedarf er seines Dieners Martin Lampe. Aus Einsicht in diesen Sachverhalt habe ich ihn auch einmal seinen Vornamen Immanuel, der doch wohl im Hebräischen »Gott mit uns« bedeutet und den ihm seine fromme Mutter in der Taufe zugedacht hat, heftig dementiren gehört! Das war einmal!, sagte er bitter. Trotzdem, von Gott verlassen fühlt er sich nicht. Gibt es auch, wie gerade er erwiesen hat, keine Beweise für die Existenz Gottes, so doch Hinweise. Er ist nun manches Mal durchaus das, was der Volksmund einen »zerstreuten Professor« nennt. Mit dem Worte zerstreut entspricht die deutsche Hauptsprache dem lateinischen confusus, Ihr werdet das Wort wohl kennen. Mir ist es ein erschütterndes Zeichen dieser Zerstreutheit, ja wörtlich genommenen »Verrücktheit«, daß er neuerdings öfter seinen eigenen, also seinen Eigennamen und Personennamen, als Cnat schreibt und unterschreibt. Es gibt kein drastischeres Indicium für den Verlust an Identität (Selbstbewußtheit) als diesen verschriebenen Namen. Anfangs dachte ich beym Lesen dieses entstellten Namens, Cant wolle damit vielleicht eine gewisse Distanc zu seiner vormaligen Existenz und Identität und eine Entwicklung, wenn auch eine nostalgische Rückwärtswendung ausdrükken – seine schottischen Vorfahren hatten sich ja wohl anders geschrieben -, mußte aber diesen Umstand später doch als Ergebnis von Confusion (Zerstreutheit) zur Kenntnis nehmen und bedauern. Hier ist auch der Platz, noch dies über seinen Eigennamen zu sagen: Das C im Anlaut von Cant hat Cants Vater und auch Sohn Immanuel anfangs geschrieben, um der schottischen Abstammung graphisch gerecht zu werden, auf die man stolz war. Später, am »Collegium Fridericianum«, dem strengen Gymnasium in Königsberg, ist dem Zöglinge diese Schreibung deshalb lästig geworden, weil die Mitschüler nun seinen Namen als Zand ausgesprochen haben, oder in der latinisirten Form Cantius als Zantius. Als er sich später wie heute wieder Kant schrieb, erklärte er gleichwohl den Anlaut als ein griechisches Kappa! Außerdem beleidigte ihn einmal ein Commilitone (Mitschüler) mit dem Hinweise, daß das englische cant »scheinheiliges Gerede« bedeuthet. Einen schlagenderen Gegenbeweis gegen das Sprüchwort »Nomen est omen« hat sicherlich nie ein Mensch geliefert als Cant, dieser »Mann mit Ecken und Kanten«, wie Freund Lenz ihn einmal nominirte.
Mit dem Worte Gott habt Ihr Herrn Cant jedenfalls gehörig überschätzt! Mag er gern, was unbestritten ist und viel bewundert wird, thiefe Einsichten und Gedanken über Gott und die Welt gewisser Maaßen, über das Universum haben, geschaffen hat er es nicht, er ist bestimmt nicht der »Schöpfer des Himmels und der Erde«. Wer sprachlos und staunend unter dem gestirnten Himmel in Ehrfurcht erschauert, wie er geschrieben hat, hat sich sicher nicht als dessen Creator überschätzet … Er ist groß, gewaltig groß und erhaben, wenn es darum geht, die abergläubischen und armseeligen Speculationen der Metaphysiker und ihre Denkfehler anzuprangern, aber letzte und endgültige Antworten auf die entscheidenden unabweislichen Fragen hat er nicht. Auf die Fragen »Woher kommen wir, wohin gehen wir?«, »Warum ist etwas und nicht vielmehr nichts?« schweigt er demüthig und eisern. Er weiß, was eine Frage bleiben muß. So gesehen ist er in meinen Augen durchaus auch ein Diener am Mysterium (Geheimnis). Vor Gott aber, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, geht der Mensch in die Kniee! Es ist wohl auch niemand ganz gescheit, der die Klärung der alles entscheidenden letzten Fragen von der so genannten Aufklärung erwartet. Ein solcher wäre buchstäblich nicht ganz »bey Troste«. Die Aufklärung ist doch nur ein defensives Programm gegen die Inspirirten (Begeisterten), die von sich behaupten, einen anderen als cognitiven Zugang zum Geheimnisse zu besitzen. Das möchte man auch dem Herrn Carl Leonhard Reinhold gerne ins Stammbuch schreiben!
Carl Leonhard Reinhold aber ist seinem Gotte Cant gegenüber nicht nur devot, sondern auch ein Schmeichler, ein notorischer Bewunderer. Einen solchen hat Cant eigentlich nicht nothwendig. Er müßte ihn härter in die Schranken weisen, zeigt aber gegenüber den ständigen Avancen (Umwerbungen) bedauerlicher Weise auch Schwäche. Ich gestehe freimüthig, daß ich Herrn Reinhold gewisser Absichten in Hinblick auf Cants Erbe verdächtige. Es ist so etwas Tartuffehaftes an ihm. Und das Einsammeln mag er auch in seinem vormaligen Kirchendienste eingeübet haben … Die Kirche habe einen großen Magen, schreibt Göthe im Zusammenhange der Collecte (Sammlung) als einer festen Institution (Einrichtung) im kirchlichen Procedere (Handeln). Reinhold verfolgt heute freilich eigene Interessen, aber dies mit der nämlichen Consequenz und Hartnäckigkeit. Er scheint es nicht nur auf eine Locke des Philosophen abgesehen zu haben, sondern auf den Pelz! Ich hoffe sehr, daß ich mit meiner Einschätzung der Person Reinholds in Euren Augen nicht anmaaßend und ungerecht erscheine. Ihr mögt auch vielleicht über Reinhold ein eigenes Urtheil und vielleicht ein günstigeres haben. Ich weiß ja, daß Euer Bruder Franz Paul von Herbert, als er von Clagenfurth nach Jena studiren kam, in Contact mit Reinholden getreten ist. Vielleicht ist auch Euer Bruder auf ihn hereingefallen, wenn ich es so freimüthig konjiciren (vermuthen) darf. Es sind freilich hauptsächlich Protestanten, die über den Apostaten Reinhold heute nichts kommen lassen. Sie halten ihn für einen Bekehrten und Erweckten!
Ich weiß nicht, ob mein verehrter Herr weiß, daß ich selbst, aus dem Saarlande gebürtig, catholischer Confession bin. Es spricht für seine Liberalität, daß er bey meiner Einstellung nicht nach meiner Einstellung gefragt und mich als den von der geisteswissenschaftlichen Facultät der Universität geschickten Secretär auf der Stelle in dieser Stellung acceptirt hat. Und es war, dies nebenbey gesagt, verehrtes Fräulein Maria von Herbert, auch nicht Ihre catholische Confession (worüber unser Kärnthner Gewährsmann berichtet), der Grund für Cants langes Schweigen auf Euer Schreiben hin, als würde er einer Altgläubigen erst gar nicht antworten. Das hatte andere Gründe, wie ich bereits angedeuthet habe. Als er freilich Ihren Namen, insbesondere Ihren Taufnamen Maria las, sagte er: Wird wohl eine Altgläubige seyn … Man erkenne dies auch an Euren Scrupeln, sagte er. Und dem schlechten Gewissen, das Catholiken auszeichne oder vielmehr entstelle!
Liebes Fräulein Maria, ich darf Euch wohl so amicaliter nennen?, Ihr müßt wissen, um Abschließendes über das Thema Confessionen zu sagen, daß es in den deutschen Ländern heute so und dergestalt ist, daß die herrschenden Kreise, der König, die Fürsten und Grafen und Barone, aber auch die Dominatoren (Thonangebenden) in Kunst, Cultur und Wissenschaft protestantischer Confession und Augsburger Bekenntnisses sind, die niederen Stände, die Bauern und Knechte aber catholisch, die Geistwerker evangelisch oder auch Freigeister, die Handwerker catholisch. (Von den Atheisten-Gottlosen- und Agnostikern-Erkenntnislosen –, die immer mehr werden, ganz zu schweigen!) Das Catholische gilt denn auch in den streng protestantischen Kreisen des Nordens als eine Sclavenreligion. So gesehen ist auch die Öconomie Cants, wie man hier ein Hauswesen nennt, eine typisch deutsche. Denn von mir abgesehen, ist auch der Diener Cants, der erwähnte Martin Lampe, Catholik. Wieder spricht es aber für die Liberalität und den freien Sinn Cants, daß er über diesen Umstand lange keine Kenntnis hatte, weil er nach solchen Belanglosigkeiten in seinen Augen nichts fragte, und dessen erst gewahr ward, als ihn Martin Lampe um die Erlaubnis bat, sich verehelichen, sich wieder und ein zweytes Mal verehelichen zu dürfen! Weil ihm die erste Lampin weggestorben war. Der reformirte Theologe, der Pfarrer in Boxberg bey Würzburg und Professor der Universität Heidelberg und deren Rector Johann Friedrich Abegg, ein Vertrauter meines Herren, hat mir folgendes, von ihm abgehörte Gespräch zwischen Immanuel Cant und Martin Lampe, seinem Diener, mitgetheilt und berichtet, das ich citiren darf: Lampe sagte also eines Morgens zu Cant: »Herr Professor, sie wollen es mir nicht erlauben!« Darauf sagte Cant: »So! Wer will denn nicht erlauben, oder was wollen sie nicht erlauben?« »Ach, sie wollen mich nicht trauen, weil es Fastenzeit ist.« »Nun so will ich an den Minister schreiben!« »Ja, das hülft nichts, man muß es dem Bischof melden. Wie ich mich vor sechzehn Jahren das erste Mal verehelichte, mußte ich auch an den Bischof mich wenden.« »So ist er schon einmal verheurathet gewesen, und er ist catholisch?« Ich habe diesen von Abegg verbürgten Dialog auch zu Protokoll genommen und ins Archiv getan, weil er mir für die Kenntnis der handelnden Personen von Belange erschien. Ich vermuthe übrigens, ohne eben Gewißheit zu haben, daß auch die Dritte im Bunde der Cantischen Lacaien und Domesticen neben Diener und Amanuensis, die liebe Köchin Luise Nitschin, catholisch ist. Ich schließe dies aus ihrem Speisenplan, denn das, was sie an den Freitagen auf den Tisch bringt, macht mir einen ausgesprochen catholischen Eindruck! Und sie scheint sich auch an die so genannten »geschlossenen Zeiten«, also die Fastenzeiten zu halten, in denen nach römischer Vorstellung nicht nur nicht gefreit, sondern auch kein Fleisch gegessen wird. Freien und Freuen am Fleischesgenusse sind in Advente und an Fasten unangebracht. Bey der ausgeprägten Vorliebe unseres Herrn für Fisch, insbesondere Kabeljau, hat dies aber noch keine Probleme gemachet. Cant dürfte noch gar nicht bemerket haben, daß er römisch-catholisch bekochet und servirt wird, so sehr er sich sonst und gerade im Falle der Lampeschen Hochzeit, die er als ein eingefleischter Cölibatär innerlich auf das Äußerste mißbilliget, ja verabscheut hat, über die »geschlossenen Zeiten« und die »papistische Willkühr« bey deren Festlegung und Festsetzung lustig gemachet hat. Er wolle essen, was ihm als Selbstdenker schmecket und gut thut, und nicht, was dem Papst schmecket oder was Rom gut findet oder schlecht machet. O selbstverschuldete Unmündigkeit! Als eine Art Entmündigung erscheint ihm freilich auch die Ehe, was ich auch bey der Antwort auf Eure Frage zu berücksichtigen habe. Denn nicht nur seinem Diener Lampe, auch seinem Bruder Johann Heinrich hat er die Verheurathung recht übel genommen, als wäre Verheurathen gleichzusetzen mit Verkommen und Verderben. So und nur so wird verständlich, daß Cant auf den Brief seines Bruders vom 13. Mai 1775, in welchem dieser seine Hochzeit, seine Statt gefundene Hochzeit, mittheilt, nicht antwortet und Glück wünscht, wie es vielleicht wünschenswerth wäre. Ob ihm Bruder Immanuel vielleicht einen Trauungs-Zeugen machen möchte, wie es natürlich gewesen wäre, wagte er ihn ja gar nicht zu fragen, denn dann wäre zu seiner Abneigung gegen das »Heurathen« auch noch die lästige Nothwendigkeit einer weiten Reise an gestanden. »Jetzt habe ich die wichtigste Veränderung meines Lebens gemachet, ich bin verheurathet!« schrieb Bruder Johann Heinrich. Vielleicht hätte sich Immanuel Cant noch zu einer Gratulation hinreißen oder bewegen lassen, wenn sein Bruder nicht seinen, Immanuels, eigenen Stand eines ledigen Cölibatärs schlecht gemachet hätte! Schreibt er doch des Weiteren: »Du mein liebster Bruder, mußt Heiterkeit und Gemüthsruhe in Zerstreuungen der Gesellschaft suchen, Du mußt Deinen kränklichen Körper den Mietlingssorgen fremder Leute anvertrauen. Ich finde die ganze Welt in der zärtlichsten Freundin meines Herzens, die meine Freuden und meine Bekümmernisse mit mir theilt, und gewiß, wenn ein herannahendes Alter seine Lasten mitbringt, sie mit der liebreichsten Pflege erleichtern wird. Ich bin glücklicher als Du, mein Bruder. Laß Dich durch mein Beyspiel bekehren. Der Cölibat hat seine Annehmlichkeiten, solange man jung ist. Im Alter muß man verheurathet seyn oder sich gefallen lassen, ein mürrisches, trauriges Leben zu führen …« Und so fort. Armseeliger Spießbürger, dummer Bruder!, sagte Cant laut dem anwesenden Lampe damals. Und als dem geistlichen Bruder in Mitau ein Sohn starb, hat er, Cant, sogar zu condoliren unterlassen. Es hat ihn aber wohl traurig gemachet und von einer so genannten »eschatologischen (endeszeitlichen) Schadenfreude«, wie sie jene Üblen empfinden, die sich durch das Unglück der in ihren Augen dummen Mitmenschen in ihren negativen Ansichten von Welt und Gesellschaft bestätigt fühlen, darf in Cants Falle auf keinen Fall gesprochen werden!
Ich erwähnte weiter oben jene Briefe mit den Bitten um Andenken und Reliquien nur, um Ihnen, werthes Fräulein Herbert, eine Vorstellung von dem oft unerquicklichen Posteingange meines Herrn und der Verstiegenheit menschlicher Begierden in Hinblick auf heraus ragende Persönlichkeiten und die Abgründe des Personencultes zu vermitteln. Ihr, werthes Fräulein Maria von Herbert, habet ihn freilich weder in Eurem ersten noch im zweyten Briefe unverschämt um Schamhaare gebethen, um es ein wenig frivol zu pointiren (auf den Punct bringen). Wenn Cant gleichwohl nicht geantwortet hat und damals auch noch nicht antworten lassen konnte, weil ich ihm aus der Personalreserve unserer Königsberger Universität erst später als Secretarius officialis und noch später auch Secretarius privatus und Amanuensis ad libitum zugeordnet wurde, so ex pricipio (aus Grundsatz). Cant wäre nicht der Verfasser jener Werke, als den ihn die Welt kennt und bewundert, wenn er allen Correspondenzwünschen nachgekommen wäre. Hätte er nach der »Critik der reinen Vernunft« alle unvernünftigen Briefe, Depeschen und Billetten, enthaltend Zustimmung, Zurückweisung, Bewunderung oder Critik, erwidert, so hätte er weder die »Critik der practischenVernunft«, noch die »Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft« noch die »Anthropologie in pragmatischer Hinsicht« verfassen können. Und ganz besonders hätte er nach seiner Schrift »Zum ewigen Frieden« im Jahre 1795 keine Ruhe zu weiterer Arbeit gefunden. Ein dauerhafter persönlicher Unfriede wäre die consequente Folge gewesen.