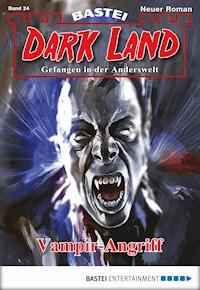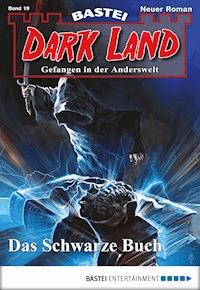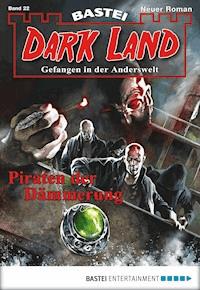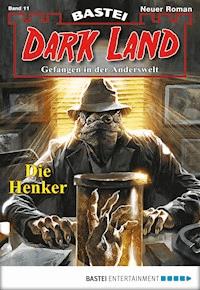2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Castor Pollux
- Sprache: Deutsch
Gallien, 16 n. Chr.
Gebannt starrten die versammelten Männer auf den Mann in der weißen Robe. Taranis stand vor dem leeren Stamm einer abgestorbenen Eiche, in deren Mitte er eine brennende Schale platziert hatte. Die magische Flamme griff bald auf die Reste des Baumes über.
Ein Raunen ging durch die Schar der gallischen Krieger, die das Ritual ihrer Vorväter bisher schweigend verfolgt hatten. Nun, da eine dunkelrote Flamme aus der Eiche hervorschoss und die Gestalt des Druiden erfasste, ohne ihn zu verzehren, glaubten auch die letzten Zweifler daran, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Mit Taranis‘ Hilfe würde es ihnen endlich gelingen, die Genovevanerinnen zu vernichten!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
WIE WAR´S WIRKLICH?
Der Sturm der Genoveva
… UND IM NÄCHSTEN ROMAN LESEN SIE:
Fußnoten
Impressum
Der Sturm der Genoveva
von Rafael Marques
Gallien, 16 n. Chr.
Gebannt starrten die versammelten Männer auf den Mann in der weißen Robe. Taranis stand vor dem leeren Stamm einer abgestorbenen Eiche, in deren Mitte er eine brennende Schale platziert hatte. Die magische Flamme griff bald auf die Reste des Baumes über.
Ein Raunen ging durch die Schar der gallischen Krieger, die das Ritual ihrer Vorväter bisher schweigend verfolgt hatte. Nun, da eine dunkelrote Flamme aus der Eiche hervorschoss und die Gestalt des Druiden erfasste, ohne ihn zu verzehren, glaubten auch die letzten Zweifler daran, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Mit Taranis’ Hilfe würde es ihnen endlich gelingen, die Genovevanerinnen zu vernichten!
WIE WAR´S WIRKLICH?
Der Orden der Genovevanerinnen taucht erstmals in dem von mir geschriebenen Roman »Unter Einfluss« in der Reihe »Professor Zamorra« (Band 1270) auf. In dieser Geschichte schließt sich Erin, die Geliebte des gallischen Kriegsherrn Vercingetorix, dem Orden an, um mit Hexenkräften Einfluss auf die entscheidende Schlacht zwischen Römern und Galliern um die Stadt Alesia zu nehmen – was ihr allerdings nicht gelingt.
Die Genovevanerinnen hat es nie gegeben, den gallischen Krieg und Vercingetorix dagegen schon. Für den römischen Feldherrn Gaius Julius Caesar markierte der Sieg in Alesia 52 v. Chr. einen großen Schritt auf seinem Weg zur Alleinherrschaft über das Römische Reich. Grund genug, einen näheren Blick auf die Ereignisse zu werfen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschichte Roms und damit der halben Welt nehmen sollten – auch wenn Castor Pollux damals noch gar nicht geboren war.
Vercingetorix war ein Fürst der Averner und hatte sich erhoben, um die Römer aus dem Land zu werfen. Nach einigen Kämpfen gelang es Caesar, ihn nach Alesia zurückzudrängen, wo sich Vercingetorix und seine Krieger innerhalb der Stadtmauern verschanzten. Daraufhin errichteten Caesars Soldaten innerhalb von wenigen Tagen einen sechzehn Kilometer langen Wall, der die Stadt vollkommen einschloss. Die Belagerung war brutal. Als die Vorräte knapp wurden, scheuchte Vercingetorix Alte, Frauen und Kinder vor die Tore, da er die verbliebenen Lebensmittel für seine Krieger brauchte. Die Römer dachten jedoch gar nicht daran, die Zivilisten durch ihre Reihen ziehen zu lassen. So verhungerten und verdursteten sie schließlich zwischen den Fronten.
Als Caesar erfuhr, dass Verstärkung für die Gallier auf dem Weg nach Alesia war, ließ er einen zweiten Wall mit einer Länge von einundzwanzig Kilometern um den ersten drumherum bauen.
Bald darauf mussten sich die Römer an zwei Fronten behaupten. Von hinten griff das Entsatzheer an, vorne unternahmen die eingeschlossenen Gallier einen Ausfall. Trotz des Zangenangriffs und ihrer zahlenmäßigen Unterlegenheit behielten die Römer am Ende die Oberhand. Dazu soll beigetragen haben, dass Caesar selbst auf dem Schlachtfeld erschien und ihnen so neuen Mut einflößte. Am Ende musste sich Vercingetorix geschlagen geben. Er wurde nach Rom gebracht und sechs Jahre später im Rahmen von Caesars Triumphfeierlichkeiten erdrosselt.
Von einigen kleineren Aufständen abgesehen, war Gallien damit geschlagen. Caesar wurde acht Jahre später von Verschwörern ermordet, die sich von dem Diktator befreien und die Republik zu neuem Glanz führen wollten. Es half wenig. Siebzehn Jahre später, 27. v. Chr., bestieg Caesars Adoptivsohn Gaius Octavius unter dem Namen Augustus als erster römischer Kaiser den Thron. Viele weitere sollten ihm folgen.
Michael Schauer
Der Sturm der Genoveva
Die Zusammenkunft der Stammesführer bot nicht wenige Risiken. Zum einen sahen es die römischen Besatzer gar nicht gern, wenn die Gallier öffentlich ihre alten Götter anbeteten. Zum anderen stellte diese Beschwörung ein sprichwörtliches Spiel mit dem Feuer dar, denn ob der Druide nun wahrhaftig die alten Götter anbetete und nicht eher finstere Dämonen, war keinem der Anwesenden so recht klar.
Taranis selbst stellte schon ein Mysterium dar. Er war anders als die meisten Druiden, lebte einsam in einer Höhle in den Bergen und mied normalerweise den Kontakt zu den Menschen, denen sich seinesgleichen normalerweise verpflichtet fühlten. Hinzu kam, dass niemand sein Alter oder seinen wahren Namen kannte, denn dass man ihn nicht von Geburt an als Himmels- und Donnergott angesprochen hatte, der unter derselben Bezeichnung bekannt war, lag auf der Hand.
Als die Übergriffe der Genovevanerinnen immer aggressiver geworden waren, war er plötzlich in den umliegenden Dörfern aufgetaucht, um seine Hilfe anzubieten.
Seinen Preis hatte er noch nicht genannt. Den Stammesführern und Dorfältesten war angesichts der ausweglosen Lage gar keine andere Wahl geblieben, als die Hilfe des Druiden anzunehmen. Dabei warnten sogar andere Druiden davor, dass ihnen dieser Mann nicht geheuer war, und nun, im Angesicht der Magie, die er beherrschte, schienen sie zumindest mit dem Ausmaß seiner Macht recht behalten zu haben.
Die dunkelroten Flammen brachten lediglich Taranis’ Umhang zum Glühen, bevor sie sich wieder auf die knorrige, tote Eiche konzentrierten.
»Nehmt die Fackeln, die ich euch gegeben habe, und haltet sie in das Feuer«, rief der Druide, der die unsicheren Blicke der Krieger wohl bemerkt hatte. »Die Flammen, die uns die alten Götter geschenkt haben, werden stark genug sein, um die Hexen zu vernichten.«
»Was ist mit den Kindern?«, rief Mergorix, einer der Stammesführer.
Damit sprach er ein Thema an, das den Menschen in der Umgebung besonders große Angst bereitete. Nicht nur, dass immer wieder junge Mädchen dazu verführt wurden, sich den Genovevanerinnen anzuschließen, sie entführten und töteten auch Kinder, die sie für ihre mysteriösen Rituale benutzten. Die Leichenfunde häuften sich in letzter Zeit, zudem galten mehrere Söhne und Töchter weiterhin als vermisst. Auch Mergorix’ einziger Nachkomme zählte dazu.
Taranis trat noch näher an die Flammen heran, sodass sein dünnes Gesicht mit den hervorstechenden Wangenknochen unter der Kapuze deutlicher zu erkennen war. Er schien die Nähe der heißen Flammen zu genießen, die wie geisterhafte Arme über seine Haut strichen, ohne ihn dabei zu verletzen. Der Widerschein des Feuers in seinen Augen legte die Vermutung nahe, dass es sich bei ihm nicht einmal um einen Menschen handelte. Manch einer fürchtete sogar, er könnte sich jeden Moment in eine finstere Kreatur verwandeln.
»Jedes Kind, das den Hexen bereits in die Hände gefallen ist, ist verloren«, verkündete er ungerührt. »Niemand kann sie mehr retten, nicht einmal ihre Seelen.«
»Aber …«
Der Stammesführer kämpfte sichtlich mit seinen Emotionen. Nun mochte nicht der Moment dafür sein, die Fassung zu verlieren, doch Mergorix hatte insgeheim so sehr darauf gehofft, eine andere Antwort zu erhalten. Immerhin war er schon so alt, dass er keinen weiteren Sohn mehr zeugen würde. Ohne Nachfolger sah sein Stamm einer unsicheren Zukunft entgegen. Mit der aufkeimenden Trauer über seinen endgültigen Verlust wuchs auch der Hass auf die Hexenführerin Genoveva, die mit ihrem Leben für ihre Verbrechen bezahlen sollte.
»Nehmt die Fackeln!«, wiederholte der Druide. »Wartet nicht mehr zu lange, sonst erlischt das Feuer wieder.«
Mergorix nickte, woraufhin auch die anderen Krieger ihre Position zwischen den Bäumen verließen, auf die Lichtung traten und den Worten des Druiden Folge leisteten. Ungerührt verfolgte Taranis das Treiben derjenigen, die ihn beauftragt hatten. Es lag auch in seinem Interesse, dass die Genovevanerinnen nicht zu viel Macht erhielten, besonders die Namensgeberin dieses verfluchten Kultes.
Nicht einmal weit entfernt, in einem einsamen Dorf in den Bergen, hausten die Hexen und versetzten die gesamte Region in Angst und Schrecken. Die Nacht war noch jung, deshalb würden seine Gefolgsleute nicht eher ruhen, bis sie das Versteck der Hexen bis auf die Grundmauern niedergebrannt hatten …
Versteckt in einem dunklen Wald lag ein Dorf, dessen Name niemand mehr auszusprechen wagte. Es war verflucht, verdammt in alle Ewigkeit, denn die Bewohner lebten längst nicht mehr oder waren den Dienerinnen der Genoveva anheimgefallen. Niemand wagte es, diesen Ort zu betreten oder ihm auch nur zu nahe zu kommen, wollte er nicht den Zorn dieser mächtigen Frauen spüren.
Das war auch nicht ohne Grund der Fall. Die Menschen, die hier hausten, mochten äußerlich noch wie Frauen wirken, in Wahrheit waren sie Monstren, die den Befehlen ihrer Herrin bedingungslos Folge leisteten. Und so sahen sie in dieser Nacht auch ungerührt zu, wie eine Jugendliche mit wallenden, dunkelbraunen Haaren in ihre Mitte trat. Im Widerschein des Feuers begann ihr nackter Körper zu glänzen. Sie schwitzte, war trotz allem nervös, andererseits aber nicht gewillt, von ihrem Vorhaben abzusehen.
Um jetzt noch einen Rückzieher zu machen, wäre es viel zu spät gewesen. Nicht nur, weil die Stimme in ihrem Kopf, die wohl aus dem um ihren Hals baumelnden Amulett stammte, ihr etwas anderes befahl, die Zuschauerinnen hätten mit ihr auch sicher dasselbe gemacht wie das, was sie mit dem zitternden Bündel vor ihren Füßen plante. Das kleine Mädchen, das sie beim Spielen in einem kleinen Bach erwischt und kurzerhand verschleppt hatte, schien noch immer darauf zu hoffen, mit dem Leben davonzukommen.
Dabei war sein Tod längst beschlossene Sache.
Eine der umstehenden, in ein dunkles Gewand gehüllten Frauen reichte ihr einen Dolch. Gnadenlos ließ die Schwarzhaarige die Klinge nach unten fahren, und als das Blut aus der Kehle des sterbenden Mädchens hervorschoss, stürzte sie sich gierig auf sie und begann, ihren Lebenssaft zu saugen.
Während der Nackten ein wilder Schrei entfuhr und sie von Krämpfen geplagt zu Boden ging, wurden die um sie stehenden Frauen von immer lauter werdenden Geräuschen abgelenkt. Hufgetrappel hallte ihnen entgegen, dabei hätte sich in dieser Nacht niemand dem Dorf nähern dürfen. Einmal davon abgesehen, dass nicht einmal die mutigsten Krieger es wagten, sich ihnen in den Weg zu stellen, da sie den Zorn der Genoveva mehr fürchteten als den ihrer eigenen Götter.
Die Schwarzhaarige kauerte am Boden und kämpfte mit den Folgen ihres Rituals, während die umstehenden Frauen nun zeigten, dass sie keine Menschen mehr waren, sondern Hexen. Sie spürten die sich ihnen nähernde Gefahr und zogen die entsprechenden Konsequenzen. Ihre Haut trocknete aus und verwandelte sich in dünnes Leder, das sich eng um die Knochen spannte. Die Augen färbten sich schwarz und fielen tief in die Höhlen hinein, während sich hinter ihren Lippen ein Raubtiergebiss mit spitzen Zähnen bildete.
Dass sie über derartige Fähigkeiten verfügten, wussten die Menschen längst, weshalb sie es normalerweise auch nicht wagten, sich ihnen zu widersetzen. In dieser Nacht schienen diese alten Gesetzmäßigkeiten nicht mehr zu gelten, im Gegenteil, nun waren es die Hexen, die sich in Acht nehmen mussten.
Dutzende berittene und mit Äxten, Speeren und Keulen bewaffnete Krieger fielen in das Dorf ein. Einige der Angreifer trugen auch Fackeln bei sich, von deren dunkelroten Flammen eine gefährliche Aura ausging.
Auch der ganz in einen weißen Umhang gehüllte Mann, der inmitten der gallischen Krieger ritt, trug eine dieser Fackeln bei sich. Längst ahnten die Frauen, dass der Druide die größte Gefahr darstellte, allerdings waren sie nicht in der Lage, ihn zu erreichen.
Es entwickelte sich ein Kampf, der von beiden Seiten mit äußerster Brutalität geführt wurde. Die Hexen, so furchteinflößend sie auch aussehen mochten, waren nicht gegen die schweren Waffen der Krieger gefeit. All der Hass der örtlichen Bevölkerung entlud sich in den gnadenlosen Schlägen, bei denen Schädel gespalten und ganze Gliedmaßen abgetrennt wurden. Gleichzeitig schossen aus den Augen der Genovevanerinnen blaue Blitze, die durch die Körper der mutigen Männer fuhren, sie verdampften und lediglich schwarze Skelette zurückließen.
Als immer mehr Krieger das Dorf stürmten, brach der Widerstand der Hexen in sich zusammen. Sobald die Frauen mit dem magischen, von dem Druiden Taranis entfachten Feuer in Berührung kamen, wurden sie restlos, mit Haut, Haar und Kleidung, von den Flammen verzehrt, sodass lediglich eine Staubfahne zurückblieb. Doch auch als ihre Körper nicht mehr existieren, brach das Feuer nicht in sich zusammen. Wie Irrwische tanzten Flammenzungen durch das Dorf, als würden sie sich gegenseitig suchen, um sich schließlich in einer einzigen gewaltigen Feuerlohe zu vereinigen.
Das war auch nötig, wie Taranis nicht ohne einen Hauch von Furcht feststellte. Am Rande des Dorfes erhob sich etwas Gewaltiges, das nur er als im Hintergrund gebliebener Betrachter wahrnahm. Ein Wesen, das von dem Tod der Hexen erzürnt war, wollte sich an den verbliebenen Kriegern rächen, denen der Sieg allein nicht genug war. Sie setzten die Häuser in Brand, trieben die verbliebenen Frauen vor sich her und metzelten sie nieder, bis keine von ihnen mehr übrig war.
Unbemerkt von ihnen näherte sich das riesige Monster, bis Taranis’ Geist Besitz von der Flammensäule nahm und sie in die richtige Richtung leitete. Als das Monster von dem Feuer erfasst wurde, stieß es einen schrillen, ohrenbetäubenden Schrei aus, der den Kopf des Druiden zum Beben brachte. Er spürte, wie ihm schwarz vor Augen wurde. Kraftlos stürzte er vom Rücken seines Pferdes auf den weichen Boden, ohne sich jemals wieder zu rühren.
Er war gestorben, getötet durch das letzte verzweifelte Aufbäumen der wahren Genoveva.
Die einstmals überlegene und furchteinflößende Genoveva, die Anführerin ihres eigenen Hexenordens, der innerhalb einer einzigen Nacht durch gallische Krieger und einen Druiden vernichtet worden war, lebte. Was man eben so Leben nannte, schoss ihr immer mal wieder durch den Kopf, während sie sich humpelnd, in einen löchrigen, schwarzen Umhang gehüllt, durch die Wälder schleppte.
Ein Schatten ihrer selbst war sie nur noch, ein lachhaftes, zuckendes Bündel, kaum mehr in der Lage, einen einfachen Menschen aus eigener Kraft zu töten. Ob es nun Glück war oder vielmehr ein zynischer Wink des Schicksals, dass sie als Einzige dem Angriff entkommen war, spielte für sie keine Rolle. Sie hatte weder Zeit noch Lust, um solch tiefsinnige Gedankengänge zu verfolgen. Zu sehr zehrten die Schmerzen an ihren Kräften, die sich unablässig durch ihren Körper fraßen.
Ihr mochte es mit dem letzten verbliebenen Rest ihrer einstigen Kraft gelungen sein, den Druiden zu töten, der Preis dafür war jedoch zu hoch gewesen. Das von ihm und seinen alten Göttern entfachte Feuer hatte ihr nicht nur die Energie aus dem Körper gezogen, sondern auch ihre Haut fürchterlich verunstaltet. Nun war sie keine wunderschöne Frau, der Menschen beider Geschlechter schon bei ihrem bloßen Anblick hoffnungslos verfielen, sondern ein abstoßendes Wesen, vor dessen Spiegelbild sie sich sogar selbst fürchtete.
Ihr blieb nur noch eine einzige Hoffnung, ihre Existenz zum Besseren zu wenden. Sie musste zurück zu einem Ort, an dem sie vor langer Zeit selbst eine besondere Weihe erfahren hatte und dem sie ihren Status als die Genoveva verdankte.
Unweit der Stadt Augustobona befand sich ein Hünengrab aus grauer Vorzeit, in dem drei riesige Skelette über den sagenumwobenen Splitter des Galar wachten. Bei diesem handelte es sich um ein Bruchstück jenes magischen Steins, der einst der berühmten Urhexe Nathaira gehört hatte. Früher war sie mit ihresgleichen dort oft zusammenzukommen, um ihr zu huldigen, denn für sie war sie so etwas wie eine Göttin. Mit dem Splitter in ihrem Besitz würde es ihr gelingen, ihre alte Macht zurückzuerlangen und ihren Kult neu aufzubauen.
Da sie trotz ihrer Verletzungen weiterhin kein Mensch war, sondern eine aus magischem Antrieb handelnde Hexe, brauchte sie weder Nahrung noch Schlaf, weshalb sie Tag und Nacht unterwegs war. Mit einer Feigheit, für die sie sich mehr und mehr schämte, vermied sie es, den Ansiedlungen zu nahe zu kommen. Nicht nur ihr Anblick würde dazu führen, Aggressionen gegen sie heraufzubeschwören, sie fürchtete auch, dass einige Häscher der gallischen Krieger immer noch hinter ihr her waren und sie einholen könnten.
Was war nur aus ihr geworden?
Die stolze Führerin eines Hexenkultes erwies sich als ein hässliches, feiges Weib, das das Ende ihrer Existenz mehr fürchtete als alles andere.
In der Dämmerung des sechsten Tages, den sie nun schon unterwegs war, gelangte sie auf dem Stammesgebiet der Tricassen auf die Kuppe eines bewaldeten Hügels. Dort, im Schutze der Bäume, war vor langer Zeit aus riesigen Gesteinsblöcken ein Grab errichtet worden.
Ob es schon immer ein Hort der Urhexe gewesen war oder sie ihn erst später für sich vereinnahmt hatte, wusste sie nicht. Jedenfalls spürte sie bereits die Ausstrahlung ihrer Magie, wenngleich es wohl schon seit längerer Zeit nicht mehr zu den rauschenden Festen von einst gekommen war. Die mächtigen Steine waren verbuscht, der Tanzplatz ihrer Schwestern unter hohem Gras verborgen. Sogar die Wurzel eines Baumes rankte sich über den verborgenen Zugang.
Genoveva gefiel die Szenerie nicht.
Was war hier in den vergangenen Jahrhunderten geschehen? Hatten die Tricassen ihre Hexenschwestern vertrieben? Sie alle waren so mächtig gewesen, wie sie es bis zu dem Einfall der Helfer des Druiden war. Und selbst wenn sie angegriffen worden wären, hätten sie immer noch unter dem Schutze Nathairas gestanden. Ein flaues Gefühl breitete sich in ihrem Magen aus, die Furcht davor, etwas zu erfahren, das sie eigentlich gar nicht wissen wollte.
Stöhnend schleppte sie sich zu den Steinen, kletterte an ihnen empor und erreichte einen Felsbrocken, der selbst für sie viel zu schwer gewesen wäre. Kein Mensch war in der Lage, ihn zur Seite zu schieben, ja selbst einfache Hexen scheiterten daran. Wer dagegen über eine Aura verfügte, die der Magie der Urhexe genehm war, dem gewährte sie Zugang. So war es auch in diesem Fall, was Genoveva zumindest einigermaßen beruhigte. Der Stein glitt zur Seite und zermalmte die sich um ihn herum ausbreitenden Wurzeln.
Anschließend warf sich Genoveva in die Tiefe. Sie musste nur einen kurzen Gang durchschreiten, bis sie in den saalartigen Raum gelangte, in dem der Urhexe in vergangenen Zeiten Menschenopfer dargebracht worden waren.
Das geheimnisvolle, graue Licht strömte noch immer aus dem Gestein und versetzte die Umgebung in ein unheimliches Zwielicht, sodass sich die drei sitzenden Skelette, die von der Größe her an Riesen erinnerten, kaum von der Umgebung abhoben.
Zu ihren Füßen befand sich ein Altarstein, auf dem ein roter Tonkrug ruhte. Aus ihm hatte sich einst eine gleißende Lichtsäule immerwährend ihren Weg zur Decke gebahnt, doch nun war dieser Schein erloschen. Auch Genovevas letzte Hoffnung zerbrach, als sie sich dem Krug näherte. Sie musste nur einen kurzen Blick hineinwerfen, um festzustellen, dass der Splitter verschwunden war.
Jemand musste ihn gestohlen haben, daran bestand kein Zweifel.
Keine Hexe hätte ihn je aus dem Krug entfernt, da dies einem Frevel gegen die Göttin gleichkam. Aber wer hätte es gewagt, ihn zu entwenden? Ein Mensch sicher nicht, er wäre bei dem kleinsten Kontakt mit dem Splitter zu Staub zerfallen.