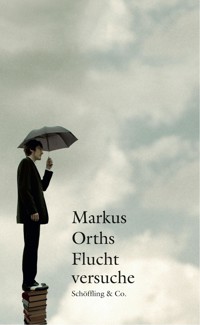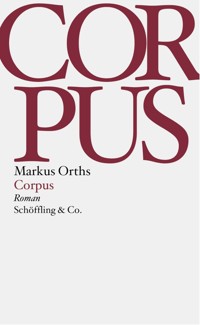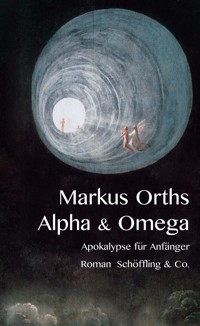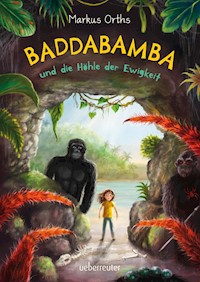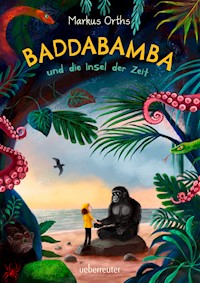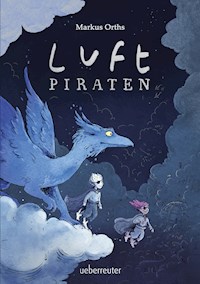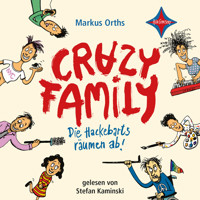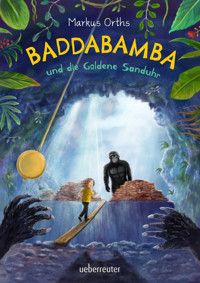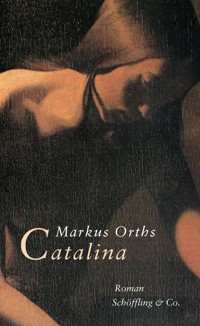
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Schöffling
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Was, wenn ein Mädchen sich entscheidet, als Mann zu leben? Ihre Haareabschneidet, Männerkleidung trägt und ihr Verhalten der neuen Rolleanpasst? Was, wenn sie die fremde Identität mit der Zeit immer mehr verinnerlicht? »Ganz von vorn beginnen, ein neuer Mensch, selber zusammengenäht, selber gestrickt in der Finsternis.«Catalina ist die Geschichte von Catalina de Erauso, die im 17. Jahrhundert lebte, eine schmale Autobiographie hinterließ und ein unglaubliches Leben führte. Markus Orths erfindet dieses Leben noch einmal neu: packend, rasant, kenntnisreich und voll unglaublicher Ereignisse und Wendungen. An einem strahlend blauen »Sonnenregentag« in San Sebastián wird Catalina als sechstes und letztes Kind von María Pérez de Galarraga y Arce geboren. Ihr zehn Jahre älterer Bruder Miguel, zu dem Catalina eine innige Beziehung entwickelt, entfacht in ihr eine Sehnsucht nach der Neuen Welt: die Silberminen Potosís, der damals reichsten Stadt Südamerikas, größer noch als Paris, Rom oder London. Als Miguel die Familie für immer verlässt und nach Potosí aufbricht, hat Catalina nur noch einen Wunsch: »Ihm hinterherfahren! schwor sie, und etwas Neues füllte sie aus, etwas, an das sie sich klammern konnte, von nun an, für immer, etwas, an das sie mit Besessenheit glauben konnte, ein Ziel, ein Sinn, eine Aufgabe.«Und was sie auf dem Weg von San Sebastián nach Neu-Spanien, Chile und Peru erlebt, ist die atemberaubende Geschichte einer verzweifelten Suche nach dem anderen, die zugleich die Suche nach sich selbst ist. Markus Orths, Autor des Bestsellers Lehrerzimmer, erreicht mit Catalina den Gipfel seiner Erzählkunst: ein ungemein spannender, fesselnder, dichter Roman und ein unerhörtes Leseerlebnis.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
I
Prolog
Verluste
Der Sonnenregentag
Blut an der Wand
Ein gelungener und ein verpasster Ausbruch
Die Höhle Ekain
Juan Bautista de Arteaga
Zweite Taufe
Vom guten und vom schlechten Spielen
Angst, Erleichterung, Entsetzen
Der Steinwurf von Sevilla
II
Der Aerosolnebel
Sprachkrank
Salve
Neue Welt
Männer oder Frauen
Erstes Töten
Im Berg von Potosí
Die Umarmung
Ein Rausch
III
Das Ende von vielem
Die Leutnantnonne
In der Finsternis
Anders sterben mögen
Eine Feder
Der Ritt nach Huamanga
Tod durch den Strang
Das Diktat
Römische Entscheidung
Epilog
Literatur
Impressum
Kurzbeschreibung
Autorenporträt
I
Prolog
Die Stadt San Sebastián am Golf von Biscaya brachte eine Reihe von Menschen hervor, die beinah in die Geschichtsbücher eingegangen wären. Zum Beispiel Manuel Pessoa, ein Walfänger, der eigentlich und in Wahrheit Amerika entdeckte, weil er schon 1397, als die Wal- und Kabeljaugründe vor der baskischen Küste leer gefischt waren, mit seinem Boot nach Island fuhr und von Island weitere 1700 Meilen südwestwärts. Dort betrat er als erster Europäer die Küste Neufundlands und somit im Prinzip Nordamerika, was ihn aber nicht so sehr interessierte wie die Baskischen Wale, die vor dieser Küste schwammen, und zwar in Hülle und Fülle, ahnungslos, friedlich, bereit zum Abschlachten. Pessoa, ein gewiefter Fischer, hütete sich, seinen Kollegen auch nur ein Sterbenswörtchen von dem, was er entdeckt hatte, zu verraten, denn was war schon der zweifelhafte, nichts einbringende Ruhm eines Entdeckers gegenüber dem geheimen Wissen um unangetastete Walfischgründe? Er schiffte lieber Jahr für Jahr wahre Walfleischberge nach San Sebastián, verkochte Tonnen von Blubber zu kostbarem Tran, haute haufenweise Knochen und Zähne aus den Walgerippen und wurde auf diese Weise statt berühmter nur immer reicher. Ihm genügte vollkommen, seinen eigenen Kindern von der Entdeckung eines Landes zu erzählen, das nicht sein durfte, wo es sich befand, da alle Karten, die man damals besaß, an dieser Stelle weiß waren wie der Schaum von Meereswellen. Oder wie der Dampf von kochendem Wasser: Der nämlich wurde für den baskischen Ingenieur Blasco de Garay zu einer derart fixen Idee, dass er im Jahr 1543 voll Überzeugung zum damaligen Herrscher nach Valladolid aufbrach, um ihm von dem zu berichten, woran er mit Besessenheit glaubte. Die Idee bestand darin, ein Schiff von einem Rad fortbewegen zu lassen, und das Rad sollte angetrieben werden von der bloßen Dampfkraft des Wassers. Blasco de Garay geriet jedoch an den Sohn Philipps des Schönen und Johannas der Wahnsinnigen, an Karl den Ersten, an einen kaiserlichen König also, der es fertig brachte, in der Alhambra einen Flügel des göttlichen Nasridenpalastes abreißen und durch einen hässlichen Steinklotz ersetzen zu lassen, was für den Betrachter den Eindruck erweckt, eine Kuh hätte ihren Fladen in eine Sommerwiese gepflanzt. Karl hatte kein Verständnis für die Idee des Ingenieurs, doch Blasco de Garay ließ sich nicht beirren und trieb aus privaten Quellen Geld auf, um seine Pläne zu verwirklichen, was ihm erst viele Jahre später gelang, als er schon in einem Alter war, in dem der Kopf ein wenig nachlässt, sodass er wohl einige Endberechnungen falsch tätigte, weshalb das erste Dampfschiff der Menschheit statt durchs Wasser zu fahren in die Luft flog und anschließend mitsamt der Idee für lange Zeit in den Fluten versank. Das geschah in Sichtweite des Hafens, von dem 1588 ein Mann namens Miguel de Oquendo y Dominguez de Segura aufbrach, um die unbesiegbare spanische Armada nach England zu begleiten: Ein außerordentlicher Mann war das, der es vom einfachen Schafhirten zum Schiffsbaumeister und schließlich sogar zum Kommandanten der Santa Ana gebracht hatte – eines der besten Schiffe seiner Zeit. Oquendo wurde nicht nur leuchtendes Beispiel und Symbol dafür, wie weit man kommen kann, wenn man etwas wirklich will, sondern auch Initiator des geflügelten Worts »Vom Schafhirten zum Kommandanten«, das sich als stehender Ausdruck etablierte und vom Baskenland in die Neuen Kolonien kam, wo es vier Jahrhunderte später in leicht abgewandelter Form immer noch die Runde macht. Doch Oquendo hatte das historische Pech, die unbesiegbare Armada gerade auf dem Feldzug zu begleiten, auf dem sie ihr Beiwort verlor, und nachdem der zerstückelte Rest der Flotte von den englischen Kanonieren gedemütigt und geschlagen zurückkehrte und auch die Santa Ana als halbes Wrack in San Sebastián einlief, starb Oquendo völlig entkräftet nach wenigen Tagen an Land. Fünf Straßen weiter stand ein Haus, und dieses Haus hieß Der Wal. Man muss wissen: Jedes baskische Haus wurde damals getauft, denn für die Basken existierte nur etwas, das einen Namen hatte. Und im Wal wurde Catalina de Erauso zwar nicht geboren, aber immerhin gezeugt.
Verluste
Catalinas Mutter, María Pérez de Galarraga y Arce, war eine Frau mit Tiefe. Man hätte meinen können, diese Tiefe zeige sich in ihrer enormen Frömmigkeit und Glaubenskraft. An den Sonntagen blieb sie länger als nötig in der Kirche, freitags aß sie fast nichts, und wenn doch, höchstens Linsen oder Stockfisch. Sie besuchte schon als junge Frau die Rosenkranzgebete im Kloster San Sebastián el Antiguo, ging für die Kreuzwegandacht zu den Franziskanern, für die Herz-Jesu-Verehrung ins Jesuitenkonvent und zum Feiern der Nährvater-Christi-Bräuche zu den Karmeliten. Zweimal war sie bereits zum Grab des Heiligen Jakob gepilgert, und überhaupt schlug ihr Herz für die Heiligen: Sie hatte alle möglichen Heiligenbildchen gesammelt und war nun im Besitz von achtzehn Heiligen, alphabetisch sortiert, Agatha (gegen Vulkanausbrüche), Augustinus (gegen Verluste aller Art), Blasius (gegen Halserkrankungen), Florian (gegen Feuersbrünste), sowie zwölf Abbildungen der obersten Heiligen, der Mutter Gottes, deren sämtliche Namen María Pérez de Galarraga y Arce kannte, und so, wenn sie ein Anliegen hatte, nicht nur zur Virgen de la Esperanza beten konnte, sondern auch zur Virgen de la Soledad, de los Dolores, de los Remedios, de la Misericordia, de los Desamparados, de las Maravillas und zu Nuestra Señora del Rosal. Hätte man aber einen Blick in ihr Tagebuch geworfen, so hätte man feststellen können, dass in jener Tiefe etwas ganz anderes lag, etwas, das darauf wartete, endlich hinauszudürfen, und als María Pérez de Galarraga y Arce am 14. Februar 1572 im Alter von zwanzig Jahren ihren so klangreichen Namen verlor, weil sie den baskischen Geschäftsmann Miguel de Erauso heiratete, da war ihr den ganzen Tag über, als klettere dieses tief in ihr sitzende Gefühl den Bauch hinauf bis hoch zum Hals. Nach der Hochzeit betrat María zum ersten Mal das Haus, das ihr Mann für sie gekauft hatte. Miguel nannte es Der Wal, in Erinnerung an den Großvater des Großvaters des Großvaters von María Pérez de Galarraga y Arce, denn das war niemand anderes als Manuel Pessoa, jener Entdecker Amerikas, von dem Marías Großmutter ihrer Enkelin immer noch erzählte. Der Wal war ein Stadthaus mitten in San Sebastián, nahe der Kirche. Es besaß einen kleinen Patio, die ebenerdigen Alkoven waren dunkel, und Miguel führte María gleich in die obere Etage. Von einer Galerie aus konnte man in den Innenhof sehen. Inès hielt María ein Tablett hin mit einer Tasse Schokolade und einem Haufen voll bucaros, aromatische Tonerde aus West-Indien. María trank die Schokolade und aß die Erdplätzchen. Dann schickte Miguel Inès hinab und führte María durch die beiden Salons. Im ersten war der Boden gekachelt, Teppiche hingen an den Wänden, Spiegel und kleine Bilder. Der zweite war durch eine Holzwand geteilt: Auf der einen Seite hatte man für die Frauen eine Estrade mit Taft bespannt und jede Menge Kissen gelegt, auf der anderen Seite standen für die Männer Stühle und Hocker bereit. María Pérez trat auf den schmiedeeisernen Balkon, dessen Ecken mit Messingkugeln geschmückt waren. Sie lehnte sich nach vorn und versuchte das Meer zu hören, aber alles, was sie vernahm, war das klatschende Geräusch, das die Nachbarn machten, wenn sie ihre Nachttöpfe auf die Straße leerten. María ging ins Schlafzimmer. Dort brannten Räucherstäbchen, und an den Wänden hingen ihre Heiligenbilder. Sie hatte Miguel gebeten, die Bilder im Haus aufzuhängen, im Haus, hatte sie gesagt, nicht im Schlafzimmer. María Pérez sammelte ihre Heiligenbilder ein, verließ das Schlafzimmer, legte die Bilder in den Salon, kehrte zu Miguel zurück, schloss die Tür, ließ die Behänge an den kleinen, vergitterten Fenstern hinab, die nicht mit Glas, sondern mit geöltem Pergament besetzt waren, zog ihr Hochzeitskleid aus, samt Reifrock – der guardainfante sollte erst 1639 per Dekret als »hurenmäßig« verboten werden –, kniete sich vor Miguel de Erauso, knöpfte dessen Hose auf und schob sein Geschlecht in ihren Mund. Sie wusste nicht genau, wie man es anstellte, lüstern zu schauen, aber sie gab ihr Bestes, sah hoch zu ihrem Mann, quetschte ihre Brüste zusammen, saugte, verwandelte die Zunge in einen Quirl, versuchte alles, was sie sich im Geheimen oft vorgestellt oder mit den anderen Mädchen durchgesprochen hatte, und fügte sich auf diese Weise mustergültig in den Rahmen der Zeit, in der sie lebte, denn die spanischen Menschen waren damals in einen regelrechten Begattungstaumel gefallen und besprangen sich wie die Wahnsinnigen, nein, nicht wie die Wahnsinnigen, im Gegenteil, viel eher, als sähen sie plötzlich ihre eigene Zukunft klar vor Augen, als wüssten sie Bescheid über die Pestepidemien, die in den nächsten Jahrzehnten durchs Land wüten würden, und als gälte es, zuvor für eine ausreichende Bevölkerungsmenge zu sorgen, damit dem Tod genügend Material zur Verfügung stünde: Es vögelten die grandes, Fürsten, Markisen und Grafen, die im Beisein der Königin die Kopfbedeckung aufbehalten durften, es vögelten die caballeros der Ritterorden von Alcántara, Montesa, Calatrava und Santiago, es vögelten die verarmten hidalgos, die wegen ihrer Verdienste bei der reconquista geadelt worden waren, es vögelten die Bürger in den Städten, die Handwerker und Kaufleute, die Soldaten, die zahllosen Dichter und Studenten, die Bauern, die den größten Teil der Steuern zahlen mussten, die Hirten und Baumfäller, die Erzarbeiter und Schmiede, die Vaganten und Bettler, Kesselflicker, Ausrufer und Maultiertreiber, die Krämer, Hausierer und Invaliden, die Lastträger und Marionettenspieler, die Schankwirte, Garköche, Büttner und Scharfrichter, die Zuhälter, Kuppler und Falschspieler, die Mauren, Zigeuner und Sklaven. Allen voran vögelte der als Asket geltende König Philipp der Zweite. Tagsüber brütete er über seinen Akten und verschob wichtige Entscheidungen auf den nächsten Tag, aber sobald die Sonne untergegangen war, wandelte er sich in einen regelrechten Thronfolgefanatiker. Er schickte seine Cousine Maria von Portugal in den Tod durch Gebären, bestieg vier Jahre lang – freilich fruchtlos – seine zweite Frau, Mary Tudor von England; er besprang mit wachsender Begeisterung die anfangs fünfzehnjährige Elisabeth von Valois, die ihm zwei nutzlose Töchter schenkte und starb, als die Ärzte die dritte Schwangerschaft übersahen; und schließlich begattete er Anna von Österreich fünf Mal erfolgreich, wobei vier Kinder das Licht der Welt nur kurz erblickten, während das fünfte endlich über beide zum Herrschen nötigen Qualitäten verfügte: Es blieb am Leben und war ein Junge. Die Menschen trieben es, wann und wo es ging, auf den Zollstationen und in den Wirtshäusern, am Hof und in der Gosse, im Madrider Alcázar und im Triana-Viertel von Sevilla, am Mittelmeer und am Atlantik, in den Sierras und den Pyrenäen, auf den riesigen Weideflächen der Extremadura und in den Erzbergwerken Navarras, in den Olivenhainen Andalusiens und den Wäldern des Ostens. Und wenn es nicht auf Anhieb klappen wollte, aß man Lauchsuppe und rotes Fleisch, das als heiß galt und den Geschlechtstrieb anfachen sollte, man schluckte alle möglichen Pülverchen, aß zerstoßenes Walelfenbein oder trank das Blut von geschlachteten Ziegen, sodass die Bevölkerungszahl des Landes sich innerhalb eines einzigen Jahrhunderts verdoppelte. Spaniens Luft war also gleichsam samengeschwängert, und aus den Pergamentfenstern drangen die Brunft- und Lustschreie der Nachbarn, als María Pérez ihren Mann bestieg und sich das harte Geschlecht wie ein Messer in den Unterleib rammte, sodass Miguels Hoden auf der Stelle rot wurden. María schrie nicht, sie war ganz konzentriert, während die beiden sich unaufhaltsam dem Ende näherten. Auch Miguel war zunächst ganz versunken in das, was geschah, ehe er plötzlich begriff, dass er dabei war zu zeugen, zu erzeugen, und da rief er in einem letzten Aufschwung und kurz bevor sich der Knoten in ihm löste: »Wie soll er heißen?« María achtete nicht auf seinen Ruf, ihre Ohren waren ganz nach innen gekehrt, sie krallte ihrem Mann die Nägel in den Rücken und schrie: »Miguel!« Dann sanken sie zueinander in einer Lache aus Schweiß, Blut und Zeugungsflüssigkeiten. Miguel de Erauso strich seiner Frau durchs Haar und sagte: »Einverstanden.«
Ein halbes Jahr und etliche Begattungsversuche später hatte María Pérez immer noch nicht empfangen, was sie empfangen wollte. Dafür musste es einen nachvollziehbaren Grund geben. Ihre Frömmigkeit, die durch die ehelichen Orgien verschüttet worden war, erwachte nun mit doppelter Kraft. María Pérez erinnerte sich an alle »Obszönitäten«, deren sie sich im Schlafzimmer »schuldig gemacht hatte«, wie es plötzlich in ihrem Tagebuch heißt. Sie sah ihre Schwangerschaftslosigkeit als Folge dieser »Sünden« an, die sie ein halbes Jahr lang immer nur als »Köstlichkeiten« bezeichnet hatte. So kam es, dass Miguel de Erauso in der Nacht plötzlich statt einer nackt auf ihn wartenden Ehefrau ein weißes Laken mit einem mittig platzierten Loch antraf, unter dem María Pérez lag und ihrem Mann eröffnete, dass sie den Geschlechtsverkehr endlich als das ansehen wolle, was er sei, nämlich ein für die Zeugung unabdingbarer Akt, dessen sündhafte Nebenprodukte wie das unmäßige Äußern von Lust sie fortan ablehnen werde. Als aber nach weiteren vier Monaten immer noch kein Ergebnis zu sehen war, wurde María Pérez von Tag zu Tag empfänglicher für die Ratschläge ihrer Großmutter Isabel, deren überkommener Glaube an alte baskische Gottfiguren in einen christlichen Aberglauben kanalisiert worden war, der nun bei María, die sich an jeden Strohhalm klammerte, auf gedeihfähigen Boden fiel. Isabel trichterte ihrer Enkelin ein, dass die Aufnahme des Samens in den Mutterschoß nur notwendige, keinesfalls aber hinreichende Bedingung für das Empfangen des Kindes sei. Man müsse zusätzlich zum Geschlechtsverkehr noch die eine oder andere rituelle Maßnahme in die Wege leiten, um sich die Gunst Gottes zu sichern. Sie, Isabel, wisse, wovon sie spreche, sie habe schließlich dreizehn Kinder empfangen. Elf von ihnen seien zwar unterwegs verloren gegangen oder tot zur Welt gekommen, daher könne sie nicht viel zur Lebensspendung sagen, aber so manches zur Lebensempfängnis. María Pérez verbrachte nun die nächsten Wochen damit, den wilden Ratschlägen ihrer Großmutter zu folgen: Sie rieb ihren Unterleib an verschiedenen alten Bäumen und Märtyrerstatuen, legte sich der Länge nach über ein Heiligengrab, trank literweise aus gesegneten Quellen, braute aus Grottenwasser und den Abschabungen von Statuen einen Teeverschnitt, den sie mit zusammengekniffenen Augen hinunterwürgte, betete zur Heiligen Margareta von Antiochia, zum Heiligen Nikolaus, zur Heiligen Ana und leckte täglich den Staub von allen möglichen Madonnenfiguren der benachbarten Kirchen. Sie war so verzweifelt, dass sie sogar die Strapazen einer Pilgerreise nach Gréoux-les-Bains zum Heiligtum Notre Dame des Œufs auf sich genommen hätte, mit zwei Eiern in der Hand: Eins davon hätte sie auf der Stelle gegessen, das andere vor Ort verscharrt und erst am 8. September wieder ausgegraben. Doch glücklicherweise blieb ihr diese Reise erspart, denn schließlich, tief im Oktober des Jahres 1574, fruchtete doch noch ein anderes großmütterliches Aberglaubemittel.
Das spielte sich ab auf dem Platz vor der Kirche, natürlich um Mitternacht. María wollte nichts falsch machen und folgte Punkt für Punkt den Anweisungen ihrer Großmutter. Sie hatte das Risiko eines Überfalls auf sich genommen und war in der Nacht durch die Straßen von San Sebastián gelaufen, ohne ihren Mann, der von alldem nichts wusste, ohne ihre Großmutter, die zu alt war, ohne Inès, die schon schlief, und ohne einen auf dem Markt gemieteten Begleiter zu ihrem Schutz. María Pérez legte ihre Hand auf die Verzierungen des Kirchenportals, betastete den eisernen Ring und das große Schlüsselloch auf Brusthöhe. Beim ersten Glockenschlag streckte sie den Zeigefinger ihrer rechten Hand aus und suchte mit der linken das Loch. Dann holte sie tief Luft und blickte ein letztes Mal nach oben, vergewisserte sich, dass der Mond nicht zu sehen war, der alles verderben konnte, aber die Wolken hatten sich mächtig zusammengebraut, und bedingungslose Schwärze lag über der Stadt von San Sebastián, als María Pérez ihren rechten Zeigefinger in das Schlüsselloch des Kirchenportals wuchtete, so tief wie möglich, und zwar nicht in die größere, obere Hälfte, die genügend Raum gelassen hätte, sondern in die viel zu enge Stelle für den Bart des Schlüssels. Sie verglich den Schmerz später mit dem der Geburt. Sie versuchte, ihn sich von der Zunge zu beißen. Es gelang nicht. Sie sagte das Gebet auf, das Isabel ihr beigebracht hatte, es rann wie von selbst von ihren Lippen, laut sprach sie, den Finger tief ins kalte Eisenloch gebohrt, der rechte Finger, hatte Isabel gesagt, damit es ein Junge wird. María erbrach eine Winzigkeit Galle. Das Schlimmste stand ihr noch bevor: Sie presste alles im Gesicht zusammen, was sie hatte, Lippen, Augen, Zähne, riss den Finger mit einem Ruck aus dem Loch und hatte das Gefühl, dass weit mehr als nur ihre Haut drin stecken blieb. Aber sie verlor weder Zeit noch Tränen, sondern lief zurück zum Wal. Ihr wurde schwarz vor Augen, sie fiel hin und griff mit der verletzten Hand in den Kot der Straße, raffte sich auf, wollte den Dreck abwischen, aber jede Berührung des Fingers war kaum auszuhalten. Sie kam nach Hause, nass und verschmutzt. Ihr Finger war ohne Haut und ohne die oberste Schicht Fleisch nur noch eine Masse fasriges Blut. Aber María Pérez war das egal, als ihr kurze Zeit später klar wurde, dass Schmerz und Aufwand sich gelohnt hatten.
Während der Schwangerschaft verhielt sich María vorbildlich. Man hatte ihr oft genug gesagt und sie wusste ganz genau, was für einen enormen Einfluss Gedanken, Wahrnehmung und Einbildungskraft einer Schwangeren auf das Kind hatten und wie schnell aus etwas flüchtig Gehörtem, Gesehenem, aus einem inneren Bild, aus einer harmlosen Phantasie im Kopf eine schreckliche Wirklichkeit im Bauch werden konnte. Sie wandte sich sofort ab, wenn ihr auf der Straße eine Missgeburt begegnete oder ein Zwerg, ein Krüppel, ein schwärenbedeckter Bettler oder eine Hexe, denn ein solcher Anblick würde durch die Augen in ihren Geist und durch ihren Geist direkt zum Kind dringen und es verunstalten. Stattdessen verbrachte sie die meiste Zeit der Schwangerschaft ruhig und friedlich im Haus und betrachtete Bilder der Heiligen Familie. Sie starrte stundenlang auf das Jesuskind. Wenn sie dessen Makellosigkeit in sich aufsaugen könnte, dachte sie, würde ihr eigenes Kind dem angeschauten Vorbild folgen und sich zu einem Spiegelbild des Originals entwickeln, zu einem Abbild Gottes. Nach fünf Monaten verließ sie das Haus nur noch, um zur Messe zu gehen, doch auch hier presste sie, wenn der Priester sich die Stola umlegte, die Augen fest zusammen, weil sie wusste: Dieser Anblick führt dazu, dass sich die Nabelschnur um den Hals des Kindes wickelt und es erwürgt. María Pérez verbot sich, an die Gefahren der Geburt auch nur zu denken: Es gab werdende Mütter, die starben, weil sie unterernährt waren oder voll von rachitischen Verwachsungen. Es gab jede Menge Fehl- und Totgeburten oder Kinder, die verkehrt herum ans Licht wollten, mit den Füßen voran: Sie erstickten im Geburtskanal. Die toten Kinder wurden im Schnellverfahren getauft, da sie sonst dazu verdammt gewesen wären, auf ewig durch die Vorhölle zu wandern. Und die Wundärzte behaupteten nicht selten mitten im Geburtsvorgang, die Schwierigkeiten seien zu groß, brachen die Prozedur ab, schlitzten die Frau auf wie einen Mehlsack – die einzige Chance, wie sie sagten, um Kind und Frau noch zu retten –, ein Eingriff, der jedoch mit dem Tod von beiden endete, und dann stopften sie das Kind dahin zurück, woraus es freiwillig nicht hatte schlüpfen wollen, in den gewaltsam gespaltenen Bauch der Frau, die man notdürftig zuschusterte und auf dem Leichenhof verscharrte.
Als María Pérez ihr erstes Kind zur Welt brachte, verlor sie nur ihren rechten Finger. Den hatte man monatelang zu heilen versucht, es aber nicht geschafft. Schließlich war er schwarz geworden, und der Arzt hatte empfohlen, den Finger während der Geburt abzunehmen, denn – hatte er doziert – Geburtsschmerz sei das beste Betäubungsmittel. Da standen also Marías Mutter, ihre Großmutter, eine Hebamme und jede Menge anderer Frauen am gewölbten Unterleib der Gebärenden, über den man einen Mariengürtel gelegt hatte, man ermunterte María Pérez, half ihr, richtete sie auf, hielt ihre Hand, wartete, packte schließlich zu und zog das Kind heraus, während der Wundarzt zeitgleich mit zweifelhaften chirurgischen Instrumenten Marías rechten Zeigefinger entfernte. Immerhin scheint Marías Tagebuch dem Arzt Recht zu geben: Denn erst als das Kind in ihren Händen lag, fiel ihr auf, dass diese Hände nur noch aus neun Fingern bestanden, und erst als sie das Kind wieder aus dem Arm gab, spürte sie den stechenden Schmerz des Fehlens. Das Kind war gesund, kein kleines Monstrum, man prüfte Hände, Augen und Gesicht, es schrie und strampelte, und der Vater schlug jede Menge Erleichterungskreuze. Außerdem war es ein Junge, den man Miguel nannte. Man schnitt die Nabelschnur nicht flach am Bauch ab, wie man es bei einem Mädchen getan hätte, sondern ließ einige Zoll Spielraum; und das blutige Wasser, mit dem das Kind gewaschen worden war, schüttete man nicht – wie bei einem Mädchen – in die symbolische Herdasche, damit es zu Hause bliebe, sondern kippte es auf die Straße, vor das Tor, denn ein Junge hatte das Haus zu verlassen, hinaus in die Welt.
In den nächsten Jahren sollte María Pérez weitere fünf Kinder zur Welt bringen. Die Empfängnis gelang sogar ohne irgendwelche kultisch-abergläubisch motivierten Handlungen, sodass María sich fragte, ob sie den Verlust ihres Zeigefingers umsonst erlitten hatte. Aber sie glaubte nicht an die Sinnlosigkeit von Geschehenem, sondern setzt sich in ihrem Tagebuch intensiv mit dem Wesen des Verlusts auseinander und kommt zu der Schlussfolgerung: Für jedes Kind, das sie bekam, wurde ihr immer auch etwas genommen.
Bei Jacintas Geburt verlor sie die Farbe ihrer Haare, die, während María Pérez unaufhörlich schrie, ins Schneeweiße kippte. Der Schmerz muss aus irgendeinem Grund ungleich größer gewesen sein als der bei Miguels Geburt, doch Tochter Jacinta ließ sich, als sie selbst erwachsen war, von der Erzählung ihrer Mutter keineswegs einschüchtern und brachte im Lauf ihrer dreiundzwanzig Fruchtbarkeitsjahre siebzehn lebendige Kinder zur Welt, von denen zwölf heirateten und im Durchschnitt wieder sechs Kinder bekamen, die Jacinta noch zu Lebzeiten zwanzig Urenkel schenkten, woraus sich rein rechnerisch – bei Subtraktion derjenigen, die vor Jacintas Ableben verstorben waren, und Addition der angeheirateten Ehepartner – das Ergebnis von einhundertundzwanzig Verwandten ergibt, die Jacinta an ihrem Sterbetag aus der Welt geleiteten. Natürlich fanden nicht alle gleichzeitig im Sterbezimmer Platz und man wachte abwechselnd an ihrem Bett, zwei Tage und zwei Nächte. Weil der Winter besonders kalt und es nur im Sterbezimmer richtig warm war, drängten die im Freien Frierenden von außen beständig hinein, wodurch ein immerwährender Durchgangsverkehr am Bett der Sterbenden entstand, niemand konnte sich setzen, alle blieben nur für Sekunden stehen und warfen Jacinta einen flüchtigen Blick zu, wurden dann von hinten weitergeschoben, sodass im Anschluss an den letzten Atemzug niemand wusste, wann genau Jacinta gestorben oder besser gesagt, wer im Moment des Sterbens an ihrem Bett gestanden war.
Marías zweitem Sohn gab man den Namen Sebastián. Diesmal verlor María das Kind selbst. Es wurde noch kurz von der Hebamme gehalten und wirkte seltsam störrisch und ungelenk, wie eine Handpuppe, reckte sich und atmete genau einmal ein, das schien ihm zu genügen. Dann sah es mit blind behangenen Augen nach vorn, ehe sein Köpfchen wie das eines Kasperle resigniert auf die Brust knickte und ein kleiner Strom Blut über sein Kinn lief, als hätte es sich im Bauch der Mutter eine Kapsel mit Theaterblut in den ungeborenen Mund geschoben.
Bei Mari Juanas Geburt verlor die Mutter drei Zähne. Die zweite Tochter wurde eine die Frömmigkeit ihrer Mutter noch weit überflügelnde Frau, die schon als Kind – früher noch als später Catalina – in ein Kloster wollte und dort immer weiter nach oben stieg, sich sozusagen unaufhaltsam emporarbeitete, von der einfachen Nonne zur Priorin und später zur Führungskraft des gesamten Ordens, nicht etwa, weil sie von einem krankhaften Ehrgeiz besessen war, sondern vielmehr, weil sie die übertragene Bedeutung des Worts Aufstieg allzu wörtlich nahm und dachte, je höher sie komme, umso mehr gelange sie wirklich nach oben, und oben war für sie gleichbedeutend mit dem, was man Himmel nannte, dem Platz, dem nahe zu sein sie wie nichts auf der Welt sich wünschte. Und als sie den obersten Platz ihres Ordens erklommen hatte und ihr klar wurde, dass sie nicht mehr weiter nach oben konnte, stieg sie eines Tages auf das Dach des Kirchturms, und von der Spitze aus kletterte sie weiter, ins Nichts hinein. Die unten stehenden Menschen hatten kurz den Eindruck, als ziehe sich Mari Juana an einem unsichtbaren Seil empor, das aus den Wolken baumelte – während zur selben Zeit, etwa zehntausend Meilen entfernt, ein Zen-Meister seinem Schüler sagte, das Leben sei wie das Ersteigen einer Stange: Oben angekommen, müsse man einfach weiterklettern. Doch Mari Juana machte den Fehler, zurück zur Erde zu schauen, statt auf ihren Weg zu vertrauen, sodass sie mit den Armen ruderte, ihr Gewicht gewann, das Gleichgewicht verlor und die Menschen mit ansehen mussten, wie Mari Juanas vergänglicher Körper in die Tiefe fiel und dort als roter Farbbeutel zerplatzte, während – das sah man zwar nicht, aber glaubte es zu sehen – ihr unvergänglicher Teil sich vom Körper löste und weiter nach oben schwebte.
Als Francisco geboren wurde, verlor María Pérez fast gleichzeitig ihre Großmutter Isabel, sodass sie einen Weinkrampf erlitt, der das Herauspressen des Jungen derart verzögerte, dass der Kleine mit einer angeborenen Langsamkeit des Begreifens auf die Welt kam. Als einzige Möglichkeit, seinen Unterhalt zu verdienen, blieb ihm nur die von allen verachtete Aufgabe des Onaniermeisters im Spielcasino. Dort musste er den Männern, die oft ganze Nächte durchspielten, das tablettartige Onaniergeschirr reichen, auf das sie ihren Samen schleuderten, in einer Ecke, ohne den Raum zu verlassen, in geradezu kynischer Offenheit. Francisco wischte dann das weißliche, klebrige, oft bis an den Rand gespritzte Zeug weg und hielt das saubere Tablett für den nächsten Spieler bereit. Das alles machte ihm nichts aus. Er hätte sich nur gern irgendjemanden gewünscht, der mit ihm gelebt hätte, er war bescheiden, das hätte ihm genügt, an so was wie Liebe wagte er nicht zu denken. Ein solcher Mensch aber stellte sich zeit seines Lebens nicht ein, sodass Francisco, der uralt wurde, allein in einem Zimmer starb, das er sich für sein geringes Gehalt leisten konnte, und niemand saß an seiner Seite, um ihm die Hand zu halten, als die letzte Luft aus seinem Körper wich.
Über Marianas Leben ist nichts bekannt. Sie wurde als fünftes Kind geboren. Das ist den Taufbüchern San Sebastiáns zu entnehmen. Im Tagebuch ihrer Mutter aber findet sich nur der wütende, gebleckte Schrei von zig herausgerissenen Seiten. Man weiß nicht, was María Pérez bei dieser Geburt verlor. Ihr Tagebuch setzt erst wieder ein am 17. April 1585, dem Geburtstag von Catalina, dem Tag, an dem María Pérez de Erauso, geborene Galarraga y Arce, die Fähigkeit verlor, je wieder zu gebären.
Der Sonnenregentag
Alles würde sich wunderbar fügen und in hellster Metaphorik leuchten, wenn das letzte Kind Marías– jener legendenbesetzte Mensch namens Catalina de Erauso, der später so lächerlich und plump als »Leutnantnonne« bezeichnet werden sollte– wenn Catalina also im zur Welt gekommen wäre und Inès (nach Begutachtung des kindlichen Geschlechts) den Auftrag erhalten hätte, das Waschwasser in die Herdasche zu schütten, aber mit der Schüssel im Flur gestolpert und so das Wasser auf den Boden geklatscht und durch die Ritzen des abschüssigen Flurs gesickert wäre, hinaus zur symbolischen Tür, unaufhaltsam in die Welt. Dieses säuberlich geschnitzte Bild hätte von Anfang an das weitere Leben Catalinas überschreiben können. Doch die Wahrheit ist, dass Catalina gar nicht erst im Haus geboren wurde, sondern schon draußen, in der Welt, und zwar an einem Tag, der die Wetterspezialisten aller Länder noch heute vor Rätsel stellt und der in der Chronik des baskischen Meteorologen Santiago de Etxeberria als »Sonnenregentag« bezeichnet wird, denn der plötzliche Einbruch des Regens an diesem Tag wird für immer unerklärbar bleiben, weil sich nachweislich ein deutlich sichtbarer blauer Himmel ohne die geringste Wolke über das Land spannte, als die im achten Monat schwangere María Pérez mit ihrem Sohn Miguel den verließ.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!