
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Celia wächst bei ihrer Mutter Vanessa in den östlichen Pyrenäen auf. Ihren Vater hat sie noch nie gesehen: Er lernte ihre Mutter in einem Nachtclub kennen, und Celia ist das Ergebnis ihres One-Night-Stands. Nun wohnt er mit seiner Familie in London, wo er als Künstler arbeitet. Celia verlebt eine unkonventionelle, aber glückliche Kindheit in Südfrankreich. Vanessa, eine Flohmarkthändlerin, schlägt sich mit Ach und Krach durchs Leben, erzieht ihre Tochter jedoch mit großer Warmherzigkeit und inmitten einer Gruppe enger Freunde. Als Celia fünfzehn ist, adoptiert Vanessa den neunjährigen Morgan, den Sohn einer verstorbenen Freundin. Außerdem zieht Vanessas neuer Freund Thierry bei ihnen ein. Eines Nachts beobachtet Celia, wie ihr Stiefvater Morgan bedrängt. Als die Mutter ihr nicht glaubt, packt sie ihren Rucksack und bricht mit Morgan nach England auf, um ihren Vater zu suchen. «Eine reife, intelligente und ungewöhnlich einfühlsame Studie des widersprüchlichen Phänomens, zu anderen zu gehören und gleichzeitig ein eigenständiger Mensch zu sein. Eberstadts bester Roman!» Kirkus Reviews
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Fernanda Eberstadt
Celia
Roman
Aus dem Englischen von Judith Schwaab
Für Maud und Theo
ERSTES BUCH
ERSTES KAPITEL
Versuch du doch mal, jemanden «Papa» zu nennen, den du noch nie in deinem Leben getroffen hast.
Rat hat so einen pinkrosa Schreibblock mit Kaugummiaroma und Mäusemuster, nach dem sie in der Schule alle ganz verrückt sind. Für ein einziges Blatt tauschen ihre Schulkameraden eine große Murmel oder einen extradicken Plombenzieher. Rat besitzt einen ganzen Block davon; sie hat ihn sich von dem Geld gekauft, das ihr Vater ihr zum Geburtstag geschickt hat. Und jetzt hat sie bereits ganze drei Blätter darauf verschwendet, ihm für die zwanzig Franc, die er ihr geschickt hat, diesen blöden Dankesbrief zu schreiben. Das war mehr Geld, als sie je in ihrem Leben besessen hat. Chr papa, mrsi… cher Papa, mersi, cher ppa…
Wo Rats Problem liegt, erkennt man an der mönchischen Akribie, mit der sie ihre Großbuchstaben ausschmückt, daran, wie sie das C in eine zischende Schlange verwandelt oder das P in einen Schützen mit gespanntem Bogen, und so kommt ihre ganze Maschinerie des Grüßens und Dankens gleich wieder zum Stehen, denn erstens weiß Rat nicht, wie man einen Brief schreibt, und zweitens hat sie, da sie ihrem Vater noch nie begegnet ist oder von ihm gehört hat, nicht den blassesten Schimmer, was für eine Art von Kind sie eigentlich sein sollte, um seinen Wunschvorstellungen zu entsprechen.
«Kann ich die Karte nochmal sehen?», fragt Rat in der Hoffnung, dass ihr das weiterhilft. Die Karte zeigt einen Clown, der auf einer Torte sitzt, und wenn man sie aufklappt, steht da auf Englisch und in unbekannter Handschrift: «Für Celia. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Alles Liebe, Papa.»
«Wo ist der Umschlag? Kann ich die Briefmarke behalten?»
«Der Brief ist mit was anderem gekommen, einer Bankangelegenheit. Ich hab den Umschlag weggeschmissen», sagt Vanessa.
«Ich wusste gar nicht, dass er weiß, wann ich Geburtstag habe», sagt Rat nachdenklich.
«Mach dich lieber wieder an deinen Brief, Rat.»
Rat stöhnt. Und schaut einen Moment später wieder auf. «Bist du sicher, dass es okay ist, wenn ich ihm auf Französisch schreibe?» Die Antwort kennt sie schon.
«Aber ja, mein Herz, dein Papa spricht gut Französisch. Er ist in der Schweiz aufs Internat gegangen.»
Rat zieht weitere Möglichkeiten und Ablenkungsmanöver in Betracht. «Vielleicht sollte ich ihm ein Foto schicken, damit er weiß, wie ich aussehe.» Es gibt einen Schnappschuss von Rat, der ihr selber gefällt und den sie mit Tesa an die Wohnzimmerwand geklebt hat. Darauf fährt sie mit ihren Rollerblades über den Bürgersteig in Canet Plage, in einem Rock, den sie sich mit Hilfe ihrer Nachbarin Cristel aus einer alten Jeans genäht hat. Sie sieht tollkühn und verwegen aus, aber auch hübsch. Ohne zu lächeln.
«Klar, mein Herz. Warum nicht?»
«Wieso schicke ich ihm nicht einfach ein Foto und lasse den Brief weg?»
Ihre Mutter versetzt ihr eine spielerische Kopfnuss, tut so, als wäre sie böse. «Jetzt mach schon, faules Stück. Schreib.»
Man muss Rat nicht dafür bemitleiden, dass sie einen Vater hat, dem sie noch nie begegnet ist und der erst aufgehört hat, die Vaterschaft zu leugnen, als ein Vaterschaftstest sie bewies. Viele Kids, die Rat kennt, sind schlechter dran. Im Fernsehen kam ein Bericht über einen Mann, der die Hunde nicht fütterte, als seine Frau in Urlaub gefahren war. Die Hunde fraßen ihr kleines Kind auf.
Außerdem sieht es nicht so aus, als wäre in ihrem Leben überhaupt Platz für einen Mann. Rat und ihre Mutter stehen sich nahe wie Schwestern, manchmal wie Zwillinge. Vanessa ist so klein – eigentlich wie ein Kind–, dass sie sogar die gleichen Klamotten tragen können. Wenn eine von ihnen schlecht träumt, wenn Leute bei ihnen übernachten oder ihnen einfach nach Kuscheln ist, kommt Vanessa zu Rat herüber und schläft bei ihr im Bett.
«Na, wird’s bald?», fragt Vanessa jetzt.
Rat zieht ein Gesicht, klappt das Blatt schnell zusammen. «Nicht gucken.»
Ihre Mutter schiebt Rats schützende Hände beiseite und betrachtet das Schlachtfeld aus Wörtern.
«Du bist wirklich ’ne Marke», sagt sie liebevoll. «Lass mich mal.» Vanessa schreibt Rat drei Zeilen vor. «Lieber Papa. Vielen Dank für das Geburtstagsgeld. Liebe Grüße, Celia.» Babyleicht.
Rat gibt sich alle Mühe, diese drei Zeilen fehlerfrei abzuschreiben, aber ihre Konzentration ist flöten. Sie macht einen Buckel, streckt sich, bohrt in der Nase, gähnt.
«Hast du’s, Liebes?»
«Ich schaff es nicht», grummelt Rat. «Ich hasse Schreiben.»
«Jetzt mach schon, Rattenkind.»
«Ich kann nicht.»
Vanessa liest den Brief, faltet ihn zusammen und schiebt ihn in ihre große Patchworktasche. «Okay? Du hast es geschafft.»
Aber Rat sitzt da wie ein Häufchen Elend.
Vanessa verwuschelt die Haare ihrer Tochter, beugt sich zu ihr hinab, pustet ihr ins Ohr, kitzelt sie. Keine Reaktion.
«Du hast es geschafft», wiederholt sie. Sie wedelt mit der Hand vor Rats Nase herum. «Was machst du denn eigentlich mit dem Geld?»
Rat zuckt mit den Schultern.
«Jetzt komm schon, du Brummbär. Wir gehen an den Strand», sagt Vanessa. «Du kannst mich zu einem Eis einladen. Ein Magnum.»
«Kommt nicht in Frage», sagt Rat. «Ich verplempere mein Geburtstagsgeld doch nicht für ein Eis.» Aber sie ist schon aufgesprungen, sucht nach ihrem Sweatshirt und nach dem Eimer, in dem sie vom Meer geschliffene Glasstücke und Muscheln sammelt.
Der Dankesbrief, den Rat an ihren Vater schreiben sollte, liegt ihr auf der Seele, denn er stellt eine beunruhigende Störung in ihrem Leben dar, das ansonsten vollkommen frei von solch altmodischen Ritualen des guten Benehmens ist. Genauer gesagt, von jeglichen Kontakten zu ihrer englischen Verwandtschaft.
Einige Jahre später, als ihr der Gedanke kommt, dass ein Vater vielleicht doch ganz nützlich sein könnte, fragt Rat ihre Mutter, warum sie nach dem Dankesbrief nie wieder von ihm gehört habe.
Und Vanessa, die an dem Tag eine Stinklaune hat und sich von ihrer halbwüchsigen Tochter nicht richtig gewürdigt fühlt, lacht kurz auf und sagt: «Hast du das denn wirklich geglaubt?» Es habe nie Geburtstagsgeld von Rats Papa gegeben, erklärt sie. Es war Vanessa, die in dem Jahr, als Rat aus der Vorschule in die Grundschule überwechselte und von anderen Kindern in der Pause gepiesackt wurde, aus der Fülle ihres Herzens diese edle Spende erfunden hat. «Ich wollte dich aufmuntern», sagt sie.
Rat ist so schockiert, dass ihre Schlagfertigkeit sie kurzzeitig im Stich lässt. Sie kommt sich verarscht vor. Sie hat das Gefühl, manipuliert worden zu sein, als sei jemand in ihr innerstes Heiligtum eingedrungen, den Ort, an dem sie von Leuten träumt, die im wachen Zustand kaum eine Rolle für sie spielen.
«Du hast mich einen Brief schreiben lassen und hattest nie vor, ihn abzuschicken?»
Vanessa zuckt mit den Achseln. «Ich dachte, es könnte dir helfen. Und es gäbe Dinge, die du deinem Vater einmal sagen müsstest.»
«So was wie danke schön?»
Es wird noch Jahre dauern, bis Rat entdecken wird, dass ihr Vater ihr zwar keine Geburtstagsgeschenke geschickt hat, aber Unterhalt für sie zahlt – eine monatliche Summe, die nach Londoner Standard wahrscheinlich eher bescheiden ist, für die Pyrénées Orientales, die östlichen Pyrenäen Frankreichs, wo sie leben, jedoch ein kleines Vermögen.
Vanessa ist eine reiche Frau, doch niemand weiß davon, am allerwenigsten ihre Tochter. Die monatlichen Zahlungen, die für Rats Unterhalt gedacht sind, sammeln sich auf einem Konto der Crédit Agricole an, getrennt von ihrem eigentlichen Konto, auf dem meistens gähnende Leere herrscht. Und währenddessen leben Vanessa und Rat ebenso wie alle anderen, die sie kennen, von der Hand in den Mund, genauer gesagt von einer Kombination aus Stütze, nicht versteuerten Einkünften und Pump.
Zu ihren Freunden ist Vanessa die Großzügigkeit in Person. Und diese Großzügigkeit kommt von Herzen. Vanessa würde sogar ihren einzigen Wintermantel hergeben, und das völlig im Ernst. Die Tatsache, dass sie im Gegensatz zu ihren Freunden und Nachbarn ein schönes Stück Geld auf der hohen Kante hat, hat sie anscheinend einfach verdrängt – denn wenn es ihr bewusst wäre, dann hätte sie sich ein neues Auto gekauft, statt in ihrem klapprigen alten Renault 5 herumzugurken. Armut ist auch etwas, das im Kopf stattfindet, und Vanessa ist aufrichtig davon überzeugt, pleite zu sein.
Als Rat später von den Unterhaltszahlungen erfährt und darüber nachdenkt, nimmt sie es ihrer Mutter gar nicht übel, dass sie ihr das Geld vorenthalten hat, denn das hätte doch am ehesten dafür verwendet werden können, sie auf eine Privatschule zu schicken, nachdem sie in der Achten durchgerasselt ist, weil das öffentliche Gymnasium in Canet so riesig und die Verhältnisse dort so schwierig sind, dass man seine gesamten geistigen Kräfte darauf verwenden muss, nicht zusammengeschlagen zu werden. Oder sie hätten mit dem Geld irgendwohin in Urlaub fahren können.
Rat macht es deshalb nichts aus, weil sie dank Vanessas Unterweisung in den Dingen des Lebens gelernt hat, für sich selbst geradezustehen. Später, wenn sie Leute kennenlernen wird, die reich geboren wurden, werden sie ihr vorkommen wie Hunde, die keinen Geruchssinn haben. Bankkonten gehören nicht in das Reich der Wirklichkeit. Wirklich ist einzig und allein die Tatsache, dass man nicht auf den Kopf gefallen ist.
Vanessa ist eine brocanteuse: Sie verkauft und kauft gebrauchte Gegenstände. Eine Jägerin und Sammlerin von Natur aus, wie sie sagt. Die Wände ihrer Wohnung sind voll behängt mit all den Dingen, an denen sie hängt: bedruckten Cocktailservietten aus einer Bar in Spanien, einer Karnevalsmaske im Leopardenmuster mit goldenen Schnurrhaaren, ausgerissenen Fotos aus alten Zeitschriften.
Viele dieser Fotos, fotokopiert und vergrößert, zeigen Rats englische Großmutter, die Mutter ihres ihr unbekannten Vaters, deren Name Celia Kidd lautet. Auch Rat heißt in Wirklichkeit so. Sie wurde nach ihrer Oma benannt, doch alle außer ihren Lehrern nennen sie Rat.
Im London der sechziger Jahre war Celia ein Topmodel. An der Küchenwand hängt eine Großaufnahme von ihr in Schwarzweiß aus der englischen Vogue. Sie zeigt ein großes Mädchen, schlank und geschmeidig wie ein Otter, mit weißer Haut und riesigen Augen, das einen Poncho aus weißen Federn und sonst offenbar nichts trägt. Ihr Blick ist fröhlich und eine Spur spöttisch.
Rats Vater, Gillem McKane, war ihr einziges Kind.
Rats Lieblingsfoto zeigt Celia mit Gillem, als der noch ein kleiner Junge war, nicht viel älter als Rat selbst. Es ist ein Farbfoto aus dem Mittelteil eines Magazins, das sich über zwei Seiten erstreckt und aus der Zeit stammt, als Celia Kidd noch mit einem englischen Filmregisseur verheiratet war.
Celia, die auf dem Foto älter ist als in ihren Tagen als Model, aber immer noch hinreißend schön, trägt eine pelzbesetzte Tunika aus Brokat. Sie liegt hingegossen auf dem Sofa, ihre langen Beine baumeln über die Armlehne. Gillem hockt zu ihren Füßen auf dem Boden und malt ein Bild. Sein Gesicht kann man nicht sehen, weil er nach unten schaut. Doch er hat langes schwarzes Haar und trägt ein Hemd mit einem Rüschenkragen. In großen Buchstaben steht auf Englisch neben dem Bild: «Mrs.Harbisons Wohnzimmer ist mitternachtsblau gehalten, ihr Lieblingssofa im Empirestil hat einen Bezug aus leuchtend rosa Samt.»
Das Leben von Celia und Gillem war so funkelnd und glamourös, dass man niemals gedacht hätte, er könne eines Tages Rats Mutter über den Weg laufen.
Doch dann kam, als Gillem schon über zwanzig war, eine Zeit, in der er und seine Mutter den Sommer in den Pyrenäen verbrachten. Sie mieteten ein großes Haus auf den Klippen oberhalb von Collioure, dem Dorf, in dem Vanessa und ihre Eltern damals lebten. Celia Kidds mondäne Freunde gingen in dem Haus aus und ein. Und diesen einen Monat August lang kam man sich in Collioure, das ansonsten eher verschlafen war, wie im schicken Saint-Tropez vor.
Rat liebt die Geschichte, wie sich ihre Eltern kennengelernt haben.
Laut Vanessa kam Gillem eines Samstagabends in den Nachtclub, in dem sie und ihre Freundinnen herumhingen.
«Wusstest du denn, wer das war?», fragte Rat.
«Natürlich. Jeder kannte ihn. Celias Sohn. Er fuhr auf seinem Motorrad in der Stadt herum, meistens mit einer umwerfend schönen Blondine hinter sich auf dem Sozius, mit der meine Freundinnen und ich immer irgendwelche Voodoospielchen machten – vertrockne und stirb, du alte Hexe. Er war die Schau. Und dann an jenem Abend, na ja, da dachte ich: O Gott, da kommt Gillem. Und er ist ganz allein.»
«Und dann hast du ihn zum Tanzen aufgefordert…?»
«Wir haben getanzt und geredet. Er hatte so einen total süßen englischen Akzent. Ich habe ihn gefragt, wo denn seine Freundin wäre, und er meinte, sie wäre zurück nach London gefahren. Und da habe ich gesagt: Ach, dann hat mein Voodoozauber also geholfen.»
«Und was hat er da gesagt?»
«Er hat gelacht. Dann haben wir noch ein bisschen getanzt, und er hat mich gefragt, ob ich Lust auf einen Spaziergang auf den Klippen hätte.»
«Und was hast du gesagt?»
«Dass ich zu viel getrunken hätte und Angst runterzufallen. Und er: Mach dir keine Gedanken, dann fallen wir zusammen.»
Diese Bemerkung hatte Vanessa total romantisch gefunden, doch für Rat war der Gedanke, dass ihre Eltern in jener Nacht ebenso gut hätten sterben können, statt sie zu zeugen, ein bisschen komisch.
«Und nach dem Sommer hast du ihn nie wieder gesehen?»
«Sie sind nicht nochmal nach Collioure gekommen.»
«Du hast ihn also nie wieder gesehen?»
«Nicht ein einziges Mal.»
«Würdest du nicht gerne mal nach ihm suchen?»
«Wozu? Wir kommen doch allein ganz gut zurecht, findest du nicht?»
Wenn Rat versucht, sich ihren Vater vorzustellen, dann nie als einen Erwachsenen, sondern als Jungen ihres Alters, so wie ihren Freund Jérôme, der nebenan wohnt, oder wie die Zigeunerkinder, mit denen sie spielt, wenn in Brix Markt ist. Sie stellt ihn sich so vor, wie er auf dem Foto aussieht: ein Junge in einem weißen Spitzenhemd mit jeder Menge schwarzer, wuscheliger Haare, die ihm in die Augen fallen.
Rat malt sich aus, wie sie diesem Jungen die Schätze zeigt, die sie in einer alten Hustenbonbondose aus Blech aufbewahrt: die abgeschliffenen Glasstücke aus dem Meer, die kleinen Geschenke, die sie letztes Jahr in dem Kuchen gefunden hat, den Vanessa zur Raunacht backt. Wenn sie auf einen Baum steigt, sitzt Gillem auf dem Ast neben ihr. Als Achtjährigen kann sich Rat ihren Vater vorstellen, aber nicht als Erwachsenen. Ihre Phantasie reicht einfach nicht dafür aus, ihn vor sich zu sehen, wie er an Vanessas Küchentisch zu Abend isst, Rat morgens in die Schule fährt oder ihr einen Gutenachtkuss gibt. All die Dinge, die andere Väter an einem Sonntagnachmittag tun – die Hecke schneiden, am Auto herumbasteln, mit den Nachbarn Boule spielen oder dich anschreien, du sollst dein Zimmer aufräumen–, all das kann sie sich bei ihm nicht vorstellen.
Es ist das erste Mal, dass sie ihre Mutter – die sie bisher immer als einen Teil von sich selbst betrachtet hat, wie die Narbe auf ihrer Stirn oder den abgebrochenen Schneidezahn – mit den Augen eines Fremden betrachtet.
Vanessa nimmt Rat und die Nachbarskinder mit an den Strand. Von ihrer Wohnung aus muss man dafür eine Schnellstraße überqueren. Es ist keine richtige Autobahn, sondern nur eine zweispurige Schnellstraße, die aber über fünf Kilometer hinweg so schnurgerade und flach verläuft, dass alle Autofahrer meinen, sie könnten hier eine kleine Trainingseinheit für die Rallye Paris– Dakar einlegen, und ordentlich auf die Tube drücken. Quer unter der Schnellstraße durch verläuft ein dickes Kanalisationsrohr, durch das man gehen könnte, doch wenn es geregnet hat, steht man hier bis zu den Knien im Schlamm. Deshalb lässt Vanessa die Kinder auf die Straßenbefestigung hochklettern und schiebt das Grüppchen jetzt über die Straße.
Dabei legt Rats Mutter keinerlei Eile an den Tag: Sie läuft einfach mitten durch den dichten Verkehr hindurch und bringt jeden Wagen, der auf sie zufährt, zum Stehen. Solenne, die gerade erst laufen gelernt hat, hält Vanessa fest an der Hand. Rat und Solennes große Schwester Emilie folgen dicht hinter ihr, wie Küken hinter der Glucke, zuerst zögernd und dann mit einem großen, ungelenken Satz die Böschung hinunter, bis sie auf der anderen Seite in Sicherheit sind.
Nur Jérôme ist zurückgeblieben. Vanessa ruft ihm zu, er solle seinen Hintern in Bewegung setzen, doch er sieht aus wie erstarrt. Bleibt stocksteif auf der anderen Straßenseite stehen, anscheinend unfähig, sich zu rühren. Da weder Vanessa noch er bereit sind einzulenken, flitzt Rat noch einmal zurück und nimmt ihn an der Hand. Jérôme ist ein Jahr älter als sie, aber manchmal rastet er einfach aus. Auf der nähergelegenen Spur tut sich eine Lücke auf, doch als sie drüben weitergehen wollen, fährt ein Laster direkt auf sie zu.
Man würde nie glauben, dass eine leblose Maschine höhnisch wirken kann, doch die herrische Lässigkeit, mit der dieser Lastwagen in allerletzter Sekunde vor ihnen zum Stehen kommt, riecht deutlich nach Verachtung. Als sie sicher auf der anderen Seite sind, verpasst Rats Mama Jérôme einen Klaps auf den dürren kleinen Hintern. «Wenn ich dir sage, komm, dann komm.»
Der Lkw-Fahrer hat sein Fenster heruntergekurbelt. Er beobachtet das Schauspiel mit ungläubiger Miene. Dann beugt er sich aus dem Fenster und sagt: «Madame, es ist nicht Ihr Sohn, der den Klaps verdient hat.»
Vanessas cremeweiße Haut läuft vor Wut knallrot an. «Connard!», schreit sie zurück. Ihre Worte gehen im Röhren des anfahrenden Lkw unter.
Rat hebt Jérômes Handtuch auf, doch ihr Kopf glüht vor Scham, so peinlich ist es ihr, ihre Mutter mit den Augen anderer zu sehen. Vanessa hat etwas offenkundig Gefährliches getan und ist dafür zur Schnecke gemacht worden, wie ein Kind!
«Was für ein Arschloch», sagt Vanessa, als sie am Strand ankommen. «Warum kümmern sich die Leute eigentlich nicht um ihren eigenen Scheiß, anstatt anderen Vorschriften zu machen und ständig herumzumeckern?»
Rat gibt keine Antwort.
Vanessa lässt sich unendlich viel Zeit, um den idealen Platz im Sand zu finden – nicht zu weit vom Wasser weg, nicht zu feucht–, wo sie schließlich ihre Matten ausrollt und mit Steinen beschwert. Jérôme und seine Schwestern sind mittlerweile schon bis zur Hüfte im Wasser.
Als Vanessa fertig ist, zieht sie sich bis aufs Bikinihöschen aus und streckt sich genüsslich auf ihrer Matte aus. Erst dann bemerkt sie, dass ihre Tochter immer noch steht.
«Was ist los?»
«Hä?»
«Was hast du denn?»
Schließlich rückt Rat mit der Sprache heraus. «Mama, das war gefährlich, was du da gemacht hast. Und warum hast du Jérôme einen Klaps gegeben?»
Es gibt eine unausgesprochene Regel, die da gerade gebrochen wurde: Solange du kein Lehrer bist, ist es nicht erlaubt, den Kindern von anderen Eltern eine zu kleben.
Vanessa setzt sich wütend auf, wie von einer Tarantel gestochen. Ihre nackten Brüste wabbeln. «Sag mal, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Mein ganzes Leben lang haben andere Leute darüber bestimmt, was ich zu tun und zu lassen habe, haben mich dafür angepflaumt, dass ich überhaupt auf der Welt bin. Glaubst du etwa, es ist leicht, vier Rotznasen zum Strand zu schleppen? Oder würdest du lieber weiter daheim hocken und schwitzen? Jetzt hab doch Spaß, freu dich. Schwimm eine Runde und amüsier dich. Und mich lass in aller Teufels Namen in Ruhe. Okay?»
Damit hat sie Rat den Wind aus den Segeln genommen. Sie setzt sich neben sie. «Du holst dir noch einen Sonnenbrand auf den Schultern.»
Sie verreibt Sonnenmilch auf dem Rücken ihrer Mutter, bis ganz hinunter zu dem kleinen Schmetterlings-Tattoo, das direkt über den beiden Sommersprossen an ihrem Hintern liegt.
Sie flicht ihrer Mutter die Haare, die hennarot gefärbt sind, hat aber keinen Gummi, um sie festzumachen. Immer wieder schlüpfen kleine Strähnen und Löckchen hervor. Sie versucht, den Zopf mit einem Strang Seegras zu verknoten, doch der reißt.
«Ach, Scheiße», sagte Vanessa. «Du schreckliches Kind. Gemeines, verwöhntes Balg», doch jetzt klingt sie liebevoll und rollt schließlich hinüber und reibt ihre Nase an der von Rat, wie es die Eskimos tun.
«Hast du deine kleine Vanilla-Milla lieb? Sag mir, dass du mich lieb hast.»
«Ja, ich hab dich lieb, Mama.»
«Ich hab dich auch lieb, mein kleines Rattenkind. Vergiss das nicht, ich hab dich ganz doll lieb.»
Rats Mutter ist eine zarte Schönheit. Sie hat ein kleines, herzförmiges, sommersprossiges Gesicht mit einem spitzen Kinn und riesengroßen Augen, wie bei einer Katze. Im Vergleich zu ihr fühlt sich Rat grobknochig und ungelenk. Sie legt sich neben ihrer Mutter in den Sand, um in Vanessas Augen schauen zu können, die tief wie ein Fluss und ganz leicht gesprenkelt sind. Wie bei einer Katze wechseln sie ihre Farbe und können je nach Stimmung mal grün-braungrau, mal braun und dann wieder grün sein.
Rat kennt die Sprache dieser Augen. Braun sind sie, wenn Vanessa traurig ist, sich um eine kranke Freundin Sorgen macht oder wegen einer verflossenen Liebe grämt. Grau sind sie, wenn sie wütend ist (ein Zwist mit Mémé Catherine, Rats französischer Großmutter, oder mit dem Vermieter, der den Abfluss immer noch nicht repariert hat). Grün sind sie, wenn ihr Lieblingslied im Radio kommt oder wenn sie im Haus herumtanzt, glücklich über einen Schal aus Knittersamt oder eine Federboa, die sie für fast geschenkt auf dem Markt gefunden hat.
«Du bist so schön, du hättest Schauspielerin werden sollen», sagt Rat. «Du wärst der absolute Superstar geworden.»
«Logo», sagt ihre Mutter trocken. «Die Geschichte meines Lebens, eine einzige Litanei von Waswärewenn.»
Und Rat fühlt sich doppelt schlecht, weil sie weiß, wenn es sie nicht gäbe, hätte Vanessa tatsächlich all das werden können, wovon sie immer geträumt hat – Malerin, Schauspielerin, Sängerin, Modedesignerin.
Und weil Vanessa ihretwegen schon auf so viel verzichten musste, bereitet es Rat ein besonders schlechtes Gewissen, dass sie ihrer Mutter das Leben zusätzlich schwermacht. Wenn Rat einmal groß ist, wird sie für sie beide ein riesiges Haus mit einem begehbaren Schrank und einem Badezimmer kaufen, in dem es eine richtig große Badewanne, verspiegelte Wände und schmeichelndes Licht mit einem Dimmer gibt. Sie wird mit Vanessa nach Venedig, nach Afrika und auf die griechischen Inseln fahren, an all die Orte, über die sie so gerne liest, und sie wird ihr jeden Morgen das Frühstück ans Bett bringen.
Rat ist nicht einfach. Das ist es, was Vanessa ihren Freundinnen erzählt – dass sie nicht einfach ist. Aber manchmal sagt sie auch: «Du bist die Liebe meines Lebens.»
ZWEITES KAPITEL
Ein Sommerabend. Der Himmel ist blassblau, doch über dem spiegelglatten Meer steht bereits ein dottergelber Mond. Je höher er steigt, desto tiefer orangerot färbt ihn der Erntestaub.
Rat und Jérôme haben sich im langen Dünengras am Strand von Saint Féliu ein Fort gebaut. Rat wünschte, sie könnten dort übernachten, doch Jérôme muss um neun zu Hause sein.
Ihre kleine Festung ist ein Beobachtungsposten, von dem aus sie die Touristen gut sehen können, die bei Chez Ernest zu Abend speisen. Es ist Samstagabend, und das Edelrestaurant am Strand ist voller eleganter Blondinen, die vor Schminke und Schmuck nur so funkeln. Sonnengebräunte Männer. Urlauber, die im abgehackten Akzent des Nordens sprechen und die Jérôme allesamt «Pariser» nennt. «Parisien, tête de chien, Parigot, tête de veau.» Hinter dem Restaurant sind die Edelkarossen mit den auswärtigen Nummernschildern geparkt – Bordeaux, Toulouse. Sogar ein Mercedes mit belgischem Kennzeichen steht da.
Einige der Erwachsenen kennt Rat aus dem Ort, es sind Kumpels von Ernest und seiner Frau; diese Männer haben meist mehr Fleisch auf den Rippen als die «Pariser». Man redet über Rugby und Boote und darüber, wie viel irgendwelche Sachen kosten. Deux mille balles hab ich für dies bezahlt, und der dix mille balles für das. Ganz normale Prahlereien eben – so wie die Dinge, mit denen die Kids in der Schule versuchen, Eindruck zu schinden.
Die «Pariser» sind eine ganz besondere Sorte. Rat nervt es total, wie sehr sie ihre Kinder verhätscheln. Am Tag werden sie ständig mit Sonnenmilch eingeschmiert und müssen Hüte aufsetzen, weil sie sonst einen Sonnenbrand bekommen. Am Strand haben sie Sandalen an, damit sie sich nicht die Füße an Glasscherben schneiden. Und sobald die Sonne untergeht, bekommen sie von ihren Müttern Kapuzensweatshirts oder Strickjacken übergezogen.
Manchmal fassen sich die Tollkühneren unter ihnen ein Herz, kommen zu Rat und Jérôme und fragen: «Wollt ihr mit uns spielen?», aber offenbar hat man ihnen eingebläut, in Sichtweite ihrer Eltern zu bleiben, und kaum macht man den Vorschlag, sich ein bisschen zu entfernen – in die Dünen zum Beispiel oder zum Bunker hinauf–, werden sie nervös. Einmal haben sie und Jérôme mit einem Jungen gespielt, der sie mit ihrem südfranzösischen Dialekt aufzog – «Warum sagt ihr eigentlich ‹demeng› statt demain?» – und erst Ruhe gab, als Rat ihn in den Schwitzkasten nahm und drohte, ihm eine Schaufel Sand in den Mund zu kippen.
Heute Abend haben Rat und Jérôme zwei Kinder ins Visier genommen, die sich an der Hängematte von Chez Ernest zu schaffen machen. Das kleine Mädchen versucht die ganze Zeit, seinen großen Bruder herunterzuschubsen. Immer wieder stößt sie gegen seinen weit nach unten hängenden Hintern, der in das Netz der Hängematte eingeschlossen ist wie ein Rollbraten, aber sie kriegt ihn einfach nicht dazu, ihr seinen Platz zu überlassen. Schließlich rennt sie zurück ins Restaurant und ruft quengelnd nach ihrer Mutter.
Die Mutter greift ein.
Mit einem theatralischen Seufzer überlässt der Junge seinen Platz dem schwesterlichen Quälgeist. Zuerst lässt er die Hängematte so hoch schwingen, wie es nur geht, und sobald die Mutter außer Sicht ist, dreht er sie auf den Kopf und befördert das Mädchen mit einem harten Plumps in den Sand. «Wenn du noch einmal zu Mami rennst, dann such ich mir die größte und haarigste Spinne, die ich finden kann, und leg sie dir heut Nacht ins Bett.»
Mittlerweile haben Rat und Jérôme das Interesse verloren.
«Wir sollten nach Hause», sagt Jérôme zögerlich.
«Noch nicht. Zuerst müssen wir sicherstellen, dass der Feind sich nicht vom Meer her nähert.» Das ist ihr Codewort dafür, in Richtung Bunker aufzubrechen.
Der Bunker, knapp außer Sichtweite von Chez Ernest, besteht aus einem Zementblock, den die Deutschen am Ende des Krieges errichtet haben, um gegen eine Landung der Alliierten an diesem Abschnitt des Mittelmeers gewappnet zu sein. An der Küste gibt es Hunderte von solchen Bunkern. Ursprünglich war dieser hier sandfarben, doch jetzt ist er überall mit Graffiti besprüht – dunkelblau, rot, gelb–, sodass er aussieht wie ein riesiges Tattoo.
Im Inneren des Bunkers gibt es einen Raum, in dem sich vermutlich die deutschen Scharfschützen versteckt hielten und wo heute die älteren Kids hingehen, um zu kiffen und zu knutschen, aber dort ist es nasskalt und dunkel, und Rat fürchtet sich. Selbst wenn ihre Freunde sie überreden reinzukrabbeln, tut sie es nur widerwillig. Nachdem dort Jahre später ein Mädchen aus Fitou vergewaltigt wird, betoniert die Stadtverwaltung den Eingang zu, und aus dem Bunker wird eine Art Pharaonengrab, über dem ein düsterer Fluch liegt.
Der Bunker hat eine seltsame Form, er sieht aus wie eine Blätterteigtasche mit scharfer Abbruchkante. Rat und Jérôme finden es toll, die Klippenwand zu besteigen. Wenn man obendrauf steht, kann man die ganze Küste sehen, von den weißen Kalksteinhängen der Corbières bis in den Süden hinab zur dunkelgrünen Wand der Albères, dem pyrenäischen Hügelland, das die Grenze zu Spanien markiert. Dazwischen liegt eine schroffe, gleißend helle Mittelmeerebene aus Sumpf, Flussarmen, Schilf und sandigen Flächen.
Dieses Stück Land ist Rats Heimat. Die glühende Sonne darüber ist ihre Sonne, und die Disteln, die ausgetrockneten Hügel und das Schilf sind die einzige Vegetation, die sie kennt. Sie war schon ein paarmal in den Bergen – auf dem Markt in Brix oder zum Zelten in der Cerdagne. Doch ansonsten ist Rats Welt flach und hat drei markante Eckpunkte: den Strand, wo sie auch ihre Lebensmittel einkaufen, das Dorf, in dem sie zur Schule geht, und ihre Wohnung.
Rats Revier ist nicht groß – von ihrem Haus bis zum Strand ist es ein Kilometer und ein weiterer bis zum Dorf, doch innerhalb dieser Grenzen kann sie sich frei bewegen.
Eine Gruppe Kinder aus dem Restaurant ist ihr und Jérôme zum Bunker gefolgt. Ein Mann ruft, und drei von ihnen verdünnisieren sich. Nur ein großer, flachsblonder Junge bleibt. Ein Junge ohne Brüder oder Schwestern, der zu niemandem in Sichtweite gehört.
«Was macht ihr?», will der Junge wissen.
Weder Rat noch Jérôme bequemen sich, ihm zu antworten.
«Wie seid ihr da hochgekommen?»
Jérôme und Rat rutschen die Schräge des Bunkers hinab und klettern wieder hoch, hinauf und hinab, achtlos, nur um ihm zu zeigen, wie einfach das ist.
Er beobachtet sie. «Soll ich meine Sandalen besser ausziehen?»
Sie geben keine Antwort.
Er fängt an zu klettern, doch jetzt sind ihm seine Strandsandalen im Weg. Er bleibt stehen, um sie zu lösen. Zuerst hält er sie in der Hand, als wolle er sie mit hochnehmen. Schließlich lässt er sie so vorsichtig fallen, als könnten sie explodieren.
Er krabbelt höher, unbeholfen, quälend langsam. Schließlich bleibt er mitten in der Wand hängen, die Arme weit ausgestreckt, genau dort, wo die schräge Betonfläche ganz glatt wird und es im Zement keine Scharten oder Löcher gibt, an denen man sich festhalten kann.
Jérôme und Rat schauen auf ihn hinunter.
Der Junge tut so, als würde er sich einfach nur ein Päuschen im Klettern gönnen, um die Aussicht zu genießen, aber es ist leicht zu durchschauen, dass er vor Angst wie gelähmt ist.
«Ich hänge fest», sagt er schließlich. «Was mach ich jetzt?»
«Wohin willst du denn, rauf oder runter? Du kannst eigentlich auch hochkommen, du bist fast da.»
«Ich kann nicht. Ich hab Angst.»
Sie beobachten ihn mit echter Verblüffung. Jérômes Schwester ist gerade mal drei Jahre alt und kann die Schräge des Bunkers wie ein Äffchen hochklettern. Dieser Junge hier ist deutlich größer. Sie haben noch nie von jemandem gehört, der hängen geblieben ist. Entweder man ist zu klein, um es zu schaffen, oder man schafft es.
Jérôme klettert hinab und hilft dem Jungen herunter. Seine Beine zittern so stark, dass er kaum stehen kann. Sie warten darauf, dass er geht, aber er bleibt immer noch. Er setzt sich in den mit Distelstacheln übersäten Sand, schaut zu ihnen hoch. Rat schnippt einen losen Stein nach ihm, damit er weggeht.
«Lass ihn in Ruhe», sagt Jérôme.
«Ist das ein Volldepp oder was?»
«Lass ihn in Ruhe.»
Rat findet es schrecklich, was im Sommer hier an der Küste geschieht. All ihre geheimen Orte, die übers Jahr menschenleer sind, werden plötzlich von Touristen überlaufen. Zwei, drei Monate lang kann man sich kaum bewegen, weil die Straßen voller skandinavischer Wohnwagen sind, die immer im Konvoi fahren, aber nicht wissen, wohin. Ihr Lieblingsstrand wird zur FKK-Zone. Und jedes Wochenende gibt es Bambule zwischen den Parisern und den Jungs aus der Gegend, meistens wegen irgendeines Mädchens.
«Hast du gehört, was mit Enzo und Marina passiert ist?»
«Was denn?»
Die Mutter von Enzo und Marina hat ein Techtelmechtel mit einem holländischen Windsurfer, den sie im Sol y Mar kennengelernt hat. Ein älterer Typ mit einem Hund. Und offenbar mit Kohle.
«Sie ist mit ihm durchgebrannt. Einfach weg. Vorgestern kommt Marina nach Hause, und es ist niemand da, kein Zettel, gar nichts. Sie ist einfach so mit ihm abgehauen», sagt Rat.
Jérôme pfeift durch die Zähne. «Und? Wer kümmert sich jetzt um sie?»
«Keine Ahnung. Ihr Vater ist behindert. Er hatte irgendeinen schrecklichen Unfall und ist seitdem wie ein Stück Gemüse.»
«Und was jetzt?»
«Weiß nicht. Schätze, sie kommen in ein Heim. Zumindest sagt das Cristel. Sie wollen abwarten, ob ihre Oma sie nimmt, aber wenn nicht, kommen sie wahrscheinlich ins Heim.»
«Putain», sagt Jérôme ernüchtert.
Die Drohung «Heim» schwebt über all den Kindern in Rats Welt, deren Lebenssituation nicht gesichert ist. Jedes Kind, das nicht mindestens mit Sekundenkleber an irgendeiner Familie haftet, kann theoretisch im Heim landen. Wenn der Lehrer bemerkt, dass du im Winter ohne Socken in die Schule kommst und zur Mittagszeit vollkommen ausgehungert bist, oder wenn es zu lange dauert, bis die Eltern endlich bereit sind, zu einer Schulsprechstunde zu erscheinen, dann steht früher oder später die Fürsorge an der Tür und will wissen, wer eigentlich der gesetzliche Vormund des Kindes ist.
Von all den Kindern, die sie kennt und die in, wie die Lehrer es nennen, einer «prekären familiären Situation» leben, ist nur Florian unverfroren genug zu sagen: «Okay, dann komme ich eben ins Heim. Dort kriege ich wenigstens drei anständige Mahlzeiten am Tag.»
«Der Junge ist immer noch da unten. Soll ich nicht noch ein Steinchen nach ihm schmeißen?»
«Ach komm, lass ihn doch.»
«Ich will aber nicht, dass er uns belauscht.»
Die Lichtgirlanden, die an den Spalieren von Chez Ernest baumeln, funkeln rot-grün-weiß. Der Himmel hat ein dunkles Neonblau angenommen.
Eine Dame in einem Sarong tritt auf die Terrasse des Restaurants hinaus. Sie ruft. «César! Cou-cou! Cé-sar!»
«Die vermisst ihren Hund», mutmaßt Jérôme. Doch aus der Art und Weise, wie sich der blonde Junge unter ihnen unsichtbar macht und in sich zusammensinkt, schließt Rat messerscharf, dass er mit den Rufen gemeint ist. Die Dame ist schön, aber der Junge nicht.
«Heißt du so, César?»
Der Junge gibt keine Antwort.
«César, ist das nicht ein Hundename? Ich dachte, die ruft ihren Hund.»
Jetzt ist ein Mann zu der Dame an den Strand getreten. Beide schauen sich um und entdecken schließlich den Jungen. Der Mann läuft auf seinen Sohn zu, dann fällt sein Blick auf Rat und Jérôme, die über die Kante des Bunkers spähen.
«Tiens», sagt der Mann und lacht. Er trägt ein schwarzes T-Shirt und eine weiße Hose. «Komm essen. Hast du deine Mutter nicht rufen hören?»
Er nickt mit dem Kinn in Richtung Bunker. «Was ist das?»
«Das ist ein deutscher Bunker», sagt Rat.
«Ach, wirklich?»
«Den haben die Nazis im Krieg gebaut.»
Rat sehnt sich so sehr danach, bei ihm Eindruck zu machen, dass es ihr in der Brust wehtut. «Möchten Sie sehen, wie ich von oben runterspringe?»
«Nein danke, lass gut sein.»
«Ihr Sohn klettert nicht besonders», sagt sie.
«Er ist ein Stadtkind.»
«Aus Paris?»
«Nein, eigentlich wohnen wir in London.»
Rats Herz klopft. Einen verrückten Moment lang denkt sie, der Mann ist ihr Vater. Er ist zurückgekommen, um sie zu suchen. «Sie sprechen gut Französisch», sagt sie, um ihn auf die Probe zu stellen.
Er lacht. «Ich bin Franzose. Ich arbeite nur in London.»
Rat sieht ihn immer noch an, weil sie nicht gleich die Flinte ins Korn werfen möchte. Vielleicht will er es ja nur nicht zugeben. «Ich war auch schon in London. Ganz oft. Mein Papa lebt da», macht sie weiter. «Er ist auch ein Stadtkind.»
«Ach, wirklich?»
«Mein Papa ist Engländer.»
Der Mann lächelt herablassend. «Aha. Sprichst du Englisch?»
«Yes. Very much. Er heißt Gillem McKane. Kennen Sie ihn?»
«London ist eine große Stadt. César, wir wollen essen.»
«Wenn ich ihn besuche, fährt er mich mit seinem roten Ferrari herum. Er wohnt in einem großen Haus in der Nähe vom Buckingham Palace. Kennen Sie ihn nicht?»
«Tut mir leid… Es ist eine große Stadt. César, Abendessen.»
«Jeder kennt ihn. Meine Oma war ein Topmodel», beharrt sie. «Ich verbringe immer meine Ferien bei ihnen.»
«Was du nicht sagst. Jetzt komm, César, wir essen. Wenn deine Mutter dich ruft, dann kommst du bitte gleich beim ersten Mal.»
«Warum heißt er denn César? Ist das nicht ein Hundename?»
«Eigentlich nicht. Es ist der Name eines Mannes, der an dieser Küste schon lange vor den Deutschen Bunker gebaut hat.»
Rat verdreht die Augen, weil er offenbar denkt, dass sie noch nie von den Römern gehört hat, aber er beachtet sie gar nicht mehr. César schüttelt sich, als wäre er gerade aus einem Traum erwacht, und bückt sich, um seine Strandsandalen zuzumachen.
«Sag tschüs zu deinen Spielkameraden», sagt der Mann. César wirft ihnen einen Blick voll unerwartet deutlichem Hass zu und bleibt stumm.
«Wissen Sie, wie viel Uhr es ist, Mister?», ruft Jérôme, als sie schon fast außer Hörweite sind.
Die Antwort ist nicht zu verstehen. Rat und Jérôme sehen zu, wie der Mann und der Junge durch das lange Gras zurück zum Restaurant schlendern. Der Mann legt César ebenso beiläufig wie besitzergreifend den Arm um die Schultern. Rat hat schon Hunger, wenn sie nur an das Essen denkt. Bei Chez Ernest gibt es gutes Essen, allerdings nicht so gut, dass es die Preise rechtfertigen würde.
«Wir sollten nach Hause gehen», sagt Jérôme. «Es ist bestimmt schon nach neun.»
Jedenfalls ist es spät genug, dass sich sogar Vanessa allmählich Sorgen machen wird, aber Rat hat einfach noch keine Lust, sich vom nächtlichen Meer, von der Flamencomusik aus dem Restaurant, dem Gelächter loszureißen. Der Himmel ist dunkelblau, und der Mond wirft einen blassgelben Lichtstreifen auf das Wasser.
Zwischen hier und zu Hause müssen sie wieder die Unterführung an der Schnellstraße hinter sich bringen, was schon bei Tage unheimlich ist. Man weiß nie, wem man begegnet oder ob man mit dem Fahrrad mitten im Schlamm stecken bleibt, was für Rat doppelt ärgerlich wäre, weil sie barfuß ist.
«Ich finde immer noch, dass César ein doofer Name ist», sagt sie.
«Ist gut, dass er dich nicht von hier oben runterspringen sehen wollte, weil du dir nämlich dein verdammtes Bein gebrochen hättest», sagt Jérôme.
Sie lachen beide. Rat beugt sich über die steil abfallende Seite des Bunkers und spuckt hinunter. «Findest du das kein bisschen blöd – César?»
«Stimmt es, dass dein Papa einen Ferrari hat?»
«Ja. So einen wie Michel.» Michel gehört die Katamaranfirma, deren Manager Jérômes Vater ist. «Ein rotes Ferrari Cabrio. So einen hat mein Vater.»
«Das ist kein Ferrari, du Blödmann, das ist ein BMW», sagt Jérôme liebevoll.
Als sie sicher zu Hause angekommen ist, sagt Vanessa, dass Rat heute Abend in ihrem Bett schlafen darf.
Rat, die gerade dabei ist, zum Geräusch des Fernsehers wegzudösen, stellt sich vor, dass der Mann in der weißen Hose ihr Papa ist und ihr väterlich-fürsorglich den Arm um die Schulter legt. Aber es ist zu seltsam, sich selbst auf der anderen Seite des Spiegels zu sehen. Wenn sie ein «Stadtkind» würde, vergäße sie dann auch, wie man den Bunker hochklettert, würde sie darum streiten, wer in der Hängematte liegen darf, und hätte urplötzlich Angst vor Spinnen?
«Vanessa», sagt sie.
«Was ist denn, Süße?»
«Glaubst du, wir könnten irgendwann mal zu meinem Papa fahren, damit ich ihn kennenlerne?»
Keine Antwort.
«Warum rufen wir ihn nicht einfach an und fragen, ob wir ihn besuchen können?»
«In London?»
«Warum nicht?»
Ihre Mutter lacht.
«Warum machen wir das nicht?», bohrt Rat weiter.
«Dein Vater ist ein seltsamer Vogel. Er geht nicht ans Telefon, und er beantwortet auch keine Briefe.»
«Das ist doch komisch.»
«Ach, ich schätze, er ist es einfach leid, dass die Leute um ihn herumscharwenzeln, bloß weil seine Mutter berühmt war.»
«Das klingt bekloppt», sagt Rat missmutig. Ein Vater, der nicht ans Telefon geht, ist doch nicht halb so gut wie einer, der einen roten Ferrari fährt.
Rat und ihre Mutter wohnen, ebenso wie Jérômes Familie, in Mas Cargol, direkt außerhalb von Saint Féliu.
Vor fünfzig Jahren war Mas Cargol ein betriebsamer Bauernhof mit Gemüsegärten, Acker- und Weideland. Heute sind das Bauernhaus und die Außengebäude komplett in Wohnungen umgewandelt worden und die umliegenden Felder in ein Gewerbegebiet mit Autowerkstätten und großen Supermärkten. Von dem alten Hof ist nichts mehr übrig als ein Garten und ein paar verwilderte Kirschbäume.
Es gibt sechs Haushalte in Mas Cargol. Ein paar der Nachbarn sind Rat egal – ein älteres Paar, das einen Geschenkeladen in Canet Plage und einen Yorkshireterrier namens Cuddles hat, der gern nach Fußknöcheln schnappt, oder der Fahrer eines Krankenwagens, der immer nachts arbeitet und die Kids anschreit, wenn sie tagsüber Krach machen–, doch mit den meisten anderen ist sie befreundet: Mit Cristel, die im Rathaus arbeitet, und Laurent, der im Hof eine Schreinerwerkstatt betreibt.
Die Cabreras, die Familie von Jérôme, leben in der einen Hälfte des eigentlichen Bauernhauses. Die andere Hälfte gehört Monsieur Bordon, einem alten Arzt aus Toulouse, der nur im Sommer herkommt und dem noch einige der anderen Apartments im Mas gehören, darunter auch das von Rat und Vanessa.
Rats und Vanessas Wohnung liegt in der cave, in der man früher den Wein gekeltert hat. Sie ist klein und gemütlich. Es gibt ein Wohnzimmer mit einer Küchenzeile am einen Ende, zwei winzige Schlafzimmer und eine Dusche. Sie haben einen kleinen Hof, in dem man sitzen und essen kann, wenn der Tramontane nicht weht, und einen Schuppen, in dem Vanessa ihre Waren für den Flohmarkt lagert.
Vanessa träumt davon, eines Tages einmal in einem Haus zu wohnen, das groß genug ist für eine richtige Badewanne und einen richtigen Schrank. Sie beklagt sich darüber, dass das Wohnzimmer überschwemmt wird, wenn es regnet, und dass der Abfluss der Toilette nicht mehr funktioniert. Rat jedoch möchte nirgendwo anders auf der Welt leben als hier.
Neun Monate im Jahr können Rat, Jérôme und die kleineren Kinder den ganzen Tag draußen spielen und sich zum Beispiel aus den verrostenden Dreschmaschinen, den kaputten Schubkarren und den alten Weinfässern, die immer noch im Hof herumliegen, einen Abenteuerparcours zusammenstellen. Sie bauen Baumhäuser in der Zeder am Ende des Gartens, sammeln Pinienzapfen und schmeißen sie mit Karacho auf den Boden, damit die winzigen gelben Pinienkerne herausfallen, oder sie machen an dem Entwässerungskanal, der bis zum Meer hinunterführt, Jagd auf Frösche.
In den kurzen Wintermonaten, wenn der Tramontane zu heftig bläst, verlagert sich das Leben nach drinnen. Dann schauen sie Zeichentrickfilme, spielen auf dem Computer von Jérômes Vater, und Rat nervt Vanessa so lange, bis sie mit ihr in die Bibliothek fährt, um neue Comics auszuleihen. Sie suchen Brennholz für den Ofen und klauen hinter dem kleinen Supermarkt in Saint Féliu Plage Obstpaletten, um sie zu verfeuern. Nachts, wenn es kalt ist, kriecht Rat zu ihrer Mutter ins Bett, die beiden kuscheln sich unter Vanessas Patchworkdecke und schauen alte Spielfilme im Fernsehen, bis der Schlaf sie übermannt.
Wenn die Tage dann wieder länger werden, sind Rat und die anderen Kinder draußen, klauen Kirschen aus dem Obstgarten, sammeln Schnecken ein, suchen nach wildem Spargel und nehmen ihre alten Forts und Verstecke wieder in Besitz.
Wenn es die Schule nicht gäbe, wäre Rats Leben beinahe perfekt. Doch kaum hat sie am Morgen deren Tore durchschritten – den sehnigen Armen ihrer Mutter nur mit Mühe entrissen–, befindet sie sich in einem wildfremden Universum, wo die Leute sie Celia nennen und sie nicht begreift, was von ihr erwartet wird, ob es nun darum geht, eine Spirale zu zeichnen oder ein Verb von einem Nomen zu unterscheiden.
In dieser Welt kann Jérôme ihr nicht helfen. Manchmal laufen sie sich im Pausenhof oder in der Cafeteria über den Weg, doch zwischen ihnen herrscht die stillschweigende Vereinbarung, dass es in der Schule keine Verbrüderung gibt; in der Pause spielt Jérôme mit den anderen Jungs Fußball, und sie hopst mit den Mädchen «Himmel und Hölle» oder macht Gummitwist. Sobald Rat alt genug ist, wird sie die Schule verlassen und das tun, was sie will. Vielleicht wird sie mit Tieren arbeiten. Im Fernsehen hat sie einmal eine Frau gesehen, die eine Auffangstation für Raubvögel betrieb, welche sich Verbrennungen zugezogen hatten, weil sie sich auf Elektroleitungen niederließen. Das wäre zum Beispiel keine so schlechte Arbeit, wenn es denn überhaupt eine Arbeit sein muss.
***
Rat liebt es, die Geschichte zu hören, wie Celia Kidd, die Mutter ihres Vaters, entdeckt wurde. Laut Vanessa, die das in einer Zeitschrift gelesen hat, begann alles an einem Nachmittag, als Rats Oma, damals achtzehn Jahre alt und frischgebackene Absolventin eines teuren Internats, die Kensington High Street entlangschlenderte.
Plötzlich tippte ihr ein kleiner dunkler Mann mit einem Wühlmausgesicht auf die Schulter, ganz außer Atem, weil er ihr meilenweit gefolgt war, und sagte: «Entschuldigen Sie, Liebes, ich würde gerne Fotos von Ihnen machen.»
«Und was hat sie gesagt?»
«Sie hat gesagt: ‹Sonst noch was?›»
«Was sollte das denn heißen?»
«Na ja, das mit den Fotos sagen oft böse alte Knacker, die einem jungen Mädchen an die Wäsche wollen. Wenn jemals jemand zu dir kommt und Fotos von dir machen will, dann sagst du: ‹Das muss ich erst mit meinem Agenten besprechen.›»
«Und was hat Celia dann gesagt?»
«‹Ich kann nicht. Ich bin mit meiner Tante zum Essen verabredet und spät dran.›»
«Und er?»
«Er hat gesagt: ‹Wie wär’s dann nach dem Mittagessen?›»
«Und?»
«Das war’s dann. In null Komma nichts erschien das Foto deiner Oma in jedem Hochglanzmagazin. Die Parfümhersteller wollten, dass sie Werbung für ihren neuen Duft macht. Die Filmregisseure fragten, ob sie schauspielern kann, und meinten, sie wäre das perfekte nächste Bond-Girl. Und die Musikproduzenten wollten wissen, ob sie tanzt. Sie könnte doch mit den Rolling Stones auftreten…»
«Cool.»
«Ihre Eltern fanden das nicht.»
«Was hatten die denn?»
«Na ja, das waren so reiche Schnösel, die es unwürdig fanden, das Foto ihrer Tochter in der Zeitung zu sehen, vor allem in einem superkurzen Minirock.»
«Und was haben sie gemacht?»
«Was konnten sie denn tun? Es war ein bisschen zu spät. Zu der Zeit war sie schon zu Hause ausgezogen und lebte mit dem Fotografen zusammen, der ihr beibrachte, wie man mit Stäbchen isst und nicht husten muss, wenn man einen Joint raucht, und die Modemagazine ließen sie rund um die Welt jetten, um sie vor den Pyramiden oder am Strand in Tahiti zu fotografieren.»
Rat kichert. «Hat sie den Fotografen dann geheiratet?»
«Nein, den Fotografen hat sie nie geheiratet. Sie hat Gillems Papa – deinen Großvater – geheiratet, der ein stinkreicher Kanadier war, und später dann noch diesen schwulen Filmemacher, aber den Fotografen nie. Sie waren aber immer gut befreundet.»
«Hat sie mich jemals getroffen?»
«Dich? Nein. Nicht einmal dein eigener Papa hat dich je getroffen.»
«Glaubst du, sie würde mich mögen, wenn sie mich treffen würde?»
Vanessa wirft Rat einen blitzschnellen Blick von der Seite zu. «Nicht, wenn du das ganze Gesicht voller Schokolade hast.»
«Nein, im Ernst.»
«Im Ernst? Klar. Du bist toll. Du bist ein tolles Mädchen. Und tolle Mädchen mögen andere tolle Mädchen. Außerdem hast du von ihr deine ewig langen Beine. Deine Kidd-Beine.»
«Echt?»
«Na ja, von deiner Stummelbein-Mama hast du sie jedenfalls nicht.»
DRITTES KAPITEL
Sie sind auf dem Weg zum Flohmarkt in Brix und rumpeln in ihrem alten VW-Bus die Küstenstraße entlang.
Es ist noch dunkel, am Himmel stehen eine Mondsichel und ein paar silberhelle Sterne. Um auf den Markt zu fahren, muss man früh los – um halb sechs, sechs–, damit man einen guten Platz bekommt.
Der Tramontane schüttelt den VW-Bus kräftig durch. Es fühlt sich an wie ein Wirbelsturm. Die östlichen Pyrenäen gelten als die Kommandozentrale der Winde. Hier treffen sie alle aufeinander, sie packen sich am Schlafittchen und streiten und schachern. Angeblich gibt es in den östlichen Pyrenäen hundertneunzehn verschiedene Winde. (Wenn man Wind verkaufen könnte, wären wir reich, haben die Leute früher gesagt, bevor in den Ausläufern des Gebirges all die riesigen Windräder aus dem Boden gestampft wurden, ohne allerdings den Leuten dort einen dicken Geldbeutel zu bescheren.)
Rat kennt nur ein paar der Winde beim Namen. Da gibt es den Narbonnaise aus dem Norden, den Vent d’Espagne aus dem Süden, den Marin, einen feuchtklammen Ostwind vom Meer, der die Gegend wochenlang in einen grauweißen Nebel hüllt. Und dann ist da der berühmt-berüchtigte Tramontane, ein rauer, heulender Wind aus dem Nordwesten, der wie ein riesiger Besen die Wolken vom Himmel fegt, aus ihrem Hof eine sturmgepeitschte Ebene macht und ihre Wohnung in einen Sandkasten verwandelt. Wenn der Tramontane weht, dann isst, atmet und pinkelt man Staub, man geht mit Staub in der Nase zu Bett und erwacht mit einem Brummschädel. Andere Leute können das nicht ausstehen, Rat jedoch stört sich nicht daran.
Der Tramontane ist Rats Wind. Als Rat damals in die Schule kam und noch keine Freunde dort gefunden hatte, fragte Vanessa sie abends immer, mit wem sie denn über Tag gespielt habe. Und Rat antwortete: «Ich hab mit dem Wind gespielt.»
«Mit welchem Wind?», fragte Vanessa lachend.
«Mit unserem.» Unserer, das war der Tramontane.
Wenn man aus dem Rückfenster schaut, während man auf die Hochebene von Château-Roussillon fährt, kann man noch einen letzten Blick auf das Meer und die graue Lagune von Saint-Cyprien werfen, auf der Schaumkronen schaukeln. Hinter Rats Fenster stehen große Felder mit Artischocken, deren raue, länglich gezackte Blätter silbrig grün sind. Die Blütenstände der Früchte leuchten lila-violett.
Als sie sich Perpignan nähern, weichen die Artischockenfelder und Weinberge Einkaufszentren. Noch hängen die schweren Gitterjalousien vor den Schaufenstern.
Dunst liegt in den Senken, dunkelgraue Wolken rahmen die Gipfel der Albères ein.
Vanessa nimmt die untere Straße durch Perpignan, entlang des Flusses Têt. Unten am Fluss liegt ein winziges Barackendorf, das aus Pappkartons und Obstkisten gezimmert ist. Drei obdachlose Männer hocken zusammengesunken an einem Lagerfeuer, ein weiterer ist beim Angeln, und direkt unterhalb der Müllverbrennungsanlage schwebt ein einsamer blauer Eisvogel mitten über dem Fluss.
Als sie wieder hoch in Richtung Hügel fahren, wird das Land trockener. Baumschulen, Treibhäuser und Gärtnereien werden von Felswänden aus Kalkstein abgelöst. Von Heideland. Die einzige Vegetation in diesen Hügeln sind verkrüppelte, immergrüne Eichen und Ginster. Es ist Banditenland. Der wilde Westen.
Es war Vanessas Exfreund Max, der sie zu den brocantes gebracht hat. Max besaß einen alten VW-Bus, mit dem er die Häuser abklapperte und die Leute fragte, ob sie etwas hätten, das sie loswerden wollten – angebrannte Töpfe, Schallplatten, Sofas mit kaputten Federn. Immer mittwochs fuhren er und Rat auf den Sperrmüll, um zu schauen, was sie von dort retten konnten. Die Leute warfen die wunderbarsten Sachen weg: Einmal fand Rat eine altmodische Schreibmaschine in einwandfreiem Zustand, bei der nur ab und zu das E klemmte. An Wochenenden gingen sie oft zu Hofflohmärkten, um das zu verkaufen, was sie auf größeren Märkten gefunden hatten.
Rat hat Max geliebt. Er war Schweizer, auf sein Heimatland jedoch nicht gut zu sprechen. Und er war der großzügigste Mensch, dem Rat jemals begegnet war. Einmal hat er ihr ein kleines Herz aus Gold geschenkt, das ein Medaillon war, und ein anderes Mal brachte er ihr aus der Schweiz ein altes Taschenmesser mit Horngriff mit, in dem sich ein ausklappbares Essbesteck verbarg.
Letzten Sommer hatte er sie alle zu einer Reise nach Marokko mitgenommen, zusammen mit Vanessas Freundin Souad und Souads Sohn Morgan. Sie fuhren in Max’ VW-Bus bis an die Südspitze Spaniens, nahmen dort die Fähre über die Straße von Gibraltar und campten an einem Strand außerhalb von Tanger.
Es war das Tollste, was Rat je gemacht hatte.
Zuerst war sie nicht besonders begeistert davon gewesen, dass Souad und Morgan bei ihrem Abenteuer mit von der Partie waren, doch Max hatte ihr erklärt, Souad sei krank, und wenn man krank sei, bräuchte man noch mehr Aufmunterung als sonst. Und das war typisch für Max: Er hatte das traurigste Gesicht, das man sich vorstellen konnte, wollte aber, dass alle anderen glücklich waren.
Auch Vanessa war von Max ziemlich hingerissen, doch seine Unentschlossenheit trieb sie in den Wahnsinn. Wenn er bei ihr übernachtete, fand ihn Rat morgens manchmal in Vanessas Bett vor, manchmal schlief er jedoch auf dem Sofa oder im VW-Bus. Irgendwann entschied Max dann, dass er sich mehr zu Männern hingezogen fühlte als zu Frauen. Er hatte sich in einen Arzt verliebt, der auf Heimaturlaub aus Réunion war, und als die Ferien des Arztes zu Ende gingen, zog Max mit ihm nach Réunion.
Als er Frankreich verließ, hatte Max Vanessa den VW-Bus praktisch umsonst überlassen. Damals war sie schon ein paar Jahre mit ihm im Trödelgeschäft tätig gewesen und hatte, wie Max sagte, ein Händchen dafür: Und wenn man findig war und seine Unabhängigkeit liebte, war es eine gute Art, seine Brötchen zu verdienen. Wesentlich besser, als zu kellnern. Außerdem war es einer der wenigen Jobs, zu dem eine alleinerziehende Mutter ihr Kind mitbringen konnte: Man brauchte Rat bloß mit einem Lutscher und einem Stapel Comics in den Bus zu setzen, und sie war den ganzen Tag glücklich.
Was das Trödeln anging, waren die östlichen Pyrenäen ein gutes Revier. Nicht für Antiquitäten, sondern für Dinge, die fast neu waren. An der Küste wurden viele kleine Wohnungen gebaut, wo die Leute ständig ein- und auszogen. Ende Juni, wenn viele Hausbesitzer ihre Mieter rausekelten, um mit Sommergästen die große Kohle zu kassieren, war die Gegend eine richtige Goldgrube. Wenn sie ratlos vor ihrem übervollen Kofferraum standen, waren die Leute einfach eher bereit, sich von einem alten Kassettenrecorder oder einem Karton voller zu klein gewordener Skiklamotten ihrer Kinder zu trennen.
Im Landesinneren war alles etwas schlichter: Man erzielte bessere Preise, aber es war schwieriger, die Ware loszueisen. Man ging in eine Bar und redete mit den Stammgästen, schaute sich die Ankündigungen im tabac an, guckte, ob jemand gestorben war oder wer etwas verkaufte, aber man musste die Leute mit Samthandschuhen anfassen. Vanessa hoffte immer darauf, einmal zufällig auf einen alten Sammler zu stoßen, der ins Pflegeheim kam und sich fragte, was er denn mit seinen in sechzig Jahren angehäuften Fernsehzeitschriften oder Marmeladengläsern anfangen sollte. Einmal hatten sie und Max von einem Typen gehört, der gerade den Hof seines Großonkels geerbt hatte. Sie waren seiner Spur gefolgt, bis zu einem gottverlassenen Schuppen in den Aspres, und was war dann passiert? Der Kerl hatte seinen Hund auf sie gehetzt! Für manche Leute ist ein brocanteur die schlitzohrigere Variante eines Diebes.
Meistens jedoch war es eine angenehme Arbeit. Vanessa nannte es manchmal «Fischen», manchmal auch «Jagen und Sammeln». Wäre es nach ihr gegangen, hätte sie sich lieber am oberen Ende der Skala betätigt und mit Spitzennachthemden und Teetässchen aus Porzellan gehandelt, statt von Hunden gehetzt zu werden, aber die Pyrenäen waren das arme Kellerloch das Landes – ein heißes Sibirien, witzelte Vanessa–, und man nahm, was man kriegen konnte.
Jetzt ist die Straße frei, und die Sonne fängt gerade an, die dunkelgrauen Berge und die Dörfchen an den Hängen mit einem goldenen Schimmer zu überziehen.
Rat fühlt sich pudelwohl in dem VW-Bus, nur sie und Vanessa. Es ist ihr Lieblingsplatz zum Reden, ein versunkenes Reich der Tagträume, in dem sie ihre Mutter dazu kriegen kann, ruhiger zu werden und ihr all die Fragen zu beantworten und all die Geschichten zu erzählen, für die sie sonst zu beschäftigt ist. Im Bus fühlt sie sich sicher, niemand kommt rein oder raus. Wenn es nach Rat ginge, würden sie die ganze Zeit hier wohnen und jede Nacht hier schlafen, so wie sie es in Marokko getan haben.
«Mama, erzählst du mir eine Geschichte?» Sie lässt ihre Stimme absichtlich kindlich und schmeichelnd klingen.
«Was denn für eine Geschichte?»
«Eine Geschichte aus deiner Kindheit.»
«Was für eine Kindheit?», gibt Vanessa zurück. «Du hast eine Kindheit. Ich hatte nie eine.»
Vanessa war ein Soldatenkind. Sie war an allen möglichen Orten in Frankreich und Deutschland aufgewachsen, je nachdem, wo ihr Vater stationiert war. Nirgendwo hatten sie länger gewohnt als drei Jahre. Als ihr Vater seinen Abschied genommen hatte, waren sie in eine Wohnung in Collioure gezogen, die sich Vanessas Eltern als Altersvorsorge gekauft hatten. Damals war Vanessas ältere Schwester bereits verheiratet gewesen und Vanessa noch ein Teenager. Es war ihr erstes richtiges Zuhause.
«Wie war Mémé Catherine denn so, als du und Marie-Christine Kinder wart?», fragt Rat. Sie zögert, weil sie mit Rats französischer Großmutter zerstritten sind.
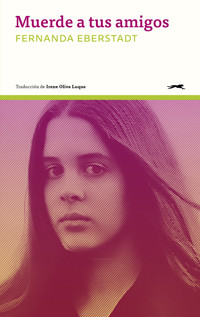













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)














