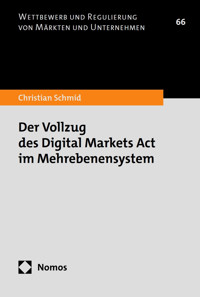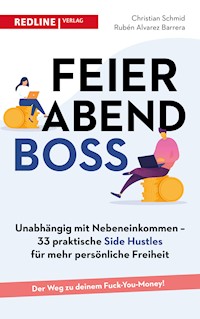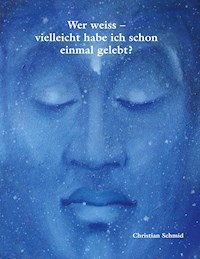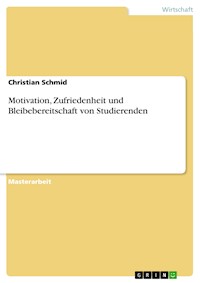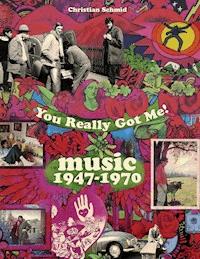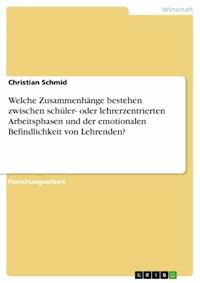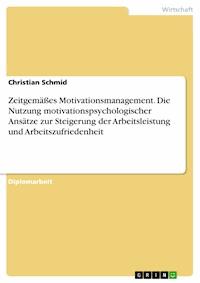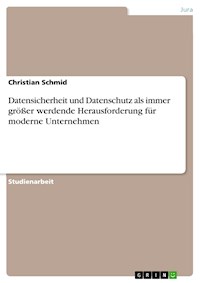28,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Cosmos Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
«Amtsschimmel. Chäferfüdletroche. Halsabschneider. Bisch nid ganz Hugo? Das isch doch Habakuk. Den Vogel abschiessen. Lügen haben kurze Beine. Mit abgesägten Hosen. Uf em Latrinewääg. Voll Tofu du Lauch.» Woher kommen diese Wörter und Redensarten? «Chäferfüdletroche» respektive «Troche wi nes Chäferfüdle» ist belegt im Bernbiet, Zürichbiet, Glarnerland, Schaffhausischen, Sankt-Gallischen, Appenzellischen sowie in Basel. Erste Belege finden sich im 19. Jahrhundert: In Jeremias Gotthelfs Roman «Leiden und Freuden eines Schulmeisters» heisst es, «ds Kreuz-Trini habe der Speck gereut, seine Würste seien trocken wie ein Käferfüdle».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Christian Schmid
Chäferfüdletroche
Redensarten- und Wortgeschichten
Cosmos Verlag
Alle Rechte vorbehalten
© 2023 by Cosmos Verlag AG, Muri bei Bern
Lektorat: Roland Schärer
Umschlag: Stephan Bundi, Boll
Satz und Druck: Merkur Druck AG, Langenthal
Einband: Schumacher AG, Schmitten
ISBN 978-3-305-00502-4
eISBN 978-3-305-00503-1
Das Bundesamt für Kultur unterstützt
den Cosmos Verlag mit einem Förderbeitrag
für die Jahre 2021–2024
www.cosmosverlag.ch
Inhalt
Wortgrübeleien
Abläschele, abluchsen
Ach und Krach, Hängen und Würgen
Als ob man einen Bettelbuben in die Hölle würfe
Altes Eisen
Amtsschimmel
Angsthase
Artefüfi und Storzenääri
Aufpeppen
Ausser Rand und Band
Bisch nid ganz Hugo?
Bugsieren und die Endung -ieren
Chäferfüdletroche
Das Blaue vom Himmel
Den Brotkorb höher hängen
Den Kürzeren ziehen
Den Vogel abschiessen
Der Schö, der Schöbi und der Schöberli
Doppelformeln und unser Körper
E Ligu Leem
E Schlötterlig aahänke
En Eggen ab haa
Gäggeligääl und gibeligälb
Gassenhauer
Genickstarre, Nackenstarre, Halskehre, Äckegstabi
Habakuk und Hawass
Halsabschneider
Hanebüchen, hagebuechig
Herrengunst und Vogelsang
Hokuspokus
I d Kluft stüürze
In den Ohren liegen
In e Wäschplere gusle
Lügen haben kurze Beine
Mein lieber Freund und Kupferstecher
Mit abgesägten Hosen
Mit der grossen Kelle anrichten
Mundartbewahrer
Nachbar
Nachrichten
Nicht bei Trost sein
Pappenstiel
Sanktnimmerleinstag
Schneckenpost
Schwerenöter
Social distancing
Tschäärbis
Tue doch nid eso groossgchotzet!
Über den grünen Klee loben
Uf di liechti Achsle nää
Uf em Latrinewääg vernää
Um ds Verrode
Um ein Haar
Umwelt
Unkraut vergeht nicht
Uschaflig
Voll Tofu du Lauch
Weg vom Fenster sein
Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
Wo Fuchs und Hase einander gute Nacht sagen
Woher kommt der Joggeli, der Birli schütteln sollte?
Wortgrübeleien
Mit unserer Sprache nehmen wir von der Welt, in der wir leben, Abstand. Wir lassen, was wir mit den Sinnen aufnehmen, ganz selten an uns heran, vielleicht in Momenten des Überwältigtseins, der Selbstvergessenheit und grosser Angst. In Momenten der Sprachlosigkeit. Normalerweise schicken wir alles, was wir wahrnehmen, in einen geistigen Umkleideraum, in dem wir das Wahrgenommene vereinfachend kostümieren, trennen, ordnen, zuordnen, in Beziehung setzen und verbinden mit Hilfe von Kategorien, die uns unser Sprachvermögen zur Verfügung stellt. Wir symbolisieren die Welt.
Das hat den grossen Vorteil, dass wir im Raum der Sprache über die Welt verfügen und planen können, ohne dass uns ihre Wirklichkeit ganz vereinnahmt. Das hat den grossen Nachteil, dass wir uns der Welt enthoben fühlen und oft nur noch verstehen wollen, was uns, aber nicht der Welt und uns von Nutzen ist. Dabei vergessen wir, dass wir aus demselben Material bestehen wie unsere ganze Ökosphäre, dass wir atmen, trinken und essen müssen, damit wir sprechen und denken können.
Sprache ist ein mächtiges Gut des Menschen, aber je älter ich werde, desto drängender stellt sich mir die Frage, ob sie wirklich gut ist. Ob wir sie nicht unablässig brauchen, um unserer Körperlichkeit zu entfliehen. Unsere Religion, unsere traditionelle Philosophie preisen den Geist, den Körper verachten sie. «Am Anfang war das Wort»: So beginnt das Johannes-Evangelium. Am Anfang war nicht das Wort, am Anfang waren Cyanobakterien und dann Pflanzen, die jene Atmosphäre schufen, welche überhaupt aerobes Leben ermöglicht. Das Wort wird vielleicht am Ende sein, wenn elektronische Geräte in einer menschenleeren Welt vor sich hin plaudern.
Manchmal nähere ich mich einem Baum, ohne ihn mir mit dem Gedanken «das ist ein Baum» als Exemplar einer abstrakten Kategorie zu entrücken. Ich versuche, mich auf dieses Wesen einzulassen, zu sehen, wie es gewachsen ist, wie es sich anfühlt, welche Farben es hat, wie es duftet, was auf ihm krabbelt und flattert, wie es zu seinen Nachbarn steht, nur um zu merken, wie sehr mich meine Sprache im Griff hat. Wie sie mir unablässig Wortkrücken hinhält: Wurzel, Stamm, Rinde, Ast, Zweig, Blatt, damit ich dieses prächtige Exemplar, das in seiner ganzen Einmaligkeit da ist, zerlegen, damit ich es ordnen, einordnen und in Beziehung bringen kann.
Im Garten, den ich mit meiner Frau seit einigen Jahren bewirtschaften darf, habe ich in ersten Ansätzen gelernt, mit Bäumen, Büschen, Gemüsepflanzen und dem Boden einen langen Dialog zu führen. Ich habe gelernt, mein Verlangen nach einer gewissen Ordnung und die Entfaltung der Pflanzen so aufeinander abzustimmen, dass wir den schwierigen Jahren der Klimazerrüttung gemeinsam begegnen können.
Damit uns die Sprache nicht beherrscht mit ihren billigsten Billigangeboten, die ganz auf unser Wohlbefinden zugeschnitten sind, sollten wir sie nicht von der Stange nehmen wie einen billigen Anzug, sondern prüfen und uns fragen, ob sie uns passt und ob sie dem, was wir mit ihr sagen, im Rahmen dessen, was der Sprache möglich ist, gerecht wird.
Sprachen haben lange Leben und Wörter, Redensarten, Sprachformeln haben uns interessante Lebensgeschichten zu erzählen. Wortgrübeleien sind deshalb wortgeschichtliche Tauchgänge, die ans Licht zu ziehen versuchen, was halb verborgen in altem Sprachschlick steckt oder von Ablagerungen ganz verdeckt ist. Der Frage Wo kommt ein Wort her? kann man sich meistens nur annähern, indem man Belege ausgräbt bis zum ältesten, den man finden kann. Doch die Spur des Wortes, der man folgt, läuft zu anderen Spuren parallel oder kreuzt sie. Andere Sprachen kommen ins Spiel. Ein Knäuel will sich bilden, man versucht, die Fäden in der Hand zu behalten und zu schauen, dass man den Faden der Erzählung nicht verliert, und muss dennoch erkennen, dass sich einiges hinter sprachgeschichtlichen Horizonten verliert.
Ich nähere mich einem Wort wie dem oben beschriebenen Baum. Wer bist du, wo kommst du her, frage ich hartnäckig, obwohl es mir seine Bedeutung unter die Nase hält und behauptet, dass ich es kenne. Meistens kennen wir Wörter, Redensarten, Formeln nicht. Wir brauchen sie, weil wir Regeln ihres Gebrauchs so kennen wie der Schachspieler die Regeln seines Spiels. Wortgeschichten verändern unser Sprachspiel nicht, aber sie können unser Sprachbewusstsein schärfen und unsere Freude an der Sprache befeuern.
Wer Wortgeschichten und nicht Wortmärchen erzählt, muss das Erzählte mit Beispielen stützen. Wichtigstes Suchwerkzeug ist das Internet. Noch nie liess sich ein derart umfangreiches Textkorpus durchforsten. Man muss sich nur Zeit nehmen und mit unterschiedlichen Schreibungen und Wortformen spielen, immer und immer wieder. Aber auch ohne grosse und kleine Wörterbücher und Nachschlagewerke aller Art wäre meine Arbeit nicht möglich gewesen. Viele sind heute frei zugänglich im Internet, z. B. deutschsprachige auf «woerterbuchnetz.de», der «Trésor de la Langue Française informatisé» auf «atilf.atilf.fr» und der «Online Etymology Dictionary» auf «etymonline.com».
Oft muss ich Sie mitnehmen bis in die Zeit der Renaissance oder ins Mittelalter, mute Ihnen zu, Beispiele oder kleine Geschichten in älterem Deutsch zu lesen. Vielleicht verstehen Sie nicht gleich alles auf Anhieb, aber die pointierten, saftigen, zuweilen witzigen, zuweilen bissigen und bösen Formulierungen lohnen die kleinen Mühen des Verstehens. Bei einzelnen Wörtern, die man kaum oder nicht versteht, habe ich die Übersetzung in runden Klammern direkt dahinter gesetzt.
Für die meisten Bücher aus der frühen Neuzeit brauche ich Kurztitel, weil die vollständigen Titel ausserordentlich lang sind. Schwimmers «Kurtzweiliger und Physicalischer Zeitvertreiber» von 1676 lautet in seiner ganzen Länge «Kurtzweiliger und Physicalischer Zeitvertreiber / Worinnen bey nahe in die Tausend höchst-anmuthige / nachdenkliche und recht nüzliche Natur-Fragen fleissigst untersuchet / und gründlich erörtert / auch zu Gelehrter und Ungelehrter sonderbarer Ergezzung / netter / reiner und lieblicher SprachÜbung hochst-gedeylich und behaglich aufgeführet».
In Texten, welche in älterem Deutsch geschrieben sind, kommen Vokale mit übergesetzten Zeichen vor, z. B. ā und î; sie kennzeichnen lange Vokale. Meine mittelbernische Mundart schreibe ich nach Dieth, d. h. ich schreibe sie lautnah, die kurzen Vokale einfach, z. B. Chäfer, buggsiere, läschele, die langen doppelt, z. B. grooss, Haas, plääre. Zitierte Mundart schreibe ich so, wie ich sie der Quelle entnommen habe. Auch die zum Teil abenteuerlichen Schreibungen von Internetbeispielen habe ich nicht verändert.
Dank schulde ich zum Schluss Roland Schärer vom Cosmos Verlag für die ausgezeichnet aufmerksame und freundschaftliche Zusammenarbeit. Meiner Frau Praxedis danke ich fürs Mitdenken.
Damit entlasse ich Sie in das Buch und wünsche, dass Sie sich «bei netter, reiner und lieblicher Sprachübung höchstgedeihlich und behaglich» vergnügen!
Abläschele, abluchsen
In seinem eindrücklichen Roman «Alpefisch» von 2020 schreibt Andreas Neeser von Brunner, der Hauptfigur, er habe «de Gaartetisch parat gmacht, won er den Elteren abgläschelet gha het». Andreas Neeser ist ein Aargauer aus dem Ruedertal; er ist in Schlossrued aufgewachsen.
Mir geht es um das Wort abläschele «abschmeicheln, abbetteln». Es ist eine Bildung mit der Vorsilbe ab- zum Verb läschele «überlisten»; seltener sind erläschele «durch Schmeicheln oder eifriges Zureden erlangen» und überläschele «durch List zu etwas verführen». Schon als Kind habe ich abläschele oft gehört. Kam ich mit einem Bonbon nach Hause oder mit irgendetwas, das mir nicht gehörte, fragte Mutter streng: Wäm hesch daas wider abgläschelet? Ich mochte das Wort, obwohl es einschmeichelnd tönt, nicht, denn in abläschele klang immer Unrechtmässiges mit: Schmeicheln, List oder gar Hinterlist.
Abläschele sagt man nicht nur im Luzern- und im Berndeutschen. Wir finden das Wort auch im «Baselbieter Wörterbuch»: aplääschele «listig abnehmen, abluchsen», im «Baseldeutsch-Wörterbuch» von Suter: ablääschele «listig abschwatzen, abluchsen», im «Zürichdeutschen Wörterbuch»: abläschele «abbetteln», im «Senslerdeutschen Wörterbuch»: abläschele «überlisten, im Spiel abnehmen» und im «Simmentaler Wortschatz»: aabläschele «mit Schmeicheln abgewinnen».
Das Wort ist recht alt, denn Gotthelf brauchte es wiederholt. So im Roman «Uli der Knecht» von 1846, wo die Meistersfrau zu Uli sagt: «Ich weiss wohl, dass es Meisterleute gibt, welche ihre Dienste betrügen und ihnen den sauer verdienten Lohn abläschlen.» Und in der Erzählung «Hans Jakob und Heiri oder Die beiden Seidenweber» von 1851, in der Hans Jakob über diejenigen schimpft, die man benutzt, um «uns armen Leuten das Geld abzuläscheln, fast so wie in einer Lotterie, und wenn sie genug haben, gehen sie damit über den Bach». Später hat es Rudolf von Tavel oft verwendet, z. B. im Roman «Der Frondeur» von 1929: «Bevor si wieder ufbroche sy […], isch ds Annelor der nächschte Burefrou es zündtrots Geraniumstöckli ga abläschelen und het’s uf ds Grab vo sym Brueder gsetzt.»
Im «Schweizerischen Idiotikon», wo sogar ein Beleg aus einem Spiel von 1606 des Berners Michael Stettler aufgeführt wird, ist abläschele dem Wort Laschele «Hängemaul, Person mit schlaff herabhängendem Maule; schlampige, plauderhafte Person» zugeordnet. Im «Wörterbuch der elsässischen Mundarten» hat Laschele die Bedeutung «Feigling», wohl ausgehend von französisch lâche «feige». Wie Laschele und abläschele miteinander in Beziehung zu setzen wären, ist mir nicht klar, denn abläschele hat eindeutig mit schwatzen und schnorren zu tun. Ich gebe deshalb zu bedenken, dass das Wort auf jiddisch loschen, laschen, lauschen «Sprache, Rede, Zunge», wie z. B. in mamme loschen «Muttersprache», zurückgehen und über das Rotwelsche in unsere Mundarten gelangt sein könnte. Rotwelsches loschen, laschen meint «sprechen». Rotwelsches laschoren, loscharen, lassoren «fragen» ist bereits in Ludwig Pfisters «Aktenmässiger Geschichte der Räuberbanden an den beiden Ufern des Mains, im Spessart und im Odenwalde» von 1812 aufgeführt. In Joseph Karl von Trains «Chochemer loschen: Wörterbuch der Gauner- und Diebs- vulgo jenischen Sprache», das in den Jahren 1832/33 neunundzwanzig Auflagen erlebte, finden wir laschoren, loscharen «fragen». Im Schwäbischen und im süddeutschen Alemannischen sind die Verben loschoren und ausloschoren «aushorchen, ausfragen» belegt. Das r kann ohne weiteres zu einem l werden; dieser Lautwandel ist sehr bekannt (peregrinus – Pilger). Mit lascholen, ausgehend von laschoren, wären wir dann schon ganz nahe bei läschele.
Bedeutungsähnlich ist das Wort abluusse, das vom alten Verb luusse «lauern», mittelhochdeutsch lûzen, abgeleitet ist. Es gibt das auf Vorteil lauernde Abschwatzen sehr gut wieder.
Die hochdeutsche Entsprechung zu abläschele, abluusse ist abluchsen «(mit List) wegnehmen, abschwatzen». Abluchsen ist wie erluchsen von luchsen «auf listige Weise herausholen, an sich bringen» oder «auf etwas lauern» abgeleitet. Das Verb ist erst seit dem 18. Jahrhundert belegt, und da schrieb man es uneinheitlich abluxen, abluksen, ablugsen oder abluchsen. Frühe Belege, in denen es immer um das Abluchsen von Geld geht, finden wir in Adam Friedrich Kirschs lateinisch-deutschem Wörterbuch von 1714: «einen praf ums Geld schneutzen / abluxen», und in Daniel Schneiders «Vollständiger Hoch-Gräflich-Erbachischen Stamm-Tafel» von 1736: «Tausend Arten und Künste erdenckt man, um uns das Geld abzuluchsen». Im Spiel «So prelt man alte Füchse» von 1777 sagt der Harlekin: «Herr D. Balanzoni ist gar der Gimpel nicht, der sich so ’n fünf-sechs hundert Luisdor abluchsen läst.»
Die unterschiedliche Schreibung hatte unter anderem damit zu tun, dass man sich nicht einig war und bis heute nicht einig ist, woher das Wort stammt. Die Erklärung im «Versuch eines bremisch-niedersächsischen Wörterbuchs» von 1768, die niederdeutsche Wortform afluksen «behende weg stehlen» sei ein Frequentativum (Wort, das eine Wiederholung anzeigt) zu niederdeutsch luken «ziehen, zupfen», wird im «Kluge» von 2002 noch heute vertreten. Auch Wahrigs «Herkunftswörterbuch» von 2009 erklärt, abluchsen «von jemandem etwas durch geschicktes Überreden erlangen» sei über mittelniederdeutsch luken «ziehen, zerren, rupfen» auf althochdeutsch liuhhan zurückzuführen und fügt an: «Die Herkunft des Verbs abluchsen zeigt also keinerlei Verbindung zum Luchs, sondern ist eine Beschreibung der Tätigkeit.»
Johann Christoph Adelung behauptet in seiner «Anweisung zur deutschen Orthographie» von 1791, das Wort sei von lugen abgeleitet und sollte deshalb ablugsen geschrieben werden. Diese Herkunftserklärung teilt niemand mehr.
Viele Wortforscher gehen heute davon aus, dass luchsen, abluchsen und erluchsen vom Wort Luchs abgeleitet sind, das man im 17. und 18. Jahrhundert oft Lux schrieb. Dieser Meinung ist auch der Ravensburger Spieleverlag, denn sein Kartenspiel «Abluxxen» ist mit einem Luchs illustriert. Luchs, ein Wort westgermanischen Ursprungs, ist wohl nach seinen nachts leuchtenden Augen benannt und gehört deshalb zu indogermanisch leuk- «leuchten».
Den Vertretern der Luchs-These gebe ich zu bedenken, dass sich mit List entwenden wie ein Luchs oder ähnliche Belege nirgends finden lassen. In Texten wird im Mittelalter und in der frühen Neuzeit immer auf die scharfen Augen des Tiers verwiesen: «ein sehr scharpffes gesicht wie ein Luchs» (1582), «scharpffsichtig wie ein Luchs» (1654), «scharpff sehen wie ein Luchs» (1673), «scharpffe Augen wie ein Lux» (1682) usw. Hendrik Balde schreibt 1715 in seinen «Christlichen Warheiten»:
«Gar wenig seyn / die auff sich selbst ihre Augen wenden. Gegen unseren aignen Fälleren (Fehler) seyn wir blind / da wir hingegen Luxen seyn auff anderer Müsshandlungen.»
Allerdings gilt der Luchs auch als listig. Die Reformatoren Johannes Oekolampad und Huldrych Zwingli behaupten 1528 in ihrem Buch über Luther: «Luter ist listig wie ein Luchs.» Der Basler Sebastian Münster schreibt in seiner «Cosmographei» von 1556: «Luchs ist ein listig Thier» und Hans Sachs (1494–1576) dichtet: «Schaw der Spieler der listig Luchs / So vil Irrweg braucht in dem spiel / Er kan vergebner griflein viel / Die Würffel meisterlich zu knüpffen (betrügerisch brauchen) / Die Kartnbletter merckn und krüpffen (knicken).» Würden sich die Verben abluchsen, erluchsen, luchsen auf den listigen Luchs beziehen, wäre es schwierig zu erklären, weshalb sie sich erst ab dem 18. Jahrhundert belegen lassen.
Ach und Krach, Hängen und Würgen
Mit Ach und Krach hat er die Prüfung bestanden, sagen wir, oder mit Ach und Krach hat sie den Halbfinal erreicht. Die Redensart mit Ach und Krach meint «mit Mühe und Not, gerade noch». Am 18. Dezember 2009 titelt die «Aargauer Zeitung»: «Den Kredit mit Ach und Krach bewilligt», und am 13. Februar 2022 lesen wir auf «srf.ch» unter dem Titel «Liverpool mit Ach und Krach – Milan neu Leader», dass sich der FC Liverpool in einem Spiel zum Sieg geknorzt hat. In der Mundartform mit ach und chrach nimmt Jakob Hunziker 1877 die Redensart sogar in sein «Aargauer Wörterbuch» auf.
Ach und Krach ist eine alte Doppel- oder Zwillingsformel mit Endreim. Viele dieser Formeln haben sich im amtlichen oder alltäglichen Sprachgebrauch verfestigt und werden heute noch gebraucht, wie die endreimenden Stein und Bein, Saus und Braus, Rand und Band und eben Ach und Krach, die stabreimenden, d. h. mit demselben Laut beginnenden Land und Leute, Haus und Hof, Kind und Kegel und die reimlosen Zeter und Mordio, recht und billig und Jahr und Tag.
Bei der Doppelformel Ach und Krach verstehen wir den ersten Teil gut, denn wer ach sagt, klagt; er meint «Klagen». Wollen wir Krach richtig verstehen, müssen wir zurück ins Mittelalter, und zwar in die Mitte des 12. Jahrhunderts. Damals wurde im Kloster St. Trutpert im Münstertal im Schwarzwald das Hohe Lied übersetzt und der Schreiber schrieb, dass wir alle diejenigen hören sollen, «die weinende unde chrachende lident die arbaite», d. h. «die weinend und seufzend Not leiden». Das Verb chrachen, krachen meint hier «seufzen». Wir lesen im «Deutschen Wörterbuch», wo krachen «seufzen, stöhnen, ächzen» aufgeführt ist, ein Textbeispiel aus dem 16. Jahrhundert, in dem von Kranken gesagt wird, sie «kriechen mit achen und krachen an (ohne) stecken den weg mehr dann sie gehen».
Die ursprüngliche Bedeutung der Doppelformel Ach und Krach bzw. Achen und Krachen ist demnach «Klagen und Seufzen». Frühe Beispiele finden wir beim süddeutschen Humanisten Sebastian Franck, und zwar in seinen «Paradoxa ducenta octogina» von 1534, in denen gesagt wird, die Sünde sei «ein arger will und widerwill […] wider got / und nichts dann ein ach und krach», sowie in seiner «Chronica des gantzen Teutschen lands» von 1539, wo von falschen Propheten die Rede ist, «deren ach und krach ist / dasss sie vilen gfallen / und ein grosse versamlung anrichten». Hier wird Ach und Krach bereits in der übertragenen Bedeutung «grösste Anstrengung, grösstes Bemühen» verwendet.
Auch im 17. Jahrhundert meint der Ausdruck mit Ach und Krach, Achen und Krachen meistens «mit Klagen und Seufzen». Conrad Dieterich mahnt in seinem «Ecclesiastes» von 1642: «Es ist dein Geburt warlich nicht mit Lachen / sondern mit Weynen / Achen und Krachen zugangen.» In einem Beispiel aus dem Jahr 1666 ist von jemandem die Rede, der «in Verzweifflung mit ach und krach […] zum Teuffel fahren» wird. Auch in einem Beleg von 1681, in dem von «Vater Saturnus» die Rede ist, «der alters wegen matt und verdrossen ist / und darumb hinden nach zaudern / und mit Ach und Krach bald anstolpern wird», können wir mit Ach und Krach mit Fug und Recht als «mit Klagen und Seufzen» verstehen.
Wir stellen fest: Aus den Doppelformeln Ach und Krach sowie Achen und Krachen mit der Bedeutung «klagen und seufzen» wurde der Ausdruck mit Ach und Krach «mit Klagen und Seufzen» entwickelt und daraus ist die Redensart mit Ach und Krach mit der übertragenen Bedeutung «mit Mühe und Not, gerade noch» entstanden. Bereits im 16. Jahrhundert ist bei Sebastian Franck die übertragene Bedeutung «grösste Anstrengung, grösstes Bemühen» belegt, welche der heutigen Bedeutung der Redensart mit Ach und Krach nahekommt. Im 18. Jahrhundert wird die Doppelformel Ach und Krach meistens im Sinne von «Klagen und Seufzen» verwendet. Noch selten kommt die Redensart mit Ach und Krach in der Bedeutung «mit Mühe und Not, gerade noch» vor, z. B. im «Staats-Gespräch in dem sogenannten Reich der Todten» von 1746, «nachdem er mit Ach und Krach 3 bis 4000 Mann, aus allerhand Leuten zusammengebracht». Erst im 19. Jahrhundert überwiegt die Redensart in derjenigen Bedeutung, die wir ihr heute geben, z. B. «mit ach und krach wurde der umgefallene Wagen wieder zum Stehen gebracht» (1832), «wir konnten mit Ach und Krach noch ein Plätzchen finden» (1835), «ein schon längst mit Ach und Krach zusammen gesparter und gepumpter Geldtransport» (1852) und im «Sprichwörter-Lexikon» (1877) von Wander: mit Ach und Krach durchkommen «mit genauer Noth, z. B. durch das Examen».
Die Form mit Achen und Krachen veraltet bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Das «Idiotikon von Kurhessen» von 1883 meint zum Wort achen, es sei «wenig mehr üblich ausser in der sehr gewöhnlichen Redensart: mit Achen und Krachen»; sehr selten kommt sie heute noch vor, z. B. im «Schmetterling» 2/2009, der Mitgliederzeitung der Partei «Die Violetten – für spirituelle Politik»: «Mit Achen und Krachen kamen 11 Personen.»
Dieselbe Bedeutung wie mit Ach und Krach hat heute mit Hängen und Würgen. Die Wörter hängen und würgen können seit dem Mittelalter verwendet werden, wenn es um Leben und Tod geht, sei es im Kampf oder in der Blutgerichtsbarkeit. Sie kommen oft nebeneinander vor, wie 1577 in der «Chronica der Lande zu Holsten» von Johann Petersen, wo von einem Herrscher berichtet wird, der «Galgen und Rad auff richten / hangen und würgen» liess.
Wir nehmen den Wörtern ihre ursprüngliche Bedeutung, wenn wir sagen, sie hat es mit Hängen und Würgen geschafft, d. h. «mit grösster Mühe, gerade noch». Erklären lässt sich das mit einer älteren Form der Redensart, die zwischen Hängen und Würgen lautet und ursprünglich «in einer sehr misslichen Lage» meinte, was den Wörtern hängen und würgen durchaus angemessen ist. Zwischen Hängen und Würgen stammt aus dem Niederländischen, denn da ist tusschen hangen en worgen bereits seit dem 17. Jahrhundert belegt. Jean-Louis Arsy übersetzt in seinem niederländisch-französischen Wörterbuch von 1699 tusschen hangen en worgen mit «entre la mort et l’espérance – zwischen Tod und Hoffnung». Genauso verwendet sie in einem frühen deutschen Beleg Wilhelm Plaum in seinen «Christ-Catholischen Grund-Wahrheiten» von 1748, den Todeskampf beschreibend, «wan wir werden ligen zwischen hangen und würgen». In diesem Sinn wird zwischen Hängen und Würgen noch im 19. Jahrhundert meistens gebraucht, so in den «Volkswirtschaftlichen Monatsheften» von 1878, wo vom Daniederliegen der Gewerbe «in einem Zustande zwischen Hängen und Würgen» die Rede ist. Es ist möglich, dass sich zwischen Hängen und Würgen «in einer sehr misslichen Lage» zu mit Hängen und Würgen «mit grösster Mühe, gerade noch» entwickelt hat wegen seiner Nähe zu mit Hangen und Bangen «mit grosser Angst, voller Sorge» und mit Ach und Krach «mit grösster Mühe, gerade noch».
Mit Hangen und Bangen ist übrigens ein verballhorntes Zitat aus Klärchens Lied im dritten Akt von Goethes «Egmont» (1788). Dort heisst es:
«Freudvoll / Und leidvoll, / Gedankenvoll sein; / Langen / Und bangen / In schwebender Pein; / Himmelhoch jauchzend / Zum Tode betrübt; / Glücklich allein / Ist die Seele, die liebt.»
Langen wird hier im Sinn von «verlangen, sehnen» gebraucht. Eduard Hanslick schreibt in seinen Kritiken «Concerte, Componisten und Virtuosen der letzten fünfzehn Jahre» von 1886 zu den von Beethoven vertonten Klärchen-Liedern:
«Dem Concertprogramme waren die Texte der Clärchen-Lieder beigedruckt, in welchen wir, wie gewöhnlich, zu lesen bekamen: ‹Hangen und Bangen in schwebender Pein›. Es ist dies ein Druckfehler, der durch seine allgemeine Verbreitung beinahe Bürgerrecht erlangt und die richtige Lesart verdrängt hat. ‹Langen und Bangen› heisst es bei Goethe, der in dem Liede Clärchens durchweg Contraste neben einander stellt: Leidvoll – freudvoll; himmelhoch jauchzend – zum Tode betrübt; ebenso Langen (Verlangen) und Bangen. Die Kürzung ‹Langen› für Verlangen ist echt Goethisch, wenngleich ungebräuchlich, undeutlich; ‹Hangen und Bangen› desto volkstümlicher. Sei es nun, dass Beethoven in einer fehlerhaften Goethe-Ausgabe sein ‹Hangen und Bangen› schon vorfand, oder ob ihm selbst der Schreibfehler zur Last falle: Thatsache ist, dass seit der unermesslichen Popularität von Beethovens Clärchen-Liedern das unrichtige ‹Hangen› überall gesagt und gesungen wird. Es dürfte schwer fallen, diesen Fehler jetzt nach siebzig Jahren aus der Welt zu schaffen; aber ein Fehler, eine ungehörige Abweichung vom Goetheschen Texte bleibt es immerdar.»
Theodor Fontane schrieb 1895 das Gedicht «In Hangen und Bangen». Im «Hamburger Abendblatt» vom 11. Januar 2011 lesen wir unter dem Titel «Sprechen Sie Hamburgisch?»: «Jüst un jüst, so eben und eben, mit Müh und Not, mit Hangen und Bangen, nämlich ganz knapp …» – mit Hangen und Bangen ist Sprachbrauch geworden und nur wenige wissen heute noch, dass dahinter Goethes Langen und Bangen mit anderer Bedeutung steckt.
Als ob man einen Bettelbuben in die Hölle würfe
Verstehen wir den Wortlaut alter Redensarten richtig? Dafür interessierte man sich bereits vor über 200 Jahren. Das zeigt eine hübsche Geschichte im «Aufrichtigen und wohlerfahrenen Schweizer-Boten» vom 8. Juli 1808:
«Hast du […] nicht wohl selber unter gemeinen Landsleuten die Redensart gehört: Das bschiesst nüt! Es isch ass wenn men ä Bättelbueb i d’Höll abegheiti!
Das Sprüchlein hörte ich oft und dick in Deutschland in Schlössern, in Königsstädten und Kaiserstädten, und das Herz im Leibe wollte mir zerspringen, ob der hochadelichen Unvernunft, und ich dachte an die armen Leute, die Fleisch und Blut haben wie wir, und auch frieren im Winter, und haben kein Holz, und kriegen nichts zu essen, wenn der Mitmensch sich ihrer nicht erbarmt, und ihre Kleinen haben auch guten Apetit – und stammen wir alle doch von Adam und Eva ab. – Siehe, das Kniebiegen kam mich an, und ich konnte in Thränen zerfliessen über der unmenschlichen, unchristlichen Redensart: Das ist so wenig, als wenn ein Bettelbube in die Hölle geschmissen würde.
Aber neulich hat mir der wackere Häfliger in Hochdorf über dieses Sprichwort die Augen eröffnet. Er sagte mir, das Sprichwort laute in seiner Urgestalt eigentlich so: Es ist so viel als wenn man einen Bettler in die Hölle würfe.
Aber lieber Freund, sagte ich, Bettler und Bettelbube ist ja alles eins, wie Spatz und Sperling.
Nicht doch! war die Antwort, denn sieh nur, es giebt eine Art kleiner Fässchen, in denen man den Elsasser Wein holt; diese Gefässe heissen Bättler, wie man’s auch in Stalders Idiotikon lesen kann. Wenn nun der Landmann das Unzureichende irgend eines Mittels ausdrücken wollte, so pflegte er zu sagen: das Mittel ist so unzureichend, als ein Bättler voll Wasser, mit dem man das Höllenfeuer auslöschen wollte.»
Redensarten können mitunter recht grob und derb sein, auch wenn sie, wie in diesem Fall, wohl aus der Feder von Geistlichen stammen. Der Erzähler glaubt sich aus seinen etwas larmoyant vorgetragenen Seelennöten erlöst, weil ihm der katholische Pfarrer Jost Bernhard Häfliger aus dem luzernischen Hochdorf erklärt, nicht ein leibhaftiger Bettler sei gemeint, sondern ein Fass, das als Bättler bezeichnet wird. Häfligers Geschichte ist wohl falsch. Ein Gefäss oder Fass mit der Bezeichnung Bettler finde ich nur im «Deutschen Rechtswörterbuch», das eine schwäbische Quelle aus dem Jahr 1635 zitiert. Im «Idiotikon» und im «Deutschen Wörterbuch» kommt es nicht vor.
Viel wichtiger ist jedoch, dass die älteste Form der Redensart von Luther stammt, und zwar aus der Schrift «An den christlichen Adel deutscher Nation» von 1520. Dort ist nicht von einem Bettler, sondern von einem Teufel die Rede:
«Dan was sie mit ablas / bullen / beichtbrieffen / butterbrieffen / und ander Confessionalibus / haben in allen landen gestolen / noch stelen unnd erschinden / acht ich als flickwerck / unnd gleich als wen man mit einem teuffel in die helle wurff.»
Vom 16. bis ins 18. Jahrhundert wird nur die Luther-Redensart es ist gleich als wenn man mit einem Teufel in die Hölle würfe «es ist, nützt, taugt nichts» überliefert. Andere Beispiele findet man erst im 19. Jahrhundert, z. B. in den «Landwirtschaftlichen Blättern für Schwaben und Neuburg» von 1872, wo wir lesen: «Das was der Einzelne auf seinem schmalen Streifen thut, ist meist vergebens, so vergebens wie wenn man, wie man zu sagen pflegt, einen Teufel in die Hölle wirft.» Doch im Ganzen bleibt sie auf Luther beschränkt.
Der Version mit dem Bettler oder Bettelbuben begegnen wir viel häufiger. Der Jesuit Josef Franz von Rodt predigt im Jahr 1680:
«Wann man einem Geitzhalss ein Stuck Gelt oder das gantze Haab und Gut eines armen Waisen hinwirfft / so ist es eben / als wann man einen Bettelbueben in die Höll werffe.»
In Abraham a Sancta Claras «Judas, der Ertz-Schelm» von 1686/95 lesen wir: «Wann ich Kayser wäre, heist es, Ofen (heute Buda, ein Teil von Budapest) wäre mir nichts, gleich so viel, als wann man einen Bettelbuben in die Höll wirfft.»
Und Anton Edler von Klein erklärt in seinem «Deutschen Provinzialwörterbuch» von 1792:
«[Einen] Bettelbuben in die Hölle werfen, etwas ohne merklichen Erfolg verrichten. Z. B. Einem sehr Hungrigen nur sehr wenig Speise geben; einem Verschwender wenig Geld reichen etc. Ist von der Idee hergenommen, dass die Hölle einen grossen Schlund habe.»