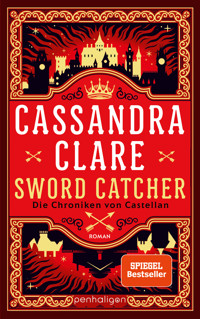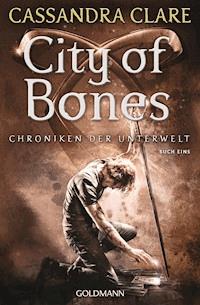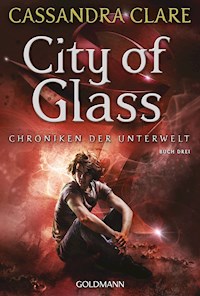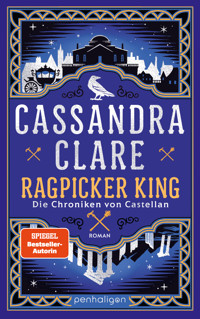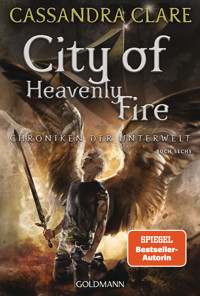10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Letzten Stunden
- Sprache: Deutsch
Die Schattenjägerin Cordelia Carstairs ist aus dem edwardianischen London nach Paris geflohen. Zu sehr schmerzt sie die unglückliche Scheinehe mit ihrer großen Liebe James Herondale. Nun sucht sie Vergessen – ausgerechnet mit James' bestem Freund an ihrer Seite. Doch unheilvolle Nachrichten treiben die beiden zurück: Während alte Feinde sich zusammentun und ein mächtiger Höllendämon nach der Macht greift, hat sich Cordelias Freundeskreis durch Intrigen und Geheimnisse entzweit. Dabei werden sie die Welt der Schattenjäger nur gemeinsam gegen das Böse verteidigen können – oder in einem letzten großen Kampf alles verlieren ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1282
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Die junge Schattenjägerin Cordelia Carstairs hat alles verloren, was ihr wichtig ist: ihre Ehre als Kämpferin, die Aussicht, Parabatai ihrer besten Freundin Lucie zu werden – und vor allem die Hoffnung, dass James Herondale, mit dem sie eine Scheinehe führt, doch noch ihre Liebe erwidern könnte. Verzweifelt flieht sie mit James’ Freund Matthew nach Paris, versucht dort, im glitzernden Nachtleben ihre Sorgen zu vergessen.
Doch allzu schnell holt die Realität die beiden ein. Schockierende Nachrichten aus der Heimat zwingen sie zurück nach Hause: Die finstere Tatiana Blackthorn ist aus der Adamant-Zitadelle geflohen, interne Streitigkeiten und Machtkämpfe schwächen die Schattenjägergemeinschaft, und London wird erneut vom Höllenfürsten Belial bedroht. Chaos und Uneinigkeit herrschen in der Stadt. Auch Cordelias Freunde sind beeinträchtigt – alle tragen schwer an ihren eigenen Geheimnissen, und es fällt ihnen schwer, einander zu vertrauen. Dabei drängt die Zeit. Denn Belial plant, ein für alle Mal die Macht an sich zu reißen und den Londoner Schattenjägern einen letzten tödlichen Stoß zu versetzen ...
Weitere Informationen zu Cassandra Clare
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
CHAIN OF THORNS
Die Letzten Stunden
BUCH DREI
ROMAN
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Chain of Thorns« bei Margaret McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe April 2023
Copyright © der Originalausgabe 2023 bei Cassandra Clare, LLC
Copyright © dieser Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,
nach einer Idee von Nick Sciacca © 2021 Simon & Schuster, Inc.
Umschlagfoto und -illustration: © Cliff Nielsen
Redaktion: Waltraud Horbas
Th · Herstellung: ast
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-20550-8V001
www.goldmann-verlag.de
Für Emily und Jed.
Ich bin froh, dass ihr endlich geheiratet habt.
Man muss ertragen lernen, was man nicht vermeiden kann. Unser Leben ist, wie die Harmonie der Welt aus widersprechenden Dingen, gleichfalls aus verschiedenen, langen und kurzen, hohen und tiefen, weichen und rauen Tönen zusammengesetzt. Der Tonsetzer, welchem nur einige Tonarten gefielen, würde mit seiner Kunst nicht viel ausrichten. Er muss sich ihrer insgesamt zu bedienen und solche zu vermischen wissen. So müssen wir das Gute und das Übel verbinden, aus denen die Wesenheit des Lebens besteht. Unser Dasein kann ohne diese Vermischung nicht bestehen, und eine Saite ist ebenso nötig dazu als die andere.
Michel de Montaigne, »Essays«
PROLOG
Später konnte James sich nur noch an die Geräusche des Winds erinnern: ein metallisches Kreischen, als würde ein Messer über eine Glasscherbe gezogen, und tief darunter ein Heulen, verzweifelt und hungrig.
Er war auf einer langen Straße unterwegs. Sie wirkte, als wäre vor ihm noch niemand hier entlanggelaufen, denn er entdeckte keinerlei Spuren auf dem Boden. Und der Himmel über ihm wirkte genauso unberührt und leer. James hätte nicht sagen können, ob es Nacht oder Tag, Winter oder Sommer war. Vor ihm lag nur eine leere, braune, endlose Landschaft, und über sich sah er nichts als grauen Himmel.
Dann hörte er es. Der Wind wurde stärker, wirbelte trockenes Laub und kleine Steine um James’ Fußknöchel, und sein zunehmendes Fauchen hätte das sich nähernde Dröhnen marschierender Füße fast übertönt.
James fuhr herum und blickte sich um. Vom Wind geformte Staubwirbel kreisten in der Luft. Sand fegte ihm ins Gesicht, brannte ihm in den Augen. Durch den verschwommenen Schleier des Sandsturms jagte ihm ein Dutzend – nein, einhundert, sogar über einhundert – dunkler Gestalten entgegen. Es konnte sich nicht um Menschen handeln, das wusste er: Auch wenn sie nicht wirklich flogen, schienen sie Teil des brausenden Winds zu sein, und Schatten umflatterten sie wie Schwingen.
Der Wind heulte in seinen Ohren, als sie über seinen Kopf hinwegrauschten – ein verwobener Haufen schattenhafter Gestalten, von denen nicht nur eine eisige Kälte, sondern auch das Gefühl drohender Gefahr ausging. Während sie geräuschvoll über und an ihm vorbeizogen, hörte er durch den Lärm ein leises Flüstern, durchdringend wie ein Faden, der durch einen Webstuhl gezogen wurde.
»Sie erwachen«, sagte Belial. »Hörst du das, mein Enkelsohn? Sie erwachen!«
Ruckartig fuhr James hoch, schnappte keuchend nach Luft. Er konnte nicht atmen. Verzweifelt grub er sich einen Weg in die Höhe, hinaus aus dem Sand und den Schatten, und fand sich plötzlich in einem Raum wieder, den er nicht kannte. Er schloss die Augen, öffnete sie erneut. Jetzt wusste er plötzlich, wo er war: in dem Herbergszimmer, das er sich mit seinem Vater teilte. Will schlief tief und fest im Nebenbett; Magnus hatte ein Zimmer ein Stück den Korridor hinunter.
James stieg aus dem Bett und zuckte zusammen, als seine nackten Füße den kalten Boden berührten. Dann schlich er lautlos zum Fenster und blickte hinaus auf die schneebedeckten Felder, die sich im Mondlicht so weit erstreckten, wie das Auge reichte.
Träume. Sie machten ihm Angst. Belial hatte ihn in seinen Träumen aufgesucht, solange James sich erinnern konnte. In seinen Träumen hatte er die kargen Königreiche der Dämonen besucht, hatte Belial töten sehen. Bis heute konnte er nicht sagen, ob ein Traum einfach nur ein Traum war – oder ob er eine schreckliche Wahrheit enthielt.
Das Schwarz und Weiß der Welt vor seinem Fenster spiegelte die Trostlosigkeit des Winters wider. Die Herberge lag irgendwo in der Nähe des zugefrorenen Flusses Tamar. Sie waren hier eingekehrt, nachdem der Schneefall gestern Abend zu dicht wurde, um noch weiterzureiten. Dabei hatte es sich weder um einen hübschen, flockigen Schneeschauer gehandelt noch um wilde, stürmische Schneeböen. Dieser Schnee hatte ihnen wütend und gezielt entgegengeweht, und seine Kristalle waren in einem spitzen Winkel auf dem kahlen, graubraunen Boden aufgeprallt wie ein nicht enden wollender Pfeilhagel.
Obwohl James den ganzen Tag nur in einer Kutsche gesessen hatte, fühlte er sich erschöpft. Er konnte sich kaum dazu bringen, etwas heiße Suppe zu essen, bevor er sich die Treppe hinaufschleppte und ins Bett fiel. Magnus und Will hatten noch eine Weile im Schankraum gesessen, in Ohrensesseln direkt beim Feuer, und sich leise unterhalten. James nahm an, dass sie über ihn sprachen. Das konnten sie ruhig tun – es war ihm egal.
Sie hatten vor drei Tagen London verlassen und sich auf die Suche nach James’ Schwester Lucie gemacht, die mit dem Hexenmeister Malcolm Fade und Jesse Blackthorns konserviertem Leichnam fortgelaufen war – aus einem Grund, der so finster und furchteinflößend war, dass niemand von ihnen das unheilvolle Wort dafür offen aussprechen wollte.
Nekromantie.
Es war von größter Bedeutung, dass sie Lucie möglichst schnell fanden – das hatte Magnus immer wieder betont. Was nicht so einfach war, wie es klang. Denn Magnus wusste zwar, dass Malcolm ein Haus in Cornwall besaß, doch er kannte den genauen Ort nicht, und Malcolm hatte jeden Versuch blockiert, die Verfolgten aufzuspüren. Also mussten sie auf eine etwas altmodischere Methode zurückgreifen und sich entlang der Route in jeder Herberge, die von Schattenweltlern besucht wurde, nach ihnen umhören. Magnus hielt dann mit den Stammgästen ein Schwätzchen, während James und Will strikte Anweisung hatten, in der Kutsche zu bleiben und ihre Schattenjägeridentität zu verbergen.
»Niemand wird mir etwas erzählen, wenn sich herausstellt, dass ich mit zwei Nephilim reise«, hatte Magnus gesagt. »Eure Zeit wird kommen, wenn wir Malcolm gegenüberstehen und ihr mit ihm und Lucie fertigwerden müsst.«
An diesem Abend hatte er James und Will erzählt, dass er das Cottage höchstwahrscheinlich gefunden hatte und dass sie es am nächsten Morgen innerhalb weniger Stunden erreichen könnten. Und falls es sich wider Erwarten nicht um das richtige Haus handeln sollte, würden sie einfach weiterreisen.
James musste Lucie unbedingt finden. Nicht nur, weil er sich Sorgen um sie machte – obwohl das der wichtigste Grund war –, sondern auch wegen all der anderen Dinge, die sich in seinem Leben ereigneten. All das, woran er sich jeden Gedanken untersagte oder gezielt verdrängte, bis er seine Schwester gefunden und in Sicherheit gebracht hatte.
»James?« Eine schlaftrunkene Stimme riss ihn aus seinen Gedanken. James wandte sich vom Fenster ab und sah, dass sein Vater aufrecht im Bett saß. »Jamie bach, was liegt dir auf dem Herzen?«
James betrachtete seinen Vater. Will wirkte müde; seine schwarze Haarmähne war zerzaust. James hatte schon oft zu hören bekommen, dass er Will ähnelte – und er wusste, dass das als Kompliment gemeint war. Sein Leben lang war sein Vater der stärkste Mann gewesen, den er kannte, unerschütterlich in seinen Prinzipien und unbeirrt in seiner Zuneigung. Will ruhte fest in sich. Nein – James ließ sich in nichts mit Will Herondale vergleichen.
Er lehnte sich mit dem Rücken gegen die kalte Fensterscheibe. »Nur ein schlechter Traum«, antwortete er.
»Hmm.« Will wirkte nachdenklich. »Letzte Nacht hattest du auch schon einen schlechten Traum. Und in der Nacht davor ebenfalls. Gibt es vielleicht etwas, worüber du mit mir reden möchtest, Jamie?«
Einen Moment lang malte James sich aus, wie es wäre, seinem Vater sein Herz auszuschütten. Belial, Grace, das Armband, Cordelia, Lilith. Einfach alles.
Aber die Vorstellung hielt nicht lange an. Er konnte sich die Reaktion seines Vaters nicht vorstellen. Konnte sich nicht vorstellen, wie er diese Worte aussprach. Er hatte all das so lange für sich behalten, dass er keinen anderen Ausweg sah, als seine Sorgen und Ängste nur noch stärker zu unterdrücken – und sich damit auf die einzige Art zu schützen, die er kannte.
»Ich mache mir nur Sorgen um Lucie«, sagte er. »Worauf sie sich da eingelassen hat.«
Wills Miene änderte sich – James glaubte für den Bruchteil einer Sekunde, einen Ausdruck der Enttäuschung über das Gesicht seines Vaters zucken zu sehen. Aber das ließ sich im Halbdunkel nur schwer ausmachen. »Dann geh wieder ins Bett«, sagte er. »Magnus meint, dass wir sie morgen wahrscheinlich finden, und dann sollten wir ausgeruht sein. Es kann durchaus sein, dass sie uns nicht freundlich empfangen wird.«
1 Das Zwielicht
Mein Paris ist das Land, wo das Zwielicht der Abendluft
mit leidenschaftlichen Nächten in Schwarz und Gold sich verbindet;
Wo, wie es scheint, zur Morgenstunde die Kälte dich findet;
Doch die Nächte voll Gold, und ihr zarter, betörender Duft!
Arthur Symons, »Paris«
Die goldenen Fliesen des Bodens glänzten im Schein des prächtigen Kronleuchters, der Tropfen aus Licht versprühte – wie Schneeflocken, die man von einem Ast herabschüttelte. Die Musik, leise und lieblich, schwoll an, als James aus der Menge der Tanzenden heraustrat und Cordelia die Hand entgegenstreckte.
»Tanz mit mir«, sagte er. In seinem schwarzen Gehrock wirkte er atemberaubend schön. Der dunkle Stoff betonte die goldene Farbe seiner Augen und die scharfen Konturen seiner Wangenknochen. Das schwarze Haar fiel ihm in die Stirn. »Du siehst wunderschön aus, Daisy.«
Cordelia ergriff seine Hand. Während er sie auf die Tanzfläche zog, drehte sie sich um und erhaschte einen Blick auf sie beide in einem Spiegel am anderen Ende des Ballsaals: James, ganz in Schwarz, und sie an seiner Seite, in einem gewagten Kleid aus rubinrotem Samt. James schaute zu ihr hinunter … Nein! Er starrte quer durch den Saal, wo ein blasses Mädchen in einem elfenbeinfarbenen Kleid und mit Haaren von der Farbe cremeweißer Rosenblütenblätter seinen Blick erwiderte.
Grace.
»Cordelia!« Matthews Stimme veranlasste sie, ruckartig die Augen zu öffnen. Ihr war leicht schwindlig, und sie musste sich kurz mit der Hand an der Wand der Umkleidekabine abstützen. Der Tagtraum – oder eher ein Albtraum? Schließlich hatte das Ganze kein besonders gutes Ende genommen – war schrecklich real gewesen. »Madame Beausoleil möchte wissen, ob du Hilfe benötigst. Obwohl ich dir natürlich liebend gern selbst helfen würde, wenn es nicht zu skandalös wäre«, fügte er schelmisch hinzu.
Cordelia lächelte. Normalerweise begleiteten Männer nicht einmal ihre Ehefrauen oder Schwestern zur Schneiderin. Als sie vor zwei Tagen zum ersten Mal hier gewesen waren, hatte Matthew allerdings dasLächeln eingesetzt, woraufhin Madame Beausoleil ihm gestattete, bei Cordelia im Laden zu bleiben. »Sie spricht kein Französisch«, hatte er gelogen, »und wird meine Hilfe brauchen.«
Doch es war eine Sache, ihn in den Laden zu lassen. Der Zutritt zur Umkleidekabine, wo Cordelia gerade ein beängstigend elegantes, rotes Samtkleid übergestreift hatte, wäre dagegen un affront et un scandale gewesen – noch dazu in einem so exklusiven Etablissement wie dem von Madame Beausoleil.
Obwohl Cordelia rief, dass sie schon zurechtkäme, klopfte es kurz darauf an der Tür und eine der Modistes erschien. Mit einem Knopfhaken bewaffnet, machte sie sich an den Verschlüssen auf der Rückseite von Cordelias Kleid zu schaffen – zweifellos nicht zum ersten Mal in ihrem Berufsleben – und drückte und zerrte an Cordelia, als wäre sie eine Kleiderpuppe. Wenige Minuten später, nachdem das Kleid geschlossen, die Brüste angehoben und die Röcke zurechtgezogen waren, wurde Cordelia in den Hauptraum des Schneidersalons geführt.
Die Inneneinrichtung erinnerte an Zuckerwerk und bestand ganz aus Hellblau und Gold, wie ein irdisches Osterei. Bei ihrem ersten Besuch war Cordelia sowohl entgeistert als auch seltsam entzückt gewesen, als sie gesehen hatte, wie die Waren hier präsentiert wurden: Mannequins, allesamt hochgewachsen und schlank und mit wasserstoffblonden Haaren, stolzierten im Raum auf und ab. Jede trug ein schwarzes Band mit einer Nummer um den Hals, die anzeigte, welchen speziellen Stil sie vorführte. Hinter einer Tür mit Spitzenvorhängen befand sich eine Fülle von Stoffballen, aus denen man wählen konnte: Samt und Seide, Satin und Organza. Angesichts dieser Schätze hatte Cordelia im Stillen Anna für ihre Ratschläge in Modefragen gedankt. Darum hatte sie bei den Spitzenstoffen und den Pastelltönen gleich abgewunken und stattdessen Stoffe ausgewählt, von denen sie wusste, dass sie ihr standen. Innerhalb weniger Tage hatten die Schneiderinnen das Bestellte genäht, und jetzt war Cordelia zurückgekehrt, um die fertigen Kleider anzuprobieren.
Matthews Miene nach zu urteilen, hatte sie gut gewählt. Er hatte es sich in einem vergoldeten Sessel mit schwarz-weiß gestreiftem Polster bequem gemacht, und auf seinem Knie lag ein aufgeschlagenes Buch: der skandalös gewagte Roman Claudine in Paris. Als Cordelia aus der Umkleidekabine trat, um in dem dreiteiligen Spiegel den Sitz ihres Kleids zu begutachten, schaute Matthew auf, und seine grünen Augen verdunkelten sich.
»Du siehst wunderschön aus.«
Einen Moment lang war Cordelia versucht, die Augen zu schließen. Du siehst wunderschön aus, Daisy. Doch sie würde nicht an James denken. Nicht jetzt. Nicht, wenn Matthew so freundlich war und ihr das Geld für diese Kleider lieh. (Sie war mit nur einem Kleid aus London geflüchtet und brauchte dringend etwas Sauberes zum Anziehen.) Schließlich hatten sie einander ein Versprechen gegeben: Matthew würde nicht exzessiv trinken, solange sie in Paris waren, und Cordelia würde sich nicht mit düsteren Gedanken an ihre Misserfolge quälen: den Gedanken an Lucie, ihren Vater und ihre Ehe. Und seit ihrer Ankunft hatte Matthew keine Flasche und nicht einmal ein Weinglas angerührt.
Cordelia verdrängte ihre Melancholie, schenkte Matthew ein Lächeln und richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Spiegel. Sie hatte fast das Gefühl, als stünde sie einer Fremden gegenüber. Das Kleid war nach Maß geschneidert: das Oberteil verwegen tief ausgeschnitten, während sich der Rock um ihre Hüften schmiegte und nach unten weiter ausfiel, wie der Stängel und die Blütenblätter einer Lilie. Die gerüschten Ärmel waren kurz und ließen Cordelias Arme unverhüllt, sodass sich ihre Runenmale tiefschwarz von ihrer hellbraunen Haut abhoben – obwohl der Zauberglanz verhinderte, dass irgendein irdisches Auge die Male bemerkte.
Madame Beausoleil, deren Salon sich in der Rue de la Paix befand, wo sich die berühmtesten Modeschöpfer der Welt – wie das Modehaus Worth oder Jeanne Paquin – niedergelassen hatten, war laut Matthew bestens mit der Schattenwelt vertraut. »Hypatia Vex kauft nur hier ein«, hatte er Cordelia beim Frühstück erzählt. Madame Beausoleils eigene Vergangenheit war zutiefst geheimnisumwoben, was Cordelia äußerst französisch fand.
Unter dem Kleid befand sich nicht sehr viel. Allem Anschein nach war es in Frankreich Mode, dass Kleider die Konturen des Körpers betonten. In diesem Fall hatte man schmale Streben in den Stoff des Mieders eingearbeitet; eine Rosette aus Seidenblumen raffte das Dekolleté, und der Rock war unten ausgestellt und mit Rüschen aus goldener Spitze eingefasst. Der tiefe Rückenausschnitt des Kleids gab den Blick auf die Wölbung der Wirbelsäule frei. Das Ganze war ein echtes Kunstwerk, und das teilte Cordelia Madame Beausoleil auch mit (auf Englisch, von Matthew übersetzt), als diese mit dem Nadelkissen in der Hand herbeieilte, um das Ergebnis ihrer Arbeit in Augenschein zu nehmen.
Madame lachte leise. »Meine Aufgabe ist sehr einfach«, erklärte sie. »Ich muss lediglich die außergewöhnliche Attraktivität Ihrer Gattin unterstreichen.«
»Ah, sie ist nicht meine Gattin«, erwiderte Matthew mit funkelnden grünen Augen. Er liebte nichts mehr als einen vermeintlichen Skandal. Cordelia schnitt eine Grimasse in seine Richtung.
Allerdings musste man Madame zugutehalten, dass sie angesichts dieser Information nicht einmal blinzelte. Aber vielleicht lag es auch nur daran, dass sie in Frankreich waren. »Alors«, fuhr sie fort, »es kommt selten vor, dass ich eine so natürliche und ungewöhnliche Schönheit einkleiden darf. Zurzeit ist die Mode ausschließlich auf Blondinen und nochmals Blondinen ausgerichtet. Aber Blondinen können solche Farben nicht tragen: Blut und Feuer sind viel zu kräftig für fahle Haut und fahles Haar. Diesen Kundinnen stehen Spitze und Pastelltöne, doch Miss …?«
»Miss Carstairs«, sagte Cordelia.
»Miss Carstairs hat für ihren Teint und ihre Haarfarbe die perfekte Wahl getroffen. Wenn Sie einen Raum betreten, Mademoiselle, werden Sie die Kerzenflamme sein, die alle Blicke wie Motten anzieht.«
Miss Carstairs. Cordelia war nicht lange Mrs Cordelia Herondale gewesen. Sie wusste, dass sie nicht an dem Namen hängen sollte. Es schmerzte zwar, ihn zu verlieren, doch das war reines Selbstmitleid, ermahnte sie sich. Sie war eine Carstairs, eine Jahanshah. In ihren Adern floss das Blut Rostams. Sie konnte sich in Feuer kleiden, wenn sie es wollte.
»So ein Kleid verdient Schmuck«, sagte Madame nachdenklich. »Ein Collier aus Rubinen und Gold. Diese Kugel ist hübsch, aber viel zu klein.« Sie schnippte mit dem Finger gegen den kleinen goldenen Anhänger an Cordelias Hals. Eine winzige Erdkugel an einer goldenen Kette.
Der Schmuck war ein Geschenk von James. Cordelia wusste, dass sie die Halskette abnehmen sollte, doch sie war noch nicht dazu bereit. Irgendwie erschien ihr diese Geste endgültiger als das Durchtrennen ihrer Ehe-Rune.
»Ich würde ihr nur allzu gern Rubine kaufen, wenn sie mich ließe«, sagte Matthew. »Aber leider Gottes lehnt sie es ab.«
Madame zog eine erstaunte Miene. Wenn Cordelia Matthews Geliebte war, wie Madame eindeutig gefolgert hatte, welchen Grund hatte sie dann, geschenkten Halsschmuck auszuschlagen? Sie tätschelte Cordelias Schulter und bedauerte sie für ihren miserablen Geschäftssinn. »In der Rue de la Paix gibt es hervorragende Juweliere«, sagte sie. »Vielleicht werden Sie Ihre Meinung ändern, wenn Sie einen Blick in die Schaufenster geworfen haben.«
»Vielleicht«, sagte Cordelia und kämpfte gegen den Drang an, Matthew die Zunge herauszustrecken. »Im Moment muss ich mich allerdings auf meine Garderobe konzentrieren. Wie mein Bekannter bereits erklärt hat, ist mein Koffer auf der Reise verloren gegangen. Wäre es Ihnen möglich, die Kleider bis heute Abend ins Hôtel Le Meurice liefern zu lassen?«
»Aber gewiss doch.« Madame nickte, begab sich zum Ladentisch am anderen Ende des Raums und begann, mit einem Bleistift Zahlen auf einem Kaufbeleg zu notieren.
»Jetzt glaubt sie, dass ich deine Geliebte bin«, wandte Cordelia sich an Matthew, die Hände in die Hüften gestemmt.
Er zuckte die Schultern. »Wir sind in Paris. Geliebte gibt es hier noch häufiger als Croissants oder unnötig kleine Kaffeetassen.«
Cordelia schnaubte missbilligend und verschwand wieder in der Umkleidekabine. Sie versuchte, nicht daran zu denken, was die bestellten Kleider kosten würden. Das rote Samtkleid für kalte Abende und noch vier weitere: ein schwarz-weiß gestreiftes Ausgehkleid mit dazu passender Jacke, ein smaragdgrünes Kleid mit nilgrünen Satinpaspeln, ein gewagtes Abendkleid aus schwarzem Satin sowie ein mit goldenen Bändern besetztes, kaffeebraunes Seidenkleid. Anna wäre bestimmt zufrieden mit ihr. Allerdings würde Cordelia ihre gesamten Ersparnisse aufwenden müssen, um Matthew das Geld zurückzuzahlen. Er hatte angeboten, die Kosten zu übernehmen, mit der Begründung, dass es für ihn kein Problem wäre. Offenbar hatten seine Großeltern väterlicherseits Henry eine Menge Geld hinterlassen. Doch Cordelia konnte es sich nicht gestatten, das Angebot anzunehmen. Sie hatte schon genug von Matthew angenommen.
Nachdem sie wieder in ihr altes Kleid geschlüpft war, kehrte sie zu Matthew in den Salon zurück. Er hatte bereits bezahlt, und Madame hatte die Lieferung der Kleider am selben Abend zugesagt. Eines der Mannequins zwinkerte Matthew zu, als er Cordelia aus dem Laden auf die Straßen von Paris hinausgeleitete, wo es von Menschen nur so wimmelte.
Es war ein klarer Tag mit blauem Himmel. Im Gegensatz zu London hatte es den Winter über in Paris nicht geschneit, und draußen war es kühl, aber hell. Cordelia stimmte erfreut Matthews Vorschlag zu, den Weg zum Hotel zu Fuß zurückzulegen, anstatt einen Fiacre – das Pariser Gegenstück zu einer Hansom-Droschke – heranzuwinken. Matthew, der sein Buch in der Manteltasche verstaut hatte, sprach noch immer über Cordelias neues rotes Kleid.
»Du wirst in den Varietés einfach alle überstrahlen.« Matthew war eindeutig der Meinung, dass er einen Sieg errungen hatte. »Niemand wird die Tänzerinnen auch nur eines Blickes würdigen. Na ja, der Gerechtigkeit halber muss erwähnt werden, dass die Tänzerinnen leuchtend rot angemalt sein werden und Teufelshörner tragen. Damit werden sie möglicherweise doch ein wenig Aufmerksamkeit auf sich ziehen.«
Er schenkte Cordelia ein Lächeln – dasLächeln, das die Herzen der unnachgiebigsten Griesgrame erweichte und starke Männer und Frauen zum Weinen brachte. Nicht einmal Cordelia war dagegen immun. Sie erwiderte sein Lächeln.
»Siehst du?«, fragte Matthew und deutete mit einer ausladenden Handbewegung auf alles, was vor ihnen lag: der breite Pariser Boulevard, die bunten Markisen der Geschäfte, die Cafés, in denen Frauen mit prachtvollen Hüten und Männer in ausgefallenen, längs gestreiften Hosen Tassen voll dickflüssiger, heißer Schokolade tranken, um sich aufzuwärmen. »Ich habe dir ja versprochen, dass du dich gut amüsieren wirst.«
Cordelia fragte sich, ob sie sich bisher amüsiert hatte. Vielleicht. Bis jetzt war es ihr jedenfalls weitestgehend gelungen, nicht daran zu denken, dass sie jeden Menschen, der ihr etwas bedeutete, auf schreckliche Weise enttäuscht hatte. Und das war schließlich der eigentliche Zweck der Reise. Wenn man erst einmal alles verloren hatte, sagte sie sich, gab es keinen Grund, nicht alle glücklichen Momente zu genießen, die sich einem boten, so klein sie auch sein mochten. Das war schließlich Matthews Philosophie, oder nicht? War sie nicht deshalb mit ihm hierhergekommen?
Eine Frau, die in einem nahe gelegenen Café saß und einen mit Straußenfedern und Seidenrosen überfrachteten Hut auf dem Kopf trug, blickte von Matthew zu Cordelia und lächelte – wohlwollend angesichts ihrer jungen Liebe, vermutete Cordelia. Noch vor wenigen Monaten wäre sie in einer solchen Situation errötet. Jetzt lächelte sie nur. Welche Rolle spielte es, wenn die Leute das Falsche über sie dachten? Jedes Mädchen würde sich glücklich schätzen, Matthew als Verehrer zu haben. Sollten Passanten sich doch ausmalen, was immer sie wollten. So ging Matthew schließlich mit allen Situationen um. Er kümmerte sich nicht im Geringsten darum, was andere dachten, und war einfach nur er selbst. Und dank dieser Haltung konnte er bemerkenswert unbekümmert durchs Leben gehen.
Cordelia bezweifelte, dass sie in ihrem Zustand ohne Matthew der Reise nach Paris überhaupt gewachsen gewesen wäre. Er hatte sie beide, hochgradig unausgeschlafen und gähnend, vom Bahnhof zum Le Meurice gebracht – und dort heiter und strahlend lächelnd mit dem Hotelpagen gescherzt. Und man hätte meinen können, dass er die ganze Nacht in einem Federbett gelegen hatte.
In der ersten Nacht hatten sie bis in den Nachmittag hinein geschlafen (in den beiden getrennten Schlafzimmern von Matthews Suite, die über ein gemeinsames Wohnzimmer verfügte). Cordelia hatte geträumt, dass sie dem Angestellten an der Rezeption des Le Meurice ihr Herz ausgeschüttet und ihm sämtliche Sünden gebeichtet hatte. Wissen Sie, meine Mutter bekommt bald ein Baby, und ich werde vermutlich nicht bei der Geburt dabei sein, weil ich stattdessen lieber mit dem besten Freund meines Mannes herumreise und mich amüsiere. Früher war ich die Trägerin des mythischen Schwerts Cortana. Sie kennen es vielleicht ausdem Rolandslied. Nun, ich habe mich als unwürdig erwiesen, dieses Schwert zu tragen, und habe es meinem Bruder gegeben. Ach ja, dadurch ist er wahrscheinlich einer tödlichen Bedrohung ausgesetzt – nicht nur durch einen, sondern gleich zwei sehr mächtige Dämonen. Außerdem sollte ich die Parabatai meiner besten Freundin werden, aber jetzt wird es nicht dazu kommen. Und ich habe mir erlaubt zu glauben, dass der Mann, den ich liebe, mich vielleicht auch liebt und nicht Grace Blackthorn. Obwohl er, was seine Liebe zu ihr angeht, immer offen und ehrlich war.
Dann hatte Cordelia den Kopf gehoben und gesehen, dass der Angestellte Liliths Gesichtszüge hatte und dass sich schwarze Schlangen in seinen Augenhöhlen wanden.
Also meines Erachtens hast du alles richtig gemacht, Schätzchen, hatte Lilith gesagt, und Cordelia war mit einem Schrei aufgewacht, der noch mehrere Minuten danach in ihrem Kopf widerhallte.
Als sie später vom Geräusch der Vorhänge geweckt wurde, die ein Dienstmädchen zurückzog, hatte sie voller Verwunderung auf den hellen Tag vor dem Fenster geblickt und auf die Dächer von Paris, die wie gehorsame Soldaten in Richtung Horizont marschierten. In der Ferne erhob sich der Eiffelturm trotzig vor einem sturmblauen Himmel. Und ein Zimmer weiter wartete Matthew darauf, dass Cordelia mit ihm zu einem aufregenden Abenteuer aufbrach.
In den darauffolgenden beiden Tagen hatten sie zusammen gegessen – einmal im wunderschönen Restaurant Le Train Bleu im Gare de Lyon, dessen Schönheit Cordelia in Erstaunen versetzt hatte: als würde sie im Inneren eines geschliffenen Saphirs speisen. Außerdem waren sie zusammen in Parks flaniert und hatten gemeinsam eingekauft – Hemden und Anzüge für Matthew bei Charvet, wo auch Baudelaire und Verlaine Kunden gewesen waren, sowie Kleider, Schuhe und einen Mantel für Cordelia. Dass Matthew ihr Hüte kaufte, hatte sie dagegen nicht zugelassen. Gewisse Grenzen musste es schließlich geben, hatte sie ihm gesagt. Matthew hatte daraufhin vorgeschlagen, die Grenze bei Regenschirmen zu ziehen, die für ein mustergültiges Erscheinungsbild unerlässlich waren und sich zugleich als Waffe nützlich erweisen konnten. Cordelia hatte gekichert und dabei festgestellt, wie schön es war zu lachen.
Doch die größte Überraschung bestand wahrscheinlich darin, dass Matthew sein Versprechen mehr als gehalten hatte: Er trank keinen Tropfen Alkohol und ließ sich sogar durch die missbilligenden Mienen der Kellner nicht erweichen, wenn er bei den gemeinsamen Mahlzeiten keinen Wein bestellte. Ausgehend von ihren Erfahrungen mit dem Alkoholismus ihres Vaters hatte Cordelia erwartet, dass es Matthew ohne das Trinken schlecht gehen würde. Aber das Gegenteil war der Fall. Matthews Blick wirkte klar, und er schien voller Energie, während er sie durch die gesamte Innenstadt von Paris zu Sehenswürdigkeiten, Museen, Denkmälern und Parks schleppte. Das Ganze fühlte sich sehr erwachsen und weltgewandt an, was vermutlich auch der Zweck der Übung war.
Jetzt sah Cordelia Matthew an und dachte: Er sieht glücklich aus. Wirklich glücklich. Und selbst wenn diese Reise nach Paris vermutlich nicht ihre Rettung war, so konnte sie zumindest dafür sorgen, dass sie ihm Freude bereitete.
Matthew nahm ihren Arm und half ihr über ein Stück schadhaften Gehweg hinweg. Cordelia musste an die Frau im Café denken, daran, wie sie bei ihrem Anblick gelächelt und sie für ein verliebtes Paar gehalten hatte. Wenn sie nur wüsste, dass Matthew nicht ein einziges Mal versucht hatte, Cordelia zu küssen. Er war stets der Inbegriff eines Gentlemans gewesen. Ein- oder zweimal, als sie sich in der Hotelsuite eine gute Nacht gewünscht hatten, hatte Cordelia geglaubt, ein Blitzen in seinen Augen zu sehen. Aber vielleicht hatte sie es sich auch nur eingebildet? Sie war nicht ganz sicher, was sie erwartet hatte, und auch nicht, wie ihre Gefühle in Bezug auf … nun ja, auf irgendetwas aussahen.
»Ich amüsiere mich gut«, bestätigte sie jetzt und meinte es auch so. Sie wusste, dass sie hier glücklicher war, als sie es in London gewesen wäre, wo sie sich ins Haus ihrer Familie in Cornwall Gardens zurückgezogen hätte. Alastair hätte versucht, nett zu sein, während ihre Mutter schockiert und verzweifelt gewesen wäre. Cordelia hätte versucht, all dem standzuhalten, und schließlich angesichts der Bürde den Wunsch verspürt zu sterben.
So war es besser. Mithilfe des Telegrafendiensts im Hotel hatte sie eine kurze Nachricht an ihre Familie geschickt und sie wissen lassen, dass sie in Paris ihre Frühjahrsgarderobe einkaufen würde, mit Matthew als Begleiter. Ihre Mutter und Alastair würden es vermutlich seltsam finden, aber zumindest nicht besorgniserregend – das hoffte sie wenigstens.
»Ich bin nur neugierig«, fügte sie hinzu, während sie sich dem Hotel näherten, das mit seiner massiven Fassade vor ihnen auftauchte, mit den schmiedeeisernen Balkonen und den hell erleuchteten Fenstern, die ihr Licht über die winterlichen Straßen warfen. »Du hast erwähnt, dass ich in einem Varieté alle überstrahlen würde? In welchem Varieté? Und wann gehen wir hin?«
»Heute Abend, um genau zu sein«, antwortete Matthew und hielt ihr die Tür auf. »Wir werden gemeinsam ins Herz der Hölle reisen. Beunruhigt dich das?«
»Ganz und gar nicht. Ich bin nur froh, dass ich mich für ein rotes Kleid entschieden habe. Es passt zum Thema.«
Matthew lachte, aber Cordelia fragte sich unwillkürlich, was um Himmels willen er damit eigentlich meinte – gemeinsam ins Herz der Hölle reisen.
Sie fanden Lucie auch am nächsten Tag nicht.
Der Schnee war nicht liegen geblieben, sodass zumindest die Straßen frei waren. Balios und Xanthos trotteten zwischen kahlen Hecken dahin, und ihr Atem stieg in der kalten Luft wie weiße Wolken auf. Zur Mittagszeit erreichten sie Lostwithiel, ein kleines Dorf im Landesinneren, und Magnus ging in einen Pub namens Wolf’s Bane, um Erkundigungen einzuziehen. Als er wieder herauskam, schüttelte er den Kopf. Trotzdem machten sie sich auf den Weg zu der Adresse, die man ihm zuvor genannt hatte. Doch wie sich herausstellte, handelte es sich um ein leer stehendes Bauernhaus, dessen altes Dach bereits in sich zusammenfiel.
»Es gibt noch eine andere Möglichkeit«, sagte Magnus und kletterte wieder in die Kutsche. Feine Schneeflocken, die wahrscheinlich von den Überresten des Dachs herunterwirbelten, verfingen sich in seinen schwarzen Augenbrauen. »Irgendwann im letzten Jahrhundert hat ein mysteriöser Gentleman aus London eine alte verfallene Kapelle am Peak Rock gekauft, in einem Fischerdorf namens Polperro. Er hat das Gebäude restauriert, verlässt es allerdings nur selten. Unter den lokalen Schattenweltlern kursiert das Gerücht, dass er ein Hexenmeister ist. Offenbar entweichen nachts hin und wieder violette Flammen aus dem Schornstein.«
»Ich dachte, dass hier ein Hexenmeister wohnen soll«, sagte Will und zeigte auf das ausgebrannte Bauernhaus.
»Nicht alle Gerüchte sind wahr, Herondale, aber es gilt, allen auf den Grund zu gehen«, erwiderte Magnus gelassen. »Wir müssten in der Lage sein, Polperro in wenigen Stunden zu erreichen.«
James seufzte innerlich. Weitere Stunden. Weiteres Warten. Weiteres Kopfzerbrechen … über Lucie, über Matthew und über Daisy. Über seinen Traum.
Sie erwachen.
»Ich werde euch mit einer Geschichte die Zeit vertreiben«, erklärte Will. »Sie handelt von meinem Höllenritt auf Balios von London nach Cadair Idris, in Wales. Deine Mutter, James, war verschwunden … Der Schurke Mortmain hatte sie entführt. Also warf ich mich in Balios’ Sattel und rief: ›Wenn du mich je geliebt hast, Balios, dann lass deine Hufe jetzt schneller laufen als je zuvor, damit sie mich zu meiner geliebten Tessa tragen, bevor ihr ein Leid geschieht.‹ Die Nacht war stürmisch, doch der Sturm, der in meiner Brust tobte, war noch viel wilder …«
»Ich kann kaum glauben, dass du diese Geschichte noch nie gehört hast, James«, sagte Magnus milde. Er und James teilten sich eine Seite der Kutsche, denn am ersten Tag ihrer Reise war schnell klar geworden, dass Will die gesamte andere Sitzbank für seine ausschweifenden Handbewegungen benötigte.
Die Vorstellung, dass James sein ganzes Leben lang Geschichten über Magnus gehört hatte und jetzt Seite an Seite mit ihm reiste, erschien ihm irgendwie seltsam. Allerdings hatte er während ihrer gemeinsamen Reise herausgefunden, dass Magnus trotz seiner extravaganten Kleidung und seines theatralischen Gebarens, das bereits mehrere Gastwirte beunruhigt hatte, überraschend ruhig und pragmatisch war.
»Nein, habe ich nicht«, antwortete James. »Jedenfalls nicht seit letztem Donnerstag.«
Er verschwieg jedoch, dass er es eigentlich als recht tröstlich empfand, die Geschichte noch einmal zu hören. Sie war ihm und Lucie oft erzählt worden, und insbesondere Lucie hatte sie als Kind geliebt: Will, der der Stimme seines Herzens folgte und überstürzt aufbrach, um ihre Mutter zu retten, von der er damals noch nicht wusste, dass sie ihn ebenfalls liebte.
James lehnte den Kopf an das Kutschenfenster. Die Landschaft draußen war spektakulär: Zu ihrer Linken fielen Klippen steil ab, an deren Fuß eine rauschende Brandung tobte. Metallisch graue Wellen schlugen krachend gegen die Felsen, die ihre wulstigen Finger weit in den graublauen Ozean hinausstreckten. In der Ferne sah James eine Kirche, die sich auf einer Landzunge gegen den Himmel abhob. Ihr grauer Turm wirkte irgendwie schrecklich einsam, schrecklich weit von allem entfernt.
Die Stimme seines Vaters drang wie ein Lied an seine Ohren, die Worte so vertraut wie ein Schlaflied. James musste unweigerlich an Cordelia denken, als sie ihm aus Ganjavis Gedichten vorgelesen hatte. An ihr Lieblingsgedicht über die unglückliche Liebe von Layla und Madschnun. An ihre Stimme, so weich wie Samt. Und als der Mond ihre Wange zum Vorschein brachte, gewann sie tausend Herzen: Kein Stolz, kein Schild konnte ihre Macht noch hemmen. Layla war ihr Name.
Cordelia lächelte ihn über den Tisch im Arbeitszimmer hinweg an. Das Schachspiel war vorbereitet, und sie hielt einen Springer aus Elfenbein in ihrer zierlichen Hand. Der Schein der Flammen brachte ihr Haar zum Leuchten – ein Heiligenschein aus Feuer und Gold. »Schach ist ein persisches Spiel«, sagte sie. »Bia ba man bazi kon. Spiel mit mir, James.«
»Kheili khoshgeli«, sagte er. Die Worte kamen ihm leicht über die Lippen: der erste Satz, den er sich auf Persisch beigebracht hatte. Obwohl er ihn bisher noch nie gegenüber seiner Frau geäußert hatte. Du bist wunderschön.
Sie errötete. Ihre vollen, roten Lippen bebten. Ihre Augen waren so dunkel und schimmerten … wie schwarze Schlangen, die zuckten, hervorschnellten und mit ihren Zähnen nach ihm schnappten …
»James! Wach auf!« Magnus’ Hand lag auf seiner Schulter und schüttelte ihn. James erwachte, würgte trocken und presste eine Faust auf seinen Magen. Er war in der Kutsche. Allerdings wirkte der Himmel jetzt dunkler. Wie viel Zeit war vergangen? Er hatte wieder geträumt. Dieses Mal war Cordelia in seine Albträume hineingezogen worden. Ihm wurde übel, und er lehnte sich gegen den gepolsterten Sitz. Dann warf er seinem Vater einen Blick zu.
Will musterte ihn mit strenger Miene, was selten vorkam. Seine Augen leuchteten dunkelblau. »James, du musst uns erzählen, was los ist.«
»Nichts.« James hatte einen bitteren Geschmack im Mund. »Ich bin eingeschlafen … ein weiterer Traum … Ich habe dir doch gesagt, dass ich mir Sorgen um Lucie mache.«
»Du hast nach Cordelia gerufen«, entgegnete Will. »Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so schmerzerfüllt geklungen hat. Jamie, du musst mit uns reden.«
Magnus schaute von James zu Will und wieder zurück. Seine Hand lag auf James’ Schulter, schwer vom Gewicht der Ringe. »Du hast auch einen anderen Namen gerufen. Und ein Wort. Eines, das mich ziemlich beunruhigt hat«, berichtete er.
Nein, dachte James. Nein. Vor dem Fenster ging die Sonne unter; die zwischen den Hügeln versteckten Bauernhöfe leuchteten dunkelrot. »Ich bin mir sicher, dass es nur Unsinn war.«
Magnus sah James ruhig an. »Du hast den Namen Lilith gerufen. In der Schattenwelt wird viel über die jüngsten Ereignisse in London geredet. Aber die Geschichte, die mir erzählt wurde, hat mich nie ganz überzeugt. Außerdem kursieren Gerüchte über die Mutter aller Dämonen. James, du brauchst uns nicht alles zu berichten, was du weißt. Aber wir werden es trotzdem herausfinden.« Er warf Will einen Blick zu. »Also, ich zumindest. Was deinen Vater angeht, kann ich nichts versprechen. Er war schon immer etwas schwer von Begriff.«
»Dafür habe ich noch nie eine russische Pelzmütze mit Ohrenklappen getragen – im Gegensatz zu gewissen anderen Anwesenden«, konterte Will.
»Alle betroffenen Seiten haben Fehler gemacht«, entgegnete Magnus. »James?«
»Ich besitze keine Ohrenklappenmütze«, sagte James.
Die beiden Männer starrten ihn an.
»Ich kann jetzt nicht alles erzählen«, hob James an und spürte, wie sein Herz einen Schlag aussetzte: Zum ersten Mal hatte er zugegeben, dass es etwas zu erzählen gab. »Nicht, wenn wir Lucie finden wollen …«
Magnus schüttelte den Kopf. »Es ist schon dunkel, und es regnet. Der Weg vom Chapel Cliff hinauf zum Peak Rock soll gefährlich sein. Es ist sicherer, wenn wir erst übernachten und uns morgen früh wieder auf den Weg machen.«
Will nickte. Es war klar, dass er und Magnus den Plan bereits gefasst hatten, während James schlief.
»Also gut«, sagte Magnus. »Beim nächsten anständigen Gasthof kehren wir ein. Ich werde für uns einen Privatsalon reservieren, wo wir uns ungestört unterhalten können. Und James … Was auch immer das Problem ist, es lässt sich lösen.«
James hatte seine Zweifel, aber es erschien ihm zwecklos, das zu sagen. Stattdessen beobachtete er durch das Fenster, wie die Sonne verschwand, und schob eine Hand in die Tasche. Cordelias Handschuhe, das Paar, das er aus ihrem gemeinsamen Haus mitgenommen hatte, waren noch da. Das Ziegenleder war so weich wie ein Blütenblatt. Rasch schloss er seine Hand fest um einen der Handschuhe.
In einem kleinen, weißen Zimmer unweit des Ozeans erwachte Lucie Herondale in unregelmäßigen Abständen, um kurz darauf wieder wegzudämmern.
Als sie zum ersten Mal aufgewacht war, hier in dem fremden Bett, das nach altem Stroh roch, hatte sie eine Stimme gehört – Jesses Stimme. Sie hatte versucht zu rufen, um ihn wissen zu lassen, dass sie bei Bewusstsein war. Aber noch bevor sie etwas sagen konnte, war die Erschöpfung wie eine kalte, graue Woge über sie hinweggefegt. Eine Erschöpfung, wie sie sie noch nie zuvor empfunden oder sich auch nur vorgestellt hatte. So tief wie eine Stichwunde. Langsam, unaufhaltsam hatte sie die Besinnung verloren, und sie war in die Dunkelheit ihres eigenen Bewusstseins gestürzt, wo die Zeit schwankte und schlingerte wie ein Schiff im Sturm und sie kaum sagen konnte, ob sie wach war oder schlief.
In den Momenten der Klarheit hatte sie nur wenige Details zusammenfügen können. Der Raum war klein und im Farbton von Eierschalen gestrichen. Es gab nur ein Fenster, durch das sie den Ozean sehen konnte, dessen Wellen heranrollten und sich wieder zurückzogen – ein dunkles, metallisches Grau mit weißen Spitzen. Sie glaubte, das Meer auch hören zu können. Doch da sich sein entferntes Tosen oft mit wesentlich unangenehmeren Geräuschen vermischte, vermochte sie nicht zu sagen, was an ihrer Wahrnehmung echt war.
Von Zeit zu Zeit kamen zwei Personen ins Zimmer, um nach ihr zu sehen. Einer war Jesse, der andere Malcolm, der sich eher zurückhielt. Irgendwie wusste sie, dass sie sich in Malcolms Haus in Cornwall befanden und dass der Atlantik draußen gegen die Felsen donnerte.
Bisher war sie nicht in der Lage gewesen, mit einem der beiden zu sprechen. Wenn sie es versuchte, hatte sie das Gefühl, als könnte ihr Verstand die Worte zwar formen, aber ihr Körper würde nicht auf seine Befehle reagieren. Sie konnte nicht einmal mit einem Finger zucken, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie wach war. Sämtliche Bemühungen schickten sie immer nur zurück in die Dunkelheit.
Bei der Dunkelheit handelte es sich allerdings nicht nur um das Innere ihres Bewusstseins. Zuerst hatte sie es dafür gehalten – die vertraute Dunkelheit, die vor dem Einschlafen kam und die lebendigen Farben der Träume mitbrachte. Diese Dunkelheit war jedoch ein Ort.
Und an diesem Ort war Lucie nicht allein. Obwohl sie ziellos durch eine endlose Ödnis zu treiben schien, konnte sie die Anwesenheit anderer spüren, die nicht lebendig, aber auch nicht tot waren. Ihre Seelen wirbelten körperlos durch das Nichts, ohne je auf Lucie oder aufeinanderzutreffen. Sie waren unglücklich, diese Seelen. Sie verstanden nicht, was mit ihnen geschah. Sie heulten unaufhörlich, wortlose Schreie des Schmerzes und der Verzweiflung, die Lucie unter die Haut gingen.
Jetzt spürte sie, wie etwas ihre Wange streifte. Die Berührung brachte sie zurück zu ihrem Körper. Sie war wieder in dem weißen Zimmer. Die Berührung an ihrer Wange stammte von Jesses Hand. Sie wusste es instinktiv, obwohl sie nicht in der Lage war, die Augen zu öffnen oder sich zu bewegen, um darauf zu reagieren.
»Sie weint«, sagte er.
Seine Stimme. Sie besaß jetzt eine Tiefe, eine Festigkeit, die sie nicht gehabt hatte, als er ein Geist gewesen war.
»Vielleicht hat sie einen Albtraum.« Malcolms Stimme. »Jesse, es geht ihr gut. Als sie dich von den Toten zurückgeholt hat, hat sie einen großen Teil ihrer Energie verbraucht. Sie muss sich ausruhen.«
»Aber verstehst du denn nicht … Sie ist in diesem Zustand, weil sie mich wiedererweckt hat.« Jesses Stimme stockte. »Wenn sie sich nicht wieder erholt … Ich könnte es mir nie verzeihen.«
»Diese Gabe, die sie besitzt – ihre Fähigkeit, durch den Schleier hindurchzugreifen, der die Lebenden und die Toten trennt –, hat sie schon ihr ganzes Leben lang. Dich trifft keine Schuld. Wenn jemand Schuld hat, dann Belial.« Malcolm seufzte. »Wir wissen so wenig über die Schattenreiche, die jenseits des Endes aller Dinge liegen. Und sie hat sich ziemlich weit hineinbegeben, um dich wieder herauszuziehen. Sie braucht Zeit, um zurückzukehren.«
»Aber was ist, wenn sie an irgendeinem schrecklichen Ort gefangen ist?« Lucie spürte die leichte Berührung erneut: Jesses Hand an ihrer Wange. Sie wünschte sich so sehr, ihr Gesicht in seine Handfläche zu pressen, dass es schmerzte. »Was ist, wenn ich sie irgendwie herausziehen muss?«
Malcolm räusperte sich und fuhr dann mit sanfterer Stimme fort: »Es sind gerade einmal zwei Tage vergangen. Wenn sie bis morgen nicht aufwacht, kann ich versuchen, sie mithilfe von Magie zu erreichen. Ich werde mich damit befassen – wenn du bis dahin aufhörst, an ihrem Bett zu stehen und dir Sorgen zu machen. Wenn du wirklich etwas Nützliches tun willst, dann kannst du ins Dorf gehen und ein paar Dinge besorgen, die wir brauchen …«
Seine Stimme schwand und verstummte schließlich vollends. Lucie war wieder an dem dunklen Ort. Aber sie nahm Jesses Anwesenheit wahr – seine Stimme klang wie ein fernes Flüstern. »Lucie, falls du mich hören kannst … Ich bin hier. Ich passe auf dich auf.«
Ich bin hier, versuchte sie zu erwidern. Ich kann dich hören. Aber wie schon zuvor wurden ihre Worte von den Schatten geschluckt, und sie fiel zurück ins Nichts.
»Wer ist ein hübscher Vogel?«, fragte Ariadne Bridgestock.
Winston, der Papagei, blickte sie aus zusammengekniffenen Augen an. Er äußerte sich nicht dazu, wer ein hübscher Vogel sein könnte oder nicht. Ariadne war sicher, dass sein Hauptinteresse den Paranüssen in ihrer Hand galt.
»Ich dachte, wir könnten uns unterhalten«, sagte sie und lockte ihn mit einer Nuss. »Papageien sollen doch sprechen. Warum fragst du nicht, wie mein Tag bisher war?«
Winston musterte sie finster. Ihre Eltern hatten ihn ihr geschenkt, vor langer Zeit, als sie neu in London gewesen war und sich nach etwas Buntem gesehnt hatte, einem Kontrast zum tristen Grau der Stadt. Winston hatte einen grünen Rumpf, einen pflaumenblauen Kopf und den Charakter eines Halunken.
Mit nur einem Blick machte er ihr klar, dass hier keine Unterhaltung stattfinden würde, bevor sie ihm nicht eine Paranuss gegeben hatte. Überlistet von einem Papagei, dachte Ariadne und reichte ihm den Leckerbissen durch die Gitterstäbe. Matthew Fairchilds Haustier war ein wunderschöner Hund mit goldenem Fell; sie dagegen war mit dem launischen Lord Byron der Vögel gestraft.
Winston schluckte die Nuss, streckte eine Kralle aus und schlang sie um einen der Gitterstäbe seines Käfigs. »Hübscher Vogel«, schnarrte er. »Hübscher Vogel.«
Besser als nichts, dachte Ariadne. »Mein Tag war scheußlich, danke der Nachfrage«, sagte sie und fütterte Winston mit einer weiteren Nuss. »Das Haus ist so leer und einsam. Mutter geistert nur niedergeschlagen herum und macht sich Sorgen um Vater. Er ist jetzt seit ganzen fünf Tagen weg. Und … ich hätte nie gedacht, dass mir Grace fehlen würde, aber wenigstens hätte ich mit ihr etwas Gesellschaft.«
Anna erwähnte sie dagegen nicht. Gewisse Dinge gingen Winston nichts an.
»Grace«, krächzte er und klopfte vielsagend an die Gitterstäbe seines Käfigs. »Stadt der Stille.«
»In der Tat«, murmelte Ariadne. Da ihr Vater und Grace in derselben Nacht aufgebrochen waren, musste es eine Verbindung zwischen den Ereignissen geben. Allerdings wusste Ariadne nicht, worin sie genau bestand. Ihr Vater hatte sich Hals über Kopf auf den Weg zur Adamant-Zitadelle gemacht, um Tatiana Blackthorn zu verhören. Am darauf folgenden Morgen hatten Ariadne und ihre Mutter festgestellt, dass Grace ebenfalls fort war. Sie musste bei Nacht und Nebel ihre wenigen Sachen gepackt und sich davongemacht haben. Erst zur Mittagszeit hatte ein Bote eine Nachricht von Charlotte überbracht, in der sie ihnen mitteilte, dass sich Grace in der Obhut der Brüder der Stille befand und mit ihnen über die Verbrechen ihrer Mutter sprach.
Diese Neuigkeiten hatten Ariadnes Mutter in höchste Aufregung versetzt. »Ach du meine Güte, wir haben unwissentlich einer Kriminellen unter unserem Dach Schutz gewährt!« Ariadne hatte mit den Augen gerollt und darauf hingewiesen, dass Grace die Brüder der Stille freiwillig aufgesucht hatte und nicht von ihnen abgeführt worden war. Und darauf, dass Tatiana Blackthorn die Kriminelle war. Tatiana hatte bereits jede Menge Ärger und Kummer verursacht. Und wenn Grace den Stillen Brüdern weitere Informationen über Tatianas illegale Machenschaften zukommen lassen wollte, dann tat sie damit nur ihre Bürgerpflicht.
Ariadne wusste, dass es lächerlich war, Grace zu vermissen. Sie hatten selten miteinander gesprochen. Aber das Gefühl der Einsamkeit war so stark, dass in Ariadnes Augen die bloße Anwesenheit einer weiteren Person eine Linderung bedeuten würde. Natürlich gab es Leute, mit denen sie sehr gern gesprochen hätte, doch sie bemühte sich nach Kräften, nicht an diese Leute zu denken. Sie waren nicht ihre Freunde, nicht wirklich. Sie gehörten zu Annas Freundeskreis. Und Anna …
Ariadnes Grübelei wurde durch das schrille Läuten der Türklingel unterbrochen. Sie sah, dass Winston eingeschlafen war und kopfüber im Käfig hing. Hastig ließ sie die restlichen Nüsse in seinen Futternapf fallen und eilte in der Hoffnung auf Neuigkeiten aus dem Wintergarten in den vorderen Bereich des Hauses.
Doch ihre Mutter hatte die Haustür bereits erreicht. Als sie ihre Stimme hörte, blieb Ariadne vor der obersten Treppenstufe stehen. »Guten Tag, Konsulin Fairchild. Und Mr Lightwood. Wie freundlich von Ihnen vorbeizukommen.« Flora Bridgestock hielt inne. »Haben Sie … habt ihr etwa … Neuigkeiten von Maurice?«
Ariadne konnte die Angst in der Stimme ihrer Mutter hören und verharrte wie angenagelt. Wenigstens stand sie hinter der Biegung der Treppe, außer Sichtweite der Haustür. Wenn Charlotte Fairchild Neuigkeiten hatte – schlechte Neuigkeiten –, dann wäre sie eher bereit, ihrer Mutter davon zu erzählen, wenn Ariadne nicht anwesend war.
Deshalb hielt sich Ariadne am Treppenpfosten fest und wartete, bis sie Gideon Lightwoods sanfte Stimme hörte. »Nein, Flora. Seit seiner Abreise nach Island haben wir nichts von ihm vernommen. Wir hatten vielmehr gehofft, dass … nun ja, dass du etwas gehört hättest.«
»Nein«, erwiderte ihre Mutter. Ihre Stimme klang weit entfernt, distanziert. Ariadne wusste, dass sie Mühe hatte, ihre Angst nicht zu zeigen. »Ich bin davon ausgegangen, dass er sich, falls er sich überhaupt bei jemandem meldet, mit dem Büro der Konsulin in Verbindung setzen würde.«
Betretenes Schweigen folgte. Ariadne fühlte sich schwindlig und vermutete, dass sich Gideon und Charlotte gerade wünschten, sie hätten auf diesen Besuch verzichtet.
»Keine Nachricht aus der Zitadelle?«, fragte ihre Mutter schließlich. »Von den Eisernen Schwestern?«
»Nein«, räumte die Konsulin ein. »Allerdings sind sie generell nicht sehr mitteilsam, gelinde ausgedrückt. Wahrscheinlich ist es ein ziemlich schwieriges Unterfangen, Tatiana zu verhören. Möglicherweise denken die Schwestern schlichtweg, dass es noch keine Neuigkeiten gibt.«
»Aber ihr habt ihnen doch mehrere Nachrichten geschickt, auf die sie nicht geantwortet haben«, sagte Flora. »Vielleicht … Was ist mit dem Institut in Reykjavík?« Ariadne glaubte zu hören, wie ein Anflug von Furcht durch den Panzer aus Höflichkeit drang. »Ich weiß, dass wir ihn nicht mithilfe von Runen orten können, da Wasser zwischen uns liegt, aber die dortigen Schattenjäger könnten es versuchen. Ich könnte euch etwas von Maurice geben, um es dorthin zu schicken. Ein Taschentuch, oder …«
»Flora.« Die Konsulin sprach in ihrem gütigsten Tonfall. Ariadne vermutete, dass sie inzwischen ihrer Mutter sanft die Hand hielt. »Diese Mission unterliegt strengster Geheimhaltung. Maurice wäre der Letzte, der wollte, dass wir die gesamte Schattenjägergemeinschaft in Aufregung versetzen. Wir werden eine weitere Nachricht zur Zitadelle schicken, und wenn wir wieder nichts hören, werden wir eigene Nachforschungen einleiten. Das verspreche ich.«
Ariadnes Mutter murmelte ein paar zustimmende Worte, doch Ariadne war beunruhigt. Die Konsulin und ihr engster Berater kamen nicht persönlich vorbei, nur weil sie auf Neuigkeiten warteten. Irgendetwas bereitete ihnen Sorgen – etwas, das sie Flora gegenüber nicht erwähnt hatten.
Nachdem Charlotte und Gideon weitere beruhigende Zusicherungen gemacht hatten, verabschiedeten sie sich. Als Ariadne hörte, dass die Tür ins Schloss fiel, stieg sie die Treppe hinunter. Ihre Mutter, die reglos im Eingangsbereich gestanden hatte, zuckte zusammen, als sie sie sah. Ariadne tat ihr Bestes, um den Eindruck zu erwecken, als wäre sie gerade erst heruntergekommen.
»Ich habe Stimmen gehört«, sagte sie. »War das die Konsulin, die gerade gegangen ist?«
Ihre Mutter nickte abwesend, in Gedanken versunken. »Und Gideon Lightwood. Sie wollten wissen, ob wir eine Nachricht von deinem Vater erhalten haben. Dabei hatte ich gehofft, sie wären hergekommen, um mir mitzuteilen, dass sie etwas von ihm gehört haben.«
»Bestimmt wird alles gut, Mama.« Ariadne nahm die Hände ihrer Mutter. »Du weißt doch, wie Vater ist. Er wird vorsichtig sein und sich genug Zeit nehmen, um so viel wie möglich herauszufinden.«
»Ja, ich weiß. Aber … es war seine Idee, Tatiana überhaupt in die Adamant-Zitadelle zu schicken. Wenn etwas schiefgegangen ist …«
»Es war ein Gnadenerweis«, sagte Ariadne nachdrücklich. »Ein Akt der Barmherzigkeit, sie nicht in der Stadt der Stille einzusperren, wo sie bestimmt noch wahnsinniger geworden wäre als ohnehin schon.«
»Aber damals wussten wir nicht, was wir heute wissen«, erwiderte ihre Mutter. »Wenn Tatiana Blackthorn etwas mit Leviathans Angriff auf das Institut zu tun hatte … dann wäre das nicht die Tat einer Wahnsinnigen, die Mitleid verdient. Sondern eine Kriegserklärung an die Nephilim. Die Tat einer gefährlichen Gegnerin, die mit dem ultimativen Bösen gemeinsame Sache macht.«
»Tatiana war in der Adamant-Zitadelle, als Leviathan angegriffen hat«, bemerkte Ariadne. »Wie hätte sie für die Geschehnisse verantwortlich sein können, ohne dass die Eisernen Schwestern es merken? Mach dir keine Sorgen, Mama«, fügte sie hinzu. »Alles wird gut werden.«
Ihre Mutter seufzte. »Ari, du hast dich zu so einer bezaubernden jungen Frau entwickelt. Du wirst mir wirklich fehlen, wenn ein guter Mann dich auswählt und du ihn heiratest.«
Ariadne brachte einen unverbindlichen Laut hervor.
»Oh, ich weiß, dass die Sache mit diesem Charles eine schreckliche Erfahrung war«, fügte ihre Mutter hinzu. »Aber du wirst bald einen besseren Mann finden.«
Dann holte sie tief Luft und straffte die Schultern. Nicht zum ersten Mal wurde Ariadne daran erinnert, dass ihre Mutter eine Schattenjägerin wie jede andere war. Die Bewältigung schwieriger Situationen gehörte zu ihren Aufgaben. »Beim Erzengel«, sagte sie in jetzt forschem Tonfall, »das Leben geht weiter, und wir können nicht den ganzen Tag in der Eingangshalle herumstehen und uns Sorgen machen. Ich muss so viele Dinge erledigen … In Abwesenheit des Hausherrn trägt die Frau des Inquisitors die Verantwortung für den Haushalt und all das …«
Ariadne murmelte zustimmend, küsste ihre Mutter auf die Wange und stieg wieder die Treppe hinauf. Auf dem Weg durch den Flur kam sie an der angelehnten Tür zum Arbeitszimmer ihres Vaters vorbei. Sie drückte die Tür etwas weiter auf und spähte hinein.
Das Arbeitszimmer war in einem schrecklichen Chaos hinterlassen worden. Falls Ariadne gehofft hatte, dass ein Blick in Maurice Bridgestocks Arbeitszimmer ihr das Gefühl schenken würde, ihrem Vater näher zu sein, wurde sie enttäuscht. Stattdessen verstärkte die Szenerie nur ihre Sorge: Denn ihr Vater war gewissenhaft und ordentlich und normalerweise sehr stolz darauf. Für Unordnung hatte er kein Verständnis. Ariadne wusste, dass er überstürzt aufgebrochen war, doch der Zustand des Zimmers machte deutlich, wie groß seine Panik gewesen sein musste.
Ohne groß nachzudenken, betrat sie den Raum und begann aufzuräumen: Sie schob den Stuhl zurück unter den Schreibtisch, befreite die Vorhänge, die sich an einem Lampenschirm verfangen hatten, und trug die Teetassen hinaus in den Flur, wo die Haushälterin sie finden würde. Vor der Kaminumrandung lag kalte Asche. Ariadne griff nach dem kleinen Kehrbesen aus Messing, um sie zurück in den Kamin zu befördern …
… und hielt inne.
Zwischen der Asche im Kamin schimmerte etwas Weißes – ein Stapel aus verkohltem Papier, mit der gestochenen Handschrift ihres Vaters. Sie beugte sich vor. Was waren das für Notizen, von denen ihr Vater geglaubt hatte, sie vor seiner Abreise aus London vernichten zu müssen?
Ariadne holte die Papiere aus dem Kamin, schnippte die Asche weg und begann zu lesen. Dabei spürte sie, wie sich eine stechende Trockenheit in ihrer Kehle ausbreitete, beinahe so, als drohte sie zu ersticken.
Oben auf der ersten Seite standen die Worte Herondale/Lightwood.
Ariadne war klar, dass sie eine Grenze überschritt, wenn sie weiterlas, doch der Name Lightwood brannte seine Buchstaben in ihre Augen. Sie konnte sich nicht davon abwenden. Falls Annas Familie in irgendwelchen Schwierigkeiten steckte, wie könnte Ariadne nicht darüber Bescheid wissen wollen?
Die Blätter waren mit Jahreszahlen beschriftet: 1896, 1892, 1900. Ariadne blätterte durch die Seiten und spürte, wie ihr ein eiskalter Finger über den Nacken fuhr.
Die Notizen in der Handschrift ihres Vaters enthielten keine Aufstellungen von Ausgaben und Einnahmen, sondern Beschreibungen von Vorfällen. Vorfälle mit Beteiligung der Herondales und Lightwoods.
Nein, keine Vorfälle. Fehler. Irrtümer. Sünden. Es handelte sich um eine Aufstellung sämtlicher Handlungen der Herondales und Lightwoods, die in den Augen ihres Vaters Probleme verursacht hatten. Alles, was als unverantwortlich oder unüberlegt bezeichnet werden konnte, war hier vermerkt.
12.03.1901:G2.L fehlt ohne Begründung bei Ratsversammlung. CF verärgert.
06.09.1898: WW in Waterloo sagen, dass WH/TH ein Treffen ablehnen, infolgedessen Unterbrechung des Markts.
08.01.1895: Leiter des Osloer Instituts lehnt Treffen mit TH ab, mit Hinweis auf ihre Abstammung.
Ariadne war übel. Der Großteil der vermerkten Vorkommnisse wirkte kleinlich oder belanglos oder schien auf Hörensagen zu basieren. Die Notiz, dass der Leiter des Instituts in Oslo ein Treffen mit Tessa Herondale abgelehnt hatte, war ekelerregend – Tessa war eine der freundlichsten Frauen, die Ariadne je kennengelernt hatte. Der Leiter des Osloer Instituts hätte verwarnt werden müssen. Stattdessen war der Vorfall hier so dargestellt, als wäre er die Schuld der Herondales gewesen.
Was war das hier? Was hatte ihr Vater sich dabei gedacht?
Ganz unten im Stapel befand sich noch etwas anderes. Ein Bogen cremefarbenes Briefpapier. Keine Notizen, sondern ein Brief. Ariadne zog das Schreiben aus dem Stapel und überflog ungläubig die Zeilen.
»Ariadne?«
Rasch schob Ariadne den Brief ins Mieder ihres Kleids, dann erhob sie sich und sah ihre Mutter an. Flora stand in der Tür. Sie runzelte die Stirn, musterte sie mit leicht zusammengekniffenen Augen und fragte mit einer Stimme, der jegliche Wärme fehlte: »Ariadne, was tust du da?«
2 Graue See
Grauer Fels und graue See,
Wellen, die sich am Ufer brechen –
Und in meinem Herzen ein Name
Unvorstellbar, ihn je wieder auszusprechen.
Charles G. D. Roberts, »Grey Rocks, and Greyer Sea«
Als Lucie endlich erwachte, hörte sie das Rauschen von Wellen und blickte in das helle Licht der Wintersonne, scharf wie eine Glasscherbe. Sie setzte sich so schnell auf, dass ihr der Kopf schwirrte. Nein, sie würde nicht wieder einschlafen, nicht ohnmächtig werden und nicht an diesen dunklen, verlassenen Ort voller Stimmen und Geräusche zurückkehren.
Sie warf die gestreifte Wolldecke, unter der sie geschlafen hatte, beiseite und schwang die Beine aus dem Bett. Ihr erster Versuch aufzustehen missglückte; ihre Beine knickten ein, und sie fiel zurück aufs Bett. Beim zweiten Mal zog sie sich an einem der Bettpfosten hoch. Das funktionierte etwas besser, und ein paar Sekunden schwankte sie hin und her wie ein alter Kapitän, der lange nicht an Land gewesen war.
Abgesehen von dem Bett – einem schlichten, schmiedeeisernen Gestell, das passend zu den Wänden eierschalenweiß lackiert war – befanden sich in ihrem kleinen Zimmer kaum Möbel. Ihr Blick fiel auf einen Kamin, in dessen Rost schwach violett glimmende Glut knisterte, und auf einen Frisiertisch aus unbearbeitetem Holz, der über und über mit Schnitzereien von Meerjungfrauen und Seeschlangen versehen war. Ihre eigene Reisetruhe stand beruhigenderweise am Fußende des Betts.
Ihre Beine kribbelten wie von tausend Nadelstichen, als sie zum Fenster ging, das in einen Erker in der Wand eingelassen war. Die Szenerie auf der anderen Seite der Fensterscheibe war eine Sinfonie aus Weiß und Dunkelgrün, Schwarz und zartestem Blau. Malcolms Haus schien auf halber Höhe einer Felskuppe zu ruhen, oberhalb eines hübschen kleinen Fischerdorfs. In der schmalen Bucht schwappte das Meer in den Hafen, und kleine Fischerboote schaukelten sanft auf den Wellen. Der Himmel schimmerte in klarem Porzellanblau, obwohl es vor Kurzem geschneit haben musste, den weiß gepuderten Dächern des Dorfes nach zu urteilen. Aus den Schornsteinen stiegen schwarze Rauchfahnen von den Kohlenfeuern auf, während die Wellen gegen die Felsen krachten – kiefergrüne Wogen und weiße Gischt.
Die Landschaft war schön – schlicht und schön. Lucie fühlte sich tief in ihrem Inneren seltsam leer, als sie die Weite des Meeres betrachtete. London schien Tausende von Meilen entfernt, genau wie die Menschen dort: Cordelia und James, ihre Eltern. Was würden sie jetzt wohl denken? Wo in Cornwall vermuteten sie sie? Bestimmt nicht hier, wo sie auf ein Meer schaute, das sich bis zur französischen Küste erstreckte.
Um sich abzulenken, wackelte sie versuchsweise mit den Zehen. Immerhin war das Kribbeln verschwunden. Die schweren Holzdielen unter ihren nackten Fußsohlen waren über die Jahre so abgenutzt, dass sie sich regelrecht glatt anfühlten, als wären sie gerade erst geschliffen worden. Lucie ging zum Frisiertisch, wo eine Waschschüssel und ein Handtuch auf sie warteten. Als sie sich selbst im Spiegel sah, hätte sie fast laut gestöhnt. Ihr Haar war verfilzt und zerzaust, ihr Reisekleid zerdrückt und verknittert, und einer der Knöpfe am Kopfkissen hatte einen Abdruck von der Größe eines Pennys auf ihrer Wange hinterlassen.
Sie würde Malcolm später um ein Bad bitten müssen, überlegte sie. Er war ein Hexenmeister und konnte gewiss heißes Wasser herbeischaffen. Für den Moment behalf sie sich, so gut es ging, mit der Waschschüssel und einem Stück Pears-Seife. Dann schälte sie sich aus ihrem ruinierten Kleid, warf es in eine Ecke und klappte ihre Reisetruhe auf. Einen Augenblick saß sie nur da und starrte auf den Inhalt – hatte sie wirklich einen Badeanzug eingepackt? Die Vorstellung, im eisgrünen Wasser des Hafens von Polperro zu schwimmen, war entsetzlich. Nachdem sie ihre Axt und ihre Monturjacke zur Seite geschoben hatte, wählte sie ein dunkelblaues Wollkleid mit Stickerei an den Ärmelbündchen und machte sich daran, mithilfe von Haarnadeln für ein einigermaßen präsentables Aussehen zu sorgen. Als sie erkannte, dass sie ihr goldenes Medaillon nicht um den Hals trug, verspürte sie einen heißen Anfall von Panik; aber nach einer Minute hektischer Suche fand sie es auf dem Nachttisch neben dem Bett.
Jesse hat es dort hingelegt, dachte sie. Sie hätte nicht sagen können, woher sie das wusste, aber sie war sich absolut sicher.
Plötzlich konnte sie es gar nicht erwarten, ihn zu sehen. Sie zog kurze Stiefel an und schlüpfte aus dem Zimmer in den Flur.
Malcolms Haus war wesentlich größer, als sie gedacht hatte. Wie sich herausstellte, war ihr Schlafzimmer eines von sechs in diesem Geschoss, und die Treppe am Ende des Flurs – mit den gleichen Schnitzereien versehen wie ihr Frisiertisch – führte hinunter in einen offenen Salon mit hoher Decke, wie er zu einem Herrenhaus passte. Eigentlich bot das Haus gar keinen Platz für die hohe Decke und die Schlafzimmer darüber; das Ganze erzeugte einen verwirrenden Effekt. Malcolm musste sein Cottage verzaubert haben, damit es innen so groß war, wie er es wünschte.
Nichts deutete darauf hin, dass sich noch jemand anderes im Haus befand, aber irgendwo von draußen drang ein gleichmäßiges, rhythmisches Hämmern herein. Nach kurzer Suche fand Lucie die Eingangstür und trat ins Freie.
Das strahlende Sonnenlicht hatte getrogen. Die Luft war kalt. Und der Wind fegte über die Felsklippen und schnitt wie ein Messer durch die Wolle ihres Kleids. Fröstelnd schlang sie die Arme um den Oberkörper und drehte sich schnell im Kreis, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Sie hatte recht gehabt, was das Haus betraf: Von außen wirkte es tatsächlich sehr klein, nicht größer als ein Cottage mit drei Zimmern. Die Fenster schienen mit Brettern vernagelt zu sein, obwohl sie wusste, dass das nicht stimmte. Und in der salzigen Luft war die weiße Farbe an vielen Stellen abgeblättert.
Das gefrorene Gras knirschte unter ihren Stiefeln, während sie dem dumpfen, hämmernden Geräusch um die Hausecke herum folgte … und dann abrupt stehen blieb.
Vor ihr stand Jesse. Er hielt eine Axt in der Hand und schaute auf einen Haufen Feuerholz, das er gerade gehackt hatte. Lucies Hände zitterten – und nicht nur vor Kälte. Er lebte