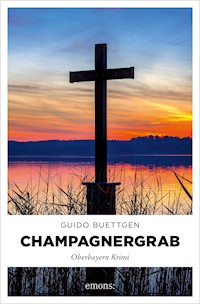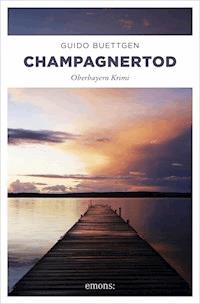
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Oberbayern Krimi
- Sprache: Deutsch
Verlockend, anonym – tödlich. Die Ermordung zweier unbescholtener Frauen sorgt für Entsetzen am Starnberger See. Als Kriminalrat Madsen Ermittlungen im familiären Umfeld der Opfer anstellt, nimmt der Fall jedoch eine unerwartete Wendung. Gewalt, Betrug und geheime erotische Doppelleben lassen die Taten plötzlich in einem völlig anderen Licht erscheinen – und Madsen taucht ein in eine ihm unbekannte Welt, in der man per Mausklick die Liebe seines Lebens findet. Oder den Tod.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Guido Buettgen, geboren 1967, war nach dem Studium der Visuellen Kommunikation in renommierten Werbeagenturen tätig und erhielt für seine Kampagnen zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen. 2010 legte er eine werbliche Pause ein, begab sich auf eine mehrmonatige Weltreise und verdiente sein Geld als Boxtrainer. Inzwischen ist er wieder in die Marketingbranche zurückgekehrt und arbeitet als Geschäftsführer einer Münchner Werbeagentur. Guido Buettgen lebt mit seiner Familie am Starnberger See.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Jan Greune/Lookphotos
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Carlos Westerkamp
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-359-2
Oberbayern Krimi
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literaturagentur Beate Riess, Freiburg.
Für Nicole, Kim und Paul.Ohne euch wäre all dies nicht möglich.
Ohne John Pemberton übrigens auch nicht.
Ich bin schon lange nicht mehr nur auf den Friedhöfen und in den Mausoleen, nicht in den Sterbestationen und Altenheimen. Ich habe die Pest- und Choleraenklaven hinter mir gelassen und den alten Schlachtfeldern den Rücken gekehrt. Ich bin das Raunen und Rauschen im Netz. Ich bin die Eins zwischen den Nullen, der Anhang, der Download, die Datei.
Ich bin der Tod 3.0.
Andreas Winkelmann, »Deathbook«
Prolog
Die Angst war das Schlimmste.
Den Hunger, der an ihren Eingeweiden nagte wie ein Hund an einem Knochen, vermochte sie zu verdrängen. Auch die Kälte, die durch ihre geschundenen Glieder kroch, ließ sich irgendwie ignorieren, und selbst der brennende Schmerz, der in ihren Schläfen tobte und ihre Augen tränen ließ, war nicht ansatzweise so schwer zu ertragen wie die Angst.
Sie hatte in irgendeiner Zeitschrift einmal etwas über Phobophobie gelesen, die Angst vor der Angst. Damals hatte sie darüber gelacht, doch die letzten Stunden hatten sie gelehrt, dass Angst wie ein Gift war, das den Körper langsam und unaufhörlich von innen zersetzte.
Angst verleihe ungeahnte Kräfte, hieß es.
Was für ein Schwachsinn!
Genau das Gegenteil war der Fall.
Angst lähmte.
Ihre Glieder erschienen schwer wie Blei, jede Bewegung erforderte unermessliche Anstrengung, und das Atmen fiel ihr so schwer, als hätte sie den Gipfel eines Achttausenders erklommen. Apathisch wanderte ihr Blick von einer Raumecke in die andere, über den nackten Betonboden und den Eimer mit ihren Exkrementen hinweg, bevor er schließlich an den roten Schlieren hängen blieb, die die steingraue Monotonie der Wände unterbrachen.
Sie ahnte, dass es Blut war, vielleicht sogar ihr eigenes, und der abgerissene Fingernagel, den sie im schummrigen Licht der von der Decke baumelnden Glühlampe gefunden hatte, ließ darauf schließen, dass sie nicht die Erste war, die in diesem kargen, kalten Raum dem Willen ihres Peinigers ausgeliefert war.
Voller Verzweiflung stieß sie einen durchdringenden Schrei aus, und das Echo, das von den Wänden widerhallte, klang wie höhnisches Gelächter.
Sie hatte nicht die geringste Ahnung, warum ausgerechnet sie von ihm ausgewählt worden war, und es war ihr völlig unklar, was genau er mit ihr vorhatte.
Es gab nur eine einzige Sache, die sie mit Sicherheit wusste.
Wenn sich die graue Stahltür öffnete, war sie tot.
EINS
»Das ist doch alles gequirlte Kinderkacke!« Genervt wischte sich der Obergefreite Kisteneich das Wasser aus dem mit Tarnfarbe bemalten Gesicht. Es regnete in Strömen, und ein scharfer Wind trieb die morgendliche Kälte erbarmungslos durch die schlammverschmierte Uniform. »Wenn ich so ’nen Quatsch schon höre: ›Feind Rot plant einen Angriff aus östlicher Richtung.‹ Als wenn die Russen heut noch zu Fuß durch die Pampa rennen würden. Das geht doch inzwischen alles per Computer. Ein Knopfdruck, und ganz Deutschland ist nur noch ein Häufchen radioaktive Asche. Und was tun wir? Wir liegen hier im Matsch rum und spielen Cowboy und Indianer! Das ist doch Schwachsinn! Und außerdem ist mein Körper einfach nicht für diesen Scheiß gemacht!«
Der Obergefreite Thiele, der neben Kisteneich durch das Dickicht robbte, grinste verstohlen. In der Tat sah es fast schon mitleiderregend aus, wie der Kamerad versuchte, seinen massigen Körper durch das dichte Unterholz zu bewegen, ohne sich dabei Dornen oder Äste ins Gesicht zu bohren. Aber Befehl war nun einmal Befehl, und der bestand in ihrem Fall darin, ein Waldstück nahe der General-Fellgiebel-Kaserne zu sichern – wenngleich es den beiden Rekruten höchst unwahrscheinlich erschien, dass irgendeine Armee dieser Welt ausgerechnet an diesem verregneten Spätsommermorgen das strategische Bedürfnis verspüren sollte, eine kleine Ausbildungskaserne südlich von Starnberg anzugreifen.
»So, mir reicht’s! Ich hab die Faxen dicke!«, verkündete Kisteneich plötzlich entschlossen und sprang auf.
»Sag mal, hast du sie noch alle?« Thiele blickte ihn erschrocken an. »Wenn jetzt der Hauptfeld kommt, dann reißt er uns den Kopf ab.«
»Mach dir mal nicht ins Hemd, Kollege!«, erwiderte Kisteneich ungerührt. »Ich will ja nicht desertieren – ich muss nur mal kurz für kleine Panzergrenadiere. Also, wenn du den Feind siehst, dann sag ihm, ich wäre ihm sehr dankbar, wenn er mit dem Angriff warten würde, bis ich fertig gepinkelt hab!«
Mit diesen Worten schulterte Kisteneich sein Gewehr und stampfte tiefer in den Wald hinein, um dort im Schutze des Dickichts ungestört seine Notdurft zu verrichten.
Thiele blickte ihm wütend nach. Sosehr er den mitunter zynischen Humor Kisteneichs auch schätzte, ärgerte er sich dennoch immer wieder über dessen Renitenz, die in regelmäßigen Abständen schmerzhafte Disziplinarmaßnahmen zur Folge hatte. Ähnliches durfte auch dieses Mal wieder zu erwarten sein, und so fluchte Thiele missmutig vor sich hin, während er auf das vor ihm liegende Feld starrte, dessen frisch gepflügte Oberfläche hier und da von ein paar stoppeligen Getreideresten unterbrochen wurde.
Plötzlich ertönte hinter ihm ein entsetzter Aufschrei.
Erschrocken fuhr er herum, und im selben Augenblick stürzte Kisteneich aus dem Gebüsch wie eine schwäbische Hausfrau durch die Wühltischware bei KiK.
»Spinnst du jetzt völlig, du Idiot?«, fuhr Thiele seinen Partner wütend an. »Setz dir doch gleich ein Blaulicht auf den Helm, damit der Hauptfeld auch wirklich sieht, dass du hier rumrennst wie ein Gestörter, anstatt Wache zu halten!«
Doch Kisteneich antwortete nicht.
Stattdessen stammelte er nur einige unverständliche Worte und deutete hektisch über seine Schulter.
»Was zum Teufel ist denn los mit dir? Hast du ’nen Geist gesehn, oder was? Nun red schon, Kerl! Was ist passiert?«
Kisteneich wischte sich den Schweiß von der Stirn und schnappte nach Luft. »Da … da liegt eine! Dahinten im Wald.«
Thiele blickte ihn verständnislos an. »Wie, da liegt eine? Eine was? Eine Kuh? Eine Schatztruhe? Eine Portion Gyros?«
»Nein, du Schwachkopf! Eine Tote! Dahinten. Halb vergraben. Verdammt, ich hab fast auf sie draufgepisst!«
Thiele starrte ihn ungläubig an. »Wie bitte? Da liegt eine Tote? Das ist doch wohl hoffentlich ein Scherz, oder?«
Doch der wirre Blick des Hünen und seine aschfahle Gesichtsfarbe ließen sämtliche Alarmglocken in Thieles Kopf schrillen. Seinen derangierten Kameraden kommentarlos zurücklassend, begab er sich vorsichtig in die Richtung, aus der Kisteneich wenige Augenblicke vorher so schockiert gekommen war. Das Waldstück war dicht bewachsen, spitze, kahle Äste ragten aus dem Nadelgehölz, und der Boden war mit Wurzeln und wild wuchernden Pflanzen übersät, sodass er behutsam einen Fuß vor den anderen setzen musste, um nicht zu stolpern. Ein paar Meter vor ihm standen die Stämme etwas weniger dicht – eine kleine, natürliche Lichtung, die auch Thiele instinktiv zum Austreten aufgesucht hätte. Er kniff die Augen zusammen und sah, dass zwischen den Wurzeln zweier gewaltiger Tannen etwas golden Schimmerndes lag.
Zaghaft trat Thiele näher.
Sein Gewehr hielt er dabei krampfhaft umklammert.
Allerdings sollte sich das als naiv erweisen.
Denn gegen den Anblick, der sich ihm kurz darauf bot, half dem jungen Soldaten keine Waffe dieser Welt.
***
Die meisten Menschen pflegten den Starnberger See bei gutem Wetter zu besuchen – zeigte sich das Gewässer sowie das umliegende Bergland doch bei Sonnenschein in seinen strahlendsten, freundlichsten Farben. Was die wenigsten jedoch wussten, war, dass der fünftgrößte See Deutschlands auch bei schlechtem Wetter ein wahres Juwel darstellte. Mit beeindruckender Kraft schlugen dann die Wellen an die steinige Uferböschung, Gischtkronen verzierten die tiefblaue Wasseroberfläche wie weiße Pinseltupfer eines Malers, und die Gipfel der Werdenfelser Alpen wirkten im nebligen Dunst fast noch majestätischer als im gleißenden Sonnenschein. Einer der größten Vorteile schlechten Wetters bestand jedoch darin, dass selbst so beliebte Grünanlagen wie das »Possenhofener Paradies« menschenleer waren, und während an sonnigen Tagen Tausende von auswärtigen Sommerfrischlern durch Mutters oberbayrische Natur mäanderten, gehörte der See bei Regen allein jenen, die der Nässe mit geeigneter Kleidung und entsprechender Einstellung entgegentraten.
So wie an jenem Septembermorgen Kriminalrat Mads Madsen und seine Begleiterin, die attraktive Starnberger Immobilienmaklerin Lissy Berghammer.
Die beiden hatten sich vor rund einem halben Jahr zufällig in Starnberg kennengelernt, und nachdem der seinerzeit frisch aus Hamburg zugezogene Kriminalpolizist im Rahmen seines ersten Falles mehrfach auf Lissy Berghammers profunde Kenntnisse der bayerischen Lebensart sowie der Starnberger Hautevolee zurückgegriffen hatte, hatte sich zwischen den beiden eine enge Beziehung entwickelt.
Allerdings sah sich Lissy Berghammer auch bei genauerer Betrachtung außerstande, den exakten Status dieser Verbindung zu definieren. Zweifellos fühlte sie sich zu Madsen hingezogen – schließlich sah der Leiter der Starnberger Polizeiinspektion glänzend aus: sportlich, kernig, mit einem gepflegten Dreitagebart und kurzem dunkelblondem Haar. Außerdem war er nicht ansatzweise so spießig, wie man das bei einem Staatsbeamten vermuten mochte. Stattdessen trug er lässige Zivilkleidung, fuhr mit seiner chromblitzenden Harley-Davidson Fat Boy statt mit dem Streifenwagen zu den Einsätzen und besaß einen wunderbaren, tiefschwarzen Humor.
Und da auch Madsens Verhalten unschwer darauf schließen ließ, dass er mehr als Sympathie für Lissy empfand, sprach im Grunde also alles für eine Beziehung, die über freundschaftliches Miteinander hinausging. Doch aus unerklärlichen Gründen hatte bisher noch keiner den entscheidenden Schritt gewagt und dem anderen seine wahren Gefühle offenbart, und so glich ihrer beider Verhalten weiterhin dem eines Menschen, der auf dem Zehn-Meter-Brett stand und das unbändige Verlangen spürte, sich ins kühle Nass zu stürzen – aber dann nicht den Mut zum Sprung aufbrachte.
»Alles okay bei dir?« Madsen unterbrach Lissy Berghammers Gedankengang mit einem provokanten Lächeln. Die beiden pflegten zweimal die Woche zusammen am See Frühsport zu betreiben, und obgleich das morgendliche Joggen ihrer körperlichen Konstitution zuträglich war, bestand der Hauptgrund dieser Aktivität darin, ihre knapp bemessene Freizeit miteinander zu verbringen. »Wie wär’s mit ’nem kleinen Wettrennen bis zur Roseninsel?«
Lissy zuckte bedauernd mit den Schultern. »Grundsätzlich gerne, Mads, aber ich muss zeitig ins Büro. Um acht sind schon die ersten Klienten da. Schade, ich glaube, heute hätt ich dich so richtig abgezogen.«
»Träum weiter, Goldlöckchen«, feixte Madsen und nahm Lissy lachend in den Arm. Es war nur eine kurze Berührung, trotzdem jagte ihr ein wohliger Schauer durch den gesamten Körper. »Aber kein Problem, verschieben wir es eben aufs nächste Mal und schauen, dass wir jetzt zurück zum Parkplatz kommen. Denkst du bitte nur dran, dass ich dir bei Gelegenheit meinen Laptop vorbeibringen wollte? Du hattest doch irgendeinen Spezialisten an der Hand, der das Ding für kleines Geld wieder zum Laufen bringen kann.«
Lissy hob warnend den Finger, während sie beide im gleichmäßigen Trab das imposante Possenhofener Schloss mit seiner weitläufigen, fast schon steril gepflegten Gartenanlage passierten.
»Achtung, lieber Mads. Wie teuer die Reparatur wird, kann ich nicht abschätzen – ich weiß ja noch nicht mal, was dem Rechner fehlt. Aber ich kann dir eins versichern: Der gute Hannes wird dich garantiert nicht über den Tisch ziehen.«
Während Lissys Gesicht gerötet und das Schnaufen zwischen ihren Worten unüberhörbar war, atmete Madsen völlig ruhig und entspannt. Dass seine anschließende Frage dennoch ein wenig gepresst klang, lag einzig und alleine an dem Anflug von Eifersucht, der ihn bei Lissys Antwort überkommen hatte.
»Soso, Hannes! Wer ist denn dieser Hannes?«
»Niemand, wegen dem du dir Gedanken machen müsstest«, winkte Lissy ab, während sie sich insgeheim über Madsens Reaktion freute.
Nicht, dass sie Eifersucht an einem Mann schätzte. Im Gegenteil, so etwas konnte außerordentlich enervierend sein. Aber im aktuellen undefinierten Status ihrer Beziehung ließ Madsens Frage darauf schließen, dass er durchaus ernst zu nehmende Gefühle für sie hegte. Eine Erkenntnis, die sie dermaßen beflügelte, dass sie spontan zu einem fulminanten Schlussspurt ansetzte, bei dem der überraschte Madsen nur mit Mühe Schritt halten konnte.
»Hannes Bokholt ist ein alter Schulfreund von mir«, rief sie ihm keuchend über die Schulter zu. »Ich glaub, früher war er mal verknallt in mich. Außerdem haben sowohl er als auch sein bester Freund in Feldafing eine Hütte am See, in denen wir als Schüler oft Partys veranstaltet haben. Das Highlight war immer das nächtliche Nacktschwimmen. Apropos Nacktschwimmen …«, Lissy warf Madsen einen koketten Blick zu, »… was hältst du davon, wenn wir da vorne am Steg auch mal kurz in den See springen? Glaub mir: Es gibt nichts Belebenderes als frühmorgens ein Bad im Starnberger See!«
Madsen schluckte. Es gehörte nicht allzu viel Phantasie dazu, um zu erahnen, dass es Lissy keineswegs alleine um das Schwimmen ging. Sich gegenseitig nackt zu sehen bedeutete einen weiteren Schritt Richtung Intimität.
Allerdings einen entscheidenden.
In diesem Augenblick ertönte plötzlich der Klingelton seines Handys, und die brachialen Gitarrenriffs von Rammsteins »Engel« zerstörten die sinnliche Atmosphäre des Augenblicks. Madsen griff nach seinem Telefon und nahm das Gespräch mit einer entschuldigenden Geste an. Dabei registrierte er für den Bruchteil einer Sekunde tiefe Enttäuschung in Lissys Blick, doch keinen Wimpernschlag später hatte sie ihre Mimik wieder vollkommen im Griff.
Als er fertig war, deutete sie auf sein Handy. »Ein Notfall?«
Madsen nickte ernst. »Ja. Ein Leichenfund. An der General-Fellgiebel-Kaserne. Sieht nach Mord aus.«
Er zögerte kurz.
Dann trat er plötzlich auf Lissy zu, umarmte sie fest und drückte ihr einen zärtlichen Kuss auf die Wange.
Anschließend spurtete er – ohne sich noch einmal umzudrehen – zu seiner Harley.
***
Der holprige, von tiefen Pfützen übersäte Feldweg war laut Beschilderung ausschließlich Traktoren vorbehalten – eine Direktive, deren Sinn sich Madsen in dem Augenblick erschloss, in dem er von der Bundesstraße 2 auf den unbefestigten Pfad abbog und auf seinem schweren Motorrad hin- und hergeschleudert wurde wie ein Cowboy auf einem bockenden Hengst. Begleitet vom Ächzen der Stoßdämpfer und dem Zischen der Regentropfen auf den heißen Auspuffrohren bemühte er sich bereits während der Fahrt, die Situation vor Ort zu erfassen.
Linker Hand thronte, strategisch geschickt auf einer kleinen Anhöhe platziert, die General-Fellgiebel-Kaserne. Der schmucklose, trutzig anmutende Gebäudekomplex wirkte wie ein riesiger Fremdkörper in dem landwirtschaftlichen Areal, und in Kombination mit der massiven Umzäunung erinnerte das militärische Anwesen Madsen spontan an einen russischen Gulag. In Fahrtrichtung vor ihm befand sich ein etwa fünfhundert Meter breites Waldstück, an dem hektische Betriebsamkeit herrschte. Kleine Gruppen von Uniformierten steckten ihre Köpfe zusammen, Männer und Frauen in weißen Overalls liefen mit Koffern bewaffnet zwischen den Bäumen umher, und trotz der frühen Morgenstunden hatten sich bereits die ersten Gaffer vor den rot-weißen Absperrbändern versammelt. Illuminiert wurde die Szenerie vom zuckenden Blaulicht der Polizei- und Militärfahrzeuge, das sich in den Regentropfen tausendfach reflektierte und den Eindruck eines gigantischen Stroboskops vermittelte.
Madsen stoppte seine Harley schwungvoll neben einem etwa dreißigjährigen, untersetzt wirkenden Beamten mit kurzen schwarzen Locken. Polizeikommissar Maximilian von Werdenfels war Madsens Partner, der älteste junge Mensch, den Madsen je getroffen hatte, und in jederlei Hinsicht das exakte Gegenteil des Kriminalrats. Er hielt sich penibel an jede Dienstvorschrift, pflegte Äußerungen und Tätigkeiten stets gründlich abzuwägen und schaffte es selbst auf dem schlammigen Feldweg, in seiner perfekt gebügelten Uniform wie aus dem Ei gepellt auszusehen.
Mit einem kurzen Gruß und ohne auf Madsens befremdliche Kombination von Sportkleidung und Motorradjacke einzugehen, reichte von Werdenfels seinem Vorgesetzten Plastiküberzüge für die Schuhe sowie ein Paar Latexhandschuhe. Anschließend gab er mit ernster Stimme den aktuellen Erkenntnisstand wieder.
»Zwei Soldaten von der Bundeswehrkaserne dort drüben haben vor knapp zwei Stunden bei einer Manöverübung eine Frauenleiche gefunden. Die Tote wurde vergraben, aber der heftige Regen und die Tiere haben den Körper teilweise wieder freigelegt. Bertram und seine Kollegen sind schon da und sichern Spuren.«
Madsen nickte zufrieden. »Ausgezeichnet! Dann schlage ich vor, wir statten dem guten Bertram jetzt mal einen Besuch ab. Der ganze Bundeswehrtrupp kann zurück in die Kaserne. Wir werden uns dann später mit ihnen unterhalten. Es macht ja keinen Sinn, dass jetzt alle hier im Regen rumstehen und sich erkälten. Schließlich brauchen wir die Jungs noch, um unser Land zu verteidigen.«
Die kleine Lichtung war durch das geschäftige Treiben der Kriminaltechniker ihrer natürlichen Idylle gänzlich beraubt. Überall im Waldboden steckten Metalltafeln mit Spurennummern, über der Leiche war zum Schutz vor dem Regen ein weißer Faltpavillon errichtet worden, und zahlreiche Scheinwerfer tauchten die Szenerie in ein grelles, kaltes Licht.
Als Madsen und von Werdenfels näher traten, streckte Stefan Bertram den Kopf aus dem Pavillon. Bertram war der Leiter der Münchner Spurensicherung und angesichts seiner langjährigen Polizeikarriere im Besitz eines Erfahrungsschatzes, auf den die Insassen eines ländlichen Altersheims nicht einmal gemeinsam kämen. Darüber hinaus pflegte er sich stets völlig unverblümt zu äußern, und während manch einen dieses offensichtliche Fehlen jeglicher Diplomatie irritierte, war Madsen die direkte Art Bertrams überaus sympathisch. Außerdem musste er jemanden, der einen Nierenstein seiner Gattin als Talisman bei sich trug, schon alleine wegen seiner Skurrilität mögen.
»Einen wunderschönen guten Morgen, meine Herren!«, empfing Bertram die Ankömmlinge und deutete amüsiert auf Madsens Jogginghose. »Interessante Dienstkleidung! Dazu noch ein Oberteil aus durchsichtigem Netzstoff, und du wärst der Held in jeder Dorfdisco.«
»Für jemanden, der die Operationsabfälle seiner Frau als Kettenanhänger spazieren trägt, lehnst du dich ganz schon weit aus dem Fenster«, konterte Madsen und hielt sich den Arm vor die Nase, um den penetranten Gestank abzuschwächen. Die Gesichtsfarbe des deutlich empfindsameren von Werdenfels hatte indes einen Weißton angenommen, der sich irgendwo zwischen frisch gefallenem Schnee und den Betttüchern aus der Ariel-Werbung bewegte. »Und außerdem: Wenn du einen Morgen, an dem man eine Leiche findet, als wunderschön bezeichnest, dann möchte ich nicht wissen, was du unter einem schlechten verstehst.«
Bertram verzichtete generös auf eine Antwort. Stattdessen wies er auf das Zeltinnere und ratterte die bis dato vorliegenden Fakten herunter.
»Weibliche Person, Anfang, Mitte vierzig, blond, weibliche Figur. Unbekleidet und vermutlich vergewaltigt. Dazu eine Kopfverletzung, die für mich auf den ersten Blick aber nicht tödlich aussieht. Außerdem hat die Frau irgendwelche seltsamen Abdrücke im Halsbereich, die ich nicht deuten kann. Möglicherweise handelt es sich um Würgemale, aber verlässlich kann das erst in der Obduktion geklärt werden. Ich schätze, die Leiche liegt noch nicht allzu lange hier, vielleicht zwei oder drei Nächte. Papiere haben wir keine gefunden, aber wo sollte die gute Frau die ohne Kleidung auch hinstecken?«
Madsen blickte sein Gegenüber konsterniert an. »Weißt du was, Bertram? Manchmal bist du echt ein gefühlloses Arschloch!«
»Nun werd aber mal nicht sentimental, mein Freund – das passt nämlich nicht zu einem Zyniker wie dir«, erwiderte der Spurensicherer ungerührt. »Und außerdem bin ich ziemlich genervt, dass ich wieder mal die Arbeit von Professor Polt übernehmen muss. Aber der Kerl verlässt seine Katakomben ja nur, wenn die Welt untergeht. Und selbst dann wäre ich mir nicht ganz sicher!«
Ungeachtet der an sich wenig erheiternden Gesamtsituation musste Madsen grinsen. Der Münchner Rechtsmediziner Professor Polt war eine Koryphäe auf seinem Fachgebiet. Allerdings wies er in der Tat eremitische Züge auf und pflegte sein Laboratorium so gut wie nie zu verlassen. Vor die Wahl gestellt, ihm deshalb zu kündigen oder aber die erste Leichenschau am Tatort ohne ihn durchführen und die Toten dann später für eine genauere Untersuchung ins Institut der Rechtsmedizin transportieren zu lassen, hatte sich die Staatsanwaltschaft angesichts von Polts unbestrittener Kompetenz für Letzteres entschieden. Somit oblag die erste Sichtung der Leiche allen juristischen Vorgaben zum Trotz dem Spurensicherer Bertram, der zwar über eine langjährige kriminalistische Erfahrung, aber keinerlei fachmedizinische Ausbildung verfügte.
»Also gut, Bertram«, brummte Madsen und rieb sich tatendurstig die Hände. »Ich würde sagen, du hast jetzt genug Onkel Doktor gespielt. Am besten, du fährst wieder zurück in dein Büro und tust das, was du wirklich kannst. Kopieren, stempeln, abheften und so weiter. Und wir zwei Profis …«, er deutete auf von Werdenfels und sich, »… wir machen jetzt mal richtige Polizeiarbeit.«
Die Leiche war im Bereich der unteren Extremitäten mit Erde, Blättern und Tannennadeln bedeckt, Oberkörper und Kopf lagen größtenteils frei. Obwohl sich die Frau nach Bertrams Schätzung noch nicht allzu lange dort befunden hatte, war die beginnende Fäulnis unübersehbar. Scharen von Schmeißfliegen hatten sich der sterblichen Überreste bemächtigt, und auch Füchse, Marder, Mäuse und andere Waldtiere hatten ihr zerstörerisches Werk bereits in Angriff genommen und sich an Augen, Nase und Lippen der Toten verlustiert. Während von Werdenfels entsetzt auf den entstellten Leichnam starrte, kniete Madsen nieder und bewegte den Kopf der Leiche vorsichtig hin und her, worauf der leblose Körper schmatzende Geräusche von sich gab – so als protestiere er gegen die Störung seiner Totenruhe.
»Siehst du diese seltsamen Abdrücke?« Stefan Bertram war hinter Madsen getreten und deutete auf den Hals der Frau. »Sie sind wegen der Fäulnis schwer zu erkennen, aber solche punktuellen Druckspuren habe ich bisher noch nie gesehen. Bin gespannt, ob Professor Polt damit was anfangen kann.«
»Wenn überhaupt jemand, dann wohl er«, brummte Madsen. »Bei der Wunde am Kopf bin ich übrigens deiner Meinung – eine üble Platzwunde, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht tödlich. Du sprachst außerdem von einer Vergewaltigung?«
Er richtete sich mit knackenden Kniegelenken auf. Natürlich hätte er auch selbst einen genaueren Blick auf den Unterleib werfen können, doch obwohl die Frau tot war, verspürte Madsen Hemmungen, ihr die Beine zu spreizen und ihren Genitalbereich zu untersuchen.
»Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie missbraucht wurde«, bestätigte Bertram. »Zumindest lassen die Blutspuren darauf schließen. Für mich sieht alles danach aus, als hätte hier ein Psychopath seinen Gelüsten freien Lauf gelassen.«
»Tja, ein normaler Mord ist das auf jeden Fall nicht. So, wie das Opfer zugerichtet wurde, steckt garantiert mehr dahinter.« Madsen warf einen langen Blick auf die Leiche und seufzte deprimiert. »Wisst ihr, welche Frage mich angesichts solcher Taten zunehmend quält? Warum zum Teufel ist die Mutter aller Arschlöcher eigentlich permanent schwanger?«
Er bekam keine Antwort.
Stattdessen ertönten Schritte vor dem Zelt, dann steckte Polizeimeister Zirngibl seinen Kopf durch den Öffnungsschlitz. Zirngibl war ein junger, engagierter Beamter, der eine gewisse Ähnlichkeit mit Jan Böhmermann aufwies, ansonsten aber ein netter Kerl war.
»Entschuldigen Sie, Herr Kriminalrat, ich wollte nur fragen …«
Er verstummte schlagartig, als sein Blick auf die Tote fiel.
»Was ist denn los, Zirngibl?«, fragte Madsen irritiert. »Das wird doch wohl nicht die erste Leiche sein, die Sie in Ihrem Leben sehen, oder?«
»Nein, das nicht«, stammelte Zirngibl leichenblass. »Aber ich kenne die Frau! Das ist Barbara Heidemann. Die ist mit mir im Starnberger Museumsverein. Diese Frau kann doch nicht tot sein! Niemand würde Barbara ermorden. Das ist unmöglich!«
»Tja, offensichtlich nicht«, brummte Madsen leise und legte Zirngibl die Hand auf die Schulter. »Hören Sie, Zirngibl, jeder von uns könnte ermordet werden. Ich, Sie, Bertram oder von Werdenfels. Warum also nicht auch diese Barbara?«
Zirngibl starrte ihn mit tränennassen Augen an. »Weil Barbara anders war als wir.« Der junge Streifenpolizist zögerte kurz, dann senkte er die Lider und sagte mit erstickter Stimme: »Ich weiß, es klingt verrückt, aber … Barbara war ein Engel!«
***
»Das gefällt mir überhaupt nicht«, murmelte Oberstaatsanwalt Dr. Nikolas Efstáthios Agasiotis und fuhr sich mit der Hand durch sein akkurat gescheiteltes schneeweißes Haar. »Das, was Sie hier gerade schildern, klingt definitiv nicht nach einem spontanen Sexualdelikt mit anschließendem Totschlag. Auch wenn ich hoffe, unrecht zu haben, wette ich meinen neuen Panamahut, dass der Typ das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Oder zum letzten Mal.«
Kriminalrat Madsen nickte. Zum einen, weil er insgeheim dieselben Befürchtungen wie der Oberstaatsanwalt hegte, und zum anderen, weil Widerspruch bei Dr. Agasiotis fast schon dem Tatbestand der Blasphemie gleichkam. In Polizeikreisen kursierte die Redewendung »Es ist nicht wichtig, dass Gott auf deiner Seite ist. Dr. Agasiotis reicht«, und damit war dessen Stellung innerhalb der Ermittlungsbehörde auch durchaus treffend definiert. Der groß gewachsene ehemalige griechische Olympiaschwimmer genoss einen hervorragenden Ruf, denn er galt als absolut integer, behandelte jeden Streifenbeamten mit demselben Respekt wie den Polizeipräsidenten höchstpersönlich und zeichnete sich außerdem durch eine fast schon gandhieske Ruhe und Gelassenheit aus. Dass er darüber hinaus zu jeder Tages- und Nachtzeit topfit zu sein schien und sein äußeres Erscheinungsbild selbst während der Teilnahme an SEK-Einsätzen an Eleganz kaum zu überbieten war, trug zu einer gewissen Legendenbildung sowie ehrfürchtiger Distanzhaltung der meisten Polizeibeamten bei.
»Ich gebe Dr. Agasiotis absolut recht: Es besteht der dringende Verdacht, dass unser Täter ein ähnliches Verbrechen schon einmal begangen hat.« Madsen deutete auf einen mittelgescheitelten Streifenbeamten, der zusammen mit Dr. Agasiotis, Kommissar von Werdenfels und zahlreichen anderen Beamten im schmucklosen Besprechungsraum der Polizeiinspektion Starnberg saß. »Hollmann, Sie setzen sich bitte mit dem LKA in Verbindung. Die Kollegen sollen ihre Datenbanken nach ähnlichen Fällen durchsuchen. Art der Verletzung, Art der Leichenentsorgung und vor allem diese ominösen Abdrücke am Hals. Vielleicht haben wir Glück und finden eine Parallele.«
Wachtmeister Hollmann nickte eifrig und kritzelte hektisch auf einem kleinen Block herum. Die Nervosität des jungen Polizisten war unübersehbar, denn während im Rest der Republik das wahre kriminelle Leben tobte, ähnelte der Dienst im beschaulichen Starnberg üblicherweise dem unter einer Glaskuppel. Und genau diese hatte mit dem Mord an Barbara Heidemann nun plötzlich einen hässlichen Riss bekommen.
»Der zweite Punkt, an dem wir schnellstmöglich angreifen sollten, ist das Opfer«, fuhr Madsen fort. »Bisher wissen wir noch sehr wenig über die Frau. Sie heißt Barbara Heidemann, wohnhaft in Starnberg, vierundvierzig Jahre alt, verheiratet, ein Sohn. Außerdem wissen wir, dass sie in der Starnberger Kulturförderung aktiv war. Der Kollege Zirngibl kannte sie von dort und hat sie als extrem hilfsbereit, sozial engagiert und liebenswürdig beschrieben. Jeder, der sie kannte, mochte sie offensichtlich.«
»Na ja, bis auf einen. Der hat sie schließlich umgebracht!«, unterbrach von Werdenfels trocken. »Was wieder einmal beweist: Gegen den Tod ist kein Kraut gewickelt.«
Madsen starrte seinen Partner kopfschüttelnd an. Von Werdenfels war zweifelsohne ein ebenso talentierter wie engagierter Polizist. Absolut gewöhnungsbedürftig hingegen waren seine verbalen Amokläufe. Von Werdenfels liebte es, bei jeder passenden – und häufig auch unpassenden – Gelegenheit, Redewendungen zu gebrauchen, die er, ohne es zu wollen, auf obskure Art und Weise durcheinandermischte. Das Faszinierende daran war, dass die neu entstandenen Wortschöpfungen bei genauerer Betrachtung tatsächlich eine gewisse Logik besaßen, und so waren von Werdenfels’ Neologismen üblicherweise allgemeiner Quell der Erheiterung. Die Tatsache, dass diesmal keiner seiner Kollegen lachte, zeigte deutlich, wie angespannt die Atmosphäre unter den Anwesenden war.
»Egal, ob gewickelt oder gewachsen – Fakt ist, dass wir schnellstmöglich klären müssen, warum ausgerechnet eine so beliebte Person wie Barbara Heidemann ermordet wurde«, erklärte Madsen, während er auf dem Flipchart den Namen des Opfers notierte. »Deswegen ist es extrem wichtig, in Erfahrung zu bringen, wo sie sich in den Tagen und Stunden vor ihrem Tod aufgehalten hat. Aus diesem Grunde werden wir beide …«, er deutete auf von Werdenfels und sich, »… dem Ehemann einen Besuch abstatten.«
»Und was machen wir?«, erkundigte sich ein Beamter, dessen muskulöser Körperbau darauf schließen ließ, dass er in seinem Freundeskreis immer dann besonders gefragt sein durfte, wenn ein Umzug ins Haus stand. »Wir können doch jetzt nicht einfach so tatenlos rumsitzen, während irgendwo in Starnberg ein perverser Vergewaltiger und Mörder rumläuft.«
»Sie haben völlig recht«, meldete sich Dr. Agasiotis zu Wort und erhob sich von seinem Platz. »Vergessen Sie bei allem Einsatz aber bitte nicht: Blinder Aktivismus hilft niemandem – uns nicht und dem Opfer auch nicht! Sobald Kriminalrat Madsen und Kommissar von Werdenfels nach ihrem Gespräch mit dem Ehemann mehr Informationen über das persönliche Umfeld der Frau haben, wird es für Sie alle genug zu tun geben.«
Die Augen sämtlicher Anwesenden waren auf Dr. Agasiotis gerichtet. Den Mann umgab eine natürliche Aura der Autorität, und so, wie er mit Anzug, Fliege und farblich passendem Einstecktuch durch den Konferenzraum wanderte, hätte man ihn ohne weiteres Styling auch für eine John-Grisham-Verfilmung casten können.
»Als Erstes muss geklärt werden, ob die Frau ihr Handy dabeihatte – in der Nähe der Leiche wurde nämlich keins gefunden. Falls ja, hat die Suche nach dem Handy oberste Priorität. Funkzellenabfrage, stille SMS, Bewegungsprofil – das ganze Programm. Machen Sie sich um die entsprechenden richterlichen Genehmigungen keine Sorgen, darum kümmere ich mich. Wie Kriminalrat Madsen bereits sagte: Nur, wenn es uns gelingt, herauszufinden, wo sich das Opfer vor seinem Tod aufgehalten hat, können wir den Tathergang erfolgreich rekonstru–«
Die auffliegende Tür unterbrach Dr. Agasiotis’ Satz. Verärgert musterte er die junge Beamtin, die mit hochrotem Kopf im Türrahmen stand und unsicher zwischen dem Oberstaatsanwalt, Madsen und von Werdenfels hin- und herblickte.
»Wir hatten uns doch ausdrücklich jede Störung verbeten!«, sagte Dr. Agasiotis tadelnd. »Oder gibt es neue Erkenntnisse vom Fundort?«
Die Polizistin verneinte.
»Dann seien Sie bitte zukünftig so freundlich, sich an unsere Anweisungen zu halten und hier nicht einfach so reinzuplatzen. Was auch immer Sie uns sagen wollten: Das hat sicherlich Zeit bis nach unserer Besprechung, nicht wahr?«
»Das weiß ich nicht, ich bin nämlich keine Ärztin«, erwiderte die Polizistin und wandte sich mit mitfühlendem Blick an Maximilian von Werdenfels. »Ich kann nur weitergeben, was die Dame aus dem Klinikum mir mitgeteilt hat. Es geht um deinen Vater, Max. Er hatte einen Herzinfarkt.«
ZWEI
Wer seine Tagungen im exklusiven Hotel »La Villa« am Ufer des Starnberger Sees abhielt, konnte von sich behaupten, die Spitze der Nahrungskette erreicht zu haben – oder aber er versuchte zumindest, gegenüber seinen Klienten diesen Eindruck zu erwecken. Dass dieses Ansinnen im Fall von Dr. Gerhard Heidemann Erfolg zu haben schien, war den beeindruckten Mienen der Konferenzteilnehmer zu entnehmen, die auf der kleinen Aussichtsterrasse zwischen toskanischem Haupthaus und Gartenpavillon standen und bei einem Glas Champagner sowohl das Ende des Regens als auch die atemberaubende Aussicht über das Anwesen und den See genossen.
»Der große Herr dort vorne ist Dr. Heidemann«, erklärte die freundliche Hotelangestellte, die Madsen und von Werdenfels an der Rezeption in Empfang genommen und auf die Freifläche begleitet hatte. Sie deutete auf einen dunkelhaarigen Mittvierziger, dessen Erscheinungsbild allen Klischees des neureichen Emporkömmlings entsprach. Die Haut war zu braun, das Hemd zu rosa und die Hose zu weiß. Dazu trug er die unvermeidlichen Tod’s Loafers und als Insignien seines sozialen Status irgendwelche VIP-Armbändchen von Automobil- oder Yachtevents. Dr. Heidemann war in ein angeregtes Gespräch mit einem älteren Herrn vertieft, der den Haarschnitt von James Last auftrug und bei dessen lachsfarbenem Jackett man zwischen Ernst und Verkleidung schlecht unterscheiden konnte.
»Vielen Dank, den Rest des Weges finden wir alleine!«, erwiderte Madsen und wandte sich an seinen Kollegen: »Bist du wirklich sicher, dass du mitkommen möchtest, Max? Ich kann das Gespräch auch ohne dich führen, wenn du ins Klinikum zu deinem Vater fahren willst.«
Von Werdenfels schüttelte den Kopf. »Danke, das ist nett von dir, Mads. Aber solange Papa noch nicht aus der Narkose erwacht ist, macht das wenig Sinn. Mama ist bei ihm und gibt mir sofort Bescheid, wenn er wach wird. Dann würde ich allerdings gerne gleich aufbrechen.«
»Na klar! Sag es einfach, wenn du losmusst. Und bis dahin wäre ich dir dankbar, wenn du dem Witwer die traurige Nachricht überbringen würdest. Erstens kannst du so was viel besser als ich, und zweitens ist mir der Typ schon unsympathisch, bevor ich auch nur ein Wort mit ihm gesprochen habe.«
Von Werdenfels nickte schmunzelnd. Es bedurfte nicht allzu viel Phantasie, um zu erahnen, dass Madsens Aversion nicht nur dem Auftreten des Unternehmers geschuldet war, sondern auch dem Gespräch, das sie wenige Minuten zuvor in Heidemanns Versicherungsagentur geführt hatten. Dort hatte sie eine blasierte Sekretärin mit missbilligendem Blick auf Madsens abgewetzte Lederjacke darüber informiert, dass ihr Vorgesetzter Gastgeber einer wichtigen Veranstaltung und daher für niemanden zu sprechen sei. Auch nicht für die Polizei. Erst als Madsen ihr mit einem strahlenden Lächeln erklärt hatte, dass er seinen glatt rasierten Arsch darauf verwetten würde, dass Dr. Heidemann sehr wohl für sie zu sprechen sei, wenn er den Grund ihres Besuches erführe, hatte der weibliche Abfangjäger pikiert das Hotel »La Villa« genannt.
Anschließend war die Sekretärin hektisch aus dem Vorzimmer gestürzt. Von Werdenfels schätzte, dass sie sich angesichts von Madsens Wortwahl auf der Bürotoilette erbrochen hatte.
»Meine Herren, Sie haben einen sehr unpassenden Zeitpunkt für Ihren Besuch gewählt«, eröffnete Dr. Heidemann kurz darauf im etwas abseits gelegenen Gartenpavillon das Gespräch und blickte dabei demonstrativ auf seinen goldenen Chronografen, dessen Größe bei jedem IOC-Funktionär Pawlow’schen Speichelfluss ausgelöst hätte. »Wie Sie vielleicht bemerkt haben, befinde ich mich gerade mitten in wichtigen Networking-Gesprächen – da ist die Anwesenheit von Polizeibeamten nur bedingt förderlich. Um was geht es denn? Vielleicht können Sie die Sache ja auch mit meiner Sekretärin regeln.«
»Das denke ich nicht«, beeilte sich von Werdenfels zu sagen, bevor Madsen Gelegenheit zu einer despektierlichen Antwort bekam. »Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Frau verstorben ist. Man hat heute Morgen ihre Leiche gefunden.«
Der Unternehmer antwortete nicht.
Stattdessen ergriff er eines der auf dem Bartresen bereitstehenden Weingläser, ging damit quer durch den Raum zu der komplett verglasten Stirnseite und ließ seinen Blick über den sanft abfallenden parkähnlichen Garten und das hölzerne Bootshaus schweifen.
Nach einer gefühlten Ewigkeit des Schweigens drehte er sich schließlich um und erkundigte sich mit zitternder Stimme: »Und Sie sind ganz sicher, dass es sich um meine Frau handelt? Jeder Irrtum ausgeschlossen?«
»Ich fürchte ja. Einer unserer Kollegen, der Ihre Frau aus dem Museumsverein kannte, hat sie eindeutig identifiziert.«
Dr. Heidemann nahm gedankenverloren einen Schluck Wein, bevor er sich mit der Stirn gegen das Glas der Panoramascheibe lehnte und einen karotinbraunen Abdruck hinterließ.
»Wie ist sie denn …? Ich meine, wo haben Sie sie denn …?«
»In einem kleinen Waldstück südlich von Starnberg, nahe der General-Fellgiebel-Kaserne. Herr Dr. Heidemann, so ungern ich es auch sage: Ihre Frau ist offensichtlich ermordet worden. Aus diesem Grunde benötigen wir jetzt auch dringend Ihre Hilfe. Wir müssen wissen, wo sie sich in den letzten Stunden und Tagen vor ihrem Tod aufgehalten hat. Und wann Sie sie zum letzten Mal gesehen haben.«
»Am Freitag«, antwortete der Unternehmer, ohne zu zögern.
»Am Freitag? Das ist vier Tage her. Wo waren Sie denn die ganze Zeit?«
Der Unternehmer errötete. »Nun, die Frage müsste vielmehr heißen: Wo war meine Frau die ganze Zeit? Ich war das Wochenende über zu Hause, aber Barbara war irgendwo unterwegs. Wir hatten am Freitag … mhmm, wie soll ich es nennen … eine kleine Meinungsverschiedenheit.«
Madsen beugte sich interessiert nach vorne und fixierte den Unternehmer mit festem Blick. »Und diese ›kleine Meinungsverschiedenheit‹ war so intensiv, dass Ihre Frau anschließend für mehrere Tage das Haus verlassen hat? Darf man denn fragen, um was es bei Ihrer Auseinandersetzung ging?«
Dr. Heidemann schlug die Hände vors Gesicht und schluchzte – für Madsens Geschmack allerdings etwas zu laut, um glaubwürdig zu sein.
»Eigentlich war es nur eine Lappalie. Es ging um unser nächstes Urlaubsziel. Barbara wollte nach Tirol, ich in die Karibik. Zuerst war das Ganze noch irgendwie komisch, denn gegensätzlicher können zwei Vorstellungen ja kaum sein. Aber irgendwann haben wir beide dann auf stur geschaltet, und die Diskussion wurde immer lauter und heftiger, bis Barbara schließlich in ihr Zimmer gestürzt und kurz darauf weggefahren ist. Ich konnte doch nicht ahnen …«
Seine Stimme erstarb, und ein heftiges Zittern überfiel seinen Körper.
»Herr Dr. Heidemann, Ihre Frau ist seit Freitagabend weg, Sie wissen nicht, wo sie ist – und Sie machen sich überhaupt keine Gedanken? Warum sind Sie denn nicht zur Polizei gegangen?«
»Weil Barbara häufiger für ein paar Tage wegfährt, auch ohne Streit. Sie setzt sich dann einfach ins Auto und fährt in die Berge in irgendein Wellnesshotel. Das ist ihre Art, den Kopf freizukriegen. Ich dachte, so was in der Art ist es auch diesmal wieder. Ihre Ausflüge dauern manchmal eine ganze Woche, deshalb habe ich mir auch keine Sorgen gemacht. Ich war wirklich fest davon überzeugt, dass Barbara sich früher oder später melden und wieder nach Hause kommen würde.«
Von Werdenfels betrachtete den Mann prüfend und zückte sein Smartphone. Während Madsen – sofern er sich überhaupt etwas notierte – herkömmliche Schreibblöcke bevorzugte, pflegte der deutlich technikaffinere Kommissar in digitaler Form zu protokollieren, und so tippte er auch diesmal ein paar Stichworte ins Notizprogramm, bevor er sich wieder an den Unternehmer wandte.
»Wir bräuchten dann bitte noch das Kennzeichen Ihrer Frau, eine Fahrzeugbeschreibung und die Handynummer. Wissen Sie, ob sie ihre Hotelaufenthalte mit Kreditkarte bezahlt hat?«
Dr. Heidemann hob bedauernd die Hände. »Ich fürchte, ich kann Ihnen nur im Hinblick auf das Auto dienen. Es ist ein rotes 2er-BMW-Cabrio. Ich habe im Büro Fahrzeugbrief und Fotos des Wagens, weil er auf meine Firma läuft. Ich lasse Ihnen das komplette Material umgehend von meiner Sekretärin ins Revier schicken. Bei Handy und Kreditkarte kann ich Ihnen allerdings nicht helfen. Wissen Sie, Barbara war in ihrer Einstellung mitunter sehr konservativ. Sie hatte gar kein Handy, und bezahlt hat sie grundsätzlich in bar.«
»Wie bitte?« Von Werdenfels hob überrascht den Kopf und warf Madsen einen zweifelnden Blick zu. »Ihre Frau hatte kein Handy? Das hat doch heute selbst jeder Zehnjährige.«
»Das mag ja durchaus sein, aber eben nicht meine Gattin«, widersprach der Unternehmer entschieden. »Barbara hatte wahnsinnige Angst davor, ständig überwacht zu werden. Ihr ist diese ganze Internet-of-Things-Geschichte höchst suspekt gewesen. Deshalb hatte sie auch keinen Mailaccount und keine Kundenkarten für irgendwelche Supermärkte. Wie gesagt: In der Hinsicht war sie sehr altmodisch.«
»Und ich dachte schon, ich wär ein Neandertaler«, brummte Madsen kopfschüttelnd. »Sagen Sie, Herr Dr. Heidemann: Sie haben doch ein Kind, richtig?«
»Ja, einen siebzehnjährigen Sohn. Jan-Hendrik ist aber seit vorletztem Schuljahr in Ettal auf dem Internat und kommt nur in den Schulferien nach Hause. Oh Gott, wie soll ich ihm das bloß beibringen? Und vor allem, wann? Ich kann hier unmöglich weg, sonst geht mir ein Megadeal durch die Lappen.«
Der Mann wanderte unruhig zwischen den Tischen hin und her. Madsen konnte sich des Gefühls nicht erwehren, dass bei dem Unternehmer der Verlust eines lukrativen Geschäfts dem der Gattin in puncto emotionaler Tragweite gleichkam.
»Eine letzte Frage noch, Herr Dr. Heidemann, dann können Sie sich wieder Ihrem Millionendeal widmen: Hatte Ihre Frau irgendwelche Busenfreundinnen, mit denen sie sich ganz offen ausgetauscht hat?«
»Warum fragen Sie das? Glauben Sie mir etwa nicht?«, zischte Heidemann mit zusammengekniffenen Augen, bevor er den irritierten Blick der beiden Beamten bemerkte und sich umgehend wieder fasste. »Ich meine, ich habe Ihnen doch schon alles gesagt. Und ich glaube nicht, dass Barbara einer Freundin mehr erzählt hätte als mir. Aber natürlich können Sie gerne selbst nachfragen. Ihre einzige engere Freundin ist Helena. Helena Berger aus Tutzing. Die Adresse habe ich nicht, aber die werden Sie ja sicherlich selbst rausfinden.«
»Natürlich. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Herr Dr. Heidemann«, sagte Madsen und verabschiedete sich von dem Unternehmer per Handschlag. Dass er dabei etwas stärker zudrückte, als es den üblichen Gepflogenheiten entsprach, lag an der großen Antipathie, die er nach wie vor gegenüber dem durchgekernerten Unternehmer und seinesgleichen empfand.
***
Hauptmann Felix von Steinäcker war eine beeindruckende Erscheinung. Nicht nur seine athletische Statur, sondern auch die akkurat geschnittene Frisur, das markante Gesicht und der stechende Blick verliehen ihm eine Distinguiertheit, die von der perfekt sitzenden Uniform mit den drei silbernen Sternen auf den Schulterklappen zusätzlich betont wurde. Seine Bewegungen wirkten geschmeidig und kraftvoll, und sein selbstsicheres Auftreten zeugte von jahrelanger Kommandotätigkeit.
»Kommen Sie doch bitte herein! Gefreiter Ötzel, zwei Kaffee für die Herren von der Kriminalpolizei!«
Bevor Madsen und von Werdenfels Gelegenheit hatten, das Getränk abzulehnen, stürmte der dienstbeflissene Adjutant bereits im Laufschritt aus dem Vorzimmer.
Madsen sah ihm fassungslos nach. »Donnerwetter! Was hat der denn vor? Will der in zehn Jahren Verteidigungsminister werden?«
Der Kompaniechef grinste anerkennend. »Sie liegen tatsächlich gar nicht so schlecht mit ihrer Vermutung. Der alte Herr dieses Rekruten ist General Ötzel, Inspekteur des Heeres, und seine Mutter ist Stabsärztin im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz. Übrigens – aber das bleibt bitte unter uns – ein furchtbarer Drache. Sie können sich also vorstellen, dass ein gewisser familiärer Druck auf den schmächtigen Schultern dieses jungen Mannes lastet – daher auch der gelegentliche Übereifer.«
Madsen warf einen kurzen Blick zu von Werdenfels und registrierte dessen mitfühlende Mimik. Was elterliche Erwartungshaltung anging, konnte sein junger Partner nicht nur ein Liedchen, sondern ganze Opern singen.
Die beiden Polizisten hatten inzwischen auf Stühlen mit olivfarbenem Kunstlederbezug Platz genommen. Madsen nutzte die Gelegenheit, die Unmenge von Zertifikaten, Diplomen und militärischen Auszeichnungen, die nahezu die gesamte Stirnwand des Büros zierten, zu begutachten. Konnte man Schützenschnüre, Sporturkunden und Fortbildungsnachweise bei einem Soldaten seines Dienstgrades noch als selbstverständlich voraussetzen, zeugten die zahlreichen internationalen Belobigungen, Ehrenmedaillen sowie die handschriftlichen Grüße und Glückwünsche mehrerer hoher politischer Würdenträger nachweislich von einer nicht alltäglichen Soldatenlaufbahn.
»Eine beeindruckende Galerie«, bemerkte Madsen und deutete auf ein Foto, das von Steinäcker auf einer KTM 400 LS-E Military zeigte. »Und eine coole Maschine! Vermutlich etwas geländegängiger als meine Fat Boy.«
Hauptmann von Steinäcker lachte kurz auf, und während er und Madsen sich über die eingeschränkte Tauglichkeit von Harley-Davidsons für den Truppeneinsatz austauschten, servierte der Gefreite Ötzel mit hochrotem Gesicht Kaffee und Gebäck. Angesichts seines Eifers hätte es Madsen nicht gewundert, wenn er anschließend Männchen gemacht und sein Vorgesetzter ihm zur Belohnung ein Leckerchen zugeworfen hätte. Doch stattdessen erteilte ihm von Steinäcker den Befehl, umgehend die beiden Rekruten herbeizuzitieren, die am Morgen die Leiche gefunden hatten.
Keine zwei Minuten später betraten die zwei jungen Männer das Büro, begleitet von einem älteren Soldaten, den die Anwesenheit von so viel Obrigkeit merklich einzuschüchtern schien. Nervös nestelte er an seinem korallenroten Barett und blickte unruhig zwischen den Anwesenden hin und her.
»Das ist Hauptfeldwebel Martens«, stellte von Steinäcker die Neuankömmlinge vor. »Er ist der Zugführer der beiden Soldaten und hatte heute die Leitung der Operation. Der Obergefreite Kisteneich zu seiner Linken hat die Leiche entdeckt. Anschließend ist der Obergefreite Thiele nochmals zum Fundort gegangen, um sich zu vergewissern, dass der Obergefreite Kisteneich sich nicht geirrt hat.«
Madsen betrachtete die beiden jungen Männer prüfend. Im Gegensatz zum frühen Morgen hatte sich das Erscheinungsbild der Soldaten grundlegend verändert. Sie trugen frisch gewaschene und gebügelte Uniformen, die Stiefel glänzten wie dereinst die Lackschuhe von Peter Alexander, und selbst die Hände der beiden wirkten, als hätten sie eine Maniküre genossen. Es war nur allzu offensichtlich, dass die Kompanieführung sich ihres untadeligen Auftretens in aller Gründlichkeit angenommen hatte.
Madsen wandte sich an den Dunkelhaarigen. »War ein ganz schöner Schock heut Morgen, oder? Schließlich findet man nicht alle Tage eine Tote.«
Der Obergefreite Kisteneich nickte eifrig. »Darauf können Sie einen lassen, Herr Kommissar! Ich hab mich echt bekotzt vor Ekel.«
Hauptmann von Steinäcker räusperte sich missbilligend. »Erstens ist Ihr Gegenüber kein Kommissar, sondern Kriminalrat. Und zweitens wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie sich etwas gewählter ausdrücken würden.«
Thiele kicherte, verstummte aber umgehend, als er den strafenden Blick seines Kompaniechefs bemerkte. Madsen fuhr indes mit seiner Befragung fort.
»Herr Kisteneich, als Sie den leblosen Körper gesehen haben, sind Sie da sofort zurück auf den Weg gelaufen, oder haben Sie sich erst noch genauer umgesehen?«
Der Obergefreite schien abermals eine flapsige Bemerkung auf der Zunge zu haben, besann sich aber dann eines Besseren und antwortete in betont akzentuierter Sprechweise: »Nein, Herr Kriminalrat, um ehrlich zu sein, hat mein Magen sofort rebelliert. Ich habe mich auf der Stelle umgedreht und bin zurück zum Kameraden Thiele. Der ist dann noch mal dorthin gegangen …«
»… und hat was gesehen?«, mischte sich von Werdenfels ein und blickte fragend zu dem zweiten Soldaten.
»Na ja, die Tote halt! Oder zumindest das, was noch von ihr übrig war. Allerdings habe ich jetzt auch nicht so genau geguckt, sondern gleich den Zugführer verständigt.«
In dem Moment, in dem sein Titel erwähnt wurde, zuckte der Hauptfeldwebel erschrocken zusammen und nahm intuitiv Haltung an.
»Ich hab dann sofort die Übung abbrechen lassen«, erklärte er eifrig, »den Kompaniechef verständigt und den gesamten Zug mit Ausnahme der beiden hier anwesenden Soldaten in die Kaserne abrücken lassen. Zusammen mit dem Herrn Hauptmann haben wir die Fundstelle abgesichert und auf die Polizei gewartet.«
»Die allerdings erst verständigt wurde, nachdem die Feldjäger vor Ort waren«, murmelte Madsen leise vor sich hin.
Der Hauptmann hatte den Kommentar dennoch vernommen und blickte den Kriminalrat vorwurfsvoll an.
»Herr Madsen, auch wir haben Dienstvorschriften, die es zu befolgen gilt. Das sollten doch gerade Sie als Polizist verstehen. Parallel zu Ihren eigenen Ermittlungen wird diese Angelegenheit selbstverständlich auch innerhalb der Bundeswehr weiterverfolgt. Schließlich wurde die Leiche von unseren Soldaten und vor unserer Kaserne gefunden. Das heißt, die Feldjäger werden einen ausführlichen Bericht schreiben, das Ganze geht dann über den Bataillonskommandeur an den Führungsstab des Heeres und von dort an das Büro des Generalinspekteurs. Da man damit rechnen muss, dass die Zeitungen in den nächsten Tagen voll mit Berichten über den Leichenfund sein werden, sollte die Bundeswehr im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit dann natürlich auch Stellung beziehen. Oder zumindest so umfassend informiert sein, dass sie es bei Bedarf umgehend könnte.«
Madsen hob beschwichtigend die Hände. »Völlig verständlich, Herr Hauptmann! Das Ganze wird seinen diplomatischen Weg nehmen, um den wir uns zum Glück nicht weiter kümmern müssen. Wir haben ja …«, er lächelte müde, um die Ironie seiner Worte zu unterstreichen, »… lediglich die Aufgabe, den Mörder zu finden und zu überführen.«
Er wandte sich abermals an die beiden jungen Soldaten. »Sie sind ausbildungsbedingt doch sicher öfter hier im Gelände unterwegs, vielleicht auch in den letzten zwei, drei Tagen. Ist Ihnen dabei irgendwas aufgefallen? Fahrzeuge, die dort nicht hingehörten, oder Personen, die Ihrer Ansicht nach möglicherweise was mit der Tat zu tun haben könnten? Irgendjemand, der Ihnen – zumindest im Nachhinein – verdächtig erschien?«
Die Rekruten schauten sich gegenseitig an und schüttelten dann die Köpfe. »Nee, uns ist nix aufgefallen«, sagte Thiele. »Allerdings scheucht uns Hauptfeldwebel Martens auch immer so durch die Botanik, dass wir so gut wie nichts von unserer Umgebung mitkriegen.«
Der Zugführer öffnete den Mund, um sich zu verteidigen, doch von Steinäcker winkte generös ab. »Lassen Sie’s gut sein, Martens, das ist völlig in Ordnung. Schließlich ist das hier ja kein Feriencamp! Meine Herren, haben Sie noch weitere Fragen an unsere beiden Obergefreiten? Ansonsten würde ich sie gerne abtreten lassen, damit sie wieder zurück zu ihrem Zug kommen.«
Madsen und von Werdenfels erhoben sich nahezu synchron von ihren Sitzen.
»Kein Problem, Herr von Steinäcker«, sagte Madsen. »Wir sind so weit durch. Wenn uns noch was einfällt, melden wir uns bei Ihnen. Ach ja, doch noch was: Uns ist aufgefallen, dass die Kaserne außerordentlich gut abgesichert ist. Hohe Zäune, Natodraht, Hundestaffel – Sie haben nicht zufällig auch eine Überwachungskamera am Tor, die in Richtung des Feldes filmt?«
Von Steinäcker dachte kurz nach und verzog dann bedauernd das Gesicht. »Die Torkamera filmt zwar in die besagte Richtung, hat aber nur einen kleinen Radius. Das Tor und die ersten zehn, maximal zwölf Meter der Kaserneneinfahrt. Alles andere hätte auch keinen Sinn, weil die Qualität der Kamera nicht ausreichen würde.«
Madsen zuckte resigniert mit den Schultern. »Schade, war nur so ’ne Idee.«
»Und gar keine schlechte«, erwiderte von Steinäcker und blickte zur Uhr. »Apropos keine schlechte Idee: Was halten Sie davon, wenn ich Sie zu einem verspäteten Mittagessen einlade? Sie sind doch jetzt auch schon seit einigen Stunden auf den Beinen.«
Madsen lächelte. »Nehmen Sie es mir bitte nicht übel, Herr von Steinäcker, aber erstens haben wir auf dem Weg schon eine Kleinigkeit gegessen, und zweitens war Kantinenessen noch nie mein Ding. Mich erinnern die riesigen silbernen Kübel irgendwie immer an Masttierhaltung.«
»Ach was, von wegen Kantinenessen.« Von Steinäcker setzte sich schwungvoll sein Barett auf den Kopf. »Ich spreche vom Offizierskasino. Da gibt es Essen à la carte! Wobei ich ausdrücklich betonen möchte, dass sich auch unsere Kantine durchaus sehen lassen kann. Vielleicht können wir Sie ja irgendwann mal davon überzeugen, Ihre Aversion über Bord zu werfen.«
»Im Leben nicht«, brummte Madsen, diesmal allerdings so leise, dass selbst der Offizier mit seinem guten Gehör es nicht vernahm. »Bevor ich in einer Kantine esse, zieht Bill Gates in ein Reihenmittelhaus!«
***
»Wird er … ich meine … kann er jemals wieder …?« Maria von Werdenfels schluchzte kurz auf und tupfte sich mit einem spitzenbesetzten Taschentuch eine Träne aus dem Augenwinkel.
Ihre Frage erschien durchaus berechtigt, denn der Anblick ihres Gatten war wahrlich beängstigend. Notdürftig mit einem mintgrünen OP-Leibchen bedeckt, war nahezu jeder freie Quadratzentimeter von Karl von Werdenfels’ Körper aufwendig verkabelt oder mit Sensoren beklebt. Darüber hinaus steckte in seiner Halsvene ein neonfarbener Katheter, durch den dem Körper Schmerz- und Beruhigungsmittel zugeführt wurden, während andere Schläuche aus dem Brustkorb Blut und Wundsekret in einen Auffangbeutel leiteten. Die Augen des Mannes waren geschlossen, sein Atem ging stoßweise und wurde übertönt vom monotonen Brummen der Beatmungsmaschine sowie vom gleichmäßigen Piepen eines EKG-Monitors.
»Es ist noch zu früh, um eine verlässliche Aussage zu machen«, sagte der Arzt, ein kleiner, kugelförmiger Mann, der seine weiße Hose so weit über den Bauch gezogen hatte, dass der Gürtel ihn in der Mitte zu teilen schien. »Hätten wir einen Stent setzen können, wäre die ganze Geschichte relativ schnell zu regeln gewesen. Leider waren bei Ihrem Mann aber insgesamt drei Kranzgefäße betroffen. Uns blieb also nichts anderes übrig, als eine Bypass-Operation durchzuführen und die verstopften Herzgefäße mit körpereigenen Adern zu überbrücken.«
»Und dafür mussten Sie …?« Maria von Werdenfels deutete fragend auf das große weiße Pflaster, das senkrecht über die Brust geklebt war.
Der Arzt nickte. »Ja, dafür mussten wir leider das Brustbein spalten und den Brustkorb öffnen. Aber machen Sie sich keine Sorgen, Frau von Werdenfels. Wir haben diese Operation schon tausendmal durchgeführt. Irgendwann muss sie ja mal klappen!« Er kicherte über seinen eigenen Witz, bis er den fassungslosen Blick seiner Gesprächspartnerin bemerkte und errötete. »Oh, bitte verzeihen Sie, gnädige Frau. Ich hatte lediglich die Absicht, Sie ein wenig aufzuheitern.«
»Nun, wenn dem so ist, dann kann ich nur hoffen, dass Ihre medizinischen Fähigkeiten nicht Ihren humoristischen Talenten entsprechen«, entgegnete Maria von Werdenfels kalt. »Und jetzt kümmern Sie sich darum, dass Ihr Chefarzt hier erscheint. Und zwar augenblicklich. Professor Rubenstein ist ein guter Bekannter meines Mannes aus dem Rotary Club, und ich halte den Zeitpunkt für ausgesprochen angebracht, ihn an die großzügigen Spenden zu erinnern, die unsere Familie dem Klinikum regelmäßig zukommen lässt. Sie verstehen, was ich damit sagen will? Ich erwarte, dass meinem Gatten die bestmögliche Behandlung zuteilwird. Und zwar vom Chefarzt höchstpersönlich – und nicht von so einem Komiker wie Ihnen!«
»Das war große Klasse!«, bemerkte eine tiefe Stimme hinter Maria von Werdenfels, während der Mediziner aus dem Raum eilte, als sei ein Rudel Krankenkassen-Sachbearbeiter hinter ihm her. »Dr. Gerling ist ein guter Arzt, da kann ich Sie beruhigen. Aber was Empathie angeht, ist bei ihm noch eine Menge Luft nach oben.«
Mit diesen Worten trat eine korpulente Krankenschwester an das Bett des Patienten, richtete mit zwei, drei geübten Griffen den Sitz der Schläuche und streckte Maria von Werdenfels dann eine bettpfannengroße Hand entgegen.
»Ich bin Schwester Clara, und unabhängig davon, ob Ihr Mann Kohle bis zum Abwinken hat oder ein Obdachloser ist, werd ich mich bestens um ihn kümmern. In meinem Aufwachraum ist während meiner gesamten Krankenschwesterntätigkeit noch nie ein Patient gestorben, und ich hab verdammt noch mal keinen Bock drauf, dass Ihr Mann mir die Statistik versaut. Also, Gnädigste, atmen Sie locker durch die Hose – wir bekommen das schon wieder hin. Zwei, drei Monate und Ihr Göttergatte flitzt wieder über Ihre Ländereien wie ein Duracell-Häschen!«
Maria von Werdenfels bedachte die Frau mit einem irritierten Blick. Weder ihr burschikoses Auftreten noch ihre Wortwahl entsprachen auch nur ansatzweise ihrer eigenen Vorstellung von Anstand und Benimm, und auch die hennarot gefärbten Haare mit der blauen Strähne und die pinkfarbenen Crocs qualifizierten die OP-Schwester nur bedingt als Mitglied ihres Bridge-Ensembles. Dennoch war sie der Frau in diesem Augenblick unendlich dankbar für ihre zuversichtlichen Äußerungen.
Sie griff in ihre Handtasche, wühlte nach ihrem Lederportemonnaie und entnahm ihm einen großen grünen Schein. »Vielen Dank, Schwester Clara, dass Sie sich gut um meinen Mann kümmern werden. Darf ich Ihnen vielleicht eine kleine – sagen wir – Zusatzgratifikation zukommen lassen, um eine entsprechende Behandlungsqualität sicherzustellen?«
Sie hielt der Krankenschwester den Schein hin und trat überrascht zurück, als diese sich mit ihrer körpereigenen Medizinballabteilung drohend vor ihr aufbaute.
»Offensichtlich haben Sie mir gerade nicht zugehört, Frau von und zu! Ich sagte, es ist mir scheißegal, ob Sie Geld haben oder nicht. Mir geht es hier nur um eins – und zwar um den Patienten! Ich werde ihm mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, bei der Genesung helfen und ihm den Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich machen. Das ist mein Job, und genau deshalb bin ich Krankenschwester geworden. Wenn Sie mir jetzt so pseudounauffällig Kohle zuschieben, bedeutet das für mich, dass Sie mich für bestechlich halten und dass Sie glauben, Sie könnten sich mit so ein paar beschissenen Euro eine bessere Behandlung für Ihren Mann kaufen. Und wenn dem so ist, gnädige Frau, dann sollten Sie hier schleunigst verschwinden, bevor ich Ihrem faltigen Hintern ein Klistier verpasse. Und dabei ist es mir scheißegal, ob Sie meinen Chef aus dem Rotier-Club kennen oder nicht!«
Maria von Werdenfels starrte die groß gewachsene Frau mit offenem Mund an.
»Bitte verzeihen Sie mir mein unüberlegtes Benehmen!«, sagte sie dann zerknirscht und blickte schuldbewusst zu Boden. »Es lag mir fern, Sie zu beleidigen. Ich bin nur der Meinung, dass gute Leistung auch honoriert werden sollte, und da ich weiß, dass die Bezahlung von Krankenschwestern allgemein mehr als unzureichend ist, wollte ich mich bei Ihnen lediglich für Ihre gute Arbeit erkenntlich zeigen.«
»Oh ja, da können Sie einen drauf lassen, dass unsere Bezahlung unzureichend ist!«, antwortete Schwester Clara, ging zu der gegenüberliegenden Wand und ergriff mit ihren großen Händen einen Besucherstuhl, als handelte es sich dabei um ein Spielzeugmöbel. »Wenn ich nicht nebenbei noch Zeitungen austragen würde, könnte ich meiner kleinen Tochter nicht mal ein Geburtstagsgeschenk kaufen. Wenn Sie uns Schwestern also wirklich was Gutes tun wollen, dürfen Sie gerne eine großzügige Spende in unsere Kaffeekasse werfen. In dem Fall profitieren dann auch alle meine Kolleginnen, und es hat nichts mit der Bevorzugung eines einzelnen Patienten zu tun. Ist das ein Deal?«
Maria von Werdenfels nickte, worauf die Schwester den Stuhl vor dem Bett ihres Mannes platzierte, eine Flasche Wasser samt Glas danebenstellte und zufrieden brummte: »Gut, dann wäre das also geklärt. Ich schlage vor, Sie setzen sich jetzt hier zu Ihrem Mann, halten ihm das Händchen und sorgen dafür, dass Sie das Erste sind, was er beim Aufwachen sieht. Wenn Sie außer dem Wasser noch irgendwas brauchen, winken Sie einfach. Ich sitze da vorne hinter der Glasscheibe und hab hier alles im Blick. Gibt’s irgendjemanden aus Ihrer Familie, den ich noch verständigen soll?«
Maria von Werdenfels schüttelte den Kopf. »Nein, vielen Dank. Mein Sohn weiß schon Bescheid. Ich habe mit ihm vereinbart, dass er erst dann kommt, wenn mein Mann wach ist.« Sie ließ sich erschöpft auf den Stuhl neben dem Bett sinken. Erst jetzt spürte sie, wie sehr ihre Kräfte geschwunden waren, seit sie die Nachricht vom Herzinfarkt ihres Gatten erhalten hatte, und sie empfand angesichts ihrer einfühlenden Art plötzlich eine tiefe Zuneigung gegenüber der raubeinigen Krankenschwester. »Wissen Sie, Schwester Clara, mein Sohn ist Polizeikommissar. Selbst wenn er wollte, könnte er gar nicht sofort kommen. Ich weiß zwar nicht im Detail, um was es bei seiner aktuellen Ermittlung geht, aber eines kann ich Ihnen versichern: Er hat ganz schön an dem Fall zu knabbern!«
***
»Ein Löffelchen Sahne?« Ohne eine Antwort abzuwarten, schaufelte Helena Berger einen solchen Berg Schlagrahm auf den Pflaumenkuchen, dass selbst ein Pottwal auf der Stelle einen diabetischen Schock erlitten hätte.
»Ja, gerne«, antwortete Maximilian von Werdenfels in Ermangelung an Alternativen und warf einen hilfesuchenden Blick zu seinem Vorgesetzten.
Doch Madsen grinste lediglich schadenfroh. Schließlich hatte sich von Werdenfels diese Situation selbst zuzuschreiben, denn dass Helena Berger, die Freundin des Mordopfers Barbara Heidemann, in puncto Häuslichkeit in eigenen Sphären schwebte, hatte sich bereits angedeutet, als sie das Grundstück betraten. Der Vorgarten war so gepflegt, dass eine Aufnahme in die Liste des UNESCO-Weltkulturerbes nur noch eine Frage der Zeit zu sein schien. Die Anzahl der Gartenzwerge und Märchenfiguren konnte mühelos mit jedem europäischen Freizeitpark konkurrieren, und spätestens als beim Betätigen der Türklingel das Volkslied »Horch, was kommt von draußen rein?« erklang, hätte von Werdenfels ahnen müssen, dass hier die personifizierte deutsche Gastlichkeit residierte – was sich dann folgerichtig auch in der Reichhaltigkeit des angebotenen Gebäcks widerspiegelte.
»Liebe Frau Berger«, wandte sich Madsen an die Hausherrin, während sich von Werdenfels durch die Sahne kämpfte wie Amundsen seinerzeit durch die Arktis. »Wir sind hier, weil –«
»Stößchen!«, unterbrach ihn die Gastgeberin. Sie hatte sich zur Feier des Tages, wie sie den unerwarteten Besuch der beiden Polizisten tituliert hatte, einen Sekt eingeschenkt und das Glas zum Prost erhoben. »Auf das Leben, meine Herren! Und Sie sind sicher, dass Sie nicht auch ein klitzekleines Schlückchen Blubberbrause möchten?«
Madsen winkte freundlich dankend ab, und auch von Werdenfels antwortete irgendetwas Ablehnendes, was aber aufgrund der Sahnemenge in seinen Backen eher klang wie der Brunftschrei eines Elches.
»Liebe Frau Berger«, wiederholte Madsen geduldig. »Wir sind hier, weil wir mit Ihnen über Barbara Heidemann sprechen möchten. Es tut uns sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Frau Heidemann tot ist. Sie wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Und um den Mörder schnellstmöglich zu finden, müssen wir mehr über Frau Heidemann erfahren. Was hat sie in ihrer Freizeit gemacht? Mit wem hat sie sich getroffen? Wo hat sie ihre Auszeiten verbracht und so weiter. Alles, was Sie uns sagen können, hilft uns. Vor allem alles, was die letzten Tage vor ihrem Tod betrifft.«
Helena Berger blickte die Polizisten verständnislos an. Die Frau war zweifelsohne nett, sympathisch und gastfreundlich – aber was ihre intellektuellen Fähigkeiten anging, hatten die beiden Ermittler bereits bei den ersten Worten erkannt, dass »Helena« und »helle« definitiv nicht über denselben Wortstamm verfügten.
»Ich verstehe nicht ganz …«, murmelte sie und zupfte sich abwesend eine nussbraune Strähne aus dem makellos geschminkten Gesicht. »Wieso sollte Barbara tot sein? So ein Unsinn. Wir haben doch am Freitagabend noch telefoniert.«
»Freitagabend?«, hakte Madsen nach. »Das ist interessant, denn zu diesem Zeitpunkt verliert sich die Spur von Frau Heidemann. Hat sie Ihnen vielleicht gesagt, wo sie sich während des Anrufes aufgehalten hat? Können Sie sich an die Nummer oder zumindest an die Vorwahl erinnern?«
»Nein, ich glaube, die Nummer war unterdrückt.«
»Verstehe. Wie war eigentlich das Verhältnis zwischen Frau und Herrn Heidemann? Gab es da öfter mal Auseinandersetzungen oder Streit?«
»Streit?« Helena Berger schüttelte entschlossen den Kopf. Den Tod ihrer Freundin schien die Frau gedanklich ebenso zu negieren wie jeden Zweifel an der Makellosigkeit der Heidemann’schen Ehe. »Die beiden sind ein absolutes Traumpaar. Sie führen eine echte Vorzeigeehe, voller Respekt, Liebe, Treue und Zuneigung. Alleine die Hochzeit auf dem Kirchplatz in Starnberg: mein Gott, diese wunderschöne Kutsche, Barbaras langes weißes Kleid, ein großer Kinderchor, weiße Tauben … Ach, es war einfach herrlich. Die beiden sind wie füreinander geschaffen. Das perfekte Paar!«
Madsen warf von Werdenfels einen verstohlenen Blick zu. Wenn es irgendetwas gab, was die Alarmglocken von Mordermittlern schrillen ließ, dann war das der Begriff »perfektes Paar«. Es mochte zweifelsohne gute Ehen geben, harmonische, stimmige, glückliche – doch sobald irgendjemand eine Beziehung als »perfekt« bezeichnete, war allergrößte Skepsis angebracht. So etwas existierte vielleicht bei Rosamunde Pilcher oder in der Raffaello-Werbung, nicht aber im wirklichen Leben.
»Hören Sie, Frau Berger, ich möchte Ihnen ungern Ihre Illusionen rauben, aber auch in der Ehe der Heidemanns hat es gelegentlich Meinungsverschiedenheiten gegeben. Eine dieser Meinungsverschiedenheiten hat dazu geführt, dass Frau Heidemann am Freitag das Haus verlassen hat und weggefahren ist. Das Ziel dieser Fahrt ist für uns von größter Bedeutung, deshalb bitte ich Sie noch einmal, gründlich nachzudenken, ob Barbara irgendetwas über ihren Aufenthaltsort gesagt hat.«
»Oder über ihre Pläne für die kommenden Tage«, ergänzte von Werdenfels. Er hatte seinen Kuchenteller inzwischen bis auf den letzten Krümel geleert und den kurzen Augenblick, in dem Helena Berger ihr Sektglas hinter sich abgestellt hatte, genutzt, um den Gürtel seiner Uniformhose ein Loch weiter zu stellen. »Haben Sie eine Ahnung, wo sich Barbara nach ihrem Aufbruch aufgehalten haben könnte? Hatte sie noch andere Freundinnen, die sie vielleicht besucht hat? Gab es Hobbys, von denen ihr Mann nichts wusste?«