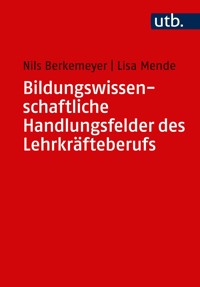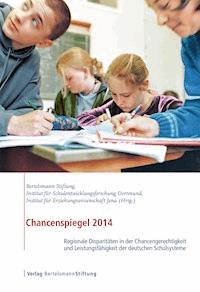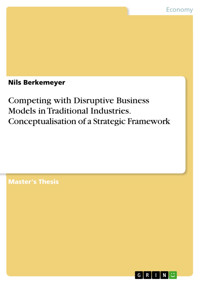3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Verlag Bertelsmann Stiftung
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Bildungschancen sind Lebenschancen. Der Chancenspiegel untersucht, wie es um die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in den deutschen Schulsystemen steht, und fragt nach deren Leistungsfähigkeit und Gerechtigkeit. Mithilfe von Daten aus der amtlichen Statistik und aus Schulleistungsuntersuchungen werden die Schulsysteme der Bundesländer in den Gerechtigkeitsdimensionen »Integrationskraft«, »Durchlässigkeit«, »Kompetenzförderung« und »Zertifikatsvergabe« vergleichend betrachtet. Im Chancenspiegel 2013 werden erstmals Veränderungen in den Ergebnissen über zwei Vergleichszeitpunkte dargestellt. Zudem beleuchtet der diesjährige Thementeil die bildungspolitischen Bemühungen und Maßnahmen der Länder zur Förderung des schulischen Ganztagsausbaus. Denn der Ganztagsschule wird das Potenzial zugeschrieben, herkunftsbedingte Benachteiligungen zu überwinden und für bessere Lernchancen zu sorgen. Der Chancenspiegel trägt mit seinen theoretischen Impulsen und empirischen Befunden dazu bei, die gesellschaftliche Debatte über ein gerechtes und leistungsstarkes Schulsystem in Deutschland sach- und lösungsorientiert zu vertiefen, um alle Kinder und Jugendlichen bestmöglich zu fördern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Bertelsmann Stiftung,Institut für Schulentwicklungsforschung derTechnischen Universität DortmundInstitut für Erziehungswissenschaft derFriedrich-Schiller-Universität Jena (Hrsg.)
Chancenspiegel 2013
Zur Chancengerechtigkeit und Leistungsfähigkeit der deutschen Schulsysteme mit einer Vertiefung zum schulischen Ganztag
Autorinnen und Autoren:Nils BerkemeyerWilfried BosVeronika ManitiusBjörn HermsteinJana Khalatbari
Unter Mitarbeit von:Michael KandersRolf StrietholtBurkhard Schwier
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in derDeutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.
© E-Book-Ausgabe 2013
© 2013 Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh
Verantwortlich: Christian Ebel
Lektorat: Heike Herrberg, Bielefeld
Herstellung: Sabine Reimann
Umschlaggestaltung: Elisabeth Menke
Umschlagabbildung: Ulfert Engelkes, Kassel
Satz und Druck: Hans Kock Buch- und Offsetdruck GmbH, Bielefeld
ISBN 978-3-86793-505-0 (Print)
ISBN 978-3-86793-535-7 (E-Book PDF)
ISBN 978-3-86793-536-4 (E-Book EPUB)
www.bertelsmann-stiftung.de/verlag
Inhalt
Vorwort
I Rahmenkonzept
1. Einleitung
2. Schulsysteme und Gerechtigkeit –Hinweise zum theoretischen Verständnis des Chancenspiegels
2.1 Schulsysteme als Untersuchungsgegenstand im Chancenspiegel
2.2 Schulsysteme und ihre gesellschaftlichen Funktionen
2.3 Betrachtung von Schulsystemen mithilfe von Gerechtigkeitstheorien
2.4 Die vier Gerechtigkeitsdimensionen im Chancenspiegel
3. Zur Veränderung von Schulsystemen
4. Methodische Hinweise
5. Grenzen und Perspektiven
II Gerechtigkeitsdimensionen schulischer Bildung im Spiegel ausgewählter Dimensionen
1. Zur Integrationskraft der Schulsysteme
1.1 Besondere Förderbedarfe und Beschulungsformen
1.2 Ausbau und Besuch von Ganztagsschulen
2. Zur Durchlässigkeit der Schulsysteme und über Anschlüsse schulischer Bildung
2.1 Übergänge und Durchlässigkeit
2.2 Anschlüsse
3. Zur Kompetenzförderung der Schulsysteme
3.1 Die Förderfähigkeit der Schulsysteme
3.2 Migrationshintergrund und soziale Herkunft
4. Zur Zertifikatsvergabe der Schulsysteme
4.1 Erworbene Abschlüsse
4.2 Fehlende Abschlüsse
5. Zur Gerechtigkeit der deutschen Schulsysteme im Ländervergleich
III Auf dem Weg zu mehr Gerechtigkeit – Aktivitäten der Länder zur Unterstützung des schulischen Ganztagsausbaus
1. Einleitung
2. Das bildungspolitische Ereignis »PISA 2000« als Impuls für die jüngere Ganztagsschulentwicklung
3. Zur bildungspolitischen Kommunikation des schulischen Ganztags in der Öffentlichkeit
4. Verankerungen des Ganztags in den Schulgesetzen der Länder
5. Zur Verteilung von Fördermaßnahmen aus dem IZBB-Programm in den Ländern
6. Regelungen zu ressourcenbezogenen Unterstützungsleistungen der Länder für Schulen mit Ganztagsangeboten: Fokus zusätzliches Lehrpersonal
7. Ganztagsschule und Chancengerechtigkeit – eine Diskussion auf Grundlage des Forschungsstands
8. Zusammenfassung
IV Fazit und Ausblick
V Anhang
1. Anmerkungen
2. Literatur
3. Tabellenverzeichnis
4. Abbildungsverzeichnis
5. Die Autorinnen und Autoren
6. Abstract
Vorwort
Bildungschancen in Deutschland:positive Trends, aber weiter großer Handlungsbedarf
Faire Bildungschancen für alle Kinder und Jugendliche sind für die Zukunftsfähigkeit und den Zusammenhalt eines Landes von grundlegender Bedeutung. Darüber gibt es keinen Streit im Land. Wie fair bzw. gerecht es aber im deutschen Bildungswesen konkret zugeht, darüber wurde schon länger erbittert gestritten – oft mehr ideologisch als faktenbasiert. Erst die PISA-Premiere vor gut zehn Jahren warf ein besonderes empirisches Schlaglicht auf die Chancengerechtigkeit in Deutschlands Schulen. Ein zentraler Befund lautete damals: In keinem anderen OECD-Land hängt der Bildungserfolg so stark von der sozialen Herkunft ab wie in Deutschland. Diese Diagnose hat dazu beigetragen, die bildungspolitische Debatte hier zu Lande etwas zu entideologisieren, aber noch immer schlagen die Wogen von Zeit zu Zeit hoch – auch, weil die Definition von Chancengerechtigkeit als ungeklärt gilt, wie auch die Frage, anhand welcher Indikatoren sie zu messen ist.
Der Chancenspiegel, der im vergangenen Jahr erstmals erschien, versucht diese Lücke zu schließen. Er fokussiert, anders als andere Formate der Bildungsberichterstattung, auf ein einzelnes Thema: die Chancengerechtigkeit der Schulsysteme Deutschlands. Dabei nimmt das Instrument sowohl die Integrationskraft und die Durchlässigkeit von Schulsystemen in den Blick als auch Dimensionen der Leistungsfähigkeit wie die Kompetenzförderung oder die Abschlüsse. Denn ein Schulsystem kann nur dann als fair bzw. gerecht angesehen werden, wenn es den Kindern und Jugendlichen Chancen eröffnet, ihr Potenzial zu entfalten und herausragende Leistungen zu erzielen – unabhängig von ihrer Herkunft. Andersgesagt: Leistung und Gerechtigkeit sind kein Widerspruch in einem Bildungssystem, das allen Kindern und Jugendlichen gerecht werden will.
Ein Jahr nach seiner Erstauflage analysiert der vorliegende Chancenspiegel nun erstmals die Veränderung von Bildungschancen in der Zeitperspektive. Verglichen werden vorrangig Zahlen und Daten aus dem Schuljahr 2011/12 mit denen aus dem Schuljahr 2009/10. Gewisse Einschränkungen erfahren mussten die Autoren wegen fehlender Verfügbarkeit von und mangelnden Zugangs zu Daten im Bereich der Kompetenzförderung. Trotzdem lassen sich deutliche Trends ablesen.
Das zentrale Ergebnis lautet: Die Chancengerechtigkeit hat sich in den vergangenen zwei Jahren deutschlandweit leicht verbessert. Um nur zwei Beispiele zu nennen: Das Risiko, die Schule ohne Abschluss zu verlassen, ist in fast allen Bundesländern gesunken, und die Chancen auf den Erwerb der Hochschulreife sind in den meisten Bundesländern gestiegen. Auf der anderen Seite wird deutlich, dass nach wie vor großer Handlungsbedarf besteht. Immer noch ist das Risiko für Förderschüler hoch, separat unterrichtet zu werden. Und die Aussicht eines Schülers, einen Platz in einer Ganztagsschule zu bekommen, ist weiterhin eher gering, vor allem im Blick auf gebundene Ganztagsschulen, die nach empirischen Studien für die Bildungschancen besonders wirksam sind. Nicht zuletzt deshalb hat auch weiterhin die soziale Herkunft großen Einfluss auf den Bildungserfolg. Das gilt für den Primarbereich, auf den bei der Kompetenzförderung im vorliegenden Chancenspiegel fokussiert wird wie auch für den Sekundarbereich, der im vergangenen Jahr im Fokus des ersten Chancenspiegels stand.
Unverändert stark ausgeprägt ist das Gefälle zwischen den Bundesländern. So zeigt der unterschiedliche Umgang mit Inklusion und schulischem Ganztag, dass es für diese zentralen Herausforderungen nach wie vor kein gemeinsames Verständnis der Länder oder bundesweite Standards gibt. Im Ergebnis bedeutet das auch, dass die Schulsysteme der Länder den Kindern und Jugendlichen höchst unterschiedliche Bildungschancen bieten – wenn auch kein Land überall vorbildlich und kein Land überall Schlusslicht ist. Wir freuen uns, wenn der Ländervergleich im Chancenspiegel für die Stärken und Schwächen der jeweiligen Schulsysteme sensibilisiert und Impulse gibt, an welchen gelungenen Beispielen sich Politik im Bildungsföderalismus orientieren kann.
Zweifellos liegt im ganztägigen Lernen ein großes Potenzial für mehr Chancengerechtigkeit und größere Leistungsfähigkeit im Schulsystem, das noch nicht ausreichend genutzt wird. Der qualitative Teil des Chancenspiegels beschäftigt sich deshalb in diesem Jahr mit Strategien zum Ausbau der Ganztagsschulen in den Bundesländern.
Wir danken Prof. Dr. Wilfried Bos, Prof. Dr. Nils Berkemeyer, Veronika Manitius und ihren Teams an den Universitäten Dortmund und Jena für die Erarbeitung des zweiten Chancenspiegels. Ihr innovativer Ansatz, die zurzeit zentralen Theorien der Gerechtigkeit mit der Schultheorie zu verbinden und ein empirie- bzw. indikatorengestütztes Verständnis von Chancengerechtigkeit grundzulegen, ist unserer Meinung nach ein Meilenstein für eine sachliche Debatte um faire Bildungschancen in Deutschland. Auch dem wissenschaftlichen Beirat danken wir herzlich für sein Engagement bei der Qualitätssicherung des Instruments, namentlich Prof. Dr. Rolf Becker, Prof. Dr. Isabell van Ackeren, Prof. Dr. Thomas Rauschenbach, Prof. Dr. Knut Schwippert, Prof. Dr. Horst Weishaupt und Prof. Dr. Ludwig Wigger.
Wir sind überzeugt, dass Staat und Gesellschaft weiter intensiv an Lösungen für mehr Chancengerechtigkeit in unserem Schulwesen arbeiten müssen. Mit dem Chancenspiegel 2013 laden wir deshalb erneut alle Bildungsinteressierten ein, sich an der Debatte über die Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen in unserem Land zu beteiligen. Alle Verantwortliche in den Bundesländern hoffen wir dabei zu unterstützen, voneinander zu lernen.
Dr. Jörg Dräger
Ulrich Kober
Mitglied des Vorstands
Director
der Bertelsmann Stiftung
Programm Integration und Bildungder Bertelsmann Stiftung
I Rahmenkonzept
1. Einleitung
Der Chancenspiegel ist ein gemeinsames Projekt der Bertelsmann Stiftung, des Instituts für Schulentwicklungsforschung der Technischen Universität Dortmund und des Instituts für Erziehungswissenschaft der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Im Jahr 2012 erschien der erste Chancenspiegel (Berkemeyer, Bos und Manitius 2012). Die dort erstmals vorgestellte gerechtigkeitsfokussierte Konzeption des Instruments zur Untersuchung der Chancengerechtigkeit von Schulsystemen ist auch das Grundgerüst des hier vorgelegten zweiten Chancenspiegels. Erneut stellen wir mithilfe der Analyse der Schulsysteme in vier Gerechtigkeitsdimensionen einen Beitrag für die Diskussion über gerechte und leistungsfähige Schulsysteme bereit. Nach einer Bestandsaufnahme im ersten Chancenspiegel werden nun neben der Beschreibung des Status quo auch Veränderungen in den Schulsystemen hinsichtlich der betrachteten Indikatoren zwischen zwei Berichtslegungen aufgezeigt, wobei ein Zeitraum von drei Schuljahren abgebildet werden kann.
Der Chancenspiegel gliedert sich in drei Teile. Die Rahmenkonzeption behandelt die theoretische Fundierung und die Indikatorisierung des Instruments. Im eigentlichen Hauptteil erfolgt dann die empirische Betrachtung der Schulsysteme im Hinblick auf ihre Chancengerechtigkeit. Dies geschieht in den vier Gerechtigkeitsdimensionen »Integrationskraft«, »Durchlässigkeit«, »Kompetenzförderung« und »Zertifikatsvergabe« unter Rückgriff auf aktuelle Daten aus der amtlichen Statistik und Studien der empirischen Bildungsforschung, wie IGLU 2011 (Bos et al. 2012a). In einem dritten Teil, dem sogenannten Thementeil, wenden wir uns den Aktivitäten und Bemühungen der Länder zur Verbesserung der Chancengerechtigkeit ihrer Schulsysteme zu. Dabei untersuchen wir unter dem übergreifenden Fokus »individuelle Förderung«, die als bedeutsame Strategie für die Herstellung von mehr Chancengerechtigkeit gilt, inwiefern die Länder hier Maßnahmen initiieren.
Um den Analysefokus einzugrenzen, werden in jedem Chancenspiegel andere Themen der individuellen Förderung behandelt. Wurden im ersten Chancenspiegel Strategien zur Sprach- und Leseförderung vorgestellt, so betrachten wir in diesem Jahr die Aktivitäten der Länder zum Ausbau des schulischen Ganztags, der politisch besehen besonders das Ziel einer verbesserten Förderung von Schülerinnen1 und Schülern verfolgt.
Die Unterscheidung des Chancenspiegels in einen Hauptteil, in dem empirisch anhand von Indikatoren Beschreibungen zum Status quo der Schulsysteme vorgenommen werden, und einen Thementeil, der auch qualitative Analysen vornimmt und über einzelne Steuerungsversuche in den Schulsystemen berichtet, kommt der zunehmenden Forderung nach, Bildungsberichte um qualitative Aspekte, etwa zu problemorientierten Aktivitäten, zu erweitern (Döbert 2010).
2. Schulsysteme und Gerechtigkeit –Hinweise zum theoretischen Verständnis des Chancenspiegels
Der Chancenspiegel ist ein Instrument, das über die Chancengerechtigkeit der 16 deutschen Schulsysteme indikatorenbasiert Auskunft gibt. Damit ist der Gegenstand benannt, mit dem wir uns beschäftigen (die Schulsysteme), und gleichzeitig der thematische Analysefokus beschrieben, mit dem wir diesen Gegenstand untersuchen möchten, nämlich die Frage, was die Schulsysteme der Bundesländer für die Chancengerechtigkeit zu leisten vermögen. Diese Analyseperspektive wirft wiederum vielfältige Fragen auf, anhand derer unterschiedlichen Aspekten von Chancengerechtigkeit nachgegangen werden kann:
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!