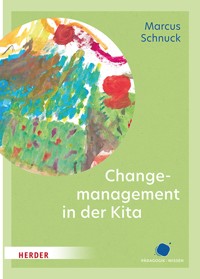
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Der vorgestellte Ansatz der (pädagogischen) Konzeptionsentwicklung ist eine kontinuierliche und praxisorientierte Methode, die den sich ständig verändernden Anforderungen des Kita-Alltags gerecht wird – besonders im Hinblick auf den Fachkräftemangel. Ohne zusätzliche Instrumente zu erlernen, führt das im Buch beschriebene Vorgehen schnell zu greifbaren Erfolgserlebnissen und lässt sich problemlos in den Alltag von Krippe und Kindergarten integrieren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Marcus Schnuck
Change-Management in der Kita
Veränderungsprozesse aktiv und nachhaltig gestalten
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2025
Hermann-Herder-Str. 4, 79104 Freiburg
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Bei Fragen zur Produktsicherheit:
Umschlagkonzeption und -gestaltung: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © Theia Farias da Silva
Papierstruktur im Innenteil: © Charunee Yodbun – shutterstock
Satz: Sabine Hanel, Gestaltungssaal
Herstellung: GRASPO CZ, A.S.
ISBN Print 978-3-451-03594-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-451-83711-1
ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83709-8
Inhalt
Einleitung
1. Wissensgrundlagen zum Change-Management
1.1 Was ist unter Change-Management zu verstehen?
1.2 Anlässe für Change-Management
1.3 Sinn als Bezugspunkt aller Veränderungsprozesse
2. Grundlogik der Gestaltung von Veränderungsprozessen
2.1 Ziel von Veränderungsprozessen
2.2 Visionen und Leitbilder im Veränderungsprozess
2.3 Veränderung kann nur von innen gelingen
2.4 Ein Modell zur Gestaltung von Veränderungsprozessen
2.5 Was es in Veränderungsprozessen zu beachten gilt
2.6 Die Rolle der Leitung in Veränderungsprozessen
3. Die pädagogische Konzeption als Instrument zur Steuerung von Veränderungsprozessen
3.1 Was ist eine pädagogische Konzeption?
3.2 Aufgabe der pädagogischen Konzeption
3.3 Kritik an den gängigen Konzeptionsentwicklungsverfahren
3.4 Der zirkuläre Konzeptionsentwicklungsprozess
3.5 Die Weiterentwicklung der pädagogischen Konzeption als Antwort auf Veränderung
3.6 Veränderungsprozesse und Konzeptionsentwicklungsprozesse – zwei Seiten einer Medaille
4. Das Qualitätsmanagement als Instrument zur Steuerung von Veränderungsprozessen
4.1 Ziel und Funktion des Qualitätsmanagements
4.2 QM-Prozesse
5. Konzeptionsweiterentwicklung und QM zusammen denken, um Veränderung praxisnah zu gestalten
5.1 Von der Praxis aus denken
5.2 Vorteile der Verbindung
Literatur
Einleitung
»Die Erschöpfung kommt ja nicht nur von der vielen Arbeit, sondern häufig auch dann, wenn in der vielen Arbeit immer weniger Sinn gesehen wird.«Monika Buhl
Dieses Buch bietet eine Lösung an, wie Veränderungen in Kitas professionell, aktiv und nachhaltig gestaltet werden können. Es möchte jede Einrichtung dabei unterstützen, in einen Zustand zu kommen, in dem ihr bzw. ihrem Team mehr gelingt als ein situatives Anpassen an die jeweiligen Herausforderungen des Alltags. Um das zu erreichen, möchte ich jede einzelne Einrichtung an einen Punkt begleiten, von dem aus es gut möglich ist, die Dinge mehrheitlich bewusst und gewollt zu steuern.
Ausgehend von der Realität der pädagogischen Praxis lege ich diesem Buch den Gedanken zugrunde, dass Veränderungen etwas Normales und Alltägliches sind – und nicht die Ausnahme. Selbstverständlich braucht der Alltag jeder Kita ein Mindestmaß an Kontinuität und Beständigkeit, damit es nicht chaotisch wird. Doch ist Veränderung ein konstantes Merkmal des pädagogischen Alltags. Mit jedem Kita-Jahr verlassen Kinder mit ihren Familien die Einrichtung und neue, andere Menschen kommen hinzu. Auch Veränderungen im Team sind ein natürlicher Bestandteil des Alltags in Kindertageseinrichtungen. Dabei bringen die Teammitglieder vielfältige Bedürfnisse und Perspektiven ein. Damit die Pädagogik sowohl den Kindern gerecht wird, die die Einrichtung besuchen, als auch den Pädagog:innen, die die Kita jeden Tag aufs Neue gestalten, sollte sie stets dynamisch bleiben, sich anpassen können und kontinuierlich weiterentwickeln.
Um die Dinge möglichst einfach zu halten, konzentriere ich mich hier auf einen Kerngedanken: Durch ein verändertes Vorgehen bei der Konzeptionsentwicklung lassen sich die Gestaltung von Veränderungsprozessen, die Konzeptionsentwicklung und das Qualitätsmanagement zusammen denken. Auf diese Weise können die vorhandenen Ressourcen effizienter genutzt und ein praxisnaher Bezug hergestellt werden.
Durch die Konzentration auf diesen Kerngedanken fallen unweigerlich einige Aspekte weg, die ebenfalls die Gestaltung von Change-Prozessen betreffen. Dabei handelt es sich sowohl um grundsätzliche Themen, wie etwa die Teamentwicklung, als auch Punkte wie zum Beispiel das Projektmanagement. Diese Einschränkung halte ich jedoch für vertretbar, da ich in der Praxis die Erfahrung mache, dass Teams und/oder Leitungen von selbst erkennen, was sie noch brauchen, nachdem sie den leitenden Grundgedanken erst einmal verinnerlicht haben.
Um dieses Verstehen zu ermöglichen, ist das Buch folgendermaßen aufgebaut: Im ersten Kapitel wird geklärt, was mit Change-Management genau gemeint ist, wie der Begriff in diesem Buch verstanden wird und wie er sich von dem verwandten Terminus der Organisationsentwicklung abgrenzt. Es widmet sich den Anlässen für Change-Vorhaben und macht deutlich, dass das Erleben von Sinn der Bezugspunkt für alle Veränderungsprozesse ist.
Das zweite Kapitel ist der Grundlogik von Veränderungsprozessen gewidmet. Zum einen stellt es ein Modell zur Gestaltung von Veränderungsprozessen vor (Schiersmann & Thiel 2018). Gleichzeitig macht es deutlich, worauf dieses Modell gedanklich basiert. Diese Logik und ihre Voraussetzungen zu verstehen ermöglicht es, die Zusammenhänge und die große Nähe zur jeweiligen Logik der Konzeptionsentwicklung und des Qualitätsmanagements nachzuvollziehen.
Darauf aufbauend wird im dritten Kapitel ein Vorgehen zur (Weiter-)Entwicklung der pädagogischen Konzeption vorgeschlagen (Schnuck 2023). Im Kern handelt es sich um einen Prozess, in dem die bislang übliche Vorgehensweise der Grundlogik von Veränderungsprozessen angeglichen wird. Dadurch wird der Charakter der pädagogischen Konzeption als zentrales Steuerungsinstrument deutlich.
Das vierte Kapitel betrachtet auf grundsätzlicher Ebene das Qualitätsmanagement – erneut mit dem Fokus auf dessen Grundlogik. Dadurch werden weiterführende Überlegungen unabhängig von jeweils bestimmten Qualitätsmanagementsystemen möglich. Zu verstehen, wie sich Change-Management, Konzeptions(weiter)entwicklung und Qualitätsmanagement zusammen denken (und praktizieren) lassen, befreit natürlich nicht von der Aufgabe, Anpassungen an die eigene Situation vor Ort bzw. das eigene QM-System vorzunehmen.
Im fünften Kapitel werden abschließend die Kerngedanken zusammengefasst. Damit werden die Überlegungen, wie und warum sich die drei verwandten Elemente, die alle mit Veränderung zu tun haben, zusammen denken und praktizieren lassen, auf den Punkt gebracht.
1. Wissensgrundlagen zum Change-Management
Die Themen in diesem Kapitel sind
→ Verständnis des Begriffs Change-Management
→ Anlässe für Change-Management
→ Die Bedeutung von Sinnhaftigkeit in Veränderungsprozessen
1.1 Was ist unter Change-Management zu verstehen?
Der erste Schritt zu einer eingehenden Beschäftigung mit dem Change-Management ist eine Begriffsklärung. Dafür wird das Change-Management von der Organisationsentwicklung abgegrenzt und der Begriff Change-Management selbst einer kritischen Betrachtung unterzogen. Anschließend wird das Verständnis von »Change« formuliert, das diesem Buch zugrunde liegt. Denn, anders als die Bekanntheit dieses Begriffs es nahelegt, existiert keine einheitliche Definition für den Begriff Change-Management.
1.1.1 Change-Management, Organisationsentwicklung oder einfach Veränderung?
Beim Change-Management geht es um die bestmögliche Gestaltung eines Weges vom Ausgangspunkt zum Ziel (vgl. Lauer 2014, S. 4). »Mithilfe des Change Managements ist es möglich, Veränderungsprozesse gut zu strukturieren und Möglichkeiten zur Umsetzung langfristig zu planen. Dabei ist es zunächst wichtig, den Begriff Change-Management zu definieren: …. (Keller 2022, S. 19).
DEFINITION
Change-Management
» … Change-Management beschreibt planmäßige mittelfristige bis langfristige, wirksame Veränderungen von Verhaltensmustern und Fähigkeiten, um zielgerichtet Prozesse und Kommunikationsstrukturen zu optimieren. Eine ganzheitliche Betrachtung auf die Organisation Kindertageseinrichtung ist notwendig« (ebd.).
Sowohl Lauer als auch Keller weisen darauf hin, sich stets den Umstand bewusst zu machen, dass Change-Prozesse immer von Menschen getragen werden. Die Beteiligung der vom Change-Prozess Betroffenen spielt also eine wichtige Rolle.
Schiersmann definiert Organisationsentwicklung wie folgt: »Bei Organisationsentwicklung handelt es sich um eine längerfristige, gezielte und geplante Veränderung ausgewählter Bereiche bzw. Dimensionen einer Organisation bzw. einer Gesamtorganisation unter aktiver Beteiligung der Beschäftigten. Es geht dabei z.B. um die Stärkung der Kommunikations- und Organisationskultur, der Zusammenarbeit in Teams, um neue Geschäftsmodelle oder Organisationsstrukturen. Beim Konzept der Organisationsentwicklung spielen die Beteiligung der Betroffenen und damit die Lernprozesse der Organisation eine zentrale Rolle – im Gegensatz zur Unternehmensberatung, die sich eher als Fachberatung versteht« (Schiersmann 2023, S. 212).
Vergleicht man diese Definitionen miteinander, ist der Unterschied gering. Weber (2023) bringt es auf den Punkt, wenn sie schreibt:
»Die theoretischen Ansätze und Modelle zur Gestaltung von Veränderungsprozessen sind in ihrer Vielzahl kaum noch zu überschauen. Sie vereinen jedoch zwei übergeordnete Ziele:
1. die Steigerung der Leistungsfähigkeit, insbesondere der Lernfähigkeit der Organisation, sowie
2. eine verbesserte Arbeitssituation der Mitarbeitenden.
[…] In letzter Konsequenz müssen diese Ansätze Selbststeuerungspotenziale für künftige Entwicklungen bei den Mitarbeitenden der Einrichtung entfalten« (ebd., S. 48).
Bei dem erwähnten Aspekt der »Leistungsfähigkeit« geht es weniger um die Leistungsfähigkeit und -bereitschaft der einzelnen Mitarbeitenden. Vielmehr geht es um die Verbesserung der Fähigkeit der Kita (Firma, Institution etc.), die Probleme, mit denen sie konfrontiert ist, zu bewältigen. Das bedeutet auch: Je besser dies der Organisation Kita gelingt, umso weniger belasten diese Probleme die Menschen, die in ihr arbeiten. Es verbessert sich also (auch) die Arbeitssituation. Dabei kommt es auf die Selbststeuerungs- und Lernfähigkeit der Kita an.
Ausgehend von diesen Gedanken lässt sich die Frage stellen, ob eine Unterscheidung zwischen Change-Management und Organisationsentwicklung überhaupt notwendig ist. Wenn eine exakte Trennung zumindest schwierig ist, könnte man allgemein von Veränderung sprechen, anstatt Dinge zu trennen, die fließend ineinander übergehen (können). Die in diesem Buch vertretene Auffassung von Change-Management tendiert in diese Richtung und hält jedoch die Unterscheidung zwischen Change-Management und Organisationsentwicklung zugleich für hilfreich. Der zentrale Unterschied liegt in der Betrachtungsebene. Keller (2022, S. 19) spricht in ihrer Definition davon, dass » [e]ine ganzheitliche Betrachtung auf die Organisation Kindertageseinrichtung (..) notwendig [ist]«. Damit meint sie die einzelne Kita als Ganzes, das gesamte Haus mit all seinen Leistungen, Abläufen etc. und Menschen. Wenn Schiersmann (2023, S. 212) von ausgewählten Bereichen »bzw. Dimensionen einer Organisation bzw. einer Gesamtorganisation« spricht, meint sie einen größeren organisationalen Zusammenhang. Die einzelne Kita ist bei dieser Betrachtungsweise ein Element oder Teil (Untereinheit) des Gesamtsystems, also ihres Trägers. Das kann ein reiner Kita-Träger in unterschiedlicher Größe sein, es kann sich aber auch um ein größeres Gesamtsystem handeln, bei dem die Kitas ein Tätigkeitsfeld unter mehreren sind, wie zum Beispiel bei Kommunen, Kirchkreisen oder (mehr oder weniger großen) Verbandsstrukturen.1
ÜBERBLICK
Change-Management vs. Organisationsentwicklung
Wenn wir uns jetzt eine konkrete Einrichtung vorstellen, zum Beispiel die Kita Sonnenschein, lässt sich vereinfacht sagen: Wenn es um die Kita Sonnenschein allein geht (z.B. Einführung eines neuen Beobachtungsverfahrens oder Eingewöhnungsmodells), denken wir an Change-Management. Geht es um die Kita als Element in einem Gesamtsystem (z.B. Entwicklung und Einführung einer Rahmenkonzeption oder eines Zeiterfassungssystems) sprechen wir von Organisationsentwicklung.
Beim Change-Management wie auch bei der Organisationsentwicklung geht es gleichermaßen um die planvolle, systematische Gestaltung von Veränderung mit dem Ziel, nachhaltige Verbesserungen hinsichtlich der Kommunikation und Abläufe zu erzielen und/oder die »Problemlösefähigkeiten« der Organisation zu erweitern. Die Veränderung erfolgt unter Beteiligung der Menschen in der Organisation. Ebenfalls zentral ist die Fähigkeit der Organisation, als Organisation zu lernen.
Über diese Gemeinsamkeiten hinaus macht die Betrachtungsebene (Kita als einzelnes System für sich oder als Element in einem Gesamtsystem) einen größeren Unterschied bei der Gestaltung von Veränderungen, als es möglicherweise auf den ersten Blick erscheint. Dabei handelt es sich zum einen um die Schlüsse, die man aus der Analyse zieht (z.B. die Gestaltungsmöglichkeiten, die das Team einer Kita tatsächlich hat), und zum anderen um die Art und Weise, wie der Veränderungsprozess angelegt, geplant und gestaltet wird.
Weil die Überlegungen und Anregungen sich hier (siehe Einleitung) auf das System der einzelnen Kita beziehen, wird im Folgenden von Change-Management gesprochen. Dennoch werden sowohl Erkenntnisse aus dem Kontext des Change-Managements als auch der Organisationsentwicklung berücksichtigt.
1.1.2 Kritik am Begriff »Change-Management«
Der Begriff Change-Management legt die Vermutung nahe, dass sich Veränderungen managen, also gezielt planen und von Anfang bis Ende steuern lassen. Solche linearen Vorstellungen haben mit der Realität von Veränderungsprozessen allerdings wenig gemein. Vielmehr ist es für Veränderungsprozesse wesentlich, »sich von solchen Steuerungsvorstellungen zu verabschieden und einen offenen und situativen Umgang mit sich verändernden Umwelten zu erlernen« (Clement 2018, S. 26).
Veränderungsprozesse lassen sich durchaus steuern, aber sie lassen sich nicht kontrollieren. Schiersmann und Thiel (2018, S. 38) sprechen in diesem Zusammenhang von den »Grenzen der Steuerbarkeit und Planbarkeit organisationaler Veränderungsprozesse«. Die Komplexität in Veränderungsprozessen ist zu hoch, als dass einfache Modelle von Ursache-und-Wirkung oder eindeutige Pfade vom Problem zur Lösung als realistisch anzunehmen sind.
Jedes Kita-Team, das einmal Veränderungen an seinem Tagesablauf vorgenommen hat, weiß, dass solche Eingriffe neben den beabsichtigten Wirkungen auch Auswirkungen an anderer Stelle haben. Werden in einer Krippe zum Beispiel die Rahmenbedingungen für die Schlafsituation verändert, hat dies häufig auch Auswirkungen auf die Pausenregelungen, was wiederum seinerseits Auswirkungen haben kann. Was bereits im Kleinen gilt, gilt für größere Veränderungsprozesse erst recht.
ÜBERBLICK
Change-Management jenseits von richtig und falsch
Folglich geht es bei einem hilfreichen Change-Management nicht darum, vorgezeichnete Wege nach der Maßgabe »richtig« oder »falsch« zu gehen. Vielmehr geht es um das eigenständige Auffinden, Aufzeigen und Entwickeln von Räumen, die produktive Interaktionen erhöhen und konstruktiv Selbstorganisation ermöglichen (vgl. Clement 2018).
Bildlich gesprochen: Den Weg vom Problem zur Lösung legt das jeweilige Team nicht mit Google-Maps zurück, sondern mithilfe eines Kompasses. Das erfordert Mut und Offenheit sowie Fehlerfreundlichkeit und Kreativität.
1.1.3 Das zugrunde liegende Change-Verständnis
Kommen wir noch einmal auf die Ausgangsdefinition (siehe Seite 8) zurück: »Change Management beschreibt planmäßige mittelfristige bis langfristige, wirksame Veränderungen von Verhaltensmustern und Fähigkeiten, um zielgerichtet Prozesse und Kommunikationsstrukturen zu optimieren. Eine ganzheitliche Betrachtung auf die Organisation Kindertageseinrichtung ist notwendig« (Keller 2022, S. 19).
Diese Definition von Keller ist die Grundlage für unser Change-Verständnis, das im Folgenden anhand einiger Aspekte weiter konkretisiert wird.
Kontinuierlicher Wandel
Hier stellt sich zunächst die Frage, in welchem Verhältnis Alltag und Veränderung stehen. Sind Veränderungen das, was den Alltag unterbricht? Schiersmann und Thiel (2018, S. 38) kommen zu dem Schluss, dass es eines kontinuierlichen Wandels bedarf, da punktuelle, begrenzte Veränderungsprozesse nicht mehr ausreichen.
Bezogen auf Kindertagesstätten zeigt sich dies z. B. am Fachkräftemangel, der zunehmenden gesellschaftlichen Vielfalt, dem Ausbau von Betreuungsplätzen und der wachsenden Größe der Einrichtungen – all das erfordert ein fortlaufendes Neudenken im Alltag.2
Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen: Der Alltag in Kitas besteht auch heute nicht ausschließlich aus Veränderung. Aber Veränderung ist zu einer Normalität geworden, und Phasen der Ruhe und Stabilität wechseln sich kontinuierlich mit Phasen der Veränderung ab. Hinzu kommt natürlich, dass eine bedürfnisorientierte Pädagogik nicht statisch sein kann.
Menschen gestalten Wandel
Change-Management ist die Gestaltung des Weges zum Ziel und damit eine Aufgabe, die sich vor allem nach innen richtet. Denn es geht darum, wie die Mitglieder des Teams einer Kita auf die sich verändernden Umstände reagieren, die sie und ihre Kita betreffen (vgl. Lauer 2014, S. 4). Wenn also, wie eingangs erwähnt, Veränderung von Menschen getragen wird, ist damit gemeint, dass mittels Change-Vorhaben zwar Prozesse und Kommunikationsstrukturen verändert werden können, diese aber nicht unabhängig von den beteiligten Menschen zu denken sind. Wir sprechen also von Handlungen, die von Menschen ausgeführt werden.
PRAXISBEISPIEL
Mittagessen
Das Mittagessen ist auch in der Kita Sonnenschein eine wichtige Bildungsgelegenheit. Hier wird dafür gesorgt, dass alle satt werden und gut durch den Tag kommen. Für einen möglichst reibungslosen Ablauf sind bestimmte Prozesse festgelegt:
1.
Essen kochen:
Caterer
2.
Essen aufbereiten:
Hauswirtschaftskraft
3.
Essen austeilen:
Fachkräfte
4.
Geschirr spülen und aufräumen:
Hauswirtschaftskraft
Das Team war unzufrieden damit, dass die Kinder sich nicht in größerem Rahmen beteiligen konnten. Deshalb beschlossen die Fachkräfte, das Mittagessen so zu gestalten, dass die Kinder künftig die Möglichkeit haben, sich ihr Essen selbst zu nehmen. Dies erforderte eine Umstellung in der Vorbereitung der Mahlzeiten: Anstelle einer großen Schüssel für alle Tische wurde nun für jeden Tisch eine kleinere Schüssel bereitgestellt. Die Fachkräfte würden den Kindern nicht mehr das Essen austeilen, sondern sie dabei begleiten und unterstützen, sich selbst zu nehmen.
Die Veränderung richtet sich in diesem Beispiel nach innen, da sie bedeutet, dass die am Prozess beteiligten Personen künftig andere Handlungen vollziehen. Und welche anderen Handlungen das sein könnten, denken sie sich zudem selbst aus. Die Hauswirtschaftskraft verteilt das Essen auf mehrere Schüsseln, die auch alle wieder gereinigt werden müssen. Die Kinder befüllen ihre Teller selbstständig und haben so die Möglichkeit, die Verantwortung für sich selbst und ihre Bedürfnisse zu übernehmen.
Bei solchen Veränderungen (neue Handlungen) ist es wichtig, dass die Betroffenen mindestens in einem gewissen Maß zur Umsetzung bereit sind. Dazu gehört, dass sie den Veränderungen einen klaren Sinn zuschreiben können (siehe Kapitel 1.3). Deshalb ist es wichtig, dass die betroffenen Personen an der Gestaltung von Veränderungsprozessen beteiligt werden. Zudem ist die Beteiligung der Mitarbeitenden essenziell, um die Leistung und Qualität zu verbessern und Voraussetzungen zu schaffen, unter denen sie sich bestmöglich entfalten können (vgl. Weber 2023, S. 30).
Struktur und Person
Veränderungsprozesse betreffen sowohl die Strukturen (Abläufe, Regeln und Regelungen, Verantwortlichkeiten etc.) als auch die Personen. Die jeweiligen Strukturen bestehen nicht an sich. Es gibt sie nur, wenn Menschen sie mit Leben füllen. Das machen wir, indem wir handeln. Der Prozess »Mittagessen« wird nur dann Wirklichkeit, wenn jemand das Essen kocht, jemand das gekochte Essen zur Kita fährt etc. Wie das Beispiel zeigt, können wir diese Strukturen selbst beeinflussen und lenken (die Kinder nehmen sich selbst) und sind von den Auswirkungen zugleich selbst betroffen (die Mitarbeitenden haben jetzt andere Aufgaben) (vgl. Robert Bosch Stiftung 2020, S. 15).
Pädagogische Fachkräfte in Kitas haben vielfältige Möglichkeiten, ihre Arbeitsbedingungen aktiv zu gestalten und diese nach Bedarf zu verändern. Die gesetzlichen Vorgaben und die jeweiligen Bildungs- bzw. Orientierungspläne lassen viel Spielraum, und in der jeweiligen Kita kommt es vor allem darauf an, zu welcher Einigung die Fachkräfte im Team kommen.
PRAXISBEISPIEL
Spielräume
In der Kita Sonnenschein entscheidet das Team unter anderem über:
• den Zeitpunkt des Mittagessens,
• die Gestaltung der Schlaf- und Entspannungszeit,
• die Anschaffung von Materialien.
Hervorzuheben ist, dass das Team auch darüber entscheidet, wie partizipativ diese Entscheidungen getroffen werden, das heißt, in welchem Maße die Kinder in den Entscheidungsprozess einbezogen werden.
Wie ein Team diesen Gestaltungsspielraum nutzen kann, hängt stark von der jeweiligen Führungskultur ab. Diese Tatsache ändert jedoch nichts an dem Umstand, dass dieser Spielraum grundsätzlich vorhanden ist. Und dieser Umstand wird deshalb so deutlich hervorgehoben, da es in Veränderungsprozessen immer auch um die Nutzung und Weiterentwicklung des Selbststeuerungspotenzials und die Fähigkeit zur Selbstorganisation geht (vgl. Weber 2023, S. 5, 48).
Veränderungsprozesse in diesem Kontext haben das Ziel, die Abläufe in der Kita zu optimieren, indem sie vereinfacht und transparenter gestaltet werden (vgl. Robert Bosch Stiftung 2020, S. 24). Gleichzeitig sollen die Prozesse dazu beitragen, subjektiv bedeutsame Probleme zu lösen (vgl. Schiersmann & Thiel 2018, S. 48).
GRUNDLAGEN
Veränderung als dynmaischer Kreislauf
Veränderungsprozesse sind zirkulär, das heißt, sie werden nicht geplant, vorbereitet, umgesetzt und rückblickend zufrieden betrachtet. Sie verlaufen in Schleifen, bei denen es vorwärts, rückwärts und seitwärts geht. Bei erfolgreichem Verlauf führen sie letztlich zu einer Veränderung der Kultur der Einrichtung, steigern die Innovationsbereitschaft und fördern die Lernfähigkeit der Kita (vgl. Robert Bosch Stiftung 2020, S. 15).
Kinder im Mittelpunkt
Trotz der verschiedenen Definitionen und der Unterschiede zwischen Change-Management und Organisationsentwicklung (siehe Seite 8ff.) bleibt die Beteiligung der Betroffenen ein durchgehendes, verbindendes Merkmal. Gemeint sind damit die Mitarbeitenden der jeweiligen Organisation. Zu den Betroffenen von Veränderungsprozessen (direkt oder indirekt) in der Kita gehören immer auch die Kinder und ihre Eltern. Sie gilt es ebenfalls, an diesen Prozessen zu beteiligen.
Wenn wir von einer Verbesserung der Qualität durch Veränderungsprozesse sprechen, geht es letztlich um die Weiterentwicklung der Qualitätsdimensionen, die auf eine bestmögliche Gestaltung der Situation der Kinder in der Kita abzielen. Veränderungen sollten dementsprechend bewirken, dass sich die Situation für die Kinder verbessert. Deshalb gilt es, die Kinder entsprechend an den Veränderungsprozessen zu beteiligen.
Ziel von Change-Management
»Das Ziel wäre entsprechend eine verlässliche Organisationsstruktur, die gleichzeitig genügend Flexibilität und verteilte Führung zulässt [Selbstorganisation, M.S.], um einerseits schnelles Handeln aller Beteiligten zu ermöglichen und andererseits genügend Stabilität und Sicherheit anzubieten« (Peters et. al. 2024, S. 50). Denn, wie noch gezeigt wird, haben Kitas es mit der Aufgabe zu tun, Kontinuität und Wandel gleichzeitig anzubieten. Um diesen Spagat zu bewältigen, braucht es die bewusste, kontinuierliche Gestaltung von Veränderung im Team.
Klare Abläufe, niedergeschriebene Prozesse und eindeutige Zuständigkeiten erleichtern es erheblich, die Anforderungen des Alltags gemeinsam zu bewältigen. So entsteht auch für die Teams ein konkreter praktischer Nutzen durch Change-Prozesse. »Es geht darum, die Arbeit so (neu) auszurichten, dass alles ineinander greift und nicht gesonderte Zeitressourcen dafür geschaffen werden müssen« (Weber 2023, S. 5). Auf diese Weise können Offenheit für Veränderung und Lust an Veränderung auch dafür sorgen, dass die Einrichtung attraktiver und interessanter wird. Erfolgreiche Veränderungsprozesse steigern die Attraktivität der Einrichtung und sind somit auch ein kleiner Schritt zur Gewinnung neuer Fachkräfte (vgl. Muth 2021, S. 19) sowie zur Bindung des aktuellen Personals.3
1.2 Anlässe für Change-Management
Die Gründe, um sich in einen Change-Prozess zu begeben, sind ausgesprochen vielfältig. Sie können sich aus einem Leitungswechsel, einer Krise, Konflikten, Personalmangel, Personalwechsel oder im Zuge der Digitalisierung ergeben. Auf der anderen Seite gibt es auch tiefere, grundlegende Ursachen: Die Anforderungen an die pädagogische Arbeit werden komplexer, unter anderem durch den Bildungsauftrag, die Heterogenität der Lebenslagen der Kinder und die Erwartung, dass Kitas als Anlaufstelle für Familien fungieren (vgl. Robert Bosch Stiftung, 2020, S. 80).
Die Anlässe für Change-Prozesse kommen
•von außen: Gesetze, Vorgaben der Trägerschaft;
•von innen: Umsetzung neuer pädagogischer Themen und deren langfristige Verankerung (z.B. die bewusstere Berücksichtigung der verschiedenen Heterogenitätsdimensionen), geringe Anmeldezahlen, mangelnde Kommunikation;
•als eine Mischung von innen und von außen: Zahl der Kinder ohne deutsche Sprachkenntnisse in der Einrichtung nimmt zu, und die Fachkräfte erachten es für sich als wichtig, dass diese Kinder
a) Unterstützung im Erlernen der deutschen Sprache erfahren und
b) vermehrt nichtsprachliche Kommunikation eingesetzt wird, um diese Kinder unabhängig von ihrem Sprachstand zu erreichen (z.B. Einsatz von Metacomkarten oder gebärdengestützter Kommunikation).





























