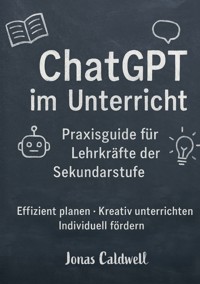
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Montagmorgen, 07:50 Uhr. Im Lehrerzimmer schwärmt Ihre Kollegin, wie ein Chatbot ihr in Sekunden ein brillantes Unterrichts-Setting erstellt hat. Neugierig? Dieses Buch zeigt Ihnen praxisnah und Schritt für Schritt, wie Sie KI wie ChatGPT, Canva und Co. gewinnbringend im Unterricht einsetzen - ganz ohne Technikfrust. Ob kreative Schreibwerkstatt, Mathe-Rätselrallye, virtueller Englisch-Austausch oder forschendes Lernen im Naturwissenschafts-Labor - zahlreiche ausgearbeitete Beispiele liefern: - Fertige Prompts & Outputs zum direkten Einsatz - Anleitungen mit Varianten für unterschiedliche Lernniveaus - Mini-Fallstudien aus echten Klassenzimmern - Checklisten, Reflexionsfragen & Vorlagen zum Download Kurze Info-Boxen zu Datenschutz, Ethik und Recht geben Sicherheit, ein Ausblick auf KI-Trends macht Sie bereit für morgen. Perfekt für alle, die den Unterricht von morgen schon heute gestalten wollen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
KAPITEL 1 – KI-GESTÜTZTER UNTERRICHT: GRUNDLAGEN, NUTZEN & LEITLINIEN
M
ONTAG
, 07:50 U
HR IM
L
EHRERZIMMER
– D
IE ERSTE
B
EGEGNUNG MIT
KI
W
AS BEDEUTET
KI-
GESTÜTZTER
U
NTERRICHT
?
KI
VERSTEHEN
: W
IE FUNKTIONIERT
C
HAT
GPT?
W
ICHTIGE
KI-T
OOLS FÜR
L
EHRKRÄFTE IM
Ü
BERBLICK
C
HANCEN UND
N
UTZEN VON
KI
FÜR
L
EHRKRÄFTE UND
L
ERNENDE
G
RENZEN UND
R
ISIKEN
: V
ON
H
ALLUZINATIONEN BIS
B
IAS BEI
KI
R
ECHTLICHE
R
AHMENBEDINGUNGEN IM
S
CHULKONTEXT
E
THISCHE
L
EITLINIEN
: KI-E
TIKETTE UND VERANTWORTUNGSVOLLE
N
UTZUNG
P
RAKTISCHE
T
IPPS FÜR DEN
S
TART
R
EFLEXIONSFRAGEN ZUM
K
APITEL
U
MSETZUNGS
-C
HECKLISTE FÜR
E
INSTEIGER
KAPITEL 2: UNTERRICHTSPLANUNG UND MATERIALERSTELLUNG MIT KI-TOOLS
S
ONNTAGABEND
, 21:00 U
HR
– P
LANUNGSVORBEREITUNG IN LETZTER
M
INUTE
U
SE
C
ASE
1: L
AST
-M
INUTE
-U
NTERRICHTSPLAN
D
EUTSCH
U
SE
C
ASE
2: K
REATIVE
A
UFGABENIDEEN IN
M
ATHEMATIK
U
SE
C
ASE
3: S
PRACHÜBUNGEN UND
T
EXTE FÜR
E
NGLISCH
U
SE
C
ASE
4: V
ISUALISIERUNG UND
I
NFOGRAFIKEN FÜR
N
ATURWISSENSCHAFTEN
U
SE
C
ASE
5: F
ÄCHERÜBERGREIFENDES
P
ROJEKT MIT
KI-I
DEEN
U
SE
C
ASE
6: T
ESTS UND
P
RÜFUNGSAUFGABEN MIT
KI
VORBEREITEN
M
INI
-F
ALLSTUDIE
: KI-
GESTÜTZTE
U
NTERRICHTSVORBEREITUNG
T
EILEN
& V
ERNETZEN
R
EFLEXIONSFRAGEN
C
HECKLISTE
: KI-T
OOLS IN DER
U
NTERRICHTSPLANUNG
(K
APITEL
2)
KAPITEL 3 KI-GESTÜTZTE INDIVIDUALISIERUNG & DIFFERENZIERUNG IM UNTERRICHT
U
SE
C
ASE
1: D
IFFERENZIERTE
L
ESETEXTE IM
D
EUTSCHUNTERRICHT
U
SE
C
ASE
2: P
ERSONALISIERTES
Ü
BEN IM
M
ATHEMATIKUNTERRICHT
U
SE
C
ASE
3: KI
ALS
S
PRACHTRAINER IM
E
NGLISCHUNTERRICHT
U
SE
C
ASE
4: I
NTERAKTIVES
S
PRECHTRAINING MIT
KI
U
SE
C
ASE
5: I
NDIVIDUELLE
H
ILFESTELLUNGEN IM NATURWISSENSCHAFTLICHEN
U
NTERRICHT
(P
HYSIK
-T
UTOR
)
U
SE
C
ASE
6: V
ISUELLE
A
UFBEREITUNG VON
L
ERNINHALTEN
C
ANVA
& C
O
M
INI
-F
ALLSTUDIE
: KI-D
IFFERENZIERUNG IN DER
P
RAXIS
R
EFLEXIONSFRAGEN
U
MSETZUNGS
-C
HECKLISTE
T
EILEN
& V
ERNETZEN
KAPITEL 3 TEIL 2: VERTIEFUNG KI-GESTÜTZTER INDIVIDUALISIERUNG UND DIFFERENZIERUNG
D
EUTSCHUNTERRICHT
: K
REATIVES
S
CHREIBEN UND
S
PRACHFÖRDERUNG MIT
KI
M
ATHEMATIKUNTERRICHT
: KI
ALS PERSÖNLICHER
T
UTOR UND
I
DEENLIEFERANT
E
NGLISCHUNTERRICHT
: S
PRACHEN LERNEN MIT
KI-U
NTERSTÜTZUNG
N
ATURWISSENSCHAFTEN
: E
NTDECKEN
, E
XPERIMENTIEREN UND
L
ERNEN MIT
KI
T
EILEN
& V
ERNETZEN
: G
EMEINSAM
KI-E
RFAHRUNGEN AUSTAUSCHEN
KAPITEL 4: KI-GESTÜTZTE PROJEKTARBEIT IN DEN HAUPTFÄCHERN
KI-U
NTERSTÜTZUNG FÜR
P
ROJEKTE
: P
OTENZIALE
& V
ORBEREITUNG
D
EUTSCH
: KI –K
URZGESCHICHTE GEMEINSAM SCHREIBEN
M
ATHEMATIK
: M
ATHE
-R
ÄTSEL ALS
T
EAM ENTWICKELN MIT
C
HAT
GPT
UND
C
ANVA
E
NGLISCH
: K
OLLABORATIVES
L
ERNEN MIT
KI –
EIN
R
EISEPROJEKT
N
ATURWISSENSCHAFTEN
: F
ORSCHEN UND
E
NTDECKEN MIT
KI-U
NTERSTÜTZUNG
M
INI
-F
ALLSTUDIE AUS DER
DACH-R
EGION
: „G
OETHE VS
. C
HAT
GPT“
IM
D
EUTSCHUNTERRICHT
R
EFLEXIONSFRAGEN
C
HECKLISTE
: KI
IM KOLLABORATIVEN
P
ROJEKTUNTERRICHT
T
EILEN
& V
ERNETZEN
KAPITEL 5: INDIVIDUELLES LERNEN MIT KI IN DEN HAUPTFÄCHERN
D
EUTSCHUNTERRICHT
: KI
ALS PERSÖNLICHER
S
CHREIB
-
UND
L
ESE
-C
OACH
M
ATHEMATIKUNTERRICHT
: I
NDIVIDUELLE
H
ILFESTELLUNGEN UND
Ü
BUNGEN MIT
KI
E
NGLISCHUNTERRICHT
: I
NDIVIDUELLES
S
PRACHTRAINING DURCH
KI
N
ATURWISSENSCHAFTEN
: S
ELBSTSTÄNDIGES
E
NTDECKEN MIT
KI-B
EGLEITUNG
T
EILEN
& V
ERNETZEN
KAPITEL 6: KI IM SCHULALLTAG – PRAXISNAHE PROJEKTE IN DEN HAUPTFÄCHERN
KI
IM
D
EUTSCHUNTERRICHT
: K
REATIVES
S
CHREIBEN NEU GEDACHT
KI
IM
M
ATHEMATIKUNTERRICHT
: K
REATIVES
P
ROBLEMLÖSEN MIT
KI-U
NTERSTÜTZUNG
KI
IM
E
NGLISCHUNTERRICHT
: S
PRACHFERTIGKEITEN SPIELERISCH AUSBAUEN
KI
IM NATURWISSENSCHAFTLICHEN
U
NTERRICHT
: F
ORSCHUNG NEU ENTDECKEN MIT
KI
T
EILEN
& V
ERNETZEN
KAPITEL 7: KOMPETENZEN FÖRDERN MIT KI – LEITLINIEN, TOOLS UND AUSBLICK
E
INLEITUNG
L
EITLINIEN FÜR KOMPETENZORIENTIERTEN
KI-U
NTERRICHT
KI-T
OOLS IM
Ü
BERBLICK
: A
KTUELLE
M
ÖGLICHKEITEN FÜR DEN
U
NTERRICHT
A
USBLICK
: KI-T
RENDS DER NÄCHSTEN
2–3 J
AHRE
W
EITERFÜHRENDE
R
ESSOURCEN
, F
ORTBILDUNG UND
L
ITERATUREMPFEHLUNGEN
T
EILEN
& V
ERNETZEN
Kapitel 1 – KI-gestützter Unterricht: Grundlagen, Nutzen & Leitlinien
Montag, 07:50 Uhr im Lehrerzimmer – Die erste Begegnung mit KI
Montagmorgen, 7:50 Uhr im Lehrerzimmer. Sie betreten mit Ihrem frisch gebrühten Kaffee den Raum, noch etwas verschlafen. Am Nebentisch unterhalten sich zwei Ihrer Kolleg*innen angeregt. Neugierig spitzen Sie die Ohren.
Kristin (Deutschlehrerin): “Stellt euch vor, ich hatte am Freitag spontan eine Vertretungsstunde in Mathe. Bruchrechnen – und Mathe ist eigentlich gar nicht mein Fach! Also hab ich in meiner Not mal dieses ChatGPT ausprobiert. Und unglaublich: In Sekunden hat mir die KI eine total kreative Übungsidee ausgespuckt.”
Ihr Kollege David zieht die Augenbrauen hoch. David (Biologielehrer): “Wirklich? Was denn für eine Idee?” – Kristin nimmt einen Schluck Kaffee und strahlt: “ChatGPT hat mir vorgeschlagen, die Klasse ein Pokémon-ähnliches Bruchmonster-Spiel entwickeln zu lassen. Die Kinder sollten Karten mit Fantasiemonstern zeichnen, deren Angriffskraft und Verteidigung als Brüche angegeben sind. Dann addieren sie die Brüche, um die Gesamtstärke zu berechnen und können mit ihren Monsterkarten gegeneinander antreten.”
Sie setzen sich nun zu den beiden. “Das klingt ja großartig!”, sagen Sie begeistert. “Was genau hat ChatGPT denn geliefert?”
Kristin zieht ihr Tablet hervor: “Schaut, ich hab es noch offen.” Auf dem Bildschirm sehen Sie den vorgeschlagenen Aufgaben-Text von ChatGPT. Kristin liest vor:
David schüttelt erstaunt den Kopf. David: “Das hat die KI dir so geliefert?” – “Ja!”, antwortet Kristin. “Ich hätte mir so eine Story nie in der Kürze ausgedacht. Die Schüler waren sofort motiviert – und ich musste mir nicht erst stundenlang etwas überlegen.”
Während Sie fasziniert zuhören, mischt sich eine weitere Kollegin ein. Frau Bauer, die erfahrene Physiklehrerin, blickt skeptisch über den Rand ihrer Brille: “Passt aber auf,” warnt sie. “KI hin oder her – man weiß nie, ob da nicht Fehler drinstecken. Und was ist mit Datenschutz?”
Es klingelt zum Unterrichtsbeginn. Auf dem Weg in Ihr Klassenzimmer schweifen Ihre Gedanken bereits ab: KI im Unterricht – Chancen, Risiken, Regeln? Sie nehmen sich vor, dem Phänomen KI-gestützter Unterricht in Ruhe auf den Grund zu gehen. Schließlich möchten Sie verstehen, wie Ihnen ChatGPT, Canva & Co. im Schulalltag helfen können – ohne in Fallen zu tappen.
Was bedeutet KI-gestützter Unterricht?
Nachdem die erste Neugier geweckt ist, stellt sich die grundlegende Frage: Was heißt eigentlich KI-gestützter Unterricht?
Kurz gesagt geht es darum, künstliche Intelligenz (KI) als Helfer im Schulalltag einzusetzen – von der Vorbereitung über die Durchführung bis zur Nachbereitung des Unterrichts. Im Unterschied zum traditionellen Unterricht, in dem Lehrkräfte alle Materialien und Impulse selbst erstellen, nutzt man bei KI-gestütztem Unterricht digitale Werkzeuge, die selbstständig lernen und Inhalte generieren können. Diese Tools unterstützen Sie als Lehrkraft, indem sie z.B. Texte formulieren, Bilder entwerfen oder Antworten auf Fachfragen liefern.
Theorie: Was genau ist „KI“?
KI-gestützt bedeutet dabei ausdrücklich: Die KI unterstützt den Unterricht, sie übernimmt ihn nicht. Die Entscheidungskompetenz und pädagogische Leitung bleiben bei Ihnen als Lehrperson. Eine KI kann beispielsweise schnelle Vorschläge für Übungsaufgaben liefern oder eine Erklärung vereinfachen, aber Sie prüfen, passen an und entscheiden, was letztlich im Klassenzimmer passiert.
Vielleicht nutzen Sie im Alltag schon längst KI, ohne es zu merken: Rechtschreibkorrekturen, Übersetzungsprogramme, personalisierte Lern-Apps oder adaptive Übungssoftware basieren oft auf intelligenten Algorithmen. Neu und aufregend sind nun vor allem generative KI-Tools wie ChatGPT oder DALL·E, die auf Eingabe hin eigenständig Texte, Bilder oder andere Inhalte erschaffen können. Seit der Veröffentlichung von ChatGPT Ende 2022 wird über solche Tools auch im Bildungsbereich intensiv diskutiert . Generative KIs eröffnen im Unterricht ganz neue Möglichkeiten – vom automatischen Erzeugen differenzierter Arbeitsblätter bis zum Brainstorming für Projektideen.
KI-gestützter Unterricht kann viele Formen haben. Zum Beispiel können Sie KI nutzen, um Unterrichtsmaterial zu erstellen (wie Kristin es getan hat), oder um als virtueller Tutor Schülerfragen zu beantworten. Denkbar ist auch, Schülerinnen und Schüler selbst kontrolliert mit KI arbeiten zu lassen, etwa um sich Texte zusammenfassen zu lassen oder individuelle Lerntipps zu bekommen. Wichtig ist stets der didaktische Mehrwert: KI einzusetzen soll entweder Ihren Arbeitsaufwand reduzieren oder das Lernen der Schüler*innen bereichern – idealerweise beides.
Natürlich steckt dieses Feld noch in den Anfängen. Viele Schulen experimentieren erst seit Kurzem mit KI-Tools; es gibt noch keine festen Konzepte, was der richtige Ansatz ist. Genau deswegen lohnt es sich, die Grundlagen, Chancen und Grenzen einmal genauer anzuschauen. In den kommenden Abschnitten gewinnen Sie das nötige Rüstzeug, um KI im Unterrichtsalltag kompetent und reflektiert einzusetzen.
KI verstehen: Wie funktioniert ChatGPT?
Um KI sinnvoll zu nutzen, lohnt es sich zu verstehen, wie ChatGPT „denkt“ – auch wenn es zunächst komplex klingt. Stellen Sie sich ChatGPT vereinfacht als einen sehr schlauen Papagei vor, der im Internet aufgewachsen ist: Es hat unzählige Texte „gelesen“ und plappert nun Wahrscheinlichkeiten nach, welche Wortfolgen typisch zusammen auftreten. Natürlich ist es mehr als Papageienplappern, aber dieser Vergleich hilft, die Grundidee zu fassen: ChatGPT wählt sein nächstes Wort basierend darauf, wie wahrscheinlich dieses Wort in Ihrem Kontext passen könnte.
Ein riesiges Sprachmodell
ChatGPT ist ein sogenanntes großes Sprachmodell (Large Language Model, LLM). „Sprachmodell“ bedeutet, dass die KI trainiert wurde, Statistiken über Sprache zu lernen. Konkret hat man dem Modell Abermillionen von Sätzen und Texten gegeben – Bücher, Zeitungsartikel, Websites – damit es lernt, wie Wörter typischerweise aufeinander folgen. Daraus entsteht ein komplexes Wahrscheinlichkeitsmodell: Gibt man einen Satzanfang vor, kann das KI-Modell vorhersagen, wie der Satz wahrscheinlich weitergeht.
Stellen Sie sich vor, Sie beginnen einen Satz mit „Es war einmal ein…“. Ein Sprachmodell hat gelernt, dass sehr oft das Wort „König“ oder „Märchen“ folgt, eher selten hingegen „Automobil“. ChatGPT berechnet solche Wahrscheinlichkeiten und entscheidet sich dann für eine Fortsetzung, die statistisch plausibel erscheint. Genau so baut es Satz für Satz, Absatz für Absatz seine Antwort auf.
Generativ und vortrainiert
Das Kürzel GPT steht für Generative Pre-trained Transformer. „Generativ“ heißt: es kann selbst Text generieren, anstatt nur vorgefertigte Antworten abzurufen. „Pre-trained“ bedeutet: das Modell wurde vorab auf riesigen Textmengen vortrainiert, lange bevor wir Nutzer ihm Fragen stellen. Und „Transformer“ bezeichnet die spezielle Netzwerkarchitektur des Modells – ein Neuronales Netz, das 2017 erfunden wurde und besonders effizient mit Sprachmustern umgehen kann.
In Zahlen gesprochen: Die GPT-3-Version (2020) von ChatGPT wurde mit rund 175 Milliarden Stellschrauben (Parameter) im Modell trainiert – eine unvorstellbar große Menge . GPT-4, das seit 2023 hinter ChatGPT steckt, ist noch deutlich größer (genaue Zahlen wurden nicht veröffentlicht). Diese Parameter justiert das Training so, dass das Modell bei Eingabe X die gewünschte Ausgabe Y produziert. Je mehr Parameter und je mehr Trainingsdaten, desto besser kann ein solches Modell Zusammenhänge in Sprache abbilden.
Theorie: Wie lernt ChatGPT?
Das Training von ChatGPT erfolgt in zwei Hauptphasen. Zunächst die Vortrainingsphase: Das Modell wurde mit gewaltigen Textmengen gefüttert und lernte dabei, das nächste Wort in einem Satz vorherzusagen. Man nennt dies selbstüberwachtes Lernen, da keine menschlichen Labels nötig waren – der nächste Wort ist ja im Text bereits vorhanden und dient als Korrektiv beim Lernen. Diese Phase macht das Modell erstaunlich sprachgewandt, aber noch nicht unbedingt wahrheitsgetreu oder hilfreich. Daher folgte Phase zwei: das Feintuning mit menschlichem Feedback. Dabei formulierten menschliche Trainer Beispiel-Dialoge und bewerteten KI-Antworten nach Qualität. Durch Reinforcement Learning from Human Feedback (RLHF) lernte das Modell, hilfreiche und höfliche Antworten zu geben und unangemessene Inhalte zu vermeiden. Dieses Feintuning ist der Grund, warum ChatGPT meist freundliche, verständliche Antworten gibt und bei beleidigenden oder verbotenen Anfragen verweigert.
Kontext und Gedächtnis
Ein beeindruckendes Merkmal von ChatGPT ist sein Kontextgedächtnis. Im Unterschied zu einfachen Chatbots der Vergangenheit kann ChatGPT sich an frühere Sätze im laufenden Gespräch erinnern. Technisch gesehen schickt man bei jeder neuen Nutzerfrage den bisherigen Gesprächsverlauf mit – die KI bezieht alle diese Informationen in die Antwort ein. So können Sie einen mehrteiligen Auftrag Schritt für Schritt mit ChatGPT erarbeiten, ohne jedes Mal alle Details neu eingeben zu müssen. Allerdings ist dieses Gedächtnis nicht unbegrenzt: Je nach Version kann ChatGPT nur eine gewisse Anzahl von Zeichen (Tokens) im Kontext behalten. Wenn ein Gespräch sehr lang wird, „vergisst“ das Modell die frühesten Teile.
Die Fähigkeit, den Kontext zu nutzen, macht ChatGPT als Unterhaltungspartner so mächtig. Es kann Rückfragen stellen, auf Klarstellungen eingehen und Antworten anpassen. Dadurch wirkt die Interaktion natürlich und flüssig – fast so, als würde ein menschlicher Tutor reagieren.
Kein Nachschlagewerk, sondern Wahrsager
Wichtig zu verstehen ist, dass ChatGPT kein klassisches Nachschlagewerk ist. Es durchstöbert bei einer Frage nicht das Internet nach der richtigen Antwort (es sei denn, Sie nutzen spezielle Versionen mit Browser-Zugriff wie Bing Chat). Stattdessen rät es gewissermaßen auf Basis seines Sprachwissens, was eine plausible Antwort sein könnte. Dies erklärt, warum ChatGPT zwar verblüffend gute, kreative Antworten formulieren kann, aber eben manchmal auch falsche Aussagen erfindet (Halluzinationen, dazu mehr in Abschnitt 1.6). Es kennt keine „Fakten“ im eigentlichen Sinne, sondern nur die Wahrscheinlichkeit, dass ein Satz inhaltlich stimmig aussieht. Wenn viele Texte im Training eine bestimmte (aber falsche) Information enthielten, kann es passieren, dass ChatGPT diese Falschinformation selbstbewusst wiedergibt.
Gleichzeitig hat ChatGPT keine direkten Erfahrungen oder echtes Verständnis. Es jongliert mit Sprache, nicht mit tatsächlichem Weltwissen. Zum Beispiel „weiß“ ChatGPT nicht, dass Feuer heiß ist – es hat nur in vielen Texten gelesen, dass „Feuer“ oft mit „heiß“ in Verbindung steht. Für unsere Zwecke reicht dieses statistische Wissen oft aus, um nützliche Antworten zu geben. Doch als Anwender*in sollten Sie im Hinterkopf behalten: Die KI liefert Vorschläge, keine garantierten Wahrheiten.
Stärken erkennen
Trotz dieser Einschränkungen sind die Stärken von ChatGPT beeindruckend. Das Modell beherrscht Deutsch und viele andere Sprachen, ohne je explizit Grammatikregeln gelernt zu haben – es hat die Regeln implizit aus den Daten mitgelernt. Es kann unterschiedliche Stile und Rollen annehmen (von sachlich bis humorvoll, vom Experten bis zum Grundschüler), je nachdem, wie man die Anfrage stellt. Und es kann kreativ Probleme lösen, indem es ungewöhnliche Ideen kombiniert, die in seinen Trainingsdaten vorkamen.
Für Lehrkräfte bedeutet das: ChatGPT kann unglaublich vielseitig eingesetzt werden, von fachlichen Erklärungen über das Umschreiben von Texten in einfachere Sprache bis zum Ausspucken von Quizfragen oder Aufsatzvorschlägen. Wenn man versteht, dass dahinter ein Wahrscheinlichkeitsautomat steckt, der viel kann, aber nicht unfehlbar ist, kann man die Möglichkeiten gezielt und kritisch nutzen.
Wichtige KI-Tools für Lehrkräfte im Überblick
Inzwischen gibt es eine Fülle von KI-Werkzeugen, doch einige stechen besonders hervor. Im Folgenden stellen wir fünf Tools vor, die Ihnen im Schulalltag nützlich sein können. Jedes Tool hat seine Stärken – von der Textgenerierung über Grafikdesign bis zur Unterrichtsplanung.
ChatGPT – der Allround-Textassistent
ChatGPT von OpenAI ist wohl das bekannteste KI-Tool. Es handelt sich um einen textbasierten Chatbot, den Sie alles Mögliche fragen können – von „Erkläre das Quadratzahlenmuster für Siebtklässler“ bis „Schreibe zehn Grammatikübungen zum Genitiv“. ChatGPT liefert in Sekundenschnelle formulierte Antworten, Erklärungen, Beispiele oder ganze Texte. Für Lehrkräfte ist es ein Allrounder: Sie können sich Quizfragen generieren lassen, Ideen für Projektarbeiten brainstormen oder einen schwierigen Begriff in einfachere Worte fassen lassen. Dabei können Sie in natürlicher Sprache mit dem Tool interagieren, Folgefragen stellen und die Antworten verfeinern. Beispiel: Eine Geschichtslehrerin könnte ChatGPT bitten: „Gib mir fünf Diskussionsfragen zum Thema Französische Revolution für 8. Klasse“ – und erhält prompt brauchbare Vorschläge. Wichtig: Die kostenlose Version von ChatGPT nutzt derzeit das Modell GPT-3.5, während die kostenpflichtige Plus-Version auf GPT-4 zurückgreift, das meist noch präzisere und längere Antworten liefert.
Canva – Design und Präsentation mit KI-Unterstützung
Canva ist ein populäres Online-Design-Tool, das gerade in Schulen immer beliebter wird. Es bietet tausende Vorlagen, um ansprechende Arbeitsblätter, Präsentationen, Poster oder Social-Media-Grafiken zu erstellen – auch ohne Grafikdesign-Kenntnisse. Was hat das mit KI zu tun? Canva nutzt KI auf subtile Weise im Hintergrund: zum Beispiel schlägt es automatisch Layout-Anpassungen vor oder nutzt Bild-Erkennungsalgorithmen, um Elemente passend anzuordnen. Darüber hinaus hat Canva inzwischen explizite KI-Features eingebaut. Mit „Magic Write“ können Sie sich direkt in Canva Texte generieren lassen (etwa eine kurze Beschreibung für ein Tafelbild), und mit dem Canva Bildgenerator (basierend auf DALL·E) lassen sich aus Textprompts Bilder erstellen. Für Lehrkräfte bedeutet das: Sie können z.B. einen Arbeitsblatt-Text von der KI schreiben lassen und diesen nahtlos ins Design einfügen, oder mit wenigen Klicks ein fehlendes Schaubild generieren. Canva kommt in einer kostenlosen Basisversion und einer Education-Version, die für Lehrkräfte sogar Premium-Funktionen gratis freischaltet.
Bing & Microsoft Copilot – KI im Web und Office
Microsoft hat mit Bing Chat und dem Microsoft 365 Copilot gleich zwei KI-Assistenten im Angebot. Bing Chat ist in die Suchmaschine Bing integriert (ähnlich wie ChatGPT, aber mit direktem Internetzugang). Fragen Sie Bing Chat z.B. „Fasse mir den Wikipedia-Artikel über Photosynthese zusammen“ oder „Suche aktuelle Statistiken zur Internetnutzung von Jugendlichen“ – der Assistent liefert Ergebnisse inklusive Quellen. Für Lehrkräfte kann Bing Chat hilfreich sein, um Recherche und KI-Antwort zu kombinieren, etwa um schnell Unterrichtsmaterial mit korrekten Fakten zu erstellen. Microsoft 365 Copilot wiederum bringt KI direkt in Word, PowerPoint, Outlook und Teams. Damit können Sie per Knopfdruck z.B. eine Präsentation entwerfen lassen: Sie geben ein Thema vor, und Copilot erstellt Ihnen eine Gliederung, Folieninhalte und sogar passende Bilder. In Word kann Copilot aus ein paar Stichpunkten einen ausformulierten Elternbrief schreiben. Das Besondere an Microsofts Lösungen ist die Integration in vertraute Anwendungen und die Datensicherheit: Für den Bildungsbereich verspricht Microsoft, dass keine personenbezogenen Daten unerlaubt die Umgebung verlassen – ein wichtiger Punkt, wenn es um Schüler*innendaten geht.
DALL·E – Kreative Bilder auf Zuruf
DALL·E (ebenfalls von OpenAI) ist eine KI, die aus Textbeschreibungen Bilder generiert. Wo ChatGPT mit Sprache jongliert, malt DALL·E Bilder. Für den Unterricht lässt sich das vielseitig einsetzen: Benötigen Sie ein Illustrationsbild für ein Arbeitsblatt, das es so nicht in Google zu finden gibt? Mit DALL·E können Sie beispielsweise eingeben: „Ein mittelalterlicher Marktplatz, gezeichnet im Stil eines Kinderbuchs“ – und binnen Sekunden entstehen mehrere einzigartige Bilder zur Auswahl. Lehrkräfte haben so die Möglichkeit, Materialien mit maßgeschneiderten Grafiken zu versehen, ohne selbst zeichnen zu müssen oder aufwändige Bildrecherchen zu betreiben. Allerdings braucht es etwas Übung, gute Textbefehle (Prompts) zu formulieren, damit die KI das Gewünschte liefert. Auch sind die Ergebnisse nicht immer perfekt – manchmal muss man mehrere Versuche starten. Ein Vorteil: Die von DALL·E erzeugten Bilder dürfen laut OpenAI frei verwendet werden, sogar für kommerzielle Zwecke, was im schulischen Kontext die rechtliche Nutzung vereinfacht. Nichtsdestotrotz gilt auch hier: Prüfen Sie die Bilder, bevor Sie sie einsetzen – gerade bei sensiblen Themen kann die KI danebenliegen.
MagicSchool – die KI-Schulassistenz
MagicSchool ist eine Plattform, die speziell für den Bildungsbereich entwickelt wurde. Anders als die allgemeinen Tools oben fokussiert MagicSchool direkt auf typische Lehrerbedürfnisse. Die Plattform umfasst über 80 KI-Tools für Lehrkräfte – von der Erstellung lehrplankonformer Unterrichtspläne über das Generieren von Übungsaufgaben und Quizzen bis hin zum Formulieren individueller Förderpläne und Elternbriefen. Die Idee dahinter: anstatt viele einzelne KI-Werkzeuge zu nutzen, bietet MagicSchool eine zentrale Lösung, die auf Bildungsinhalte zugeschnitten ist. Beispielsweise können Sie mit MagicSchool mit wenigen Klicks einen kompletten Wochenplan für Ihre Klasse erstellen lassen oder einen KI-Chatbot bauen, der auf Ihren eigenen Unterrichtsmaterialien basiert (und den Schüler*innen als zusätzlicher Lernbegleiter dienen kann). MagicSchool legt eigenen Angaben zufolge großen Wert auf Datenschutz und Schulsicherheit – die Plattform wirbt damit, besonders sicher und DSGVO-konform zu sein, sodass auch ganze Schulen und Bezirke sie einsetzen. Für Lehrkräfte im DACH-Raum ist MagicSchool noch ein Newcomer-Tipp, da es ursprünglich aus den USA stammt und vor allem dort bereits millionenfach genutzt wird . Dennoch lohnt ein Blick darauf, denn es zeigt, wohin die Reise geht: KI-Lösungen werden zunehmend maßgeschneidert für die Schule entwickelt.
Chancen und Nutzen von KI für Lehrkräfte und Lernende
KI-Tools bieten eine ganze Reihe von Vorteilen – sowohl für Sie als Lehrkraft als auch für Ihre Schüler*innen. Im Idealfall sparen sie Ihnen Zeit und Routinearbeit und eröffnen gleichzeitig neue Lernchancen im Klassenzimmer. Hier einige der wichtigsten Pluspunkte:
Entlastung und Zeitersparnis für Lehrkräfte: Viele Lehrkräfte leiden unter einer hohen Arbeitsbelastung – über die Hälfte fühlt sich ausgebrannt . KI kann helfen, Routineaufgaben abzunehmen. Das beginnt bei der Unterrichtsvorbereitung: Anstatt stundenlang Material zu recherchieren oder Aufgaben zu formulieren, können Sie dies in Minuten von ChatGPT & Co. erledigen lassen. Eine deutsche Lehrerin berichtet etwa, dass sie dank KI die Erstellung differenzierter Aufgaben deutlich beschleunigen konnte: „Die Erstellung von differenziertem Unterstützungsmaterial ist essenziell, aber unfassbar zeitaufwändig. Hier suchte ich nach Möglichkeiten, effizienter zu arbeiten – und habe mithilfe von KI einen guten Weg gefunden.“ Durch den KI-Einsatz bleibt ihr mehr Zeit für die eigentliche pädagogische Arbeit mit den Schüler*innen. Auch andere Routinearbeiten wie das Zusammenfassen von Protokollen, Entwerfen von Elternbriefen oder Übersetzen von Texten können KI-Tools übernehmen – Sie müssen nur noch drübersehen und anpassen.
Kreativer Ideenlieferant und Qualitätssteigerung: KI kann als kreativer Sparringspartner dienen, der frische Impulse gibt. Beim Brainstorming von Projektideen oder Einstiegen in neue Unterrichtseinheiten steht mancher Lehrkraft mal der Kopf still – hier liefert eine KI in Sekunden verschiedenste Vorschläge. Geschichtslehrer Hauke P. schildert: „Ich gebe eine erste Idee ein und erhalte eine Rückmeldung, entwickle meine Idee weiter und lass mir darauf Rückmeldung geben – wie bei einem Pingpongspiel. So entstehen im Zusammenspiel von Mensch und Maschine Fragen oder praktische Beispiele, die meinen Unterricht vielseitiger und lebendiger machen.“ Dieses gemeinsame Tüfteln mit der KI kann Unterrichtskonzepte deutlich verbessern. Auch fertige Materialien profitieren: Eine KI als „mitdenkendes Werkzeug“ kann auf Lücken oder Verbesserungsmöglichkeiten hinweisen. Lehrer Joscha F. berichtet, dass er ChatGPT nun häufig für kleine Zwischenschritte nutzt – quasi als didaktischen Assistenten: „Heute nutze ich die KI mehr im Sinne der Ko-Konstruktion als ‘mitdenkendes’ Werkzeug für viele kleine Zwischenschritte und Überlegungen. Das spart Zeit und hilft mir, bessere Inhalte zu erstellen.“
Individualisierung und Förderung der Lernenden: Ein großer Pluspunkt von KI im Unterricht ist die Möglichkeit zur Differenzierung. Mit KI-Unterstützung lassen sich Lernmaterialien auf verschiedene Niveaustufen zuschneiden, ohne dass Sie alles manuell neu schreiben müssen. So können starke Schülerinnen herausfordernde Aufgaben erhalten, während andere eine vereinfachte Version des gleichen Themas bearbeiten – und trotzdem alle gemeinsam am Thema bleiben. Die Berliner Lehrerin Michelle W. erstellt beispielsweise mit ChatGPT für ihren Englischunterricht automatisch vereinfachte Lesetexte und Wortlisten für unterschiedliche Sprachniveaus, sodass alle Schülerinnen dem Inhalt folgen können . Gleichzeitig generiert sie Wissenskarten mit gestuften Hilfestellungen (von kleinen Tipps bis zur Lösung) für den Mathematikunterricht . Ohne KI wäre dieser Grad an individueller Förderung extrem zeitaufwändig – mit KI wird es realistisch umsetzbar.
Auch außerhalb der Differenzierung können Lernende durch KI profitieren. Ein Chatbot wie ChatGPT kann als persönlicher Tutor fungieren, der auf Fragen antwortet oder etwas noch einmal anders erklärt – und zwar genau dann, wenn die Schülerinnen es brauchen. Schülerin Lena muss abends Hausaufgaben in Geschichte erledigen? Statt frustriert aufzugeben, könnte sie ChatGPT um eine Erklärung bitten, wenn kein Mensch erreichbar ist. Natürlich ersetzt das nicht die Lehrkraft, aber es kann eine zusätzliche Hilfestellung bieten. Gerade ruhigere Schülerinnen trauen sich vielleicht, einer KI Fragen zu stellen, die sie im Klassenraum nicht zu fragen wagen.
Motivation und neue Lernwege für Schülerinnen: Die eingangs erzählte Geschichte vom Bruchmonster-Spiel zeigt, wie KI zu motivierenden Lernsettings beitragen kann. Eine anfänglich trockene Matheübung verwandelte sich durch die kreative Idee der KI in ein spannendes Spiel – die Schülerinnen bastelten begeistert ihre Karten und rechneten eifrig Brüche, sogar noch in der Pause . Solche Erlebnisse sind Gold wert: KI kann helfen, verstaubte Unterrichtsthemen in einen Kontext zu bringen, der Jugendliche anspricht. Ob Rollenspiele, Rätselgeschichten oder Wettbewerbe – die generative KI sprudelt vor Ideen, auf die man selbst vielleicht nicht gekommen wäre. Für die Lernenden bedeutet das mehr Abwechslung und Eigenaktivität. Sie können durch KI-Anregungen Projekte machen, die vorher nicht denkbar waren, oder komplexe Inhalte auf spielerische Weise entdecken.
Nicht zuletzt bereitet der kontrollierte Einsatz von KI im Unterricht die Schüler*innen auch auf die Zukunft vor. Sie lernen, mit KI-Werkzeugen kompetent umzugehen, ihre Möglichkeiten zu nutzen und ihre Grenzen kritisch zu reflektieren. Angesichts der rasanten Verbreitung von KI in allen Lebensbereichen ist dies selbst ein wichtiger Lerngewinn.
Lehrkräfte, die KI bereits erproben, berichten insgesamt von positiven Erfahrungen. In Umfragen zeigt sich, dass die Mehrheit der Lehrpersonen, die Chatbots im Klassenzimmer einsetzen, dem Einsatz positiv gegenübersteht . All diese Chancen bedeuten natürlich nicht, dass KI ein Wundermittel ist – aber richtig eingesetzt kann sie den Unterricht bereichern und den Schulalltag für alle Beteiligten ein Stück einfacher machen.
Grenzen und Risiken: Von Halluzinationen bis Bias bei KI
Wo Licht ist, ist auch Schatten – das gilt auch für KI im Unterricht. Trotz aller beeindruckenden Fähigkeiten haben ChatGPT & Co. deutliche Grenzen und bergen Risiken, derer man sich bewusst sein muss. Hier die wichtigsten Stolpersteine:
„Halluzinationen“ und falsche Antworten: Eines der größten Probleme bei generativen KI-Modellen ist ihre Neigung zu Halluzinationen. Damit ist gemeint, dass die KI überzeugend klingende, aber falsche Informationen erfinden kann. ChatGPT antwortet immer im Tonfall größter Sicherheit – selbst dann, wenn es eigentlich keine verlässliche Grundlage hat. Fragt man z.B. nach einer Quelle oder einem Zitat, kann es passieren, dass ChatGPT eine Quelle angibt, die es gar nicht gibt. Auch Sachfragen beantwortet die KI nicht immer korrekt. So erhielt ein Lehrer auf die Frage nach den Hauptstädten aller deutschen Bundesländer eine Liste, in der eine Hauptstadt falsch war – die KI hatte sie schlicht geraten. Diese Halluzinationen entstehen, weil das Modell keine echten Fakten kennt, sondern nur Wörter statistisch kombiniert. OpenAI weist selbst darauf hin, dass ChatGPT Fehler machen und „nicht korrekte oder irrelevante Antworten erzeugen“ kann. Als Lehrkraft müssen Sie KI-Antworten immer kritisch prüfen. Oder wie Lehrer Joscha es formuliert: „Wie bei allen KI-generierten Texten muss überprüft werden, ob die Inhalte tatsächlich korrekt sind.“ Man darf die Ergebnisse der KI also nicht ungeprüft weitergeben – schon gar nicht an Schüler*innen.
Verzerrungen und Bias im Output: Ein weiteres Risiko sind eingebettete Vorurteile (Bias) in den KI-Antworten. Da KI-Modelle auf Basis großer Datenmengen aus dem Internet lernen, übernehmen sie auch die darin enthaltenen Stereotype und Unausgewogenheiten. So könnte eine KI unbeabsichtigt geschlechtsspezifische Rollenklischees verstärken, z.B. immer einen Mann als Wissenschaftler und eine Frau als Assistentin in Beispielen darstellen. Auch ethnische oder kulturelle Bias sind möglich – etwa wenn in Trainingsdaten bestimmte Gruppen unterrepräsentiert waren. Die Entwickler versuchen zwar, solche Verzerrungen herauszufiltern, aber vollständig gelungen ist das nicht. Für den Unterricht bedeutet das: Achten Sie auf subtile Vorurteile in KI-generierten Inhalten. Gegebenenfalls muss man Formulierungen anpassen oder Beispiele diversifizieren. Die KI reflektiert nicht moralisch, was sie ausgibt – diese Verantwortung bleibt bei uns Menschen.
Mangelndes Kontextverständnis: Aktuelle KI kennt weder Ihre Klasse noch den konkreten Bildungsplan auswendig. Sie liefert allgemeine Antworten, die nicht immer passgenau für Ihre Situation sind. So können Vorschläge der KI didaktisch danebenliegen, wenn sie den Lernstand der Schüler*innen oder spezifische Unterrichtsziele nicht „begreift“. Beispielsweise könnte ChatGPT eine Erklärung zu schwierig formulieren oder einen kulturell unpassenden Vergleich wählen, weil es den Kontext nicht wirklich versteht. Hier ist Ihre pädagogische Expertise gefragt, um einzuschätzen, was von den KI-Vorschlägen wirklich geeignet ist.
Abhängigkeit und Kompetenzverlust: Ein subtileres Risiko ist, dass man sich vielleicht zu sehr auf die KI verlässt. Wenn Lehrkräfte jede Idee von ChatGPT holen, besteht die Gefahr, die eigene Kreativität verkümmern zu lassen. Auch Schülerinnen und Schüler könnten versucht sein, Aufgaben einfach von der KI erledigen zu lassen, statt selbst zu üben – Stichwort Schummeln mit KI. Bereits kursieren KI-geschriebene Aufsätze oder Hausarbeiten. Die Versuchung ist da, doch lernt der Mensch dabei kaum etwas. Zudem sind Schulen gefordert, Regelungen zu finden: Ist der Einsatz von KI bei Hausaufgaben erlaubt oder gilt es als Täuschungsversuch? (Darauf gehen wir im nächsten Abschnitt zu Recht und Ethik noch ein.) Wichtig ist, dass sowohl Lehrende als auch Lernende KI als Werkzeug begreifen, nicht als Krücke. Es soll unterstützen, aber das eigene Denken nicht ersetzen.
Datenschutz und Sicherheitsfragen: Schließlich darf man nicht vergessen, dass bei der Nutzung mancher KI-Tools Daten an externe Server fließen. Gibt man z.B. Schülerlisten oder Notizen in eine amerikanische KI-Plattform ein, können datenschutzrechtliche Probleme auftreten. Auch besteht ein (wenn auch geringes) Risiko, dass sensible Informationen durch KI verarbeitet und eventuell sogar in anderer Form wieder ausgespuckt werden. Daher sollte man vorsichtig mit persönlichen Daten umgehen, wenn man KI verwendet. Im Schulkontext bedeutet das konkret: Keine Klarnamen von Schüler*innen oder vertrauliche Angaben in öffentliche KI-Dienste eingeben. Nutzen Sie nach Möglichkeit datenschutzgeprüfte Angebote. Mehr dazu im nächsten Abschnitt über die rechtlichen Rahmenbedingungen.
Trotz dieser Grenzen und Risiken sollte man KI nicht verteufeln – man muss sie aber kennen. Wenn Sie um diese Stolpersteine wissen, können Sie bewusst gegensteuern: Prüfen Sie Fakten, sensibilisieren Sie Ihre Klasse für mögliche Fehler und legen Sie klare Regeln fest. Dann bleibt KI ein nützliches Hilfsmittel und wird nicht zur Gefahr.
Rechtliche Rahmenbedingungen im Schulkontext
Beim Einsatz von KI im Schulbereich spielen rechtliche Vorgaben – allen voran Datenschutz und Nutzungsbedingungen – eine zentrale Rolle. Hier gilt es, sorgfältig hinzuschauen, um keine Regeln zu verletzen:
Datenschutz (DSGVO): Schulen unterliegen strengen Datenschutzbestimmungen. Wenn Sie KI-Tools verwenden, dürfen keine sensiblen personenbezogenen Daten ohne weiteres in solche Dienste eingegeben werden. Viele der populären KI-Dienste (wie ChatGPT oder DALL·E) werden von US-Firmen betrieben. Werden z.B. Namen von Schülerinnen, Leistungsdaten oder andere persönliche Informationen eingegeben, wandern diese Daten auf Server außerhalb der EU – das kann gegen die DSGVO verstoßen. Kein Wunder, dass Aufsichtsbehörden hellhörig sind: Italien blockierte ChatGPT im Jahr 2023 zeitweise wegen Datenschutzbedenken. Die Bildungsbehörden in DACH sind ebenfalls vorsichtig. So empfehlen viele Schulträger, KI vorerst nur für die Unterrichtsvorbereitung durch Lehrkräfte zu nutzen, nicht aber direkt durch Schülerinnen mit deren Daten. Der Kanton Zürich schreibt etwa vor, dass Schulen die Nutzung von KI rechtskonform gestalten müssen . Praktisch heißt das: Wenn KI im Unterricht eingesetzt wird, dann nur so, dass keine personenbezogenen Daten ungeklärt nach außen gegeben werden. Nutzen Sie möglichst Plattformen, die datenschutzkonform geprüft wurden (viele arbeiten an speziellen Education-Versionen). Im Zweifel sollten Sie eine Einwilligung der Eltern einholen, bevor Schüler*innen eigene Accounts erstellen oder personenbezogene Daten in KI-Systeme eingeben.
Nutzungsbedingungen und Altersgrenzen: Neben dem staatlichen Datenschutzrecht gelten auch die Regeln der Anbieter. Ein wichtiger Punkt: Mindestalter. Laut OpenAI muss man mindestens 13 Jahre alt sein, um Chat-GPT nutzen zu dürfen; unter 18-Jährige benötigen die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten . Ähnliche Altersgrenzen gelten für viele andere KI-Dienste. Für die Sekundarstufe I bedeutet das: Jüngere Klassen (unter 13) sollten nicht individuell mit solchen Tools arbeiten, und auch bei älteren Schüler*innen ist eine Zustimmung der Eltern ratsam, sofern sie eigene Accounts verwenden. Als Lehrkraft dürfen Sie KI-Plattformen natürlich selbst nutzen (Sie erfüllen ja die Altersbedingung), aber achten Sie darauf, diese nur im Einklang mit den AGB einzusetzen. Die meisten Anbieter untersagen zum Beispiel, ihre Dienste zur Erstellung von schädlichen oder beleidigenden Inhalten zu verwenden – doch das versteht sich von selbst.
Urheberrechtliche Fragen: Was ist mit dem Urheberrecht, wenn KI Inhalte erstellt? Grundsätzlich sind KI-generierte Texte oder Bilder oft nicht klar urheberrechtlich geschützt (weil kein menschlicher Urheber im klassischen Sinne vorliegt). Als Lehrkraft dürfen Sie die von der KI erzeugten Materialien in der Regel frei verwenden. Allerdings ist Vorsicht geboten, wenn Sie die KI ausdrücklich bitten, geschützte Werke zu nutzen (z.B. „Schreibe einen Aufsatz im Stil von Harry Potter“ oder „Zeige mir ein Bild von Mickey Mouse“). Solche Prompts könnten zu Ergebnissen führen, die Rechte Dritter tangieren. Hier sollten Sie Zurückhaltung üben. Im Zweifel gilt: KI-Ergebnisse lieber als Inspiration sehen und dann mit eigenen Worten/dem eigenen Stil ausarbeiten, statt sie 1:1 zu veröffentlichen.
Schulinterne Regelungen: Da KI-Tools noch neu sind, befinden sich viele Schulen in der Findungsphase, was erlaubte und unerlaubte Nutzung angeht. Klären Sie am besten im Kollegium, wie Sie mit Schülerarbeiten umgehen, bei denen KI genutzt wurde. Muss ein Schüler angeben, wenn ChatGPT beim Erstellen eines Textes geholfen hat? Wird die Nutzung von KI in Hausaufgaben toleriert oder als Täuschungsversuch gewertet? Solche Fragen sollten Sie idealerweise proaktiv besprechen und klare Regeln formulieren. In Klassenarbeiten und Prüfungen ist der Einsatz von KI natürlich verboten (ähnlich wie bei Spickzetteln oder unerlaubten Hilfsmitteln). Für Hausaufgaben könnten Schulen aber bspw. erlauben, dass Recherche-KIs wie Bing genutzt werden, solange die Eigenleistung erkennbar bleibt.
Fazit: Halten Sie sich über die rechtlichen Entwicklungen auf dem Laufenden. Die Gesetzgebung rund um KI (etwa der geplante AI Act der EU) befindet sich im Fluss. Schulen und Behörden werden voraussichtlich noch genauere Richtlinien erarbeiten. Bis dahin gilt: Im Zweifel den Datenschutz wahren, Altersvorgaben beachten, Transparenz schaffen und die Nutzung von KI klar kommunizieren. Dann bewegen Sie sich auch rechtlich auf der sicheren Seite.
Ethische Leitlinien: KI-Etikette und verantwortungsvolle Nutzung
Neben Gesetzen braucht es im Umgang mit KI auch einen ethischen Kompass. Es geht darum, KI respektvoll, fair und verantwortungsbewusst einzusetzen – sowohl als Lehrkraft wie auch mit den Schüler*innen. Hier sind einige Leitlinien einer guten KI-Etikette im Schulalltag:
Offenheit und Lernbereitschaft: Begegnen Sie KI-Technologien mit einer konstruktiven, offenen Haltung. KI ist gekommen, um zu bleiben – statt sie zu verteufeln, sollten wir sie kennenlernen und gemeinsam mit den Schüler*innen den Umgang damit üben . Das bedeutet auch: Bleiben Sie neugierig und bilden Sie sich weiter, denn die Entwicklungen gehen rasant.
Ergänzen, nicht ersetzen: Nutzen Sie KI als Werkzeug, nicht als Ersatz für menschliche Interaktion. KI kann den Unterricht bereichern, aber sie kann Sie als Lehrperson nicht ersetzen – und soll es auch nicht. Stellen Sie sicher, dass der pädagogische Kern weiterhin von Ihnen kommt. KI-Ideen oder - Materialien sollten immer in Ihren didaktischen Gesamtplan eingebettet sein, nicht losgelöst davon. Ebenso sollen Schüler*innen KI als Hilfsmittel sehen, um eigene Fähigkeiten zu erweitern, nicht um das Denken abzugeben.
Transparenz und Ehrlichkeit: Gehen Sie offen damit um, wenn Sie KI einsetzen. Weihen Sie z.B. Ihre Klasse ein: „Diese Übung habe ich mit Hilfe von ChatGPT erstellt.“ So lernen die Jugendlichen, KI-Einsatz als etwas Normales und Legitimiertes zu sehen – aber eben auch als etwas, das man offenlegt. Fördern Sie auch bei Schüler*innen Ehrlichkeit: Wenn jemand KI für eine Hausaufgabe genutzt hat, sollte er oder sie das kenntlich machen. Schaffen Sie eine Kultur, in der KI-Nutzung nicht als Schummeln betrachtet wird, solange offen damit umgegangen wird und die eigenen Gedanken erkennbar bleiben.
Fairness und Teilhabe: Achten Sie darauf, dass der KI-Einsatz niemanden benachteiligt. Nicht alle Schülerinnen haben zuhause Zugang zu den neuesten KI-Tools; planen Sie also Alternativen ein, damit kein Kind ausgeschlossen wird. Fördern Sie inklusiven Einsatz: KI kann gerade förderbedürftigen Schülerinnen helfen (etwa durch extra Erklärungen), aber das gelingt nur, wenn alle die Chance haben, sie zu nutzen. Fair heißt auch, auf Bias zu achten (wie im vorigen Abschnitt besprochen) – geben Sie allen das Gefühl, dass KI-Inhalte kritisch geprüft und ggf. angepasst werden, um gerecht zu bleiben.
Respekt und Datenschutz: Behandeln Sie KI wie einen öffentlichen Raum: Was man ihr anvertraut, könnte theoretisch in falsche Hände geraten. Geben Sie also nichts preis, was vertraulich bleiben muss (z.B. lästern Sie nicht über einzelne Schülerinnen in einem Chatbot-Dialog – das wäre unprofessionell und potenziell riskant). Begegnen Sie auch den KI-Modellen mit einem gewissen Respekt: Sie sagen bitte und danke im Chat? Warum nicht – Sie modellieren damit gutes Benehmen, auch gegenüber digitalen Helfern. Und wenn die KI einmal einen unpassenden Vorschlag macht, reagieren Sie sachlich und erklären Sie ggf., warum das unangebracht ist. So vermitteln Sie Ihren Schülerinnen einen kritischen und zugleich respektvollen Umgangston mit Technik.
Mensch im Mittelpunkt: Bei aller KI-Faszination – behalten Sie immer den Menschen im Zentrum. Pflegen Sie weiterhin den direkten Dialog mit Ihren Schüler*innen, fördern Sie Empathie, Kreativität und kritisches Denken jenseits der Technologie. Machen Sie deutlich, dass KI ein Tool ist, das menschliche Fähigkeiten ergänzt. Die Entscheidungen – ob im Unterricht oder im Leben – müssen letztlich wir Menschen treffen. Dieser Grundsatz hilft, eine gesunde Balance zu wahren: KI ist wertvoll, aber der zwischenmenschliche Aspekt der Bildung bleibt unverzichtbar.
Diese ethischen Leitlinien überschneiden sich teilweise mit den zuvor genannten Prinzipien . Im Kern läuft es darauf hinaus, bewusst mit KI umzugehen, Vorbild für die Schüler*innen zu sein und die Werte der Bildungsarbeit – wie Ehrlichkeit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit – auch im digitalen Wandel hochzuhalten.
Praktische Tipps für den Start
Nach all den Informationen juckt es Ihnen vielleicht in den Fingern, KI nun selbst auszuprobieren. Doch wie fängt man am besten an? Hier ein paar praktische Tipps für Ihren Einstieg:
Klein anfangen: Stürzen Sie sich nicht gleich in ein großes KI-Projekt. Wählen Sie zunächst einen einfachen Anwendungsbereich aus, der Ihnen liegt – z.B. eine Unterrichtsstunde, für die Sie mit ChatGPT ein paar Impulsfragen generieren lassen. Oder probieren Sie Canva aus, um ein existierendes Arbeitsblatt optisch aufzupeppen. Durch überschaubare Experimente sammeln Sie erste Erfahrungen, ohne dass gleich alles perfekt sein muss.
Eigenes Experimentieren vor dem Klasseneinsatz: Bevor Sie KI-Aktivitäten mit Ihrer Klasse durchführen, testen Sie die Tools selbst in Ruhe. Stellen Sie ein paar Testfragen an ChatGPT, lassen Sie sich von DALL·E ein Bild erstellen oder klicken Sie sich durch MagicSchool. So bekommen Sie ein Gefühl für Stärken, Schwächen und Tücken. Notieren Sie sich interessante Ergebnisse und Fallstricke. Diese Vorbereitung hilft, spätere Pannen im Unterricht zu vermeiden.
Gezielt prompten: Die Qualität der KI-Antworten hängt stark von Ihrer Eingabe (Prompt) ab. Überlegen Sie also genau, wie Sie Ihre Anfrage formulieren. Seien Sie spezifisch („Gib drei knackige Beispiele für…“) und geben Sie Kontext an („Niveau 7. Klasse, Hauptschule“). Scheuen Sie sich nicht, nachzuhaken oder den Prompt umzubauen, falls die erste Antwort nicht passt. Prompten will gelernt sein – aber keine Sorge, man wird schnell besser darin. Mit der Zeit entwickeln Sie ein Gefühl, wie Sie der KI die gewünschten Resultate entlocken.
Mit Kolleginnen austauschen: Sie sind nicht allein! Vielleicht gibt es in Ihrem Kollegium schon erste KI-Erfahrungen – tauschen Sie sich aus. Gemeinsames Ausprobieren mit Kolleginnen (z.B. in einer Fachkonferenz oder einem Workshop) kann den Einstieg erleichtern. Teilen Sie erfolgreiche Prompts oder Anwendungsfälle miteinander. Einige Schulen richten sogar KI-AGs für Lehrkräfte ein, um Know-how aufzubauen. Nutzen Sie auch Online-Communities und Fortbildungsangebote: Von Webinaren bis Blogs (etwa das Deutsche Schulportal) gibt es viele Quellen mit Praxisbeispielen und Tipps.





























