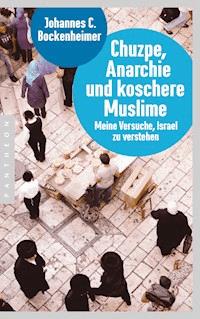
13,99 €
Mehr erfahren.
Unerhörtes aus dem gelobten Land
Chuzpe, Anarchie und koschere Muslime ist eine sehr persönliche Annäherung an den Staat der Juden, seine Menschen und deren Eigenheiten. Die zionistischen Träumereien Theodor Herzls dienen hierbei als Spuren, die den Autor mal in die Vergangenheit, in die noch junge Geschichte Israels führen, mal in die Gegenwart, zu seinen aktuellen Debatten und Konflikten, mit denen das Land immer wieder die Schlagzeilen dominiert. Ein Land wohlgemerkt, das weniger Einwohner hat als der Freistaat Bayern.
Johannes C. Bockenheimer gelingt ein behutsames, mitunter skurriles Porträt Israels, das letztlich vor allem eines tut: bestens unterhalten.
»Ich arbeite seit einiger Zeit an einem Werk, das von unendlicher Größe ist«, schrieb der österreichische Journalist Theodor Herzl 1895 in sein Tagebuch, »seit Tagen und Wochen füllt es mich aus bis in die Bewusstlosigkeit hinein.« Der Grund für die Ohnmachtsanfälle war die Arbeit am Manuskript seines Buches Der Judenstaat. Herzl skizzierte darin die Gründung eines Landes, das den Juden zur Heimat werden sollte – und brach damit die zionistische Revolution los. Obwohl ihm mit der Schrift weder literarisch noch politisch ein Meisterwerk gelang, wurde es zur Inspiration für Millionen – vier Jahrzehnte nach Herzls Tod feierte der Staat Israel seinen Unabhängigkeitstag. Aber war die Revolution erfolgreich, ist Israel wirklich das Land geworden, von dem Herzl träumte?
Der Journalist Johannes C. Bockenheimer hat sich in den vergangenen Jahren mit israelischen Schriftstellern, Politikern, Rabbis, Managern und Pornostars über ihr Land unterhalten. Bockenheimers Fazit: Die Revolution ist (vorerst) gescheitert – aus anderen Gründen allerdings, als man denken könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 202
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Unerhörtes aus dem Gelobten Land
»Ich arbeite seit einiger Zeit an einem Werk, das von unendlicher Größe ist«, schrieb der österreichische Journalist Theodor Herzl 1895 in sein Tagebuch, »seit Tagen und Wochen füllt es mich aus bis in die Bewusstlosigkeit hinein.« Der Grund für die Ohnmachtsanfälle war die Arbeit am Manuskript seines Buches »Der Judenstaat«. Herzl skizzierte darin die Gründung eines Landes, das den Juden zur Heimat werden sollte – und brach damit die zionistische Revolution los. Obwohl ihm mit der Schrift weder literarisch noch politisch ein Meisterwerk gelang, wurde es zur Inspiration für Millionen – vier Jahrzehnte nach Herzls Tod feierte der Staat Israel seinen Unabhängigkeitstag.
Aber war die Revolution erfolgreich, ist Israel wirklich das Land geworden, von dem Herzl träumte? Der Journalist Johannes C. Bockenheimer hat sich in den vergangenen Jahren mit israelischen Schriftstellern wie Amos Oz, mit Politikern, Rabbis, Managern und Pornostars über ihr Land unterhalten. Bockenheimers Fazit: Die Revolution ist (vorerst) gescheitert – aus anderen Gründen allerdings, als man denken könnte.
Johannes C. Bockenheimer hat in Hamburg Politikwissenschaften und in Beer Sheva/Israel Nahostwissenschaften studiert. Anschließend volontierte er an der Georg von Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten. Zunächst arbeitete er als Korrespondent im Berliner Büro des Handelsblatts, seit Dezember 2014 ist er im Wirtschaftsressort des Tagesspiegels tätig. Bockenheimer berichtete in der Vergangenheit u. a. für die Jüdische Allgemeine, die Zeit und den Evangelischen Pressedienst immer wieder aus Israel und den Palästinensischen Gebieten. 2011 war er Nahost-Fellow des Teddy-Kollek-Stipendiums.
Johannes C. Bockenheimer
Chuzpe, Anarchie und koschere Muslime
Meine Versuche, Israel zu verstehen
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Der Pantheon Verlag ist ein Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH.
Erste Auflage
Oktober 2015
Copyright © 2015 by Pantheon Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: © Peter Rigaud/laif
Satz: Ditta Ahmadi, Berlin
ISBN 978-3-641-15673-2
www.pantheon-verlag.de
Für meine Neffen Jonathan und Itamar, denen ich eigentlich ein Buch über das Leben der Dinosaurier versprochen hatte. Weil sich mein Wissen über Ceratosaurus, Pentaceratops oder den Tyrannosaurus Rex bereits nach dem ersten Absatz als unzureichend herausstellte, muss diese Widmung zugleich auch als Entschuldigung dienen.
Inhalt
1. Was Theodor Herzl dem Tyrannosaurus Rex voraushatte
2. Warum Amos Oz über rote Ampeln läuft
3. Warum Sayed Kashua beim Abheben des Flugzeugs zum Muslim wird – und bei der Landung zum Israeli
4. Wie mich Yuval Steinitz einmal beinahe verhungern ließ
5. Warum Ester Levanon sauer auf Mose ist
6. Warum Jonathan Agassi den Sex mit Arabern schätzt
7. Warum Dani Dayan an einem Ort lebt, an dem er nicht leben will
8. Wie Rabbi Hirsch einmal einer Zionistin auf den Leim ging
9. Warum Anat Hoffman gegen Monopole kämpft
10.Warum Theodor Herzl gescheitert ist
1.Was Theodor Herzl dem Tyrannosaurus Rex voraushatte
Im Anfang war das Wort, so heißt es in der Bibel. Doch auch wenn Apostel Johannes damit zweifelsohne ein hübscher Satz gelungen ist, krankt er doch an einer Schwäche: Mit der Realität hat er nichts zu tun. Denn wie mittlerweile bekannt ist, war es nicht ein Wort, sondern eine mächtige Explosion, der Urknall, der die Dinge ins Rollen brachte. Mit ihm entstanden Zeit, Raum und Materie; dann breiteten sich Sterne im Universum aus, Planeten folgten. Auf einem dieser Planeten – unserem – bildete sich eine Atmosphäre, die Leben zuließ. Erst erblickten Einzeller das Licht der Welt, dann ließen sich Mehrzeller blicken, und schließlich, viele Millionen Jahre später, bevölkerten komplexe Organismen wie der Dinosaurier die Erde. Viel Zeit war den Reptilien freilich nicht vergönnt, denn so plötzlich, wie sie aufgetaucht waren, verschwanden sie auch wieder und machten Platz für eine neue Spezies – den Menschen. Erst mit ihm, gut dreizehneinhalb Milliarden Jahre waren seit dem Urknall vergangen, fiel dann tatsächlich das erste Wort.
Apostel Johannes mag mit seiner Theorie von der Geschichte des Universums einem Irrtum aufgesessen sein, was jedoch die Menschheitsgeschichte angeht, lag Jesus’ Lieblingsjünger goldrichtig. Denn mit unseren Worten können wir Menschen nicht nur über das Wetter plaudern oder unseren Artgenossen den kürzesten Weg zum nächsten Supermarkt beschreiben. Mit unseren Worten können wir auch über Dinge sprechen, die es eigentlich gar nicht gibt. »Jede großangelegte menschliche Unternehmung – angefangen von einem archaischen Stamm über eine antike Stadt bis zu einer mittelalterlichen Kirche oder einem modernen Staat – ist fest in gemeinsamen Geschichten verwurzelt, die nur in den Köpfen der Menschen existieren.« Das schrieb der israelische Historiker Yuval Harari in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit und machte damit gleichzeitig deutlich, was der Homo sapiens dem Dinosaurier und anderen Lebewesen voraushat: die Fähigkeit, aus fiktiven Geschichten reale Welten zu schaffen. So gesehen hatte Apostel Johannes dann doch recht, als er schrieb: »Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist.«
Und wenn es auf dieser Welt ein Völkchen gibt, das weiß, wie mächtig Worte sein können, dann sind es die Juden. Mit der Torah haben sie in den vergangenen Jahrtausenden unsere Künste, unsere Wissenschaften und unsere Gesellschaften tiefer geprägt als jeder Geschichtenerzähler vor oder nach ihnen. Die Juden und ihre Worte sind dabei so unzertrennlich geworden, dass man, wenn man heute von den Juden spricht, auch vom Am HaSefer, vom Volk des Buches spricht.
Doch wo Licht ist, fällt auch Schatten: Mit der Bibel gelang dem Nomadenstamm von der arabischen Halbinsel zwar ein beispielloser Bestseller. Gleichzeitig aber plagen die Israeliten seit viertausend Jahren Probleme mit Trittbrettfahrern und Kopisten. Wer heute etwa auf den Berg Sinai steigt, läuft am Bergfuß an einem christlich-orthodoxen Kloster vorbei – und stolpert an der Bergspitze über eine sunnitische Moschee. So hatte sich Mose die Zukunft sicherlich nicht vorgestellt. Damals, als er vor Ort mit Meißel und Steinplatte zugange war. Das Volk des Buches mag die Geschichte von Mose und dem einen Gott erfunden haben. Weitergeschrieben wird sie mittlerweile auch von anderen.
Das Volk der drei Bücher
Wenn aber die Juden das Am HaSefer sind, dann müssten die Israelis als das Am schloched HaSeferim in die Geschichte eingehen ‒ als das Volk der drei Bücher. Denn mindestens genauso wichtig wie die Torah waren für die Gründung des Staates Israel die Werke eines österreichischen Journalisten, die ab dem späten 19. Jahrhundert unter Europas Juden für Furore sorgten – und ihren Autor beinahe in den Wahnsinn trieben. »Ich arbeite seit einiger Zeit an einem Werk, das von unendlicher Größe ist«, schrieb Theodor Herzl 1895 in sein Tagebuch, »seit Tagen und Wochen füllt es mich aus bis in die Bewusstlosigkeit hinein.«
Der Grund für seine Ohnmachtsanfälle war die Arbeit am Manuskript seines Buches Der Judenstaat. Herzl skizzierte darin die Gründung eines Landes, das den Juden zur Heimat werden sollte. Wenige Jahre später ließ er seinem Erstlingswerk die utopische Novelle Altneuland folgen, in der er den ersten Entwurf aus dem Judenstaat noch detaillierter ausarbeitete. Letztendlich gelang Herzl mit seinen Schriften etwas, was nur wenige Autoren von sich behaupten können: Er brach eine Revolution los – die zionistische Revolution.
Ausgerechnet Herzl. Denn von allen Revolutionären war der Österreicher wohl der schillerndste: ein Frauenschwarm und Muttersohn, ein eitler Dandy und gescheiterter Poet, ein jüdischer Jules Verne und zugleich weltlicher Prophet. 1860 in Budapest als Sohn deutschsprachiger Juden geboren, war es für Herzl dabei ein langer Weg bis zur Prophetie. Die Synagoge, nur einen Steinwurf von seinem Geburtshaus entfernt, besuchte er allenfalls an den hohen Feiertagen, und auch als es seine Familie später nach Wien zog, verbrachte er seine Tage lieber mit Fechtduellen in einer deutschnationalen Burschenschaft als mit Tallit, Torah und der jüdischen Tradition.
Obwohl Herzl mit Der Judenstaat und Altneuland weder literarisch noch politisch ein Meisterwerk gelang, nahmen ihn seine Leser beim Wort ‒ vier Jahrzehnte nach seinem Tod feierte der Staat Israel seinen Unabhängigkeitstag. Dabei lesen sich die Schriften über weite Strecken wie eine jüdische Variante von Robinson Crusoe, in dem der Irrfahrer nicht auf einer einsamen Insel, sondern mit Kippa und Chanukka-Dreidel im Koffer im Nahen Osten strandet.
Beseelt vom Fortschrittsglauben seines Zeitalters, skizzierte Herzl in den Büchern einen Judenstaat, in dem sich die Menschen von elektrischen Bahnen unterirdisch durch die Städte chauffieren lassen und in dem der Strom in verzweigten Rohranlagen durch Wasserkraft produziert wird. Die zähe politische Debatte, die Religionen ‒ aber auch den Antisemitismus ‒ hätte Herzl hingegen am liebsten dort zurückgelassen, wo sie in den vergangenen Jahrhunderten Schaden angerichtet hatten: im alten Europa.
Herzl schrieb naiv wie ein Schuljunge und wurde doch zur Inspiration für Millionen. Nicht nur ließen seine Leser den Judenstaat vom Buch zur Realität werden, in Haifa fährt seit den fünfziger Jahren zudem die »Karmelit«, mit eins Komma acht Kilometer Streckenlänge die kleinste U-Bahn der Welt. Mehr noch, die Namen gleich zweier Städte erinnern heute an den Verstorbenen. Herzlia ist die eine davon, Tel Aviv die andere. Wer einen Israeli nach dem Weg nach Tel Aviv fragt, der fragt ihn nach dem Weg zum »Frühlingshügel«. Diesen Namen trug die hebräische Übersetzung des Romans Altneuland. Dass man ihm einmal solche Denkmäler setzen würde, das hätte wohl nicht mal der eitle Herzl zu hoffen gewagt, als er über seinen Manuskripten brütete.
Doch was ist das für eine Nation, die den Roman eines österreichischen Journalisten zum Bauplan ihres Staates gemacht hat? Was ist das für ein Land, dem Worte, Geschichten und Schriftsteller so sehr ans Herz gewachsen sind, dass ganze Städte nach ihnen benannt werden? Wer die israelische Seele ergründen will, so viel steht fest, der sollte zuallererst mit den Autoren des Landes sprechen.
2.Warum Amos Oz über rote Ampeln läuft
Deutsche Gene
Ich bin mit Amos Oz verabredet. Städte wurden nach ihm zwar keine benannt, dafür wird seit Jahren gemunkelt, dass er der erste in Israel geborene Schriftsteller sein könnte, dem der Literatur-Nobelpreis verliehen wird. Eine erstaunliche Karriere für jemanden, der mit sechzehn Jahren aus Rebellion gegen das intellektuelle Elternhaus in den Kibbuz zog, um dort fortan Traktor zu fahren und Felder zu bestellen. Sein Vater sprach zehn Sprachen, schrieb Gedichte und verdiente sein Geld als Bibliothekar. Seine Mutter hatte Philosophie studiert, sprach vier Sprachen fließend und las Bücher in drei weiteren. Er aber sei damals ein glühender Zionist gewesen. Und ein Schwätzer, der nicht länger nur Maulheld sein, sondern sein Leben ganz dem Herzl’schen Traum von der Besiedlung des Landes widmen wollte.
Oz’ rebellischer Plan ging auf, zwei Jahre dauerte es, bis sein Vater nach seinem Auszug wieder ein Wort mit ihm sprach. In der Zwischenzeit war aus dem schmächtigen Jugendlichen ein junger Mann geworden, der über Schweißarbeit nicht nur gelesen, sondern sie auch verrichtet hatte. Doch mit jedem Jahr, das er länger im Kibbuz lebte, verringerte sich die Zeit, die er auf dem Feld verbrachte. Wie es Menschen so oft passiert, wenn sie älter werden, holte auch Oz das eigene Milieu wieder ein. Aus dem Kibbuznik wurde ein Intellektueller. Er wurde zum Schriftsteller, der für seine Fiktion zwar geliebt, für seine politischen Wortmeldungen aber kritisch beäugt wird. Von allen Seiten. Israels Rechte wirft ihm bis heute Verrat vor, weil er einer der Ersten war, der sich für eine Zweistaatenlösung mit den Palästinensern aussprach. Den israelischen Linken wiederum ist er nicht geheuer, weil er ihnen immer wieder den Spiegel vorgehalten, ihnen ihre Widersprüche und ihre Selbstgefälligkeit aufgezeigt hat.
In der politischen Landschaft Israels sitzt Amos Oz zwischen allen Stühlen – und mir sitzt er heute Abend auf dem Sofa gegenüber. Die Wand hinter ihm scheint aus Büchern gebaut, dicht an dicht drängen sie sich in den Regalen. Einzig ein Aquarium unterbricht die Anhäufung zahlloser Buchrücken und gibt den Blick frei auf die Wand, von der sich an manchen Stellen schon der Putz löst. Wegen israelischer Wände bin ich aber nicht gekommen, ich will durch sie hindurchsehen und einen Blick auf das werfen, was sich hinter ihnen abspielt. Doch wie bringe ich einen der größten Denker dieses Landes dazu, mir Interna auszuplaudern? Ich versuche es mit einem Plausch über die Straßenverkehrsordnung.
Es gebe ein deutsches Gen in mir, erzähle ich ihm, das es mir unmöglich mache, Ampeln bei Rot zu überqueren. Bei meinen israelischen Freunden hat mir das Spott und Häme eingebracht. Denn selbst in dunkler Nacht, wenn Autos, Busse und Menschen längst schlummern, fürchte ich mich davor, dieses Gesetz zu brechen. Man muss Vorbild für die Kinder sein, immer und überall, so hat man es mir in Deutschland eingebläut. Oz lacht, seine israelischen Gene zwängen ihn regelmäßig zum genauen Gegenteil. »Im Judentum gibt es eine lange Tradition der Anarchie, da kann man nicht auf jede einzelne rote Ampel Rücksicht nehmen.« Aber, ach ‒ das denke ich mir im Stillen ‒, wären es nur die roten Ampeln! Ich saß in diesem Land in einem Bus, der auf der Autobahn den Rückwärtsgang einlegte. Und ich fuhr im dichten Berufsverkehr mit einem Taxi, das für ein Überholmanöver die Parkbucht einer Bushaltestelle nutzte.
»Regeln, Gesetze und Vorschriften haben in Israel den Rang einer Handlungsempfehlung. Sie gelten immer nur so lange, bis jemand eine bessere Idee hat«, sagt Oz ungerührt. Und das sei eigentlich immer der Fall. Diese Missachtung für Vorschriften beginnt bei der Straßenverkehrsordnung, sie endet aber nicht dort. Sie setzt sich fort in der Politik, in der Wirtschaft, in der Religion, kurz: in allen Fragen, mit denen sich Menschen herumschlagen müssen. »Der Respekt vor Autoritäten ist ein hübsches Konzept der übrigen Welt, für uns Israelis ist das aber nichts.« Oz kneift die Augen zusammen, während er das sagt. So als sei schon das Aussprechen des Wortes »Autorität« etwas furchtbar Unanständiges. »Es ist egal, ob es sich um den Premierminister, den Rabbi oder die Eltern handelt, im Land der Propheten ist jeder sein eigener Prophet, jeder weiß es besser. Wir Israelis streiten miteinander, wir streiten mit uns selbst, und wenn mal Gott mit einer schlechten Idee um die Ecke kommt, dann streiten wir auch mit ihm.«
Dass man sich im Staat der Juden mit Gott persönlich zankt, ist dabei nicht etwa Zeichen einer fortschreitenden Säkularisierung, sondern altbewährte Tradition. Der jüdische Stammvater Abraham war vor viertausend Jahren der Erste, der seinen Schöpfer wissen ließ: Einspruch, Euer Ehren! Den entsprechenden Nachweis in Form einer Torah-Anekdote hat der bekennende Atheist Oz erstaunlich schnell bei der Hand: Als Gott die Bewohner der Städte Sodom und Gomorra für ihr lasterhaftes Treiben mit der Zerstörung ihrer Städte bestrafen wollte, nahm er sich Abraham zur Seite, um ihn über seine Pläne in Kenntnis zu setzen. Noch während Oz den biblischen Schwank zu Ende erzählen kann, dämmert es mir: einen Juden nach seiner Meinung fragen? Ein lausiger Anfängerfehler.Denn natürlich kam es so, wie es kommen musste. Abraham hielt wenig von den göttlichen Bestrafungsplänen und begann stattdessen mit seinem Schöpfer zu feilschen – »genau so«, sagt Oz, »wie es die Händler mit ihren Kunden auf dem Schuk Mahane Jehuda tun«, Jerusalems großem Markt.
Sein Gegenvorschlag war, dass Gott die Städte verschonen solle, für den Fall, dass Abraham fünfzig anständige und gottesfürchtige Männer auftreiben könne. Gott ließ sich auf den Deal ein, und Abraham hätte nun losziehen und sich auf die Suche nach den anständigen Männern machen können. Das tat er aber nicht. Stattdessen feilschte er munter weiter. Abraham handelte den Schöpfer erst auf fünfundvierzig Männer herunter, dann auf vierzig, dann auf dreißig, auf zwanzig und schließlich auf zehn. Abraham gewann allerdings nur die Schlacht, dann musste er sich geschlagen geben. Denn im Las Vegas der Bronzezeit waren anständige Männer so rar gesät wie Bananen in der DDR. Chuzpe bringt einen mitunter weit, aber nicht immer weit genug.
Wenn Abraham in Sodom und Gomorra auch nur einen Etappensieg verbuchen konnte, sein Aufbegehren gegen den Schöpfer hat die jüdische Zivilisation auf zwei Weisen tief geprägt. Einerseits müssen sich bis heute mindestens zehn Männer finden, bevor ein jüdischer Gottesdienst beginnen kann. Andererseits, und das ist die weitaus wichtigere Lektion aus dem Debakel von Sodom und Gomorra, gibt es nichts in dieser Welt, was sakrosankt, was unantastbar wäre. Dieser Tradition des Widerspruchs ist man in Israel treu geblieben. Das gilt nicht nur am Schabbat oder an den hohen Feiertagen, es gilt vierundzwanzig Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, in guten wie in schlechten Zeiten.
Tolstoi im Schützengraben
Eine überaus schlechte Zeit für die Pflege dieser Tradition dürfte der Juniabend im Jahr 1967 gewesen sein, bevor der Sechstagekrieg ausbrach. Oz war Reservist in einer Panzereinheit und wartete nahe der ägyptischen Grenze auf den Marschbefehl. Hätte sich Dwight D. Eisenhower am Vorabend des D-Days auf Diskussionen eingelassen? Hätte Arthur Wellesley, besser bekannt als General Wellington, kurz vor der Schlacht von Waterloo noch alle seine hundertzwanzigtausend Soldaten um ein Meinungsbild gebeten? Eher nicht, denke ich. Doch ich denke falsch, denn ich denke an Europa. In Israel laufen die Dinge anders: »Der General unserer Brigade, Israel Tal, erklärte unserem Zug am Vorabend seine taktischen Pläne für die anstehende Operation.« Er kam nicht weit, nach wenigen Sätzen wurde der hochdekorierte Militär von einem Zwischenruf aus den hinteren Reihen unterbrochen: »Entschuldigen Sie, Herr General, Sie sind im Begriff, einen schweren konzeptionellen Fehler zu begehen!«
Der Einspruch kam von einem Unteroffizier der Reserve, der, so erinnert sich Oz, »leicht dicklich und keine vierzig Jahre alt« war, nach militärischen Maßstäben ein Dreikäsehoch also. In jeder anderen Armee auf Mutter Erde hätte man den Mann für seinen aufmüpfigen Zwischenruf zum Strafdienst in der Brigade-Toilette verdonnert. Nicht so bei den israelischen Streitkräften. Dieser Mann war mit der Strategie seines Generals ganz und gar nicht einverstanden, und niemand nahm Anstoß daran, dass er seinen Widerspruch auch lautstark kundtat. In einem Land, in dem nicht mal das Wort Gottes heilig ist, sind es die Worte eines Generals erst recht nicht. Was folgte, war aber nicht etwa eine taktische Manöverkritik, in der über Geschützstellungen und die richtige Position von Panzerverbänden gefachsimpelt wurde. Nein, was folgte, war ein Ausflug in die Weltliteratur, den man im Literaturseminar der Universität von Tel Aviv erwartet hätte, nicht aber im Schützengraben der israelischen Südfront. »Der Unteroffizier fragte den General, ob er von Tolstoi Krieg und Frieden gelesen habe.« Der Gesichtsausdruck des Generals muss sich in diesen Sekunden irgendwo zwischen Verwunderung und Ahnungslosigkeit bewegt haben. Tolstoi? Krieg und Frieden? Worauf will dieser Mann hinaus?
Spannung im Wohnzimmer der Familie Oz. Im Aquarium blubbert die Luftpumpe. Oz weiß, wie man das Publikum fesselt. Er schweigt, schmunzelt und lässt mich zappeln. Ich tue ihm den Gefallen und hake nach. Wie war die Antwort des Generals, hatte er das Buch gelesen? »Selbstverständlich, nach eigener Aussage sogar mehrfach«, rekapituliert er. Denn General Tal war nicht nur ein verdienter Veteran, er war auch ein belesener Bürger, wie er an diesem Abend stolz seine Soldaten wissen ließ. Bevor er sein Leben der Armee widmete, hatte er ein Diplom in Philosophie von der Hebräischen Universität von Jerusalem erworben. Mit dem Verweis auf seine akademischen Meriten hoffte Tal, den Unteroffizier in seine Schranken gewiesen zu haben und endlich fortfahren zu können. Doch weit gefehlt, der vermeintliche Triumph des Generals über den Unteroffizier war eben nur das: ein vermeintlicher.
Wie sich herausstellte, war der widerspenstige Reserveoffizier seinerseits im Zivilleben Professor für russische Literatur an der Universität in Tel Aviv. General schlägt Unteroffizier, doch Professur schlägt Diplom. Siegessicher legte der Unteroffizier deshalb nach: »Wenn Sie das Buch gelesen haben, dann sollten Sie es ja eigentlich besser wissen!« Wie einen Studenten im Erstsemester wies er seinen General zurecht: »Sie sind im Begriff, denselben Fehler zu wiederholen, der den Russen vor hundertfünfzig Jahren den Sieg bei der Schlacht von Borodino gekostet hat.« Tolstoi habe das in seinem Buch doch überaus deutlich gemacht.
Man muss sich vor Augen führen, dass sich diese Plauderei über die Sternstunden der russischen Literatur nicht etwa in ungezwungener Runde bei Kaffee und Kuchen zutrug. Es war Sonntag, der 4. Juni 1967, und die Existenz des jungen Staates war in Gefahr. Über Monate hinweg hatten die Regierungen der arabischen Nachbarstaaten Israel mit der Vernichtung gedroht. Die Soldaten dieser Länder standen Gewehr bei Fuß an der Grenze und warteten auf den Marschbefehl. Die Stimmung in Israel war dementsprechend düster. In der Bevölkerung hatte sich das Gefühl breitgemacht, dass sich »eine neue Katastrophe« anbahne; dass den Juden gar ein »weiterer Holocaust« drohe, schrieb der Historiker Michael Oren über die bedrückende Stimmung. Nicht weniger apokalyptisch drückte es Ministerpräsident Levi Eschkol aus: »Blut vet sich giessen vie vasser«, warnte er seine Landsleute auf Jiddisch.
Doch selbst in dieser finsteren Stunde gelang es der Truppe nicht, die jüdische Lust an der Debatte abzustreifen. »Zunächst waren es nur General und Unteroffizier, die sich zankten. Nach und nach mischte sich dann auch der Rest des Zuges ein«, erinnert sich Oz. Es endete in einem heillosen Durcheinander. Die Scharfschützen stritten mit der Fernmeldeeinheit über Militärtheorien, im Speziellen über die von Carl von Clausewitz. Der Brigade-Koch wiederum diskutierte mit den Panzergrenadieren über die Rationalität des Krieges im Allgemeinen. Über vierzig erwachsene Männer hatten alle ihre ganz eigene Vorstellung davon, ob und wie die Schlacht zu gewinnen sei. »Das ist Israel«, sagt Oz, »ein Land, bevölkert von Ausrufezeichen, die laufen gelernt haben.« Kaum zu glauben, dass dieser zankende Haufen sich überhaupt darauf einigen konnte, am nächsten Tag gemeinsam in den Krieg zu ziehen. Dass der Krieg dann aber auch noch in Rekordzeit gewonnen wurde, grenzt an ein Wunder. Die Vermutung liegt nahe, dass die arabischen Soldaten es nach sechs Tagen Dauerzwist mit ihren israelischen Opponenten schlicht und einfach leid waren, auch nur einer weiteren Debatte der Hebräer beiwohnen zu müssen. Dann doch lieber kapitulieren und beim Schabbat, pardon!, während der nächsten al-Dschumu’a zur Ruhe kommen.
Was würde Herzl tun?
Widerspruch als Staatsdoktrin – mich plagen Zweifel, ob Theodor Herzl die Lust an der Debatte ebenfalls als zentrales Element der jüdischen Zivilisation benannt hätte. Zumindest in seinen Büchern deutet nichts darauf hin. In Altneuland schwärmte er davon, dass man im Judenstaat die Besetzung der hohen Ämter nicht im lärmenden Konkurrenzkampf der Demokratie ausloten würde, die Amtsträger würden stattdessen nach Leistung und Persönlichkeit auserwählt werden. Schon wer Wahlkampf betreibe, hätte sich dadurch automatisch disqualifiziert. Dass sich sechs Millionen zankende Juden auf ein solches System einlassen würden, auch nur versuchsweise, scheint mir so wahrscheinlich wie ein Schneemann im sommerlichen Eilat. Nein, Herzl wollte weder streiten noch sich gegen Autoritäten auflehnen. Hätte er sich nicht vor über einem Jahrhundert von uns verabschiedet, würde Herzl heute gemeinsam mit mir an der Ampel auf grünes Licht warten. Dass nicht alles so gekommen ist, wie es sich der Vater des Zionismus gewünscht hat, bekümmert Amos Oz indes wenig. Ganz im Gegenteil: Ob er sich manchmal wünsche, seine Leute hätten sich für Herzls Träume ein bisschen mehr ins Zeug gelegt, frage ich ihn.
Seine hebräische Antwort fällt knapp aus: »«. Auf Deutsch heißt das so viel wie: »Pfff«.
Der Grund für Oz’ beleidigtes Schnauben liegt in zwei Sätzen begründet, die Herzl im Judenstaat zu Papier gebracht hat und die Oz ihm niemals verzeihen wird. Herzl schrieb: »Wir können doch nicht Hebräisch miteinander reden. Wer von uns weiß genug Hebräisch, um in dieser Sprache ein Bahnbillett zu verlangen?« Stattdessen schlug er vor, man solle es im künftigen Judenstaat wie in der Schweiz machen und einen Sprachföderalismus etablieren. »Jeder behält seine Sprache, welche die liebe Heimat seiner Gedanken ist«, schrieb er. Am liebsten wäre es ihm freilich gewesen, wenn man sich im Judenstaat auf Deutsch als gemeinsame Sprache einigen könne, notierte er in seinen Tagebüchern.
Welch ein Affront für den hebräischen Dichter und Denker Amos Oz! Denn dieser Mann hat nicht nur drei Dutzend Bücher auf Hebräisch geschrieben, er kann auch Bahntickets in dieser Sprache lösen. Und nicht nur er, neun Millionen andere Menschen können es auch. »Es gibt mittlerweile mehr Menschen in dieser Welt, die Hebräisch sprechen, als Menschen, die österreichisches Deutsch sprechen«, rechnet mir Zahlenzauberer Oz triumphierend vor. Das sei siebzig Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges die schönste Rache an Hitler, die er sich vorstellen könne. Ich werde den Eindruck nicht los, dass es für Oz auch eine kleine Rache an dem anderen Österreicher, an Herzl, ist, der ihn und seine Landsleute mit der deutschen Sprache malträtieren wollte.





























