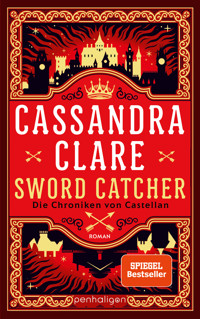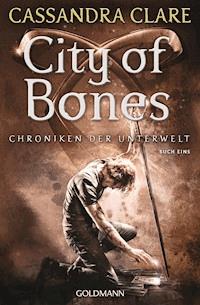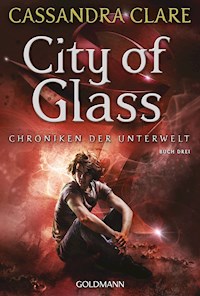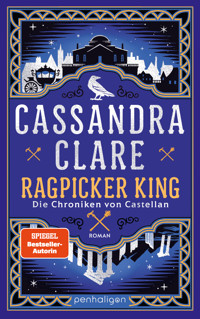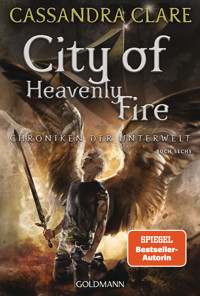9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Schattenjäger
- Sprache: Deutsch
Nach langer Reise quer über den Atlantik trifft die sechzehnjährige Tessa Gray im Viktorianischen London ein. Dort hofft sie, ihren verschollenen Bruder wiederzufinden. Doch statt einer Familienzusammenkunft warten Gefahr und Dunkelheit auf sie in den engen Gassen der Stadt. Vampire, Hexenmeister und Schlimmeres treiben hier ihr Unwesen, und nur die Schattenjäger wagen es, sich den Dämonen der Unterwelt in den Weg zu stellen. Sie retten Tessa das Leben. Als die junge Frau dann herausfindet, dass sie selbst ein Wesen zwischen Schatten und Licht ist und über große Kräfte verfügt, muss sie sich entscheiden: zwischen Gut und Böse, zwischen Loyalität und Liebe ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 810
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Völlig ahnungslos tritt die sechzehnjährige Tessa Gray ihre Reise aus den USA ins viktorianische London an, wo sie ihren lange verschollenen Bruder suchen will – doch was sie findet, sind die nebelverhangenen Gassen einer Stadt, deren Unterwelt von gefährlichen Wesen beherrscht wird: Vampiren und Hexenmeistern, Werwölfen und Dämonen. Nur die Schattenjäger wagen es, sich diesen Wesen entgegenzustellen. Was sie nicht verhindern können, ist, dass Tessa kurz nach ihrer Ankunft von den geheimnisvollen Dunklen Schwestern entführt wird. Denn die junge Frau ist keine gewöhnliche Sterbliche: Wie Tessa schmerzhaft erfahren muss, ist auch sie ein Wesen der Unterwelt und mit außergewöhnlich starken magischen Kräften ausgestattet. Kräfte, die sie selbst noch nicht beherrscht, die sie aber zur begehrten Waffe im ewigen Krieg von Gut gegen Böse machen.
Im Kampf um ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung stehen ihr die Londoner Schattenjäger bei. Vor allem Jem und Will, zwei Freunde, die unterschiedlicher nicht sein könnten – und die doch eng miteinander verbunden sind. Bald kämpfen die drei Seite an Seite gegen die bösen Mächte, die Tessa und die gesamte Schattenjägergemeinde gefährden. Und gegen die Gefühle, die das enge Band zwischen ihnen selbst zu zerreißen drohen …
Weitere Informationen zu Cassandra Clare
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
Clockwork Angel
Chroniken der Schattenjäger
BUCHEINS
Roman
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »The Infernal Devices. Book One. Clockwork Angel« bei Margaret K. McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Erstmals auf Deutsch erschienen im Jahr 2011.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Neuausgabe Juni 2022
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Cassandra Clare, LLC
Copyright © dieser Ausgabe 2022
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Franca Fritz und
Heinrich Koop © 2011 Arena Verlag GmbH, Würzburg, www.arena-verlag.de
Gedicht S. 201: Algernon Charles Swinburne, Dolores; © Amshaugk Verlag 1990
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon
Covermotiv: © Cliff Nielsen
TH · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-29213-3V002
www.goldmann-verlag.de Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Jim und Kate
Lied der Themse
Ein Hauch von Salz
liegt in der Luft. Der Strom schwillt an,
wird dunkler, bald teebraun,
steigt weiter, trifft auf Grün.
Darüber am Ufer die Zahnräder und Riemen
monströser Maschinen
rattern und rasen, der Geist darin,
versteckt in ihren Spulen,
wispert von Mysterien.
Jedes Goldrädchen hat Zähne,
jedes große Rad bewegt
ein Paar Hände, die schaufeln
das Wasser aus dem Fluss,
es verzehren, in Dampf verwandeln
zum Antrieb der gewaltigen Maschine,
gnadenlos bis zum Zerfall.
Die Flut steigt weiter, sanft und leise,
zerstört die mechanische Ordnung.
Salz und Rost und Schlick
bremsen das Getriebe.
Unten am Ufer
die eisernen Kessel
rütteln an ihren Ankerketten
mit dem hohlen Dröhnen
einer gigantischen Glocke,
wie Pauken und Kanonen,
die grollen im Klange von Donnerschlägen.
Und der Strom, er wogt vorbei.
Elka Cloke
Prolog
London. April 1878.
Der Dämon explodierte in einem Regen aus blutigem Sekret und Eingeweiden.
William Herondale riss die Hand mit dem Dolch zurück, doch es war zu spät: Die zähflüssige Säure des Dämonenbluts hatte sich bereits in das Metall der glänzenden Klinge gefressen. Fluchend warf er die Waffe beiseite, die in einer trüben Wasserpfütze landete und dort noch kurz weiterschwelte wie ein erloschenes Streichholz. Der Dämon war natürlich längst verschwunden – verschlungen von jener Höllenwelt, der er entsprungen war, allerdings nicht, ohne ein gewaltiges Chaos zu hinterlassen.
»Jem!«, rief Will und drehte sich um. »Wo steckst du? Hast du das gesehen? Mit einem einzigen Hieb niedergestreckt! Nicht schlecht, was?«
Doch Will erhielt keine Antwort. Nur wenige Sekunden zuvor hatte sein Kampfgefährte noch direkt hinter ihm gestanden und ihm Rückendeckung gegeben, da war Will sich absolut sicher; aber nun lag die feuchte, gewundene Straße dunkel und verlassen vor ihm. Verärgert runzelte er die Stirn – es machte deutlich weniger Spaß, mit seinen Kampfeskünsten anzugeben, wenn niemand da war, der ihm zuhörte. Will warf einen Blick über die Schulter, in Richtung der Stelle, wo sich die Straße zu einer Gasse verengte und hinunter zu den schwarzen, wogenden Fluten der Themse führte. In der Ferne konnte Will die dunklen Umrisse der Schiffe erkennen, die dort an den Docks festgemacht hatten – ein Wald aus Masten, wie ein blattloser Obstgarten. Keine Spur von Jem. Vielleicht war er zur Narrow Street zurückgekehrt, auf der Suche nach besserer Beleuchtung. Achselzuckend eilte Will den Weg zurück, den er gekommen war.
Die Narrow Street verlief quer durch Limehouse, zwischen den Docks am Flussufer und den übervölkerten Elendsvierteln, die sich nach Westen in Richtung Whitechapel ausdehnten. Die enge Straße machte ihrem Namen alle Ehre und war von dicht stehenden Lagerhäusern und windschiefen Holzhütten gesäumt. Im Moment wirkte sie menschenleer – selbst die Trunkenbolde, die normalerweise aus dem Gasthof The Grapes getaumelt kamen, hatten offenbar bereits irgendwo einen Platz für die Nacht gefunden, wo sie ihren Rausch ausschlafen konnten.
Will hielt sich gern in diesem Teil der Stadt auf; ihm gefiel der Gedanke, sozusagen am Rande der Welt zu stehen, wo jeden Tag Schiffe zu unvorstellbar weit entfernten Häfen ausliefen. Und die Tatsache, dass es sich um ein Seemannsviertel handelte, mit Spielhöllen, Opiumhöhlen und Bordellen an jeder Straßenecke, tat seiner Begeisterung für die Gegend auch keinen Abbruch. An einem Ort wie diesem konnte man leicht die Zeit und alles andere um sich herum vergessen. Nicht einmal der Geruch – eine Mischung aus Rauch und Unrat, Tauwerk und Teer, fremdländischen Gewürzen und dem typischen Dunst der Themse – stieß ihn ab.
Langsam schaute Will in beide Richtungen der ausgestorben daliegenden Straße. Dann fuhr er sich mit dem Ärmel seines schweren Mantels übers Gesicht, um das Dämonensekret wegzuwischen, das ihm auf der Haut brannte und nun grüne und schwarze Flecken auf dem dicken Tuch hinterließ. Außerdem hatte er eine klaffende Schnittwunde auf dem Handrücken davongetragen. Er könnte jetzt gut eine Iratze gebrauchen, überlegte Will. Vorzugsweise eine von Charlotte – sie besaß eine echte Begabung für das Zeichnen von Heilrunen.
Plötzlich löste sich ein Schemen aus den Schatten und bewegte sich auf Will zu. Rasch wandte Will sich in Richtung der Gestalt, hielt dann aber inne. Es handelte sich nicht um Jem, sondern um einen irdischen Schutzmann mit glockenförmigem Helm, der seine Runde drehte. Mit einem verwirrten Gesichtsausdruck starrte er Will an … oder vielmehr durch ihn hindurch. So vertraut Will auch der Umgang mit Zauberglanz war, erschien es ihm doch immer wieder merkwürdig, wenn sein Gegenüber durch ihn hindurchschaute, als existierte er überhaupt nicht. Plötzlich überkam ihn der unwiderstehliche Drang, den Schlagstock des Polizisten zu stehlen und zuzusehen, wie der Mann herumwirbelte, auf der Suche nach seinem Gummiknüppel. Aber Jem hatte ihn bei früheren Gelegenheiten deswegen schon mehrfach getadelt, und obwohl Will Jems Bedenken überhaupt nicht nachvollziehen konnte, lohnte es sich nicht, ihn zu verärgern.
Kopfschüttelnd setzte der Polizist sich wieder in Bewegung. Dabei murmelte er leise vor sich hin, dass er von nun an dem Alkohol abschwören wolle – ehe er noch tatsächlich Dinge zu sehen begann, die nicht existierten.
Will trat einen Schritt beiseite, um den Mann passieren zu lassen, und rief dann: »James Carstairs! Jem! Wo steckst du, du treuloser Halunke?«
Dieses Mal kam eine leise Antwort aus der Dunkelheit: »Hier drüben. Folg einfach dem Elbenlicht.«
Will bewegte sich in Richtung von Jems Stimme, die aus einer düsteren Gasse zwischen zwei Lagerhäusern zu kommen schien. Ein schwacher Lichtschein glomm in den Schatten wie die flackernde Flamme eines Irrlichts. »Hast du gehört, was ich eben gesagt habe? Dieser Shax-Dämon hat doch wirklich geglaubt, er könnte mich in seine verdammten Klauen bekommen, aber ich hab ihn in die Enge getrieben und …«
»Ja, ich hab dich gehört.« Der junge Mann, der nun am Eingang der Gasse erschien, wirkte im Licht der Gaslaterne bleich – noch bleicher als sonst, was schon ziemlich außergewöhnlich war. Da er keine Kopfbedeckung trug, fiel der Blick sofort auf seine Haare, die in einem seltsam strahlenden Silber schimmerten wie die Farbe einer nagelneuen Münze. Auch seine Augen in dem kantigen Gesicht mit den fein geschnittenen Zügen leuchteten in diesem Ton; lediglich ihre leichte Mandelform verriet seine Herkunft. Die Vorderseite seines weißen Hemdes war mit dunklen Flecken übersät, und an seinen Händen klebte rot schimmerndes, noch feuchtes Blut.
Will musterte ihn angespannt. »Du blutest. Was ist passiert?«
Doch Jem wischte Wills Sorge mit einer Handbewegung fort. »Das ist nicht mein Blut.« Dann drehte er den Kopf in Richtung der Gasse hinter ihm. »Es ist ihres.«
Will spähte an seinem Freund vorbei in die tiefen Schatten des schmalen Durchgangs. Am hinteren Ende lag eine zusammengekrümmte Gestalt – nur ein Schemen in der Dunkelheit. Aber als Will genauer hinschaute, konnte er die Umrisse einer blassen Hand ausmachen und ein Büschel heller Haare. »Eine tote Frau?«, fragte er. »Eine Irdische?«
»Eher ein Mädchen. Kaum älter als vierzehn.«
Als Will daraufhin mehrere wüste Flüche ausstieß, wartete Jem geduldig, bis sein Freund sich wieder beruhigt hatte.
»Wenn wir doch nur ein bisschen früher hier gewesen wären«, schimpfte Will abschließend. »Dieser verdammte Dämon …«
»Das ist ja das Merkwürdige an der Geschichte. Ich glaube nicht, dass das hier das Werk dieses Dämons ist«, erwiderte Jem stirnrunzelnd. »Shax-Dämonen sind Parasiten, Brutparasiten. Normalerweise hätte er sein Opfer doch in seine Höhle gezerrt, um ihm seine Eier unter die Haut zu legen, solange es noch am Leben ist. Aber dieses Mädchen hier … jemand hat mit dem Messer auf sie eingestochen … mehrfach. Und ich glaube auch nicht, dass das hier an diesem Ort passiert ist. Dafür findet sich in der Gasse einfach nicht genug Blut. Ich denke, sie wurde irgendwo anders überfallen und hat sich dann hierhergeschleppt, wo sie an ihren Verletzungen gestorben ist.«
»Aber der Shax-Dämon …«
»Aber ich sag’s dir doch: Ich glaube nicht, dass das ein Shax-Dämon war. Meines Erachtens hat der Dämon sie nur verfolgt … sie aufgespürt … aus irgendeinem anderen Grund oder für irgendjemand anderen.«
»Shax-Dämonen haben in der Tat einen feinen Geruchssinn«, räumte Will ein. »Ich hab schon von Hexenmeistern gehört, die sie zum Aufspüren vermisster Personen eingesetzt haben. Und dieser Dämon hier schien sich sehr zielbewusst zu bewegen.« Erneut schaute er an Jem vorbei auf die kleine, jämmerliche Gestalt in der Gasse. »Du hast nicht zufälligerweise die Tatwaffe gefunden?«
»Doch. Hier.« Jem zog etwas aus der Innentasche seiner Jacke – ein in ein weißes Tuch gewickeltes Messer. »Das ist eine Art Misericordia oder Stilett. Sieh mal, wie dünn die Klinge ist.«
Will nahm die Waffe entgegen. Die Klinge war in der Tat sehr dünn und endete in einem Heft aus poliertem Bein, an dem getrocknetes Blut klebte. Stirnrunzelnd wischte Will die Klinge am groben Stoff seines Ärmels sauber, bis auf dem Metall ein eingraviertes Symbol zum Vorschein kam: zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz bissen und so einen perfekten Kreis bildeten.
»Ein Ouroboros«, sagte Jem, dicht über die Klinge gebeugt. »Sogar ein doppelter. Was, denkst du, hat das zu bedeuten?«
»Das Ende der Welt«, erwiderte Will, den Blick noch immer auf den Dolch geheftet. Ein mattes Lächeln umspielte seine Lippen. »Das Ende und den Anfang der Welt.«
Jem runzelte die Stirn. »Die Symbolik ist mir bekannt, William. Ich meinte eigentlich, was die Anwesenheit dieses Symbols auf dem Stilett wohl zu bedeuten hat?«
Ein Windstoß, der vom Fluss hinaufkam, zerzauste Wills Haare. Mit einer ungeduldigen Handbewegung wischte er sie sich aus den Augen und widmete sich wieder der Klinge. »Das ist das Symbol eines Alchemisten, keines Hexenmeisters oder Schattenweltlers. Und das bedeutet in der Regel, dass Menschen die Finger im Spiel haben – jene Sorte törichter Irdischer, die glaubt, die Beschäftigung mit Magie sei der Weg zu Ruhm und Reichtum.«
»Jene Sorte, die in der Regel als blutiger Haufen im Inneren eines Pentagramms endet«, bestätigte Jem grimmig.
»Und die gern in den Schattenweltvierteln unserer schönen Stadt herumschleicht.« Vorsichtig wickelte Will die Waffe in sein Taschentuch und schob sie in seine Manteltasche. »Meinst du, Charlotte lässt mich die Ermittlungen durchführen?«
»Meinst du denn, dass dir ein solcher Fall anvertraut werden kann … in der Schattenwelt Londons? Mit all den Spielhöllen, den magischen Lasterhöhlen, den leichten Mädchen …«
Ein Lächeln umspielte Wills Lippen – ein Lächeln, wie es Luzifer wenige Augenblicke vor seiner Verbannung aus dem Himmel gelächelt haben mochte. »Was meinst du: Ob der morgige Tag zu früh ist, um mit den Nachforschungen zu beginnen?«
Jem seufzte. »Mach doch, was du willst, William. Das tust du ja sowieso.«
Southampton. Mai 1878.
Tessa konnte sich gar nicht mehr an die Zeit erinnern, als der Klockwerk-Engel noch nicht zu ihrem Leben gehört hatte. Er stammte von ihrer Mutter, die ihn auch zum Zeitpunkt ihres Todes getragen hatte. Danach war der Engel in eine Schmuckkassette gelegt worden, bis ihr Bruder Nathaniel ihn eines Tages herausgenommen hatte, um zu überprüfen, ob das Uhrwerk noch intakt war.
Kaum größer als Tessas kleiner Finger, präsentierte die winzige Messingstatuette ein fein geschnittenes Gesicht mit geschlossenen Augenlidern. Die Hände waren über einem langen Schwert verschränkt, und die kleinen, geschlossenen Bronzeschwingen auf dem Rücken der Figur schienen kaum größer als die einer Grille. Unter ihnen hindurch verlief eine dünne Kette, sodass der Engel wie ein Medaillon um den Hals getragen werden konnte.
Tessa wusste, dass der Engel aus mechanischen Teilen gefertigt war, denn wenn sie ihn sich ans Ohr hielt, konnte sie das Geräusch des Uhrwerks hören wie das Ticken einer Taschenuhr. Ihr Bruder Nate hatte überrascht die Augen aufgerissen – verwundert, dass der Engel nach so vielen Jahren immer noch funktionierte – und nach einem Knopf, einem Rädchen oder einem anderen Aufziehmechanismus gesucht, aber nichts gefunden. Schließlich hatte er den Engel achselzuckend an Tessa weitergegeben, die ihn von diesem Moment an nicht mehr abgelegt hatte. Selbst nachts, wenn sie schlief, ruhte der Engel an ihrer Brust; sein beständiges Ticktack, Ticktack schlug wie der Puls eines zweiten Herzens.
Jetzt in diesem Augenblick hielt Tessa den Engel fest umklammert, während die Main sich zwischen anderen wuchtigen Dampfschiffen einen Weg hindurchbahnte, auf der Suche nach einem Ankerplatz in den Docks von Southampton. Nate hatte darauf bestanden, dass Tessa nach Southampton reiste statt nach Liverpool, wo die meisten transatlantischen Dampfer anlegten. Da er behauptet hatte, Southampton sei ein wesentlich angenehmerer Landungsplatz als die Stadt am Mersey, war Tessa ein wenig enttäuscht, als sie nun zum ersten Mal einen Blick auf das englische Festland werfen konnte. Die Landschaft wirkte trostlos und grau. Regen trommelte auf die Turmspitzen einer weit entfernten Kirche, während schwarzer Qualm aus den Schornsteinen der Schiffe aufstieg und den ohnehin düsteren Himmel zusätzlich verdunkelte. Am Kai stand eine reglose Menschenmenge, in dunkle Kleider gehüllt und mit aufgespannten Regenschirmen. Angestrengt hielt Tessa nach ihrem Bruder Ausschau, doch der Nebel und der Nieselregen waren zu dicht, um irgendjemanden erkennen zu können.
Tessa erschauderte. Der Wind, der von der See kam, war eisig. In all seinen Briefen hatte Nate stets behauptet, London sei wundervoll und die Sonne scheine jeden Tag. Na, dann hoffen wir mal, dass das Wetter dort besser ist als hier, überlegte Tessa, denn sie besaß keine warme Kleidung – nichts außer einem Wollumhang, der ihrer Tante Harriet gehört hatte, und einem Paar dünner Handschuhe. Die meisten Kleidungsstücke hatte sie veräußert, um die Beerdigungskosten ihrer Tante bezahlen zu können – in der festen Überzeugung, dass ihr Bruder ihr neue Sachen kaufen würde, sobald sie in London eintraf.
Ein Ruf schallte vom Kai hoch. Die Main, deren schimmernder, schwarz gestrichener Rumpf regenfeucht glänzte, war vor Anker gegangen, und nun pflügten sich kleine Boote durch die grauen Fluten, um Gepäck und Passagiere an Land zu bringen. Diese verließen in Strömen das Schiff, offensichtlich ganz begierig darauf, endlich wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Welch ein Unterschied zur Abfahrt in New York. Damals war der Himmel strahlend blau gewesen, und eine Blaskapelle hatte gespielt. Aber da es niemanden gegeben hatte, der ihr zum Abschied hätte winken können, war es für Tessa kein allzu schöner Moment gewesen.
Mit hochgezogenen Schultern schloss sie sich nun der von Bord gehenden Menge an. Eisige Regentropfen stachen ihr wie spitze Nadeln in die ungeschützte Haut, und ihre Finger in den dünnen Handschuhen fühlten sich feucht und klamm an. Als sie endlich den Kai erreichte, schaute Tessa sich erwartungsvoll um, immer auf der Suche nach Nate. Da sie sich während der Überfahrt von den anderen Passagieren weitestgehend ferngehalten hatte, hatte sie seit fast zwei Wochen mit keiner Menschenseele mehr ein Wort gewechselt. Umso mehr freute sie sich jetzt darauf, Nate endlich wiederzusehen und jemanden zum Reden zu haben.
Doch ihr Bruder war nirgends zu finden. Tessas Blick schweifte über die Stapel von Gepäckstücken und das Frachtgut in den zahlreichen Kisten und Boxen bis hin zu den Bergen von Früchten, Gemüsen und Salaten, die im strömenden Regen welk wurden. Ganz in der Nähe machte sich ein Dampfschiff mit Ziel Le Havre zum Auslaufen bereit, und eine Gruppe durchnässter Seeleute stürmte an Tessa vorbei, wobei sie lautstark französische Flüche ausstießen. Als sie versuchte, den Männern auszuweichen, wäre sie fast von einer Horde von Bord kommender Passagiere niedergetrampelt worden, die sich in den Schutz der Eisenbahnstation flüchtete.
Doch Nate konnte sie nirgendwo entdecken.
»Sind Sie Miss Gray?« Die Stimme klang kehlig und besaß einen starken Akzent. Vor Tessa war wie aus dem Nichts ein großer Mann aufgetaucht, mit einem weiten schwarzen Mantel und einem hohen Hut, dessen Krempe das Regenwasser wie eine Zisterne einfing. Er hatte seltsam heraustretende, fast schon hervorquellende Augen wie die eines Froschs, und seine Haut wirkte so rau wie Narbengewebe. Nur mit Mühe gelang es Tessa, nicht erschrocken zurückzuweichen. Aber der Mann kannte ihren Namen. Wer in diesem Teil der Erde konnte ihren Namen wissen, wenn er nicht auch Nate kannte?
»Ja.«
»Ihr Bruder schickt mich. Bitte folgen Sie mir.«
»Wo ist er?«, wollte Tessa wissen, doch der Mann marschierte bereits davon. Sein Gang wirkte holprig, als würde er aufgrund einer alten Verletzung hinken. Nach einem Moment der Verwirrung raffte Tessa ihre Röcke und eilte ihm nach.
Zielstrebig bahnte sich der Mann einen Weg durch die Menge. Dabei streifte er mehrere Passanten mit der Schulter, sodass diese zur Seite sprangen und über seine Unhöflichkeit schimpften. Tessa musste förmlich laufen, um mit ihm Schritt zu halten. Kurz darauf bog er abrupt um einen Stapel Kisten und blieb vor einer mächtigen, glänzend schwarzen Kutsche stehen, an deren Schlag goldene Buchstaben prangten. Doch der Regen und der Nebel verhinderten, dass Tessa die Aufschrift genau lesen konnte.
Dann schwang die Tür der Kutsche auf, und eine Frau beugte sich heraus. Sie trug einen riesigen Federhut, der ihr Gesicht verbarg. »Miss Theresa Gray?«
Tessa nickte. Der Mann mit den Glupschaugen beeilte sich, der Dame aus der Kutsche zu helfen – und unmittelbar dahinter kam eine weitere Dame zum Vorschein. Beide Frauen öffneten sofort ihre Regenschirme, um sich vor den eisigen Tropfen zu schützen, und musterten dann Tessa.
Ein seltsames Paar, überlegte Tessa: Eine der Frauen war sehr groß und dünn, mit einem hageren, verhärmten Gesicht. Ihre farblosen Haare waren im Nacken zu einem straffen Knoten zusammengesteckt. Sie trug ein Kleid aus leuchtend violetter Seide, die sich durch den Regen an manchen Stellen bereits dunkler verfärbt hatte, und dazu farblich passende violette Handschuhe. Die andere Frau war dagegen klein und gedrungen, mit winzigen Augen, die tief in den Höhlen lagen. Die leuchtend rosafarbenen Handschuhe, die sie über ihre großen Hände gestreift hatte, ließen diese wie grelle Pfoten erscheinen.
»Theresa Gray«, sagte die kleinere der beiden Frauen nun. »Welch eine Freude, endlich Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen. Ich bin Mrs Black, und dies ist meine Schwester, Mrs Dark. Ihr Bruder hat uns geschickt, um Sie nach London zu begleiten.«
Durchfroren und verwirrt zog Tessa ihren Umhang fester um die durchnässten Schultern. »Ich verstehe nicht ganz. Wo ist Nate? Und warum ist er nicht selbst gekommen?«
»Er ist leider verhindert. Dringende Geschäftsangelegenheiten haben ihn in London aufgehalten. Mortmain konnte unmöglich auf seine Dienste verzichten. Aber er hat Ihnen eine Nachricht geschickt.« Mrs Black hielt Tessa einen zusammengerollten Papierbogen entgegen, den der Regen bereits zu durchweichen begann.
Tessa nahm den Brief und wandte sich ab, um ihn schnell zu überfliegen. Es war eine kurze Nachricht ihres Bruders, der sich dafür entschuldigte, dass er sie nicht persönlich in Southampton abholen konnte. Außerdem teilte er ihr mit, dass Mrs Black und Mrs Dark – Ich nenne sie die Dunklen Schwestern, Tessie, aus naheliegenden Gründen, und sie scheinen damit durchaus einverstanden zu sein! – sie sicher zu seinem Haus in London geleiten würden. Die beiden Damen seien nicht nur seine Vermieterinnen, sondern auch treue Freundinnen und genössen sein vollstes Vertrauen.
Dieser Brief gab den Ausschlag. Er stammte ganz sicher von Nate – zum einen war das seine Handschrift, und zum anderen hatte niemand außer ihm sie je Tessie genannt. Tessa schluckte, rollte die Nachricht zusammen und schob sie in ihren Ärmel. Dann wandte sie sich wieder den Schwestern zu. »Nun denn«, sagte sie und kämpfte gegen das Gefühl der Enttäuschung an – sie hatte sich so sehr auf ein Wiedersehen mit ihrem Bruder gefreut. »Sollen wir einen Gepäckträger bitten, meinen Koffer zu holen?«
»Nicht nötig, nicht nötig«, flötete Mrs Dark, deren heitere Stimme einen seltsamen Kontrast zu ihren verkniffenen grauen Gesichtszügen bildete. »Wir haben bereits dafür Sorge getragen, dass Ihr Gepäck vorausgeschickt wird.« Sie schnippte kurz mit dem Finger, worauf der glupschäugige Mann sich auf den Kutschbock schwang, und legte Tessa eine Hand auf die Schulter. »Kommen Sie, mein Kind. Es wird Zeit, dass wir Sie ins Trockene bringen.«
Als Tessa sich auf die Kutsche zubewegte, von Mrs Darks knochigem Griff vorwärtsgeschoben, lichtete sich der Nebel und ließ das golden schimmernde Emblem auf der Tür zum Vorschein kommen: Die Worte »The Pandemonium Club« wanden sich kunstvoll um zwei Schlangen, die sich gegenseitig in den Schwanz bissen und einen Kreis bildeten. Tessa runzelte die Stirn. »Was hat das zu bedeuten?«
»Nichts, worüber Sie sich Gedanken machen müssten«, erwiderte Mrs Black, die bereits in die Kutsche geklettert war und ihre Röcke über eine der bequem wirkenden Sitzbänke gebreitet hatte. Das gesamte Innere der Kutsche war mit üppigem violettem Samt ausgestattet, und vor den Fenstern hingen violette Vorhänge mit goldenen Quasten.
Mrs Dark half Tessa in die Kutsche und kletterte dann selbst hinterher. Als Tessa sich auf der gegenüberliegenden Sitzbank niedergelassen hatte, griff Mrs Black nach der Kutschtür, zog sie hinter ihrer Schwester fest zu und schloss den peitschenden Regen damit aus. Dann schenkte sie Tessa ein strahlendes Lächeln, wobei ihre Zähne im Halbdunkel der Kutsche wie aus Metall schimmerten. »Machen Sie es sich bequem, Theresa. Wir haben eine lange Fahrt vor uns.«
Tessa lehnte sich gegen die Polster und legte eine Hand um den Klockwerk-Engel an ihrer Kehle. Sein beständiges Ticken spendete ihr Trost, während die Kutsche ruckartig anfuhr und durch den düsteren Nachmittag preschte.
Sechs Wochen später
1
Das Dunkle Haus
Jenseits dies’ Orts, voll Zorn und Tränen ragt auf der Alb der Schattenwelt.
William Ernest Henley, »Invictus«
»Die Schwestern wünschen, Sie in ihrem Zimmer zu sehen, Miss Gray.«
Tessa legte das Buch, in dem sie gelesen hatte, auf ihren Nachttisch und drehte sich zu Miranda um, die in der Tür der kleinen Kammer stand – so wie jeden Tag um diese Uhrzeit, wenn sie die Nachricht überbrachte, die sie jeden Tag überbrachte. In ein paar Sekunden würde Tessa sie bitten, im Flur auf sie zu warten, und dann würde Miranda den Raum verlassen. Zehn Minuten später würde sie jedoch zurückkehren und ihre Botschaft wiederholen. Und wenn Tessa nicht gehorsam mitkam, würde Miranda sie packen und hinter sich herziehen – da konnte Tessa sich noch so sehr mit Händen und Füßen dagegen wehren. Miranda würde sie die Treppe hinunterzerren und durch den Flur schleifen, bis zu dem stickig heißen, stinkenden Raum, wo die Dunklen Schwestern bereits auf sie warteten.
Genau so hatte es sich an jedem Tag der ersten Woche im »Dunklen Haus« abgespielt, wie Tessa das Gebäude, in dem sie gefangen gehalten wurde, inzwischen nannte. Bis sie irgendwann erkannt hatte, dass Schreien und Treten ihr nicht viel nützten und reine Kraftverschwendung waren – Kraft, die sie sich besser für andere Gelegenheiten aufsparen konnte.
»Einen Augenblick, Miranda«, sagte Tessa nun. Das Dienstmädchen machte einen ungelenken Knicks, ging aus dem Zimmer und zog die Tür hinter sich zu.
Tessa stand auf und sah sich in dem kleinen Raum um, der seit den vergangenen sechs Wochen ihre Gefängniszelle darstellte. Die mit einer Blümchentapete versehene Kammer war winzig und äußerst spärlich möbliert: ein schlichter Holztisch mit einem weißen Spitzentischtuch, an dem sie all ihre Mahlzeiten einnahm; ein schmales Messingbett, in dem sie schlief; der abgenutzte Waschtisch mit der angestoßenen Porzellankanne, an dem sie sich wusch; die Fensterbank, die ihr als Bücherregal diente; und ein harter Stuhl, auf dem sie jeden Abend saß und die Briefe an ihren Bruder schrieb – Briefe, von denen sie wusste, dass sie sie nie würde abschicken können und die sie unter ihrer Matratze versteckte, wo die Dunklen Schwestern sie nicht finden würden. Diese Briefe dienten ihr als eine Art Tagebuch und Ausdruck ihrer Hoffnung, dass sie Nate eines Tages wiedersehen würde und sie ihm dann übergeben konnte.
Langsam ging sie zu dem Spiegel an der gegenüberliegenden Wand und glättete ihre Haare. Die Dunklen Schwestern – wie sie genannt zu werden wünschten – schätzten es nicht, wenn Tessa unordentlich wirkte. Darüber hinaus schienen sie sich aber nicht weiter für das Äußere des Mädchens zu interessieren … ein Glück, denn der Anblick ihres Spiegelbilds ließ Tessa nun zusammenzucken. Graue, tief liegende Augen starrten ihr aus dem blassen, ovalen Gesicht entgegen – ein erschöpftes, überschattetes Gesicht, ohne Farbe in den Wangen oder den Hauch einer Hoffnung in den Zügen.
Tessa trug das unvorteilhafte schwarze, gouvernantenhafte Kleid, das die Schwestern ihr nach der Ankunft in London gegeben hatten. Trotz der Versprechungen der beiden war Tessas Koffer nicht eingetroffen, und dies war nun das einzige Kleidungsstück, das sie besaß. Rasch wandte Tessa den Kopf ab.
Ihr eigenes Spiegelbild hatte sie nicht immer zusammenzucken lassen. Zwar galt Nate mit seinem attraktiven Äußeren in der Familie als derjenige, der die Schönheit ihrer Mutter geerbt hatte, aber Tessa war mit ihren glatten braunen Haaren und den ruhigen grauen Augen auch recht zufrieden gewesen. Jane Eyre hatte braunes Haar gehabt und viele andere Romanheldinnen ebenfalls. Und es war auch gar nicht so schlimm, groß zu sein. Jedenfalls größer als die meisten Jungen ihres Alters … das konnte man nicht abstreiten. Aber Tante Harriet hatte ihr stets eingeschärft, solange eine groß gewachsene Frau sich gerade hielt, würde sie immer hoheitsvoll wirken.
Allerdings wirkte sie im Moment alles andere als hoheitsvoll, überlegte Tessa. Sie sah verhärmt und ungepflegt aus, wie eine verängstigte Vogelscheuche. Und sie fragte sich, ob Nate sie überhaupt erkennen würde, wenn er sie jetzt zu Gesicht bekäme.
Dieser Gedanke versetzte ihr einen Stich. Nate. Er war derjenige, für den sie das alles hier auf sich nahm, aber manchmal vermisste sie ihn so sehr, dass ihre Brust schmerzte, als hätte sie zerbrochenes Glas geschluckt. Ohne ihn war sie vollkommen allein auf der Welt. Es gab sonst niemanden, der für sie da war. Niemanden auf der ganzen Welt, den es kümmerte, ob sie noch lebte. Diese grauenvolle Vorstellung drohte sie manchmal zu überwältigen und in eine bodenlose Dunkelheit zu stoßen, aus der es kein Entrinnen gab. Wenn sich auf der ganzen Welt niemand für einen interessierte, existierte man dann überhaupt noch?
Das Klicken des Türschlosses riss Tessa aus ihren Gedanken. Die Tür schwang auf, und Miranda erschien auf der Schwelle.
»Es wird jetzt Zeit, dass Sie mitkommen«, sagte sie. »Mrs Black und Mrs Dark warten bereits.«
Tessa musterte das Dienstmädchen widerwillig. Sie konnte einfach nicht abschätzen, wie alt Miranda war. Neunzehn? Fünfundzwanzig? Ihr glattes, rundes Gesicht hatte etwas Altersloses an sich, und ihre Haare – übrigens von einer undefinierbaren Farbe – waren streng hinter die Ohren gekämmt. Genau wie der Kutscher der Dunklen Schwestern besaß auch Miranda hervorstehende Augen, sodass sie aussah, als wäre sie ständig überrascht. Die beiden mussten irgendwie verwandt sein, überlegte Tessa.
Als sie gemeinsam die Treppe hinunterstiegen – Miranda mit ihrem hölzernen, schwerfälligen Gang zwei Schritte vor Tessa –, berührte Tessa rasch die Kette, an dem der Klockwerk-Engel hing. Die kurze Berührung war ihr inzwischen zur Gewohnheit geworden, eine Geste, die sie vor jedem erzwungenen Besuch bei den Dunklen Schwestern machte. Sie hielt den Engel fest umklammert, während sie nun Treppe für Treppe hinabstiegen und endlos lange Korridore passierten. Das Dunkle Haus besaß mehrere Etagen, aber außer dem Raum der Dunklen Schwestern, den Fluren und Treppenhäusern und ihrem eigenen Kämmerchen hatte Tessa noch keinen anderen Bereich zu Gesicht bekommen. Schließlich erreichten sie das dämmrige Kellergeschoss. Hier unten war die Luft muffig. Feuchtigkeit glitzerte an den klammen Wänden, was die Schwestern jedoch nicht zu stören schien. Ihr Büro lag in der Nähe der Treppe, geschützt hinter einer breiten Flügeltür, während ein schmaler Gang in die andere Richtung führte und sich in der Dunkelheit verlor. Tessa hatte keine Ahnung, was sich am Ende dieses Flurs befinden mochte, aber irgendetwas an der undurchdringlichen Finsternis der Schatten ließ sie nicht bedauern, dass sie es noch nicht herausgefunden hatte.
Die Tür zum Büro der Schwestern stand weit auf. Miranda stapfte, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, in den Raum, wohingegen Tessa ihr nur widerstrebend folgte. Sie hasste dieses Zimmer mehr als jeden anderen Ort auf der Welt.
Zunächst einmal war es darin immer heiß und feucht, wie in einem Sumpfgebiet, selbst wenn der Himmel vor Tessas Fenster grau und regnerisch wirkte. Die Wände schienen Schwitzwasser abzugeben, und die Polsterung der Sessel und Sofas war klamm und stockfleckig. Außerdem roch es in diesem Raum seltsam, wie am Ufer des Hudson an einem heißen Tag: nach Wasser und Unrat und Schlick.
Wie üblich erwarteten die Schwestern sie bereits hinter ihrem riesigen, erhöhten Schreibtisch, und wie üblich waren sie in bunt schillernde Farben gekleidet. Mrs Black hatte sich in ein leuchtend lachsrosa Kleid gezwängt, während Mrs Dark in einem pfauenblauen Gewand auf ihrem Platz thronte. Doch gegenüber den farbenprächtigen Satinstoffen wirkten ihre Gesichter wie graue, halb leere Ballons. Beide Frauen trugen wie immer Handschuhe – ganz gleich, wie stickig der Raum auch sein mochte.
»Du kannst gehen, Miranda«, sagte Mrs Black und setzte den schweren Messingglobus auf dem Schreibtisch mit einer trägen Bewegung ihres molligen, weiß behandschuhten Zeigefingers in Bewegung. Tessa hatte bereits mehrfach versucht, einen näheren Blick auf die Weltkugel zu werfen – irgendetwas an der Anordnung der Kontinente erschien ihr merkwürdig, vor allem der Bereich im Zentrum Europas –, doch die Schwestern hielten ihn sorgfältig von ihr fern. »Und schließ die Tür hinter dir.«
Mit ausdrucksloser Miene tat Miranda, wie ihr geheißen. Tessa bemühte sich, nicht zusammenzuzucken, als die Tür hinter dem Dienstmädchen ins Schloss fiel und damit auch den letzten Hauch einer Brise in diesem stickigen Raum ausschloss.
Mrs Dark neigte den Kopf zur Seite. »Komm her, Theresa.« Von den beiden Frauen war sie die freundlichere – sie versuchte eher, zu umschmeicheln und zu überreden, während ihre Schwester durch Schläge und böse gezischte Drohungen zu überzeugen gedachte. »Und nimm das hier«, fügte sie hinzu und hielt Tessa etwas entgegen.
Eine Schleife, wie Tessa sofort erkannte. Ein schäbiges Stück rosa Stoff, das vielleicht als Haarband eines jungen Mädchens gedient hatte.
Inzwischen war Tessa daran gewöhnt, dass die Dunklen Schwestern ihr irgendwelche Gegenstände reichten. Gegenstände, die einst anderen Leuten gehört hatten: Krawattennadeln und Taschenuhren, Trauerschmuck und Kinderspielzeug. Einmal ein Schnürsenkel, dann ein einzelner Ohrring, beide blutverschmiert.
»Nun nimm schon«, forderte Mrs Dark sie erneut auf, mit einem Hauch Ungeduld in der Stimme. »Und verwandle dich.«
Tessa nahm die Schleife. Sie lag leicht in ihrer Hand, leicht wie ein Schmetterlingsflügel, und die Dunklen Schwestern starrten sie ungeduldig an. Tessa erinnerte sich an einige Bücher, die sie gelesen hatte – Romane, in denen die Hauptfiguren vor Gericht standen, zitternd und betend, dass der Urteilsspruch der Richter im Old Bailey »nicht schuldig« lautete. Und wie oft hatte sie sich in diesem Raum selbst auf der Anklagebank gefühlt, ohne genau zu wissen, welches Verbrechen man ihr vorwarf.
Sie drehte die Schleife in der Hand und erinnerte sich an das erste Mal, als die Dunklen Schwestern ihr einen Gegenstand gereicht hatten: einen Damenhandschuh mit Perlmuttknöpfen am Handgelenk. Die beiden Frauen hatten sie angeschrien, sich endlich zu verwandeln, sie geschlagen und geschüttelt, während Tessa mit wachsender Panik wieder und wieder beteuert hatte, sie wisse nicht, wovon die Schwestern redeten, und sie habe nicht die geringste Ahnung, was sie von ihr wollten.
Damals war sie nicht in Tränen ausgebrochen, obwohl ihr wirklich danach zumute gewesen war. Aber Tessa hasste es zu weinen, vor allem vor Leuten, denen sie nicht traute. Und von den wenigen Menschen auf der Welt, denen sie vertraute, war einer tot und der andere im Gefängnis. Die Dunklen Schwestern hatten ihr das erzählt. Sie hatten ihr versichert, dass sie Nate in ihrer Gewalt hätten und dass er sterben müsste, wenn Tessa nicht tat, was sie verlangten. Zum Beweis hatten sie ihr seinen Ring gezeigt, den Ring, der einst ihrem Vater gehört hatte und der nun blutverklebt war. Zwar hatten die Schwestern ihr nicht erlaubt, ihn in die Hand zu nehmen oder auch nur zu berühren, aber Tessa hatte den Ring trotzdem erkannt. Er gehörte zweifellos Nate.
Danach hatte sie alles getan, was die beiden Frauen von ihr verlangten. Sie hatte das bittere Gebräu geschluckt, das sie ihr gaben, die stundenlangen Übungen über sich ergehen lassen und sich gezwungen, so zu denken, wie es den Schwestern gefiel. Diese hatten ihr befohlen, sie solle sich selbst als einen Klumpen Ton betrachten, der auf der Töpferscheibe geformt und gestaltet wird; sie solle sich vorstellen, sie besäße eine strukturlose und wandelbare Gestalt. Dann hatten sie verlangt, Tessa solle sich tief in die ihr überreichten Gegenstände hineinversetzen, sie als Lebewesen betrachten und den Geist herauslocken, der in ihnen schlummerte.
Es hatte Wochen gedauert, und als Tessa sich schließlich zum ersten Mal verwandelt hatte, war dieses Erlebnis so unerträglich schmerzhaft gewesen, dass sie sich übergeben musste und dann das Bewusstsein verloren hatte. Als sie wieder zu sich gekommen war, hatte sie auf einem der stockfleckigen Sofas im Büro der Schwestern gelegen, ein feuchtes Tuch auf der Stirn. Mrs Black hatte sich über sie gebeugt, mit essigsaurem Atem und leuchtenden Augen. »Das hast du gut gemacht, Theresa«, hatte sie gesagt. »Sehr gut.«
Als Tessa an jenem Abend in ihr Zimmer zurückgekehrt war, hatten dort Geschenke für sie gelegen – zwei neue Bücher auf ihrem Nachttischchen. Offenbar hatten die Dunklen Schwestern erkannt, dass Tessas größte Leidenschaft das Lesen war, und ihr eine Ausgabe von Dickens’ Große Erwartungen und Louisa May Alcotts Roman Betty und ihre Schwestern besorgt. Tessa hatte die beiden Bücher an sich gedrückt und sich in der Einsamkeit ihres kleinen Zimmers gestattet, in Tränen auszubrechen.
Danach war es ihr leichter gefallen … das Verwandeln. Zwar verstand Tessa noch immer nicht, was in ihrem Inneren dabei vor sich ging, aber sie hatte sich die Schritte eingeprägt, die die Dunklen Schwestern sie gelehrt hatten – so wie sich ein Blinder die Anzahl der Schritte merkt, die er vom Bett zur Schlafzimmertür benötigt. Tessa wusste nicht, was sich um sie herum an diesem seltsamen dunklen Ort befand, den sie auf Geheiß der Schwestern aufsuchen musste, aber sie kannte den Weg, der durch ihn hindurchführte.
Diese Erinnerungen nahm sie nun zu Hilfe und schloss ihre Finger fest um das verschlissene rosa Haarband in ihrer Hand. Dann öffnete sie ihren Geist und ließ die Dunkelheit über sich hereinbrechen. Sie ließ sich durch die Verbindung führen, die sie mit der Schleife und dem darin innewohnenden Geist – das geisterhafte Echo der früheren Besitzerin des Gegenstands – untrennbar verknüpfte, ließ sich wie von einem leuchtend goldenen Faden durch die Schatten geleiten. Der Raum, in dem sie sich befand, die stickige Hitze, die schnaufende Atmung der Dunklen Schwestern, all dies versank um sie herum, während sie dem Faden folgte und das Licht immer heller leuchtete, bis es sie schließlich umhüllte wie eine wärmende Decke.
Ihre Haut begann zu prickeln und dann zu brennen, als würden Tausende winziger Nadeln hineinstechen. Diese Phase der Verwandlung war anfangs der schlimmste Teil gewesen – jener Teil, der Tessa davon überzeugte, dass sie jeden Moment sterben würde. Doch inzwischen hatte sie sich daran gewöhnt und ertrug diese Phase mit stoischer Gelassenheit, während ihr ganzer Körper zu zittern begann. Der Klockwerk-Engel an ihrem Hals schien schneller zu ticken, wie im Einklang mit dem Rhythmus ihres pochenden Herzens. Und der Druck unter ihrer Haut stieg immer mehr an, bis Tessa schließlich aufstöhnte und die geschlossenen Augen aufriss, wobei sich die aufgestaute Spannung schlagartig entlud.
Es war vollbracht.
Tessa blinzelte benommen. Der erste Moment nach der Verwandlung erinnerte sie immer an das Auftauchen aus einem Badezuber, mit winzigen Wasserperlen, die an den Wimpern hafteten. Langsam schaute sie an sich herab: Ihre neue Gestalt wirkte zart, fast schon zerbrechlich, und der Stoff ihres Kleides hing lose an ihr herab und warf Falten auf dem Boden. Tessas Blick fiel auf ihre Hände, die sie vor der Brust zusammengepresst hatte – bleiche, dünne Hände mit gesprungenen Fingerspitzen und abgekauten Nägeln, unbekannte, fremde Hände.
»Wie heißt du?«, fragte Mrs Black herrisch. Sie war aufgestanden und schaute aus blassen, brennenden, fast schon gierigen Augen auf Tessa herab.
Tessa brauchte nicht zu reagieren: Das Mädchen, dessen Haut sie trug, antwortete für sie und sprach durch sie, so wie Geister offenbar durch ein Medium kommunizierten. Aber Tessa gefiel dieser Vergleich nicht – die Verwandlung war so viel intimer und so viel furchteinflößender. »Emma«, erwiderte die Stimme aus ihrem Inneren nun. »Miss Emma Bayliss, Madam.«
»Und wer bist du, Emma Bayliss?«
Die Stimme antwortete, und die Worte ergossen sich aus Tessas Mund und brachten lebendige Bilder mit sich: Emma war in Cheapside zur Welt gekommen, als eines von sechs Kindern. Ihr Vater war tot, und ihre Mutter verkaufte im East End Pfefferminzwasser von einem Handkarren. Schon als kleines Kind hatte Emma gelernt, durch Näharbeiten ihren Teil zum Lebensunterhalt der Familie beizutragen. Bis spätabends saß sie an dem niedrigen Küchentisch und nähte Säume im Schein einer Talgkerze. Und manchmal, wenn der Stummel vollständig herabgebrannt war und die Familie kein Geld zum Kauf einer neuen Kerze besaß, ging das Mädchen hinaus auf die Straße und hockte sich unter eine der städtischen Gaslaternen, um dort seine Arbeit fortzusetzen …
»War das der Grund, warum du dich in der Nacht deines Todes auf der Straße herumgetrieben hast, Emma Bayliss?«, fragte Mrs Dark. Sie lächelte matt und fuhr sich mit der Zunge über die Oberlippe, als könne sie die Antwort förmlich erahnen.
Plötzlich sah Tessa eine schmale dunkle Gasse vor sich, mit weißen Nebelschwaden, und eine silberne Nadel, die im schwachen Schein des gelblichen Gaslichts auf und ab wippte. Dann ertönten Schritte, gedämpft durch den dichten Smog. Hände griffen aus den Schatten nach ihr, packten sie an den Schultern, zerrten sie in die Dunkelheit. Sie schrie auf. Das Nähzeug rutschte ihr aus den Fingern, und die rosa Schleife fiel aus ihren Haaren, während sie sich verzweifelt wehrte. Eine harsche Stimme schrie sie wütend an. Und dann blitzte die silberne Klinge eines Messers auf, schlitzte ihre Haut auf, ließ das Blut aufspritzen. Ein Schmerz so brennend wie Feuer und nie gekannte Furcht durchfuhren ihren Körper. In Todesangst schlug sie um sich, und es gelang ihr, dem Mann, der sie festhielt, den Dolch aus der Hand zu treten. Mit dem Mut der Verzweiflung raffte sie die Waffe an sich und rannte fort, so schnell sie konnte, während das Blut immer schneller aus der klaffenden Wunde strömte und sie immer schwächer wurde. Mühsam schleppte sie sich in einen Durchgang, wo sie schließlich zusammenbrach. Plötzlich hörte sie ein heiseres Zischen hinter sich. Sie wusste instinktiv, dass irgendetwas ihr gefolgt war, und sie hoffte inständig, dass sie sterben würde, bevor es sie eingeholt hatte …
Die Verwandlung zerbrach wie springendes Glas. Mit einem Aufschrei stürzte Tessa auf die Knie, und die zerrissene kleine Schleife glitt ihr aus der Hand. Sie befand sich wieder in ihrem eigenen Körper – Emma war verschwunden, wie eine abgelegte Haut. Tessa war wieder sie selbst.
Aus weiter Ferne drang Mrs Blacks Stimme zu ihr: »Theresa? Wo ist Emma?«
»Sie ist tot«, wisperte Tessa. »Sie ist in einer Gasse gestorben … verblutet.«
»Gut«, schnaufte Mrs Dark zufrieden. »Gut gemacht, Theresa. Das war sehr gut.«
Tessa schwieg. Die Vorderseite ihres Kleids war mit Blut bespritzt, aber sie spürte keinen Schmerz: Sie wusste, dass es sich dabei nicht um ihr eigenes Blut handelte. Schließlich geschah dies nicht zum ersten Mal … Taumelnd schloss sie die Augen und zwang sich, nicht das Bewusstsein zu verlieren.
»Wir hätten sie viel eher dazu auffordern sollen«, sagte Mrs Black. »Das Schicksal dieses Mädchens, dieser Emma, hat mich die ganze Zeit beschäftigt.«
»Ich war mir nicht sicher, ob sie schon dazu in der Lage war«, erwiderte Mrs Dark kurz angebunden. »Du erinnerst dich ja wohl noch an den Vorfall mit dieser Mrs Adams, oder?«
Tessa wusste sofort, wovon die beiden Schwestern sprachen. Wochen zuvor hatte sie sich in eine Frau verwandelt, die an einem Schuss mitten ins Herz gestorben war. Das Blut hatte sich in Strömen über ihr Kleid ergossen, und Tessa hatte sich umgehend zurückverwandelt und hysterisch geschrien und geschluchzt, bis die Schwestern ihr begreiflich gemacht hatten, dass sie unverletzt war.
»Aber seitdem hat sie hervorragende Fortschritte gemacht, meinst du nicht, Schwesterherz?«, erwiderte Mrs Black. »Wenn man bedenkt, in welchem Zustand sie zu uns gekommen ist. Sie wusste ja nicht einmal, was sie war.«
»In der Tat: Sie war vollkommen ungeformter Ton«, pflichtete Mrs Dark ihr bei.
»Wir haben hier wahrhaftig ein Wunder vollbracht. Ich wüsste nicht, warum der Magister nicht äußerst zufrieden mit uns sein sollte.«
Mrs Black schnappte nach Luft. »Soll das heißen … Glaubst du wirklich, es ist so weit?«
»O ja, unbedingt, liebes Schwesterherz. Sie ist so weit. Für unsere kleine Theresa wird es Zeit, ihren Herrn und Meister kennenzulernen.« Eine selbstgefällige Freude schwang in Mrs Darks Stimme mit, ein unangenehmer Klang, der Tessa aus ihrer Benommenheit riss. Von wem redeten die beiden? Wer war dieser Magister? Zwischen halb geschlossenen Lidern sah sie, wie Mrs Dark an dem seidenen Klingelzug riss, der Miranda herbeirufen würde, damit diese Tessa auf ihr Zimmer zurückbrachte. Offenbar war der Unterricht für heute beendet.
»Möglicherweise morgen«, murmelte Mrs Black, »oder vielleicht sogar heute Abend. Wenn wir den Magister wissen lassen, dass sie bereit ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht unverzüglich hierhereilt.«
Mrs Dark trat kichernd hinter dem Schreibtisch hervor. »Ich verstehe ja, dass du es kaum erwarten kannst, für all unsere Mühen entlohnt zu werden, liebe Schwester. Aber Theresa sollte nicht nur bereit sein. Sie sollte auch … präsentabel sein. Meinst du nicht auch?«
Mrs Black, die ihrer Schwester gefolgt war, murmelte eine Antwort, die jedoch unterbrochen wurde, als die Tür aufging und Miranda in den Raum marschierte, mit demselben stumpfsinnigen Gesichtsausdruck wie immer. Tessas Anblick, die blutüberströmt auf dem Boden kauerte, schien sie nicht im Geringsten zu überraschen. Andererseits hatte sie in diesem Raum wahrscheinlich schon viel schlimmere Dinge gesehen, dachte Tessa.
»Bring das Mädchen zurück auf sein Zimmer, Miranda.« Der begierige Unterton in Mrs Blacks Stimme war verschwunden und der üblichen Schroffheit gewichen. »Hol die Sachen … du weißt schon … die, die wir dir gezeigt haben … und sorge dafür, dass sie entsprechend gekleidet und frisiert ist.«
»Die Sachen … die Sie mir gezeigt haben?«, fragte Miranda verständnislos.
Mrs Dark und Mrs Black tauschten einen angewiderten Blick und stellten sich so vor Miranda, dass sie Tessas Sicht versperrten. Dann hörte Tessa, wie sie dem Mädchen etwas zuzischten, und schnappte dabei ein paar Worte auf: »Roben« und »Kleiderkammer« und »Sorge mit allen Mitteln dafür, dass sie hübsch aussieht«. Und schließlich hörte Tessa den ziemlich bissigen Kommentar: »Ich bin mir nicht sicher, ob Miranda schlau genug ist, um solcherart vagen Anordnungen Folge zu leisten, Schwesterherz.«
»Sorge dafür, dass sie hübsch aussieht.« Aber wieso interessierten sich die Schwestern plötzlich dafür, dass sie hübsch aussah – wenn sie sie doch zwingen konnten, jede gewünschte Gestalt anzunehmen? Was spielte es für eine Rolle, wie sie tatsächlich aussah? Und warum sollte das diesen Magister kümmern? Allerdings ließ das Verhalten der Schwestern darauf schließen, dass er ihres Erachtens Wert auf ein attraktives Äußeres legte.
Mrs Black rauschte aus dem Zimmer, ihre Schwester wie üblich im Kielsog. An der Tür hielt Mrs Dark plötzlich inne und drehte sich noch einmal zu Tessa um. »Denke daran, Theresa, dass dieser Tag, dieser Abend das Ziel all unserer Anstrengungen ist.« Dann raffte sie mit ihren knochigen Fingern ihre Röcke und fügte hinzu: »Und wehe dir, du enttäuschst uns!« Eine Sekunde später fiel die Tür hinter ihr mit einem Knall ins Schloss.
Tessa zuckte zusammen, wogegen Miranda wie üblich vollkommen unbeeindruckt wirkte. Während der ganzen Wochen im Dunklen Haus war es Tessa nicht ein einziges Mal gelungen, das andere Mädchen zu erschrecken oder zu einer überraschten, unbedachten Reaktion zu verleiten.
»Kommen Sie«, sagte Miranda nun. »Wir müssen nach oben gehen.«
Langsam richtete Tessa sich auf. Ihre Gedanken überschlugen sich förmlich. Ihr Dasein im Dunklen Haus war zwar schrecklich gewesen, aber sie hatte sich fast daran gewöhnt, wie sie nun schlagartig erkannte. Denn sie hatte jeden Tag gewusst, was sie erwartete. Und natürlich war ihr bewusst gewesen, dass die Dunklen Schwestern sie für irgendetwas vorbereiteten, aber sie hatte keine Ahnung gehabt, was dieses »Etwas« sein mochte. Irgendwie hatte sie geglaubt, dass die beiden sie nicht töten würden – was vielleicht sehr naiv gewesen war. Andererseits: Warum sollten die Schwestern sich all die Mühe mit ihrer Ausbildung geben, wenn sie ohnehin dem Tode geweiht war?
Doch irgendetwas in Mrs Darks selbstgefälligem Ton ließ Tessa nachdenklich werden. Irgendetwas hatte sich verändert. Die Schwestern hatten erreicht, was sie mit ihr hatten erreichen wollen. Nun würden sie »entlohnt« werden. Aber wer war derjenige, der sie entlohnen würde?
»Kommen Sie«, wiederholte Miranda. »Wir müssen Sie für den Magister bereit machen.«
»Miranda …«, setzte Tessa mit sanfter Stimme an, so als spräche sie mit einer nervösen Katze. Zwar hatte Miranda noch keine einzige von Tessas Fragen beantwortet, aber das bedeutete ja nicht, dass man es nicht noch einmal versuchen konnte. »Miranda … wer ist der Magister?«
Stille machte sich breit, eine lange Stille, während der Miranda mit ausdruckslosem Gesicht vor sich hin starrte. Doch dann erwiderte das Mädchen zu Tessas Überraschung: »Der Magister ist ein sehr bedeutender Mann. Es wird eine große Ehre für Sie sein, wenn Sie mit ihm vermählt werden.«
»Vermählt?«, stieß Tessa hervor. Der Schock war so groß, dass sie den Raum plötzlich glasklar sehen konnte: Miranda, den blutbespritzten Teppich auf dem Boden, den schweren Messingglobus auf dem Schreibtisch, noch immer in der leicht geneigten Position, in der Mrs Black ihn zurückgelassen hatte. »Ich? Heiraten? Aber … wer ist er denn überhaupt?«
»Er ist ein sehr bedeutender Mann«, wiederholte Miranda. »Es wird eine große Ehre sein.« Sie ging auf Tessa zu. »Sie müssen jetzt mitkommen.«
»Nein.« Tessa wich vor dem anderen Mädchen zurück, bis sie mit dem unteren Rücken schmerzhaft gegen die Schreibtischkante stieß. Verzweifelt sah sie sich um. Sie könnte zwar zu fliehen versuchen, aber sie würde niemals an Miranda vorbeikommen, die die Tür blockierte. Und der Raum besaß weder Fenster noch Türen zu benachbarten Zimmern. Wenn sie sich hinter dem Schreibtisch verschanzte, würde Miranda sie einfach hervorzerren und auf ihr Zimmer schleifen. »Miranda, bitte.«
»Sie müssen jetzt mitkommen«, wiederholte Miranda lediglich und marschierte unaufhaltsam auf Tessa zu.
Tessa konnte in den schwarzen Pupillen des Dienstmädchens bereits ihr eigenes Spiegelbild erkennen, konnte den leicht bitteren, fast verbrannten Geruch wahrnehmen, der in Mirandas Kleidern hing.
»Sie müssen …«
Mit einer Kraft, die sie sich selbst nie zugetraut hätte, riss Tessa den Messingglobus vom Schreibtisch, hob ihn hoch und schlug ihn Miranda mit voller Wucht über den Schädel.
Der massive Fuß traf mit einem übelkeiterregenden Klang gegen die Stirn des Mädchens. Miranda taumelte rückwärts – und richtete sich dann auf. Tessa schrie erschrocken auf, ließ den Globus fallen und starrte entsetzt auf das Mädchen: Die gesamte linke Gesichtshälfte war zerschlagen wie eine eingedrückte Maske aus Pappmaschee. Der linke Wangenknochen war zertrümmert, die Lippe gegen die Zähne gequetscht. Aber es floss kein Blut, nicht ein einziger Tropfen.
»Sie müssen jetzt mitkommen«, sagte Miranda, im selben ausdruckslosen Ton wie immer.
Tessa starrte sie mit offenem Mund an.
»Sie müssen mitko… Sie m-müssen … Sie … Sie … Sssssssss…« Mirandas Stimme bebte und brach. Und dann gab sie nur noch unverständliches Gebrabbel von sich. Langsam bewegte sie sich auf Tessa zu, wandte sich dann aber ruckartig zur Seite, zuckend und taumelnd. Tessa löste sich vom Schreibtisch und wich tiefer in den Raum zurück, während das verletzte Mädchen sich nun um die eigene Achse drehte, schneller und schneller. Miranda torkelte durch das Büro der Schwestern wie eine Betrunkene, stieß schrille Schreie aus und prallte schließlich so heftig gegen die gegenüberliegende Wand, dass sie das Bewusstsein verlor. Krachend ging sie zu Boden und lag dann vollkommen reglos da.
Tessa stürzte zur Tür hinaus in den Flur und schaute sich nur noch einmal kurz um. Es hatte den Anschein, als ob schwarzer Qualm aus Mirandas Körpermitte aufstieg, aber Tessa nahm sich nicht die Zeit, genauer hinzusehen. Fluchtartig stürmte sie durch den Korridor und ließ die Tür hinter sich sperrangelweit offen stehen.
Als sie die Treppe erreichte und hinaufrannte, wäre sie fast über ihre Röcke gestolpert und schlug mit dem Knie gegen eine der harten Stufen. Der Schmerz ließ sie aufstöhnen, doch sie rappelte sich auf und stürmte weiter nach oben bis zum ersten Treppenabsatz, wo sie sich zum Korridor wandte. Der Gang lag lang und gewunden vor ihr und verlor sich irgendwo in den Schatten. Während Tessa weiterrannte, erkannte sie, dass der Korridor von zahlreichen Türen flankiert wurde. Sie hielt kurz inne und rüttelte an einer der Türen, doch diese war fest verschlossen. Und auch die nächste Tür und die darauf folgenden ließen sich nicht öffnen.
Am Ende des Korridors befand sich eine weitere Treppe. Tessa rannte die Stufen hinunter und fand sich schließlich in der Eingangshalle wieder. Dieser Bereich sah aus, als wäre er einst imposant und prächtig gewesen: Der Boden bestand aus großen, nun allerdings geborstenen und fleckigen Marmorplatten, und vor den hohen Fenstern auf beiden Seiten hingen schwere Vorhänge. Ein schmaler Lichtstrahl drang durch den Stoff und fiel auf eine gewaltige Haustür. Tessas Herz machte einen Satz. Sie stürzte auf die Tür zu, drehte den Knauf und stieß die Flügeltüren auf.
Dahinter kam eine enge kopfsteingepflasterte Gasse zum Vorschein, mit schmalen Reihenhäusern auf beiden Seiten. Der Geruch der Stadt traf Tessa wie ein Schlag – es war so lange her, dass sie Gelegenheit gehabt hatte, frische Luft zu atmen. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt und hüllte den Himmel in ein dunkelblaues Zwielicht, durch das Nebelschwaden zogen. In der Ferne konnte Tessa Stimmen hören, das Kreischen spielender Kinder, das Klappern von Pferdehufen. Aber die Straße vor ihr war menschenleer – bis auf einen Mann, der wenige Schritte entfernt an einer Gaslaterne lehnte und im Lichtschein eine Zeitung las.
Tessa stürmte die Stufen hinunter auf den Fremden zu und packte ihn am Ärmel. »Bitte, Sir, bitte helfen Sie mir …«
Der Fremde drehte sich um und schaute auf sie herab.
Tessa unterdrückte einen Schrei. Das Gesicht des Mannes war weiß und wächsern, wie an jenem Tag, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte, am Kai in Southampton. Seine hervorstehenden Augen erinnerten Tessa an Miranda, und seine Zähne schimmerten metallisch, als ein breites Grinsen über sein Gesicht zog.
Es war der Kutscher der Dunklen Schwestern.
Tessa wirbelte herum, um zu fliehen, doch es war bereits zu spät.
2
Kalte Hölle
Zwischen zwei Welten schwebst du, Menschenkind, Wie zwischen Tag und Nacht der Dämmrung Saum. Du weißt nicht, was wir werden, was wir sind.
Lord Byron, »Don Juan«
»Du dummes kleines Ding«, fauchte Mrs Black und zog mit einem Ruck das Seil fest, mit dem Tessas Handgelenke an das Bettgestell gefesselt waren. »Was hast du dir dabei gedacht? Einfach so wegzulaufen! Was hast du denn geglaubt, wo du hinkönntest?«
Tessa schwieg eisern, schob das Kinn vor und starrte gegen die Wand. Sie wollte nicht zulassen, dass Mrs Black oder ihre schreckliche Schwester mitbekamen, wie nahe sie den Tränen war und wie tief die Seile, mit denen sie ans Bett gebunden war, ihr in die Fuß- und Handgelenke schnitten.
»Sie ist sich der Ehre, die ihr zuteilwird, überhaupt nicht bewusst«, knurrte Mrs Dark, die in der Tür stand, als wollte sie sichergehen, dass Tessa sich nicht losriss und erneut flüchtete. »Ein wahrhaft widerwärtiger Anblick.«
»Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um sie für den Magister vorzubereiten«, seufzte Mrs Black. »Ein Jammer, dass wir nur solch minderwertiges Material zum Arbeiten hatten – trotz ihrer Begabung. Sie ist eine kleine, hinterlistige Närrin.«
»In der Tat«, bestätigte ihre Schwester. »Sie ist sich doch wohl im Klaren darüber, was mit ihrem Bruder geschieht, wenn sie erneut versucht, sich uns zu widersetzen? Dieses eine Mal mögen wir ja noch gewillt sein, Gnade walten zu lassen, aber beim nächsten Mal …« Sie stieß ein böses Zischen aus, das dafür sorgte, dass sich Tessas Nackenhaare aufrichteten. »Beim nächsten Mal wird Nathaniel nicht so viel Glück haben.«
In dem Moment konnte Tessa sich nicht länger zurückhalten. Obwohl sie wusste, dass sie eigentlich nicht mit den Schwestern reden und ihnen diese Genugtuung nicht schenken sollte, platzte sie heraus: »Wenn Sie mir verraten hätten, wer der Magister ist oder was er von mir will …«
»Er will dich heiraten, du kleine Närrin.« Mrs Black hatte den letzten Knoten festgezogen und trat einen Schritt zurück, um ihr Werk zu begutachten. »Er will dir alles geben, was ein Mädchen sich nur wünschen kann.«
»Aber warum?«, flüsterte Tessa. »Warum mir?«
»Wegen deiner Begabung«, erwiderte Mrs Dark. »Aufgrund dessen, was du bist und was du kannst … was wir dir beigebracht haben. Du solltest uns dankbar sein.«
»Aber was ist mit meinem Bruder?« Tränen stiegen Tessa in die Augen. Ich werde nicht weinen, ich werde nicht weinen, ich werde nicht weinen, ermahnte sie sich wieder und wieder. »Sie haben mir gesagt, wenn ich alles tue, was Sie von mir verlangen, dann würden Sie ihn freilassen …«
»Wenn du erst einmal mit dem Magister vermählt bist, wird er dir alles geben, was du willst. Und wenn du für deinen Bruder die Freiheit wünschst, wird er dafür sorgen.«
In Mrs Blacks Stimme schwang nicht eine Spur von Reue oder Gefühl mit.
Mrs Dark kicherte. »Ich weiß, was sie jetzt denkt. Sie denkt: Wenn sie alles bekommen kann, was sie will, dann wird sie sich unseren Tod wünschen.«
»Vergeude deine Zeit nicht damit, etwas Derartiges auch nur in Erwägung zu ziehen!« Mrs Black versetzte Tessa einen Kinnstüber. »Wir haben einen hieb- und stichfesten Vertrag mit dem Magister. Er wird uns niemals schaden können, noch würde er das wollen. Schließlich ist er uns zu Dank verpflichtet, weil wir ihm dich überreichen.« Sie beugte sich vor und senkte ihre Stimme zu einem Flüstern: »Er wünscht, dich gesund und wohlbehalten in Empfang zu nehmen. Du kannst dich also glücklich schätzen – denn ansonsten hätte ich dich grün und blau geprügelt. Wenn du es wagst, dich uns noch einmal zu widersetzen, werde ich seinen Wunsch ignorieren und dich auspeitschen lassen, bis deine Haut sich in Streifen von den Knochen löst. Hast du das verstanden?«
Statt einer Antwort wandte Tessa das Gesicht zur Wand.
An Bord derMainhatte es eine Nacht gegeben, in der Tessa nicht schlafen konnte und an Deck gegangen war, um frische Luft zu schnappen. Das Dampfschiff befand sich gerade auf Höhe von Neufundland, und aus der nachtblauen Meeresoberfläche ragten weiß glitzernde Gebirge auf – Eisberge, wie ihr einer der Matrosen verriet. Große Eisbrocken, die sich aufgrund des warmen Wetters von der Eisdecke im Norden gelöst hatten. Langsam segelten sie auf der dunklen Wasserfläche wie die Türme einer versunkenen weißen Stadt. Ihr Anblick war Tessa unfassbar traurig und einsam erschienen.
Aber damals hatte sie nur einen ersten Eindruck von Einsamkeit bekommen, erkannte sie nun. Nachdem die Schwestern gegangen waren, verspürte Tessa nicht länger das Bedürfnis, in Tränen auszubrechen. Der Druck hinter ihren Lidern war verschwunden und einem dumpfen Gefühl der Verzweiflung gewichen. Mrs Dark hatte recht gehabt: Wenn Tessa den Tod der beiden Schwestern hätte veranlassen können, hätte sie keine Sekunde gezögert.
Probeweise zog sie an den Seilen, die ihre Arme und Beine an das Bettgestell fesselten, doch sie gaben nicht nach. Die Knoten waren so fest geknüpft, dass die Seile ihr tief in die Haut schnitten und die Blutzufuhr abschnürten. Ihre Hände und Füße hatten bereits zu prickeln begonnen. Ihr blieben vermutlich nur noch wenige Minuten, bis ihre Extremitäten vollkommen taub geworden waren, überlegte Tessa.
Ein – nicht gerade geringer – Teil von ihr hätte am liebsten aufgegeben und einfach nur dagelegen, bis der Magister gekommen wäre und sie abgeholt hätte. Der Himmel vor dem kleinen Fenster wirkte bereits dunkel; es konnte also nicht mehr lange dauern. Vielleicht wollte er sie ja wirklich heiraten. Vielleicht wollte er ihr ja tatsächlich alles geben, was ein Mädchen sich nur wünschen konnte.
Doch plötzlich hörte Tessa die Stimme ihrer Tante Harriet in ihrem Kopf: Wenn du einen Mann gefunden hast, den du heiraten möchtest, Tessa, dann denk daran: Nicht an seinen Worten, sondern an seinen Taten wirst du erkennen, welch eine Sorte Mann er ist.
Und natürlich hatte Tante Harriet recht: Kein Mann, den sie jemals würde heiraten wollen, hätte dafür gesorgt, dass sie wie eine Gefangene und eine Sklavin behandelt wurde. Und er hätte auch nicht ihren Bruder eingesperrt oder sie im Namen ihrer »Begabung« foltern lassen. Das Ganze war ein Hohn und ein Witz. Gott allein wusste, was dieser Magister mit ihr vorhatte, wenn er sie erst einmal in seine Finger bekam. Und falls er sie am Leben ließ, würde sie sich wahrscheinlich bald wünschen, lieber tot zu sein.
Himmel, was für eine nutzlose Begabung sie doch besaß! Die Macht, ihr Erscheinungsbild zu verändern. Wenn sie doch nur die Macht besäße, Dinge in Flammen aufgehen oder Metall zerbersten oder Messer aus ihren Fingern wachsen zu lassen! Oder wenn sie die Macht hätte, sich selbst unsichtbar zu machen oder auf die Größe einer Maus zu schrumpfen …
Plötzlich wurde Tessa still, so still, dass sie das Ticken des Klockwerk-Engels an ihrer Brust hören konnte. Sie brauchte sich doch gar nicht auf die Größe einer Maus zu schrumpfen, oder? Sie musste sich lediglich so klein machen, dass die Fesseln um ihre Handgelenke locker herabhingen.
Sie wusste, dass sie sich ein zweites Mal in eine bestimmte Person verwandeln konnte, ohne irgendeinen Gegenstand zu berühren, der diesem Menschen gehört hatte. Die Dunklen Schwestern hatten ihr eingebläut, wie das funktionierte. Zum ersten Mal in ihrem Leben war Tessa froh über eine ihrer Zwangslektionen.
Sie drückte sich fest in die harte Matratze und rief sich die Bilder wieder vor Augen: die Gasse, die Küche, die tanzende Nadel, den Schein der Gaslaterne. Durch reine Willensanstrengung leitete Tessa die Verwandlung ein. Wie heißt du? Emma. Emma Bayliss …
Die Verwandlung überrollte sie wie ein rasender Zug, nahm ihr fast den Atem, während sich ihre Haut veränderte und ihre Knochen sich neu zusammensetzten. Tessa unterdrückte den Schrei in ihrer Kehle und bäumte sich auf …
Und dann war es vollbracht. Blinzelnd starrte sie an die Decke, anschließend zur Seite auf ihr Handgelenk und die Fesseln. Da waren sie: Emmas Hände, zart und zerbrechlich, und das Seil lag locker um ihre dünnen Gelenke. Triumphierend riss Tessa ihre Hände aus den Fesseln, setzte sich auf und rieb sich die roten Striemen auf der Haut.
Ihre Füße waren jedoch noch nicht freigekommen. Rasch beugte Tessa sich vor und fingerte fieberhaft an den Knoten herum. Wie sich herausstellte, war Mrs Black im Umgang mit Tauwerk geschickt wie ein Seemann: Als sich das Seil endlich löste, waren Tessas Finger eingerissen und blutig. Hastig richtete sie sich auf und sprang vom Bett.