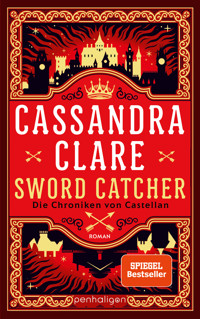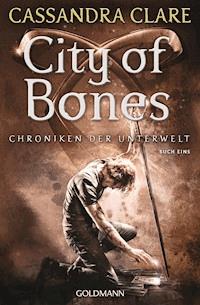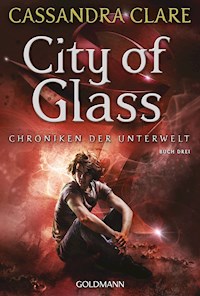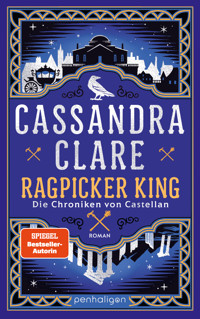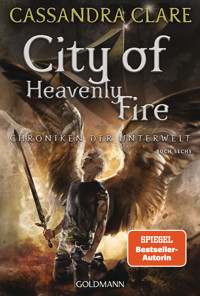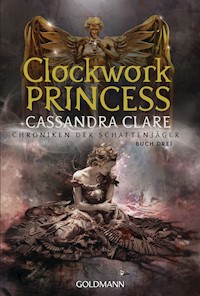
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Chroniken der Schattenjäger
- Sprache: Deutsch
Kurz vor ihrer Hochzeit sollte Tessa Gray eigentlich überglücklich sein. Wenn nicht die Gemeinschaft der Londoner Schattenjäger in ihrer Existenz bedroht wäre. Denn Tessas Widersacher Mortmain verfügt über eine Armee seelenloser Maschinen, die alles zu vernichten droht. Nur ein Detail fehlt ihm zur Ausführung seines Plans: Tessa selbst und ihre außergewöhnlichen Kräfte. Als er sie in seine Gewalt bringt, eilen Jem und Will, die beide Anspruch auf das Herz der jungen Frau erheben, zu ihrer Rettung. Doch am Ende ist es Tessa selbst, die über ihr Schicksal entscheiden muss, um dem Dunkel Einhalt zu gebieten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 849
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Tessa Gray steht kurz vor ihrer Hochzeit mit Jem Carstairs. Doch ihr vermeintliches Glück wird jäh zerstört, als die Londoner Schattenjäger sich einer fatalen Bedrohung gegenübersehen: Aus dem Verborgenen heraus rüstet ihr Erzfeind, Magister Axel Mortmain, zum Angriff und droht, die Schattenjägergemeinschaft mit seiner Armee seelenloser Automaten ein für alle Mal auszulöschen.
Um Mortmain zuvorzukommen und seine finsteren Pläne zu durchkreuzen, macht Tessa sich selbst auf die Suche nach dem Magister. An ihrer Seite ihr Verlobter Jem und sein Freund Will – der gegen jede Vernunft nicht von seiner Liebe zu Tessa lassen kann.
In einem Wettlauf gegen die Zeit und im Stich gelassen von denen, die eigentlich ihre Verbündeten sein sollten, versteht Tessa schließlich, dass sie es ist, die die entscheidende Rolle im Kampf um die Zukunft der Schattenjäger spielt. Aber kann eine einzelne junge Frau, selbst wenn sie über außergewöhnliche Kräfte verfügt, eine ganze Armee besiegen?
Weitere Informationen zu Cassandra Clare
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
Clockwork Princess
Chroniken der Schattenjäger
BUCHDREI
Roman
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »The Infernal Devices. Book Three. Clockwork Princess« bei Margaret K. McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Erstmals auf Deutsch erschienen im Jahr 2013.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Neuausgabe März 2023
Copyright © der Originalausgabe 2013 by Cassandra Clare, LLC
Copyright © dieser Ausgabe 2023
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Franca Fritz und Heinrich Koop © 2013 Arena Verlag GmbH, Würzburg, www.arena-verlag.de
Covergestaltung: UNO Werbeagentur, München, unter Verwendung eines Entwurfs von Russell Gordon
Covermotiv: © Cliff Nielsen
Illustration Buchrücken: © 2015 by Nicolas Delort (Landschaft), Pat Kinsella (Figur)
Karte auf den Umschlaginnenseiten: Drew Willis
TH · Herstellung: ik
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN: 978-3-641-29217-1V001
www.goldmann-verlag.de
Ihm stimm ich bei, der uns in reichenAkkorden ew’ge Wahrheit singt:Erstorb’nes Selbst kann aufwärts steigen,Wenn es zu höh’rer Tat sich zwingt.
Alfred Lord Tennyson, »In Memoriam A. H. H.«
Prolog
York, 1847
»Ich hab Angst.« Das kleine Mädchen saß auf dem Bett. »Großvater, kannst du bei mir bleiben?«
Aloysius Starkweather schnaubte ungehalten, rückte einen Stuhl näher ans Bett und ließ sich darauf nieder. Doch der ungeduldige Ton war nicht ganz ernst gemeint: Insgeheim freute es ihn, dass seine Enkelin ihm bedingungslos vertraute und er häufig der Einzige war, der sie beruhigen konnte. Sein schroffes Verhalten hatte sie nie abgeschreckt, trotz ihres zarten Wesens. »Es gibt nichts, wovor du dich fürchten musst, Adele«, erwiderte er. »Du wirst schon sehen.«
Adele schaute ihn aus großen Augen an. Normalerweise würde der Ritus der ersten Rune unten in einem der größeren Säle des Yorker Instituts stattfinden, doch aufgrund Adeles schwacher Konstitution hatte man beschlossen, die Zeremonie in ihr warmes, vor Zugluft geschütztes Schlafzimmer zu verlegen. Mit kerzengeradem Rücken saß das Mädchen auf dem Bettrand, in ein rotes Festgewand gekleidet, unter dem die dünnen nackten Ärmchen hervorschauten. Ein rotes Seidenband hielt ihre feinen hellen Haare im Nacken zusammen, und ihre Augen schienen riesig in dem mageren Gesichtchen. Alles an ihr wirkte so fein und zerbrechlich wie eine Porzellanpuppe.
»Die Brüder der Stille …«, setzte sie an. »Was werden sie mit mir machen?«
»Gib mir mal deinen Arm«, forderte Starkweather seine Enkelin auf, die ihm vertrauensvoll den rechten Arm entgegenstreckte. Er drehte ihn leicht und betrachtete das feine Geflecht blauer Adern, das unter der Haut hindurchschimmerte. »Die Brüder werden ihre Stelen nehmen – du weißt ja, was eine Stele ist – und dich mit einem Runenmal versehen. Normalerweise beginnen sie mit der Voyance-Rune, doch in deinem Fall werden sie zuerst eine Stärkerune auftragen.«
»Weil ich nicht sehr kräftig bin.«
»Richtig, zur Stärkung deiner Konstitution.«
»Genau wie Rinderbrühe.« Adele rümpfte die Nase.
Aloysius lachte. »Hoffentlich nicht ganz so unangenehm. Du wirst ein leichtes Brennen spüren, deshalb musst du tapfer sein und solltest nicht weinen, denn Schattenjäger jammern nicht bei jedem kleinen Wehwehchen. Das Brennen wird bald nachlassen, und du wirst dich viel besser und stärker fühlen. Damit ist die Zeremonie dann beendet, und wir gehen alle nach unten in den Festsaal des Instituts und feiern. Mit Kaffee und Kuchen.«
Adele baumelte aufgeregt mit den Beinen. »Ein Fest!«
»Ja genau, ein Fest. Und ein paar Geschenke.« Aloysius klopfte auf seine Westentasche. Darin steckte eine kleine Schachtel, die in elegantes blaues Papier geschlagen war und einen winzigen Familienring enthielt. »Eines der Geschenke habe ich hier in meiner Tasche. Du bekommst es, sobald die Zeremonie vorüber ist.«
»Für mich hat noch nie jemand ein Fest gemacht.«
»Damit begehen wir deine Einführung in den Kreis der Schattenjäger«, erklärte Aloysius. »Du weißt ja, warum das so wichtig ist, nicht wahr? Mit deinen ersten Runenmalen wirst du zu einer Nephilim, genau wie ich, deine Mutter und dein Vater. Die Runen bedeuten, dass du ein Mitglied der Schattenjägergemeinschaft bist. Ein Mitglied unserer Kriegerfamilie. Etwas ganz Besonderes und besser als alle anderen.«
»Besser als alle anderen«, wiederholte Adele langsam, als die Tür aufschwang und die Brüder der Stille das Schlafzimmer betraten.
Aloysius sah, wie in Adeles Augen Angst aufflackerte. Rasch zog sie ihren Arm zurück, woraufhin er leicht verärgert die Stirn runzelte: Es gefiel ihm nicht, dass seine Nachkommenschaft Furcht zeigte. Andererseits konnte er nicht leugnen, dass die Brüder mit ihrem gespenstischen Schweigen und ihren eigenartigen, fast gleitenden Schritten tatsächlich unheimlich waren. Lautlos durchquerten sie den Raum und blieben neben Adeles Bett stehen, als sich die Tür erneut öffnete und die Eltern des Mädchens das Zimmer betraten: Adeles Vater, Aloysius’ Sohn, in scharlachroter Schattenjägermontur und seine Frau in einem weiten roten Gewand und mit einer goldenen Halskette, an der eine Enkeli-Rune hing. Sie schenkten ihrer Tochter ein strahlendes Lächeln, das diese leicht zittrig erwiderte, selbst als sich die Stillen Brüder ihr nun zuwandten.
Adele Lucinda Starkweather. Die Stimme des ersten Stillen Bruders – Bruder Cimon – erklang in Adeles Kopf. Du hast nun das Alter erreicht, in dem es sich geziemt, dich mit dem ersten Runenmal des Erzengels zu versehen. Bist du dir der hohen Ehre bewusst, die dir zuteilwird, und wirst du alles in deiner Macht Stehende tun, um dich ihrer würdig zu erweisen?
Adele nickte gehorsam. »Ja.«
Und akzeptierst du diese Engelsrunen, die deine Haut auf alle Ewigkeit kennzeichnen werden, in unauslöschlicher Erinnerung an den Dank, den du dem Erzengel schuldest, und an deine heilige Pflicht gegenüber der Welt?
Erneut nickte Adele gehorsam, und Aloysius’ Herz schwoll vor Stolz. »Ja, ich akzeptiere sie«, bestätigte sie.
Dann lasst uns beginnen. Eine Stele blitzte in der weißen Hand eines der Brüder auf. Er nahm Adeles zitternden Arm, platzierte die Spitze der Stele auf ihrer Haut und begann zu zeichnen.
Dicke schwarze Linien flossen aus der Spitze, und Adele schaute verwundert zu, wie das Symbol für Stärke auf der blassen Haut ihres Unterarms Gestalt annahm: ein elegantes Symbol aus einander kreuzenden Linien, das sich über ihre Adern erstreckte und ihren ganzen Arm umspannte. Plötzlich verkrampfte sich ihr Körper, ihre kleinen Zähne gruben sich in ihre Unterlippe, und sie blickte suchend zu Aloysius auf, der bestürzt erstarrte, als er sah, was ihre Augen erfüllte.
Schmerz. Zwar gehörte ein leichtes Brennen durchaus zu einem Runenmal, doch in Adeles Augen erkannte er reinste Qual.
Aloysius sprang so heftig auf, dass sein Stuhl umstürzte und über den Boden rutschte. »Aufhören!«, brüllte er, aber es war bereits zu spät. Die Rune war vollendet. Der Stille Bruder trat einen Schritt zurück und starrte auf die Stele. Blut klebte an der Spitze. Adele wimmerte leise, eingedenk der mahnenden Worte ihres Großvaters, nicht zu weinen. Doch dann verfärbte sich ihre blutige, aufgerissene Haut schwarz, platzte auf und löste sich vom Knochen. Sie brannte förmlich unter der Rune, als stünde sie in Flammen – und Adele konnte den Schmerz nicht länger unterdrücken. Sie warf den Kopf in den Nacken und schrie und schrie …
London, 1873
»Will?« Charlotte Fairchild drückte die Tür zum Fechtsaal des Instituts auf. »Will, bist du hier?«
Statt einer Antwort ertönte nur ein unterdrücktes Grunzen. Die Tür schwang vollends auf und gab den Blick auf den großen, hohen Raum frei. Charlotte hatte seit ihrer Kindheit in diesem Saal trainiert und kannte ihn in- und auswendig: jede Unebenheit im Parkettboden, die uralte Zielscheibe, die auf das Holz an der Nordwand gemalt war, und die fast schon antiken Sprossenfenster, deren Glasscheiben im unteren Bereich dicker waren als am oberen Rand. In der Mitte des Saals stand Will Herondale, ein Messer in der rechten Hand.
Er wandte Charlotte den Kopf zu, und sie wunderte sich wieder einmal, was für ein sonderbares Kind er doch war – obwohl er mit zwölf Jahren eigentlich nicht mehr als Kind bezeichnet werden konnte. Ein recht hübscher Junge, mit dichtem schwarzem Haar, das sich am Kragen wellte und ihm im Moment schweißfeucht an der Stirn klebte. Bei seiner Ankunft im Institut war er von der Sonne und der frischen Landluft gebräunt gewesen, doch nach sechs Monaten in der Stadt hatte seine Haut jede Farbe verloren, wodurch seine geröteten Wangen nun deutlich hervorstachen. Seine Augen schimmerten in einem ungewöhnlich leuchtenden Blau. Eines Tages würde er zu einem attraktiven Mann heranwachsen, sinnierte Charlotte – sofern es ihm gelang, etwas gegen die finstere Miene zu unternehmen, die seine Gesichtszüge ständig überschattete.
»Was ist denn, Charlotte?«, fauchte er. Will sprach noch immer mit einem leicht walisischen Akzent, der sehr charmant geklungen hätte, wenn sein Ton nicht so mürrisch gewesen wäre. Er wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn und musterte Charlotte ungehalten, die zögernd den Saal betreten, dann aber innegehalten hatte.
»Ich bin schon seit Stunden auf der Suche nach dir«, sagte sie mit einer gewissen Schärfe, obwohl sie genau wusste, dass man mit einem harschen Ton bei Will nur wenig erreichte. Andererseits erreichte man bei ihm generell sehr wenig, wenn er übler Laune war – und das war er fast ständig. »Hast du vergessen, was ich dir gestern erzählt habe? Dass wir heute einen Neuankömmling im Institut erwarten?«
»Nein, das hab ich keineswegs vergessen.« Will warf das Messer, das jedoch knapp außerhalb der Zielscheibe in der Holzplatte landete – was seine Miene nur noch mehr verfinsterte. »Es ist mir schlichtweg egal.«
Der Junge hinter Charlotte gab einen erstickten Laut von sich. Ein Lachen, dachte sie im ersten Moment, aber das konnte doch unmöglich sein, oder? Man hatte sie gewarnt, dass der Gast aus Shanghai nicht bei bester Gesundheit sei, doch sein Anblick beim Verlassen der Kutsche hatte sie äußerst bestürzt: bleich und schwankend wie ein Rohr im Wind, die lockigen schwarzen Haare von silbernen Strähnen durchzogen, als wäre er ein hochbetagter Mann und kein Junge von zwölf Jahren. Seine großen Augen in dem fein geschnittenen Gesicht besaßen eine betörende, aber auch melancholische Schönheit und schimmerten ebenfalls silberschwarz.
»Will, wirst du wohl höflich sein!«, tadelte Charlotte, wandte sich dann dem anderen Jungen zu, zog ihn hinter sich vor und schob ihn in den Saal hinein: »Kümmere dich nicht um Will; er ist nur schlecht aufgelegt. Will Herondale, darf ich dir James Carstairs vom Institut in Shanghai vorstellen?«
»Jem«, sagte der Junge. »Alle nennen mich Jem.« Er trat einen weiteren Schritt vor und musterte Will mit freundlichem Interesse. Zu Charlottes Überraschung sprach er vollkommen akzentfrei Englisch, aber dann erinnerte sie sich, dass sein Vater Engländer gewesen war. »Wenn du willst, kannst du mich auch so nennen«, fuhr der Junge fort.
»Nun ja, wenn alle dich so nennen, kann man das wohl kaum als besondere Gunst bezeichnen, oder?«, entgegnete Will sarkastisch; für jemanden so Junges war er zu erstaunlicher Unfreundlichkeit fähig. »Ich denke, eines wirst du bald erkennen, James Carstairs: Wenn du dich um deine eigenen Angelegenheiten kümmerst und mich in Ruhe lässt, wird das für uns beide das Beste sein.«
Charlotte seufzte innerlich. Sie hatte so sehr gehofft, dass dieser gleichaltrige Junge sich als ein Mittel erweisen würde, Wills Zorn und Gehässigkeit zu mildern. Doch offenbar hatte Will die Wahrheit gesagt, als er ihr mitteilte, es interessiere ihn nicht, ob noch ein weiterer junger Schattenjäger im Institut eintreffen würde. Er wollte keine Freunde und litt auch nicht darunter, dass er keine besaß. Verstohlen warf Charlotte Jem einen Blick zu in der Erwartung, ihn überrascht oder gekränkt zu sehen.
Doch er lächelte nur nachsichtig, als sei Will ein Kätzchen, das ihn zu beißen versucht hatte. »Seit meiner Abreise aus Shanghai hatte ich keine Gelegenheit zum Trainieren«, sagte er. »Ich könnte einen Partner gebrauchen – jemanden für einen Übungskampf.«
»Geht mir genauso«, meinte Will. »Aber ich brauche jemanden, der mit mir mithalten kann, und nicht irgendeinen kränklichen Greis, der aussieht, als stünde er schon mit einem Fuß im Grab. Andererseits würdest du vermutlich ein hervorragendes Übungsziel abgeben.«
Charlotte, die – im Gegensatz zu Will – James Carstairs Vorgeschichte kannte, spürte, wie sich ihr bei diesen Worten der Magen umdrehte. Schon mit einem Fuß im Grab, gütiger Gott! Was hatte ihr Vater gesagt? Jems Leben hing von einer drogenähnlichen Substanz ab, irgendeine Art von Arznei, die sein Leben verlängerte, ihn aber nicht vor einem vorzeitigen Tod bewahren konnte. Ach, Will.
Hastig setzte sie sich in Bewegung, um sich zwischen die beiden Jungen zu stellen und Jem vor Wills Grausamkeiten zu schützen, die in diesem Fall noch zutreffender waren, als er selbst ahnte. Doch dann hielt sie inne.
Jem hatte keine Miene verzogen. »Wenn du mit ›schon mit einem Fuß im Grab‹ andeuten willst, dass ich sterbenskrank bin, hast du recht«, sagte er. »Mir bleiben noch etwa zwei Jahre … drei, wenn ich Glück habe. Das sagen zumindest die Ärzte.«
Nicht einmal Will konnte seine Bestürzung verbergen. Seine Wangen färbten sich feuerrot. »Ich …«
Doch Jem steuerte bereits auf die Zielscheibe zu. Mit einer schnellen Handbewegung riss er das Messer aus dem Holz, machte auf dem Absatz kehrt und marschierte zurück. Trotz seiner schlanken Statur war er fast so groß wie Will. Er blieb dicht vor Will stehen und schaute ihm fest in die Augen. »Wenn du willst, kannst du mich für Zielwurfübungen nutzen«, sagte Jem so beiläufig, als würde er über das Wetter reden. »Mir scheint, ich habe bei diesem Training wenig zu befürchten. Du bist kein besonders guter Werfer.« Damit drehte er sich um, zielte und ließ das Messer durch die Luft segeln. Die Klinge bohrte sich mitten ins Zentrum der Scheibe und federte leicht nach. »Oder aber …«, fuhr Jem fort und wandte sich Will wieder zu, »oder aber du könntest mir erlauben, dich zu unterrichten. Denn ich bin ein ausgezeichneter Werfer.«
Charlotte starrte verwundert auf die Szene, die sich ihr bot. Ein halbes Jahr lang hatte sie beobachtet, wie Will jeden von sich gestoßen hatte, der versuchte, ihm näherzukommen: Tutoren, Charlottes Vater, ihr Verlobter Henry, die Lightwood-Brüder. Dabei war er stets mit einer Mischung aus Gehässigkeit und wohldosierter Grausamkeit vorgegangen. Wenn Charlotte nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, wie er einmal in Tränen ausgebrochen war, hätte sie vermutlich auch längst jede Hoffnung fahren lassen.
Und dennoch stand Will nun hier und musterte Jem Carstairs, einen Jungen, der so zerbrechlich wie Glas wirkte, und der harte Ausdruck in seinem Blick schien langsam zu bröckeln und einer zaghaften Unschlüssigkeit zu weichen. »Du bist nicht wirklich sterbenskrank, oder?«, fragte er mit einem seltsamen Unterton in der Stimme.
»Leider doch. Das hat man mir zumindest versichert.«
»Tut mir leid«, murmelte Will.
»Nein, tu das nicht«, erwiderte Jem leise, legte seine Jacke ab und zog ein Messer aus seinem Gürtel. »Verhalte dich nicht wie alle anderen. Sag nicht, dass es dir leidtut. Sag lieber, dass du mit mir trainierst«, fügte er hinzu und streckte Will das Messer mit dem Griff voraus entgegen.
Charlotte hielt den Atem an und wagte nicht, sich zu bewegen. Sie hatte das Gefühl, Zeugin eines sehr wichtigen Moments zu sein, auch wenn sie nicht sagen konnte, worum es dabei genau ging.
Will griff nach dem Messer, ohne Jem auch nur eine Sekunde aus den Augen zu lassen. Dabei streiften seine Finger Jems Hand.
Das war das erste Mal, dachte Charlotte, das erste Mal, dass sie ihn dabei beobachtet hatte, wie er einen anderen Menschen freiwillig berührte.
»Ja, ich werde mit dir zusammen trainieren«, sagte Will.
1 Ein furchtbarer Tumult
Montagsbraut: schöne HautDienstag mit Schleier: Geld und GefeierMittwoch am Altar: einfach wunderbarDonnerstag gefreit: lange gereutFreitag vermählt: sehr schlecht gewähltSamstag gebunden: Ach, hätten sie sich doch nie gefunden!
Alte Volksweisheit
»Der Dezember ist ein sehr günstiger Zeitpunkt für eine Hochzeit«, sagte die Schneiderin, den Mund voller Stecknadeln, was ihr aufgrund jahrelanger Übung aber keinerlei Probleme beim Sprechen bereitete. »Denn wie heißt es so schön: ›Fällt im Dezember der Schnee schon bald, wird eine geschlossene Ehe sehr alt.‹« Geschickt steckte sie eine letzte Nadel in das Kleid und trat dann einen Schritt zurück. »So. Was halten Sie davon? Der Schnitt ist einem von Worths Modeentwürfen nachempfunden.«
Tessa betrachtete sich in dem hohen Spiegel, der in ihrem Zimmer zwischen den beiden Fenstern hing. Das Kleid war aus mattgoldener Seide gefertigt, wie es der Schattenjägertradition entsprach. Denn die Nephilim betrachteten Weiß als die Farbe der Trauer und lehnten es ab, darin zu heiraten, auch wenn Königin Victoria diese Mode persönlich populär gemacht hatte. Brüsseler Spitze säumte das eng geschnittene Mieder und die Ärmel.
»Es ist wunderschön!« Charlotte klatschte in die Hände und beugte sich vor; ihre braunen Augen funkelten vor Begeisterung. »Tessa, die Farbe steht dir einfach hervorragend.«
Tessa drehte und wendete sich vor dem Spiegel. Das Gold verlieh ihren viel zu blassen Wangen etwas Farbe, das enge Korsett modellierte ihre Figur an den richtigen Stellen, und der Klockwerk-Engel an ihrem Hals beruhigte sie mit seinem beständigen Ticken. Darunter baumelte der Jadeanhänger, den Jem ihr gegeben hatte. Tessa hatte die Kette verlängern lassen, sodass sie beide Schmuckstücke gleichzeitig tragen konnte, weil sie auf keines auch nur einen Moment verzichten wollte. »Meinst du nicht, dass die Spitze vielleicht ein wenig zu üppig ist?«, fragte sie zweifelnd.
»Auf keinen Fall!« Charlotte lehnte sich zurück und legte unbewusst eine Hand schützend auf ihren Bauch. Sie war immer so schlank, fast schon hager gewesen, dass sie nie ein Korsett gebraucht hatte. Und nun, da sie ein Kind erwartete, war sie dazu übergegangen, sich in Teekleider zu hüllen, in denen sie wie ein kleiner Vogel aussah. »Hier geht es um deinen Hochzeitstag, Tessa. Wenn es je eine Entschuldigung für üppig dekorierte Kleider gegeben hat, dann doch wohl diese. Stell dir die Zeremonie nur einmal vor!«
Tessa hatte genau damit bereits viele Nächte verbracht. Sie war sich nicht sicher, wo Jem und sie heiraten würden, denn die Kongregation beriet noch immer über ihren Antrag. Doch wenn sie sich ihre Hochzeit ausmalte, sah sie sich stets in einer Kirche, in der sie durch den Mittelgang zum Altar schritt, vielleicht an Henrys Seite, den Blick fest auf ihren Verlobten geheftet, wie es sich für eine Braut geziemte. Jem würde Schattenjägerkleidung tragen, allerdings keine Kampfmontur, sondern eine Art Militäruniform, die speziell für diesen Anlass entworfen wurde: schwarz mit Goldbändern an den Ärmeln und goldenen Runen an Kragen und Taschen.
Er würde so unglaublich jung darin aussehen. Sie beide waren noch so jung. Tessa wusste, dass eine Hochzeit mit siebzehn beziehungsweise achtzehn Jahren nicht üblich war, doch sie standen in einem Wettlauf gegen die Uhr – Jems Lebensuhr, bevor diese ihr Ticken einstellte. Unwillkürlich fuhr Tessas Hand zu ihrem Hals, wo sie das vertraute Vibrieren ihres Klockwerk-Engels spürte.
Besorgt schaute die Schneiderin zu ihr hoch. Sie war eine Irdische, keine Nephilim, besaß aber die Gabe des zweiten Gesichts, wie alle Dienstboten der Schattenjäger. »Soll ich die Spitze lieber entfernen, Miss?«
Ehe Tessa antworten konnte, klopfte es, und dann drang eine vertraute Stimme durch die Tür: »Tessa, bist du da? Ich bin’s, Jem.«
Ruckartig setzte Charlotte sich auf. »O nein! Er darf dich auf keinen Fall in deinem Brautkleid sehen!«
Verblüfft starrte Tessa sie an. »Und warum nicht?«
»Das ist ein alter Schattenjägerbrauch – es bringt Unglück!« Charlotte sprang auf. »Schnell! Versteck dich hinter dem Schrank!«
»Hinter dem Schrank? Aber …« Tessa stieß einen unterdrückten Schrei aus, als Charlotte sie an den Hüften packte und sie im Gänsemarsch hinter den Schrank führte, wie ein Polizist einen besonders widerspenstigen Verbrecher. Wieder frei, glättete Tessa ihr Kleid und schnitt Charlotte eine Grimasse. Dann spähten sie um die Ecke des Möbelstücks, während die Schneiderin sich mit einem kurzen Blick in ihre Richtung vergewisserte, dass die beiden nicht zu sehen waren, bevor sie zur Tür ging und diese einen Spalt öffnete.
Jems silberner Haarschopf schimmerte in der Dunkelheit des Flurs. Seine Jacke saß schief, und er wirkte ein wenig zerzaust. Verwundert spähte er durch den Türspalt, bis er Charlotte und Tessa halb versteckt hinter dem Schrank entdeckte und sich seine Miene aufhellte. »Gott sei Dank«, sagte er erleichtert. »Ich wusste nicht, wo ihr alle wart. Gabriel Lightwood ist unten in der Eingangshalle und veranstaltet einen furchtbaren Tumult.«
»Schreib ihnen, Will«, bat Cecily Herondale. »Bitte. Nur einen einzigen Brief.«
Will warf seine verschwitzten dunklen Haare in den Nacken und funkelte sie an. »Stell deine Füße auf die richtige Position«, befahl er statt einer Antwort und zeigte mit der Spitze seines Dolchs auf die entsprechenden Stellen: »Da und dort.«
Cecily seufzte und bewegte ihre Füße. Sie wusste, dass ihre Haltung nicht korrekt war – das hatte sie schließlich absichtlich getan, um Will zu ärgern. Ihr Bruder war leicht zu piesacken, daran erinnerte sie sich noch gut. Während ihrer gemeinsamen Kindheit hatte sie ihn mühelos zu allem Möglichen herausfordern können, beispielsweise auf das steile Dach ihres Herrenhauses zu klettern. Und sie hatte jedes Mal dieselbe Reaktion bekommen: ein wütendes Aufblitzen in Wills blauen Augen, ein angespannter, entschlossener Zug um die Mundwinkel … und gelegentlich ein gebrochenes Bein oder ein verrenkter Arm.
Natürlich war der fast erwachsene Will nicht der Bruder, an den sie sich erinnerte. Er schien sowohl aufbrausender als auch verschlossener als früher. Von ihrer Mutter hatte er das gute Aussehen geerbt und von ihrem Vater die Sturheit – und wahrscheinlich auch seinen Hang zur Maßlosigkeit, obwohl Cecily sich diese Vermutung nur aus geflüsterten Andeutungen der Institutsbewohner zusammengereimt hatte.
»Heb die Klinge an«, sagte Will. Seine Stimme klang so kühl und professionell wie die ihrer ehemaligen Gouvernante.
Cecily hob die Waffe. Sie hatte eine ganze Weile gebraucht, um sich an die Schattenjägermontur zu gewöhnen: die weite Hose, das locker geschnittene, tunikaähnliche Oberteil und der Gürtel um ihre Taille. Doch inzwischen bewegte sie sich darin so sicher wie in ihrem bequemsten Nachthemd. »Ich verstehe nicht, warum du noch nicht einmal darüber nachdenken willst, ihnen zu schreiben. Einen einzigen, kurzen Brief.«
»Und ich verstehe nicht, warum du nicht darüber nachdenken willst, nach Hause zu fahren«, entgegnete Will. »Wenn du wieder zurückgehen würdest, brauchtest du dir nicht länger Sorgen um unsere Eltern zu machen, und ich könnte …«
Da Cecily diese Litanei schon Hunderte Male gehört hatte, unterbrach sie ihren Bruder: »Was hältst du von einer Wette, Will?« Mit einer Mischung aus Freude und Enttäuschung sah sie, wie Wills Augen aufleuchteten, genau wie früher bei ihrem Vater, sobald man ihm eine Wette unter Gentlemen vorgeschlagen hatte. Männer waren doch so vorhersehbar!
»Welche Art von Wette schwebt dir vor?«, fragte Will und trat einen Schritt näher. Er trug seine Kampfmontur, und Cecily konnte die Runenmale an seinen Handgelenken und die Mnemosyne-Rune an seiner Kehle erkennen. Es hatte eine Weile gedauert, bis sie die Male nicht mehr als Hautverschandelung betrachtet hatte, aber inzwischen war sie daran ebenso gewöhnt wie an die Schattenjägerkluft und die großen, hallenden Flure und Säle des Instituts und dessen eigenartige Bewohner.
Cecily zeigte auf die Wand direkt vor ihnen, wo jemand vor langer Zeit mit schwarzer Farbe eine Zielscheibe aufgemalt hatte: ein schwarzes Zentrum, umgeben von einem größeren Kreis. »Wenn ich die Mitte dreimal hintereinander treffe, musst du einen Brief an Dad und Mam schreiben und ihnen sagen, wie es dir geht. Du musst ihnen von dem Fluch erzählen und ihnen erklären, warum du fortgegangen bist.«
Wills Gesichtszüge verschlossen sich wie eine Tür – wie jedes Mal, wenn sie diese Bitte an ihn richtete. Doch dann erwiderte er: »Das schaffst du im Leben nicht, Cecy.«
»Nun, in diesem Fall dürfte es dir ja nichts ausmachen, die Wette einzugehen, William.« Sie nannte ihn absichtlich bei seinem Geburtsnamen, weil sie wusste, dass es ihn ärgerte, wenn sie ihn so ansprach. Im Gegensatz zu seinem besten Freund – nein Parabatai … seit ihrer Ankunft im Institut hatte sie gelernt, dass das zwei völlig verschiedene Dinge waren. Wenn Jem ihn mit William anredete, schien ihr Bruder das als einen Kosenamen zu betrachten. Vielleicht erinnerte er sich aber auch nur an früher, wie sie ihm als kleines Kind auf ihren kurzen, stämmigen Beinchen überallhin gefolgt war und dabei laut Will, Will gekräht hatte. Sie hatte ihn nie »William« genannt, immer nur »Will« oder Gwilym, die walisische Variante.
Verärgert kniff Will die Augen zusammen, die dieselbe dunkelblaue Farbe hatten wie ihre eigenen. Jedes Mal, wenn ihre Mutter früher davon gesprochen hatte, dass Will sich eines Tages zu einem echten Herzensbrecher entwickeln würde, hatte Cecily sie zweifelnd angeschaut. Damals hatte ihr Bruder nur aus dünnen Armen und Beinen bestanden und immer völlig zerzaust und schmutzig ausgesehen. Doch inzwischen verstand sie, was ihre Mutter gemeint hatte; sie hatte es in dem Moment gesehen, als sie in den Speisesaal des Instituts gekommen war und er sich verwundert von seinem Stuhl erhoben hatte. In jenem Augenblick hatte sie gedacht: Das kann unmöglich Will sein.
Und dann hatte er diese Augen auf sie gerichtet, die Augen ihrer Mutter, und Cecily hatte den Zorn darin erkannt. Will war keineswegs erfreut gewesen, sie zu sehen. Und statt des hageren Jungen aus ihren Erinnerungen, mit den wirren schwarzen Haaren und der schmutzigen Kleidung, hatte dieser hochgewachsene, Furcht einflößende Mann vor ihr gestanden. Die Worte, die sie hatte sagen wollen, waren plötzlich wie aus ihrem Gedächtnis gelöscht, und sie hatte sich aufgerichtet und ihn ebenfalls angefunkelt. Und daran hatte sich bis zum heutigen Tage nichts geändert: Will duldete ihre Anwesenheit nur widerstrebend, als wäre sie ein Steinchen in seinem Schuh, ein kleines, aber beständiges Ärgernis.
Nun holte Cecily tief Luft, hob das Kinn und bereitete sich auf den ersten Messerwurf vor. Will wusste nichts von den vielen Stunden, die sie in diesem Fechtsaal verbracht hatte, und er würde auch nie davon erfahren. Wieder und wieder hatte sie trainiert und geübt, das Gewicht des Messers in der Hand auszubalancieren. Und dabei hatte sie gelernt, dass ein guter Messerwurf hinter dem Körper begann. Cecily ließ die Arme locker herabhängen, nahm dann den rechten Arm nach hinten, hinter ihren Kopf, bevor sie ihn mit Schwung nach vorn schnellen ließ und dabei ihr ganzes Gewicht in den Wurf legte. Als die Messerspitze sich in einer Linie mit dem Ziel befand, ließ sie die Waffe los, riss die Hand zurück und hielt die Luft an.
Das Messer bohrte sich mit der Spitze in die Wand, exakt in die Mitte der Zielscheibe.
»Eins«, sagte Cecily und schenkte Will ein überlegenes Lächeln.
Er musterte sie mit steinerner Miene, riss das Messer aus dem Holz und reichte es ihr.
Cecily warf erneut. Der zweite Wurf landete genau wie der erste im Zentrum der Scheibe, wo die Waffe wie ein spöttischer Zeigefinger leicht nachwippte.
»Zwei«, verkündete Cecily mit Grabesstimme.
Will presste die Kiefer aufeinander, während er das Messer ein weiteres Mal holte und ihr reichte. Lächelnd nahm sie es entgegen. Unerschütterliche Zuversicht strömte wie frisches Blut durch ihre Adern. Sie wusste, dass sie es schaffen konnte. Denn sie hatte schon immer genauso hoch klettern, genauso schnell laufen, genauso lange die Luft anhalten können wie Will …
Sie warf das Messer. Einen Sekundenbruchteil später bohrte es sich ins Ziel, und Cecily sprang in die Luft, klatschte in die Hände und vergaß im Siegestaumel einen Moment lang ihre guten Manieren. Ihre Haare lösten sich aus der Frisur und fielen ihr ins Gesicht; ungeduldig schob sie die Strähnen beiseite und wandte sich grinsend an ihren Bruder: »Du wirst diesen Brief schreiben. Du hast mit mir gewettet!«
Zu ihrer Überraschung lächelte Will. »Selbstverständlich werde ich den Brief schreiben«, sagte er. »Ich werde ihn schreiben und dann ins Feuer werfen.« Als Cecily empört protestierte, hielt er mahnend eine Hand hoch. »Ich habe gesagt, dass ich ihn schreiben würde. Aber von abschicken war nie die Rede.«
Entrüstet schnappte Cecily nach Luft. »Wie kannst du mich nur so hereinlegen?!«
»Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht zur Schattenjägerin geschaffen bist. Denn sonst hättest du dich nicht so leicht reinlegen lassen. Ich werde diesen Brief nicht schreiben, Cecy. Es verstößt gegen das Gesetz, und damit ist der Fall erledigt!«
»Als ob du dich jemals für das Gesetz interessiert hättest!« Wütend stampfte Cecily mit dem Fuß auf, was ihre Verärgerung nur noch steigerte: Sie verabscheute Mädchen, die auf den Boden stampften, wenn ihnen etwas nicht passte.
Will kniff die Augen zu Schlitzen. »Und du interessierst dich nicht dafür, eine Schattenjägerin zu sein. Was hältst du von folgendem Vorschlag: Ich werde einen Brief schreiben und dir geben, wenn du versprichst, ihn persönlich zu Hause abzuliefern – und niemals hierher zurückzukehren.«
Cecily zuckte zusammen. Natürlich erinnerte sie sich an zahlreiche Auseinandersetzungen mit Will, beispielsweise wegen ihrer Porzellanpuppen, die er aus einem Dachfenster hatte »fliegen« lassen. Aber sie hatte auch schöne Erinnerungen an einen liebevollen Bruder, der ihr das aufgeschlagene Knie verbunden oder ihre flatternden Seidenbänder wieder in die Haare geflochten hatte. Doch diese Liebenswürdigkeit fehlte dem Will, der nun vor ihr stand. Nach seiner Flucht aus dem Elternhaus hatte ihre Mutter die ersten Jahre viel geweint, Cecily an sich gedrückt und geklagt, dass die Schattenjäger »ihm jede Liebe nehmen« würden. Diese Leute sind »kalt«, hatte sie Cecily erzählt, kalt und herzlos. Sie hatten ihr verboten, ihren Mann zu heiraten, der Schattenjäger war. Was konnte er nur bei ihnen wollen, ihr Will, ihr Kleiner?
»Nein, ich werde nicht nach Hause zurückkehren«, entgegnete Cecily und erwiderte entschlossen seinen Blick. »Und wenn du weiter darauf bestehst, dann werde ich … dann werde ich …«
Die Tür des Fechtsaals schwang auf, und Jems Silhouette erschien im Rahmen. »Ah«, sagte er, »ihr seid inzwischen bei wüsten Drohungen angekommen. Verstehe. Geht das schon den ganzen Nachmittag so, oder habt ihr gerade erst angefangen?«
»Er hat angefangen«, knurrte Cecily und zeigte mit dem Kinn auf Will, obwohl sie genau wusste, dass das wenig Zweck hatte. Jem, Wills Parabatai, behandelte sie mit jener geistesabwesenden Liebenswürdigkeit, die den kleinen Schwestern der besten Freunde vorbehalten war, doch er würde immer zu Will halten. Auf freundliche, aber unerschütterliche Weise stellte er Will über alles andere in der Welt.
Nun ja, über fast alles andere … Bei ihrer Ankunft im Institut hatte ihr Jems Anblick zunächst den Atem verschlagen: Mit seinen silbernen Haaren und Augen und den feinen Zügen besaß er eine ungewöhnliche, fast überirdische Schönheit. Er wirkte auf sie wie ein Märchenprinz, und möglicherweise hätte Cecily sogar zärtliche Gefühle für ihn entwickeln können, wenn nicht der geringste Zweifel daran bestanden hätte, dass er bis über beide Ohren in Tessa Gray verliebt war. Er folgte ihr mit den Augen auf Schritt und Tritt, und seine Stimme nahm einen anderen Klang an, wenn er mit ihr sprach. Vor langer Zeit hatte Cecily einmal gehört, wie ihre Mutter in amüsiertem Ton über einen Nachbarsjungen gesagt hatte, er habe ein Mädchen auf eine Weise angesehen, als wäre sie »der einzige Stern am Firmament«. Genauso schaute Jem Tessa an.
Selbstverständlich nahm Cecily ihm das nicht übel: Tessa war ihr gegenüber freundlich und nett, wenn auch ein wenig zurückhaltend. Und sie hatte die Nase ständig in ein Buch gesteckt, genau wie Will. Wenn das die Sorte von Mädchen war, die Jem bevorzugte, dann hätten sie, Cecily, und er ohnehin nicht zusammengepasst. Und je länger sie im Institut lebte, desto deutlicher erkannte sie, wie schwierig eine derartige Verbindung die Beziehung zu ihrem Bruder gemacht hätte. Will zeigte Jem gegenüber einen wild entschlossenen Beschützerinstinkt und hätte sie mit Argusaugen beobachtet, damit sie ihn ja nicht aufregte oder irgendwie kränkte. Nein, nein, es war besser, sich aus dieser Geschichte herauszuhalten.
»Ich habe gerade darüber nachgedacht, mir Cecily zu schnappen, sie in den Hydepark zu schleppen und an die dortigen Enten zu verfüttern«, erwiderte Will, schob sich die dunklen Haare aus der Stirn und schenkte Jem eines seiner seltenen Lächeln. »Ich könnte etwas Hilfe dabei gebrauchen.«
»Bedauerlicherweise wirst du deine Pläne für einen Schwestermord wohl noch ein wenig aufschieben müssen. Gabriel Lightwood ist unten in der Eingangshalle, und ich sage nur zwei Worte … zwei deiner Lieblingsworte, zumindest wenn man sie kombiniert.«
»›Extremer Einfaltspinsel‹?«, fragte Will. »›Nichtswürdiger Emporkömmling‹«
Jem grinste. »›Dämonenpocken‹.«
Dank jahrelanger Übung balancierte Sophie das schwere Tablett mühelos mit einer Hand, während sie gleichzeitig an Gideon Lightwoods Zimmer klopfte. Sie hörte ein paar hastige Schritte, dann wurde die Tür aufgerissen.
Gideon stand in schwarzer Hose mit Hosenträgern und einem weißen Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln vor ihr. Seine Hände waren nass, genau wie seine Haare, als wäre er sich schnell mit angefeuchteten Fingern durch die Locken gefahren.
Sophies Herz machte einen kleinen Satz, bevor es sich wieder beruhigte, und sie zwang sich, eine missbilligende Miene zu ziehen. »Mr Lightwood«, sagte sie. »Hier sind die Scones, die Sie verlangt haben. Und Bridget hat Ihnen noch einen Teller mit Sandwiches heraufgeschickt.«
Gideon trat einen Schritt zurück, um sie in den Raum zu lassen. Das Zimmer war wie alle anderen Gästezimmer des Instituts ausgestattet: schwere dunkle Möbel, ein wuchtiges Pfostenbett, ein breiter Kamin und hohe Fenster, die in diesem Fall auf den Innenhof zwei Stockwerke tiefer hinausgingen. Sophie spürte Gideons Blick auf sich, während sie das Tablett auf dem Tisch beim knisternden Feuer abstellte. Sie richtete sich auf, wandte sich ihm zu und faltete die Hände vor ihrer Schürze.
»Sophie …«, setzte er an.
»Mr Lightwood«, unterbrach sie ihn. »Gibt es sonst noch irgendetwas, das Sie wünschen?«
Gideon schaute sie teils aufgebracht, teils wehmütig an. »Ich wünschte, Sie würden mich Gideon nennen.«
»Das habe ich Ihnen doch schon erklärt: Ich kann Sie nicht mit Ihrem Taufnamen ansprechen.«
»Ich bin ein Schattenjäger; ich habe keinen Taufnamen. Sophie, bitte.« Vorsichtig trat er einen Schritt auf sie zu. »Bevor ich hierhergezogen bin, dachte ich, wir könnten so etwas wie Freunde werden. Doch seit dem Tag meiner Ankunft im Institut zeigen Sie mir nur noch die kalte Schulter.«
Unwillkürlich griff Sophie sich an die Wange. Sie erinnerte sich an den jungen Herrn Teddy, den Sohn ihrer früheren Herrschaften. Und daran, wie er sie immer in irgendwelche dunklen Ecken gezerrt und gegen die Wand gepresst hatte, wie seine schrecklichen Hände über ihr Mieder gestrichen waren und er ihr ins Ohr gemurmelt hatte, sie solle lieber freundlich zu ihm sein, wenn ihr etwas an ihrer Stelle läge. Der Gedanke bereitete ihr Übelkeit, selbst jetzt, nach all den Jahren.
»Sophie.« Gideon musterte sie besorgt. »Was ist los? Falls ich irgendetwas getan habe, um Ihren Unmut zu erregen … ein falsches Wort oder sonst irgendetwas … bitte sagen Sie es mir, damit ich es wiedergutmachen kann.«
»Nein, Sie haben nichts falsch gemacht. Aber Sie sind ein Gentleman, und ich bin ein Dienstmädchen. Und alles, was darüber hinausginge, wäre eine zu große Vertraulichkeit. Bitte bringen Sie mich nicht in eine solche Situation, Mr Lightwood.«
Gideon, der seine Hand angehoben hatte, ließ sie entmutigt sinken.
Er wirkte so kläglich, dass Sophie das Herz schmolz. Ich könnte alles verlieren, wenn ich mich darauf einlasse … Und was hat er schon zu verlieren? Nichts, ermahnte sie sich. Diese Worte wiederholte sie fast gebetsmühlenartig jede Nacht, wenn sie allein in ihrem kleinen Zimmer lag und seine sturmgrünen Augen vor sich sah.
»Ich dachte, wir wären Freunde«, sagte Gideon.
»Ich kann nicht mit Ihnen befreundet sein.«
Zögernd trat er einen Schritt vor. »Und was wäre, wenn ich Sie fragen würde, ob …«
»Gideon!« Henry stand atemlos in der offenen Tür. Er trug eine seiner schrecklichen grün-orange gestreiften Westen. »Dein Bruder ist hier. Unten …«
Überrascht riss Gideon die Augen auf. »Gabriel ist hier im Institut?«
»Ja. Und er brüllt die ganze Zeit … irgendetwas über deinen Vater. Aber er will uns nichts Genaueres sagen, jedenfalls nicht, solange du nicht da bist. Also komm.«
Gideon zögerte; sein Blick wanderte von Henry zu Sophie, die sich unsichtbar zu machen versuchte. »Ich.«
»Du musst sofort kommen, Gideon.« Henry wurde nur selten laut, aber wenn, dann mit erstaunlicher Wirkung. »Gabriel ist von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt.«
Gideon wurde blass. Er griff nach seinem Schwert, das an einem Haken hinter der Tür hing. »Bin schon unterwegs.«
Gabriel Lightwood lehnte an der Wand in der Eingangshalle; er trug keine Jacke, und sein Hemd und seine Hose waren blutgetränkt. Durch die weit geöffnete Eingangstür konnte Tessa die Kutsche der Familie Lightwood mit dem flammenartigen Wappen sehen. Sie stand direkt vor der Treppe; Gabriel musste sie selbst hierhergelenkt haben.
»Gabriel«, sagte Charlotte in ruhigem Ton, als wollte sie ein wild gewordenes Pferd besänftigen. »Gabriel, bitte sag uns, was passiert ist.«
Der junge Lightwood – groß und schlank und mit blutverklebten braunen Haaren – rieb sich gehetzt mit den Händen, die ebenfalls rot leuchteten, übers Gesicht. »Wo ist mein Bruder? Ich muss unbedingt mit meinem Bruder sprechen.«
»Er wird gleich hier sein. Ich habe Henry losgeschickt, um ihn zu holen, und Cyril beauftragt, die Institutskutsche bereit zu machen. Gabriel, bist du verwundet? Brauchst du eine Iratze?« Charlotte klang besorgt und mütterlich – als hätte dieser Junge nicht versucht, sie zu demütigen, damals in Benedict Lightwoods Bibliothek, und als hätte er sich nie mit seinem Vater gegen sie verschworen, um ihr die Leitung des Instituts zu entreißen.
»Das ist ziemlich viel Blut«, bemerkte Tessa und schob sich an Charlotte vorbei. »Gabriel, das stammt nicht alles von dir, oder?«
Gabriel schaute sie an. Es war das erste Mal, dass er keine arrogante Pose einnahm, überlegte Tessa. In seinen Augen war nur benommene Furcht – Furcht und Verwirrung. »Nein … das Blut stammt von ihnen …«
»Ihnen? Wen meinst du?« Gideon stürmte die Treppe hinunter, das Schwert in der rechten Hand. Neben ihm liefen Henry und Jem, dicht gefolgt von Will und Cecily.
Abrupt blieb Jem stehen, und Tessa erkannte, dass er ihr Brautkleid sah. Er schaute sie aus großen, runden Augen an, doch die anderen drängten bereits an ihm vorbei, und er wurde von ihnen mitgerissen, wie ein Blatt in der Strömung.
»Ist Vater etwas zugestoßen?«, fragte Gideon aufgeregt, als er seinen Bruder erreichte. »Bist du verwundet?« Besorgt umfasste er Gabriels Kinn und drehte es zu sich.
Obwohl Gabriel größer war, sprach aus seinem Blick eindeutig der jüngere Bruder: eine Mischung aus Erleichterung darüber, dass sein großer Bruder da war, und einem Anflug von Unmut über dessen gebieterischen Ton. »Vater …«, setzte Gabriel an. »Vater ist ein Wurm.«
Will stieß ein kurzes Lachen aus. Er trug seine Montur, als käme er direkt aus dem Fechtsaal, und seine Haare klebten feucht an den Schläfen. Er vermied jeden Blickkontakt mit Tessa, doch daran war sie inzwischen gewöhnt. Will schaute sie kaum noch an, es sei denn, es ließ sich nicht vermeiden. »Wie schön, dass du unsere Sichtweise teilst, Gabriel, aber das ist nun wirklich eine äußerst ungewöhnliche Art und Weise, dies mitzuteilen.«
Gideon warf Will einen tadelnden Blick zu, ehe er sich wieder seinem Bruder zuwandte. »Was meinst du damit, Gabriel? Was hat Vater getan?«
Doch Gabriel schüttelte nur den Kopf. »Er ist ein Wurm«, wiederholte er tonlos.
»Ich weiß. Er hat Schande über den Namen der Familie Lightwood gebracht und uns beide belogen. Er hat unserer Mutter das Leben schwer gemacht und sie zugrunde gerichtet. Aber wir müssen nicht notwendigerweise so werden wie er.«
Gabriel riss sich von seinem Bruder los und schaute ihn finster an. »Du hörst mir nicht zu«, knurrte er. »Vater ist ein Wurm. Ein Wurm. Ein verdammt großes, schlangenartiges Wesen. Seit Mortmain die Arzneilieferungen eingestellt hat, geht es ihm immer schlechter. Er verändert sich. Diese Geschwüre auf seinen Armen … sie haben sich inzwischen auf seinem ganzen Körper ausgebreitet. An seinen Händen, am Hals und … auf seinem Gesicht …« Gabriels grüne Augen suchten Will. »Alles Anzeichen für Dämonenpocken, stimmt’s? Du weißt doch alles darüber, oder? Bist du nicht eine Art Experte auf dem Gebiet?«
»Na ja, aber du brauchst nicht so zu tun, als hätte ich die Krankheit erfunden. Nur weil ich an ihre Existenz geglaubt habe«, erwiderte Will. »Es gibt zahlreiche Belege dafür … alte Berichte in der Bibliothek …«
»Dämonenpocken?«, Cecily war verwirrt. »Will, wovon redet er?«
Will öffnete den Mund, und eine leichte Röte zeichnete sich auf seinen Wangen ab. Tessa unterdrückte ein Lächeln. Cecily lebte nun schon seit Wochen im Institut, aber ihre Anwesenheit störte und ärgerte Will noch immer. Er schien nicht zu wissen, wie er sich gegenüber seiner jüngeren Schwester verhalten sollte, die nicht mehr das kleine Mädchen aus seiner Kindheit war und deren Gegenwart ihm nicht gefiel. Und dennoch hatte Tessa selbst gesehen, wie er Cecily nicht aus den Augen gelassen, wie er jeden ihrer Schritte beobachtet hatte, mit demselben liebevollen Beschützerinstinkt, mit dem er manchmal auch Jem bedachte. Die Existenz von Dämonenpocken und der genaue Infektionsweg zählten bestimmt nicht zu den Dingen, die er Cecily gern erklären wollte. »Das ist nichts, was dich interessieren müsste«, murmelte er.
Gabriel schaute zu Cecily und öffnete überrascht den Mund. Tessa konnte sehen, wie er sie von Kopf bis Fuß betrachtete. Wills Eltern mussten sehr attraktiv gewesen sein, dachte Tessa, denn Cecily war mindestens so gut aussehend wie Will – die gleichen glänzenden schwarzen Haare und tiefblauen Augen.
Cecily erwiderte Gabriels Blick und musterte ihn neugierig; vermutlich fragte sie sich, wer dieser junge Mann war, der ihren Bruder offenbar überhaupt nicht mochte.
»Ist Vater tot?«, fragte Gideon mit erhobener Stimme. »Haben die Dämonenpocken ihn umgebracht?«
»Nicht umgebracht«, erklärte Gabriel. »Verändert. Vor ein paar Wochen hat er unseren gesamten Hausstand nach Chiswick verlegt. Ohne erkennbaren Grund. Und dann, vor wenigen Tagen, hat er sich in seinem Studierzimmer eingeschlossen. Er hat sich geweigert herauszukommen … wollte den Raum nicht einmal zu den Mahlzeiten verlassen. Heute Morgen bin ich erneut zu ihm gegangen. Aber als ich dort ankam, war die Tür aus den Angeln gerissen. Und auf dem Boden war eine … eine Schleimspur, die aus dem Zimmer und durch den Korridor führte. Ich folgte der Spur die Treppen hinunter und hinaus in den Garten.« Gabriel schaute in die Gesichter der verstummten Institutsbewohner. »Er hat sich in einen Wurm verwandelt. Das versuche ich ja die ganze Zeit zu sagen.«
»Ich nehme nicht an, dass die Möglichkeit bestünde … ihn, äh, zu zertreten?«, fragte Henry in die Stille hinein.
Gabriel musterte ihn angewidert. »Ich hab den ganzen Garten durchsucht. Und dabei habe ich einen Teil unserer Dienstboten gefunden. Und wenn ich sage ›Ich habe einen Teil gefunden‹, dann meine ich das wortwörtlich. Sie waren in … in Stücke gerissen worden.« Er schluckte und schaute auf seine blutverschmierte Kleidung hinab. »Und dann hörte ich ein Geräusch – ein hohes, heulendes Geräusch. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie er auf mich zukam. Ein riesiger Lindwurm, wie ein Drache aus uralten Sagen. Mit weit aufgerissenem Maul, in dem messerscharfe Zähne aufblitzten. Ich hab auf dem Absatz kehrtgemacht und bin zum Stall gerannt. Der Wurm ist mir schlängelnd gefolgt, aber ich konnte auf die Kutsche springen und sie durch das Eingangstor lenken. Dieses Wesen – Vater – ist mir nicht gefolgt. Ich glaube, es fürchtet sich davor, in der Öffentlichkeit gesehen zu werden.«
»Aha«, meinte Henry. »Dann ist es also zu groß, um zertreten zu werden.«
»Ich hätte nicht davonlaufen sollen«, sagte Gabriel, den Blick auf seinen Bruder geheftet. »Ich hätte bleiben und gegen dieses Wesen kämpfen sollen. Vielleicht hätte es ja mit sich reden lassen. Vielleicht steckt Vater noch irgendwo da drin.«
»Vielleicht hätte es dich aber auch in der Luft zerfetzt«, wandte Will ein. »Deine Beschreibung … diese Verwandlung in einen Dämon … kennzeichnet das Endstadium von Dämonenpocken.«
»Will!« Bestürzt rang Charlotte die Hände. »Warum hast du das denn nicht gesagt?«
»Nun ja, die Bücher zum Thema Dämonenpocken stehen in der Bibliothek«, erwiderte Will leicht gekränkt. »Ich habe niemanden daran gehindert, sie zu lesen.«
»Ja sicher, aber wenn Benedict sich in ein gewaltiges Schlangenwesen verwandelt, sollte man doch annehmen, dass du das zumindest hättest erwähnen können«, entgegnete Charlotte. »Als eine Angelegenheit von allgemeinem Interesse sozusagen.«
»Erstens habe ich nicht gewusst, dass er sich in einen gewaltigen Wurm verwandeln würde«, konterte Will. »Das Endstadium von Dämonenpocken äußert sich in der Verwandlung zu einem Dämon. Aber es hätte auch jede andere Art von Dämon sein können. Und zweitens dauert es Wochen, bis der Umwandlungsprozess abgeschlossen ist. Ich hätte gedacht, dass selbst ein behördlich anerkannter Idiot wie Gabriel davon Notiz genommen und jemanden benachrichtigt hätte.«
»Benachrichtigt? Wen denn?«, fragte Jem nicht ganz unberechtigt. Er war im Laufe des Gesprächs näher an Tessa herangetreten, und ihre Hände hatten einander kurz gestreift, als sie nebeneinanderstanden.
»Den Rat. Den Postboten. Uns. Irgendjemanden«, erwiderte Will und warf Gabriel einen verärgerten Blick zu, der inzwischen wieder etwas Farbe im Gesicht hatte und Will wütend anfunkelte.
»Ich bin kein behördlich anerkannter Idiot …«
»Der Mangel einer offiziellen Bescheinigung ist noch lange kein Zeichen von Intelligenz«, murmelte Will.
»Wie ich bereits sagte, hat Vater sich während der vergangenen Wochen in seinem Zimmer eingeschlossen …«
»Und das kam dir nicht komisch vor?«, fragte Will.
»Du kennst unseren Vater nicht«, sagte Gideon mit ausdrucksloser Stimme – ein Tonfall, auf den er manchmal zurückgriff, wenn sich ein Gespräch über seine Familie nicht umgehen ließ. Dann wandte er sich wieder seinem Bruder zu, legte ihm die Hände auf die Schultern und redete so leise auf ihn ein, dass die anderen seine Worte nicht verstehen konnten.
Jem, der noch immer neben Tessa stand, verschränkte seinen kleinen Finger mit Tessas. Eine liebevolle Geste, an die Tessa sich im Lauf der vergangenen Monate so sehr gewöhnt hatte, dass sie manchmal unbewusst die Hand ausstreckte, sobald sie Jem neben sich spürte. »Ist das dein Brautkleid?«, fragte er leise.
Tessa blieb eine Antwort erspart, da Bridget mit Schattenjägermonturen auf dem Arm in der Eingangshalle erschien und Gideon sich plötzlich wieder an die anderen Anwesenden wandte: »Chiswick. Wir müssen sofort los. Zumindest Gabriel und ich, falls sonst niemand mitkommt.«
»Ihr beide allein?«, platzte Tessa bestürzt heraus. »Warum wollt ihr denn keine Unterstützung anfordern …?«
»Der Rat …«, bemerkte Will, dessen blaue Augen funkelten. »Er will nicht, dass der Rat von seinem Vater erfährt.«
»Würdest du das denn wollen?«, schnaubte Gabriel hitzig. »Wenn es um deine Familie ginge?« Verächtlich verzog er den Mund. »Ach, vergiss es! Es ist ja nicht so, als ob du wüsstest, was Treue bedeutet …«
»Gabriel!«, ermahnte Gideon seinen Bruder scharf. »Sprich nicht in diesem Ton mit Will.«
Verwundert starrte Gabriel Gideon an, was Tessa ihm kaum zum Vorwurf machen konnte. Gideon wusste von Wills Fluch, von seiner Überzeugung, die für seine feindselige Haltung und seine schroffen Manieren verantwortlich war. Alle im Institut wussten davon, aber sie behandelten es als Privatsache und hatten niemanden außerhalb des Instituts eingeweiht.
»Wir werden euch begleiten. Selbstverständlich werden wir euch begleiten«, sagte Jem, gab Tessas Hand frei und trat einen Schritt vor. »Gideon hat uns einen Dienst erwiesen. Und das haben wir nicht vergessen, nicht wahr, Charlotte?«
»Natürlich nicht«, bestätigte Charlotte und drehte sich zu dem Dienstmädchen um. »Bridget, die Kampfmonturen …«
»Praktischerweise trage ich meine Montur bereits«, bemerkte Will, während Henry seinen Gehrock abstreifte und gegen eine Schattenjägerjacke und einen Waffengurt tauschte. Jem folgte seinem Beispiel, und plötzlich herrschte in der Eingangshalle hektische Betriebsamkeit: Charlotte wechselte leise ein paar Worte mit Henry, eine Hand schützend auf ihren Bauch gelegt. Tessa wandte den Blick ab, um den beiden einen Moment für sich zu gönnen, und sah dann, wie sich ein heller Haarschopf über einen dunklen beugte. Jem stand mit gezückter Stele neben Will und trug ihm ein Runenmal auf den Hals auf, während Cecily ihren Bruder mit finsterer Miene musterte.
»Auch ich trage praktischerweise bereits eine Kampfmontur«, verkündete sie.
Ruckartig riss Will den Kopf hoch, was Jem ein verärgertes Schnauben entlockte. »Kommt überhaupt nicht infrage, Cecily!«, teilte Will seiner Schwester knapp mit.
»Du hast kein Recht, darüber zu entscheiden.« Cecilys Augen blitzten. »Und ich werde mitkommen.«
Wütend drehte Will den Kopf zu Henry, der entschuldigend die Achseln zuckte. »Sie hat das Recht dazu. Schließlich hat sie die vergangenen zwei Monate hart trainiert …«
»Sie ist doch noch ein kleines Mädchen!«
»Du warst mit fünfzehn auch nicht anders«, bemerkte Jem leise, woraufhin Will wieder zu ihm herumwirbelte. Einen Moment lang schienen alle den Atem anzuhalten, sogar Gabriel. Jem erwiderte Wills Blick ruhig, und nicht zum ersten Mal hatte Tessa den Eindruck, als fände zwischen ihnen ein stummer Dialog statt.
Schließlich seufzte Will und ließ den Kopf leicht sinken. »Als Nächstes will Tessa ebenfalls mitkommen.«
»Selbstverständlich komme ich mit«, sagte Tessa. »Ich mag zwar keine Schattenjägerin sein, aber auch ich habe hart trainiert. Jem wird nicht ohne mich aufbrechen.«
»Du trägst doch noch dein Brautkleid«, protestierte Will.
»Nun ja, jetzt, da ihr alle es gesehen habt, kann ich es unmöglich zur Hochzeit tragen«, erklärte Tessa. »Schließlich bringt das Unglück.«
Will stöhnte irgendetwas auf Walisisch – unverständliche Worte, doch eindeutig im Ton eines Mannes geäußert, der sich geschlagen gibt. Jem schenkte Tessa ein kleines besorgtes Lächeln. Im selben Moment schwang die Institutstür auf und tauchte die Eingangshalle in strahlend helles Herbstlicht.
Cyril stand atemlos auf der Schwelle. »Die zweite Kutsche ist jetzt auch bereit«, verkündete er. »Wer kommt nun alles mit?«
Adressat: Konsul Josiah Wayland
Absender: Die Kongregation
Verehrter Konsul,
wie Ihnen zweifellos bekannt ist, neigt sich Ihre Amtszeit als Konsul nach zehn Jahren nun ihrem Ende entgegen. Es wird Zeit, einen Nachfolger zu bestimmen.
Was uns betrifft, so ziehen wir es ernsthaft in Erwägung, Charlotte Branwell, geborene Fairchild, für diese Position zu benennen. Als Leiterin des Londoner Instituts hat sie hervorragende Dienste geleistet, und wir gehen davon aus, dass sie Ihre Zustimmung besitzt, da sie schließlich von Ihnen nach dem Tod ihres Vaters auf diesen Posten berufen wurde.
Da wir größten Wert auf Ihre geschätzte Meinung legen, würden wir es begrüßen, wenn Sie uns Ihre diesbezüglichen Ansichten mitteilen könnten.
Mit vorzüglichster Hochachtung
Victor Whitelaw, Inquisitor, im Namen der Kongregation
2 Der Eroberer Wurm
Von Tollheit und Sünde gewürzt,Dahinter sich lauter Elend und GrausZum verworrenen Knoten schürzt.
Edgar Allan Poe, »Der Eroberer Wurm«
Als die Institutskutsche durch das Tor zum Lightwood House in Chiswick ratterte, konnte Tessa die Schönheit des Anwesens in Ruhe bewundern – was bei ihrem ersten Besuch mitten in der Nacht nicht möglich gewesen war. Ein langer, von Bäumen gesäumter Kiesweg führte zu einem imposanten weißen Gebäude mit einer kreisförmigen Auffahrt. Mit seinen klaren, symmetrischen Linien und hoch aufragenden Säulen besaß das Haus große Ähnlichkeit mit Skizzen, die Tessa einmal von antiken griechischen und römischen Tempeln gesehen hatte. Eine Kutsche stand vor der Eingangstreppe.
Sorgfältig gepflegte Kieswege schlängelten sich durch ein Labyrinth von Gärten, die selbst zu dieser kühlen Jahreszeit in leuchtenden Herbstfarben erstrahlten – spät blühende rote Rosen und Winterastern in warmen Orange-, Gelb- und Goldtönen.
Als Henry die Kutsche zum Stehen gebracht hatte, kletterte Tessa mit Jems Hilfe die Stufen hinunter. Nun hörte sie Wasser plätschern: vermutlich ein Bach, den man umgeleitet hatte, damit er durch die Gartenanlage strömte. Dieses Anwesen war so schön, dass Tessa es kaum mit dem Ort in Verbindung bringen konnte, an dem Benedict seinen schrecklichen Ball gegeben hatte – obwohl sie den Pfad wiedererkannte, den sie an jenem Abend genommen hatte. Er führte um das Haus herum zu einem Gebäudeteil, der den Eindruck erweckte, als habe man ihn erst kürzlich dort angebaut …
Hinter Tessa rollte die Equipage der Familie Lightwood vor, mit Gideon auf dem Kutschbock. Sekunden später drängten Gabriel, Will und Cecily gleichzeitig aus der Kutsche, während Gideon von seinem erhöhten Sitz kletterte. Die Geschwister Herondale stritten noch immer miteinander, und Will unterstrich seine Argumente mit weit ausholenden Gesten, wohingegen Cecily ihn nur finster musterte. Ihr wütender Gesichtsausdruck verlieh ihr eine so große Ähnlichkeit mit ihrem Bruder, dass Tessa unter anderen Umständen darüber gelacht hätte.
Gideon, der noch blasser wirkte als zuvor, drehte sich mit gezückter Klinge im Kreis. »Tatianas Kutsche«, sagte er knapp, als Jem und Tessa auf ihn zukamen, und zeigte auf das Fuhrwerk vor der Eingangstreppe, dessen Schläge weit geöffnet waren. »Sie muss spontan zu einem Besuch hergekommen sein …«
»Ausgerechnet heute!« Gabriel klang wütend, aber in seinen Augen stand große Sorge. Tatiana war ihre Schwester und hatte vor Kurzem geheiratet. Das schildförmige Zeichen auf dem Kutschschlag, ein Dornenkranz, musste das Familienwappen ihres Mannes sein, überlegte Tessa. Schweigend schauten sie und die anderen zu, wie Gabriel zur Kutsche ging und einen langen Säbel aus dem Gürtel zog. Vorsichtig spähte er durch die Tür und fluchte dann laut. »An den Sitzen klebt Blut«, wandte er sich an Gideon. »Und … dieses Zeugs hier.« Er stocherte mit der Säbelspitze an einem der Räder herum. Als er die Klinge zurückzog, baumelte ein langer, übel riechender Schleimfaden daran herab.
Will zückte sein Seraphschwert und rief: »Eremiel!« Sofort leuchtete die Klinge weiß auf wie ein heller Stern im herbstlichen Licht. Will zeigte zuerst nach Norden und dann nach Süden. »Die Gärten umgeben das gesamte Gebäude und erstrecken sich bis hinunter zum Fluss«, erklärte er. »Vor nicht allzu langer Zeit habe ich den Dämon Marbas durch jeden Winkel des Anwesens gejagt. Benedict muss hier irgendwo sein, denn ich glaube kaum, dass er das Gelände verlassen hat. Das Risiko, gesehen zu werden, ist einfach zu groß.«
»Wir übernehmen den Westflügel, und ihr kümmert euch um den östlichen Teil«, sagte Gabriel. »Ruft, wenn ihr irgendetwas Ungewöhnliches seht; dann kommen wir sofort zu euch.« Entschlossen wischte er seine Klinge im Gras neben der Kiesauffahrt sauber und folgte seinem Bruder um das Gebäude herum.
Will wandte sich in die andere Richtung, dicht gefolgt von Jem. Cecily und Tessa bildeten die Nachhut. An der Hausecke hielt Will kurz inne und sondierte den Garten auf ungewöhnliche Anzeichen oder Geräusche. Einen Augenblick später bedeutete er den anderen, ihm zu folgen.
Während sie sich leise vorwärtsbewegten, blieb Tessa mit einem Absatz im Kies stecken, der überall unter den Hecken lag. Sie strauchelte kurz, richtete sich aber sofort wieder auf.
Doch Will warf ihr über die Schulter einen finsteren Blick zu und knurrte: »Tessa!«
Es hatte einmal eine Zeit gegeben, in der er sie Tess genannt hatte, doch das war wohl endgültig vorbei, dachte Tessa.
»Du solltest nicht hier sein«, fuhr er fort. »Du bist auf einen Kampf überhaupt nicht vorbereitet. Warte wenigstens in der Kutsche.«
»Nein, das werde ich nicht«, erwiderte Tessa trotzig.
Verärgert wandte Will sich an Jem, der ein Lächeln zu unterdrücken versuchte: »Tessa ist deine Verlobte. Bring du sie gefälligst zur Vernunft.«
Jem, der seinen Stockdegen gezückt hatte, lief ein paar Schritte über den Kies auf sie zu. »Tessa, bitte tu es mir zuliebe.«
»Du glaubst, dass ich nicht kämpfen kann …«, entgegnete Tessa und erwiderte seinen Blick mit erhobenem Kopf, »… weil ich ein Mädchen bin.«
»Ich glaube, dass du nicht kämpfen kannst, weil du ein Brautkleid trägst«, erklärte Jem. »Und wenn du mich fragst, wäre selbst Will nicht in der Lage, in diesem Kleid vernünftig zu kämpfen.«
»Möglicherweise nicht kämpfen«, kommentierte Will, der Ohren hatte wie eine Fledermaus, »aber ich würde eine strahlende Braut abgeben.«
Plötzlich zeigte Cecily in die Ferne. »Was ist das da?«
Die drei anderen wirbelten herum und sahen, dass eine Gestalt auf sie zustürmte. Da die Sonne schon tief stand, war Tessa einen Moment geblendet und konnte nicht viel erkennen. Doch schon bald verwandelte sich das verschwommene Bild in eine junge Frau, die in ihre Richtung lief. Sie hatte ihren Hut verloren; ihre hellen Haare wehten im Wind. Als sie näher kam, sah Tessa, dass sie groß und hager war und ein leuchtend rosafarbenes Kostüm trug, das einmal sehr elegant gewesen sein musste. Jetzt aber hing es zerfetzt und blutgetränkt an ihr herab. Hysterisch kreischend warf sie sich Will in die Arme.
Will taumelte rückwärts und hätte beinahe sein Schwert fallen lassen. »Tatiana …«
Tessa vermochte nicht zu sagen, ob Will die junge Frau wegschob oder ob sie sich aus eigenem Antrieb zurückzog. Jedenfalls löste sie sich ein paar Zentimeter von Will, sodass Tessa zum ersten Mal ihr schmales, kantiges Gesicht sehen konnte. Sie hatte die gleichen rotblonden Haare wie Gideon, die gleichen leuchtend grünen Augen wie Gabriel und hätte eigentlich hübsch sein können, wäre da nicht dieser verkniffene Ausdruck ständiger Missbilligung in ihrem Gesicht gewesen. Und trotz der Tränen, die ihr über die Wangen strömten, hatte sie etwas Theatralisches an sich, als wüsste sie ganz genau, dass alle Augen auf sie gerichtet waren – vor allem Wills.
»Eine riesige Kreatur«, wimmerte sie. »Ein Monster … es hat den armen Rupert aus der Kutsche gerissen und sich mit ihm davongemacht!«
Will schob Tatiana noch weiter von sich fort. »Was meinst du mit ›Es hat sich mit ihm davongemacht‹?«
Tatiana zeigte in die Ferne. »D-dort hinten!«, schluchzte sie. »Das Monster hat ihn in den italienischen Garten gezerrt. Zunächst konnte Rupert seinem Biss entkommen, aber dann hat es ihn verfolgt. Und sosehr ich auch geschrien habe, es hat meinen armen Liebling einfach nicht l-losgelassen!« Erneut brach sie in Tränen aus.
»Du hast geschrien«, stellte Will kühl fest. »War das alles? Oder hast du sonst noch etwas getan?«
»Ich habe sehr viel geschrien«, erwiderte Tatiana gekränkt, löste sich dann vollständig aus Wills Griff und funkelte ihn aus ihren grünen Augen an. »Wie ich sehe, bist du so kleinlich wie eh und je.« Dann schaute sie an Tessa vorbei zu Jem. »Mister Carstairs«, sagte sie förmlich, als wären sie auf einer Gartenparty. Als ihr Blick an Cecily hängen blieb, kniff sie die Augen zu Schlitzen. »Und du musst …«
»Ach, beim Erzengel!« Genervt schob Will sich an ihr vorbei, woraufhin Jem Tessa ein kurzes Lächeln schenkte und ihm dann folgte.
»Du kannst niemand anderes als Wills Schwester sein«, wandte Tatiana sich aufgeregt an Cecily, während Will und Jem in der Ferne verschwanden. Tessa hingegen ignorierte sie demonstrativ.
Cecily starrte sie ungläubig an. »Das bin ich. Allerdings wüsste ich nicht, was das ausgerechnet jetzt für eine Rolle spielt. Tessa … kommst du mit?«
»Natürlich«, sagte Tessa und folgte ihr. Ob es Will – oder Jem – nun gefiel oder nicht: Sie würde nicht tatenlos zusehen, wie die beiden sich in Gefahr begaben. Sie wollte bei ihnen sein. Nach einem Moment hörte sie Tatianas zögerliche Schritte auf dem Kiesweg hinter sich.
Sie entfernten sich nun vom Haus und liefen leise in Richtung des italienischen Gartens, der halb versteckt hinter einer hohen Hecke lag. In der Ferne spiegelte sich ein Sonnenstrahl auf der Glasfläche einer Orangerie mit Kuppeldach. Es war ein wunderschöner Herbsttag, mit einer frischen Brise, die den Duft von feuchtem Laub herantrug. Tessa hörte ein Rascheln und warf einen Blick über die Schulter zum Haus. Die glatte weiße Fassade ragte hoch hinter ihr auf, nur durchbrochen von geschwungenen Balkonen.
»Will«, wisperte sie, als er die Arme hob und ihre Hände sanft von seinem Nacken löste.
Langsam streifte er Tessas Handschuhe ab, die kurz darauf neben der Maske und den Haarnadeln auf dem Boden landeten. Dann nahm er seine eigene Maske ab, warf sie beiseite, fuhr sich mit den Händen durch die feuchten schwarzen Haare und schob sie sich aus der Stirn. Die untere Kante der Maske hatte leichte Vertiefungen auf seinen Wangen hinterlassen, wie helle Narben. Doch als Tessa die Rillen berühren wollte, fing er ihre Hände sanft ab. »Nein, nicht… Bitte lass mich dich zuerst berühren«, raunte er. »Ich habe mich so lange danach gesehnt …«
Eine heiße Röte stieg Tessa in die Wangen, und sie wandte sich vom Haus und den damit verbundenen Erinnerungen ab. Inzwischen hatte die kleine Gruppe eine Lücke in der Hecke erreicht. Durch diese Öffnung war der italienische Garten deutlich zu sehen, umgeben von weiteren Sträuchern und Bäumen. Im Zentrum der halbkreisförmigen Gartenanlage befand sich ein Springbrunnen, in den eine Statue der Göttin Venus Wasser goss. Weitere Statuen säumten die Wege, die strahlenförmig vom Zentrum abgingen: berühmte Politiker und Geschichtsschreiber der Antike wie Caesar, Herodot oder Thukydides, aber auch Dichter und Dramatiker wie Aristoteles, Ovid und Homer. Tessa hastete gerade an den Statuen von Vergil und Sophokles vorbei, als ein markerschütternder Schrei die Stille zerriss.