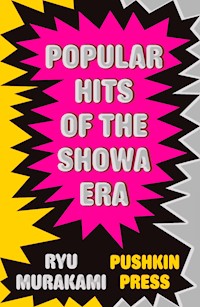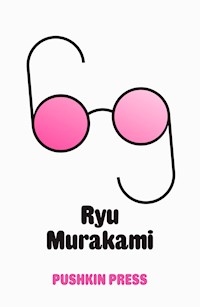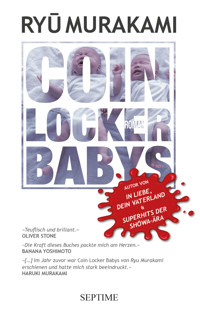
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Hashi und Kiku wurden nach ihrer Geburt in Münzschließfächern zurückgelassen. Die beiden Jungs verbringen ihre Jugend zunächst im Waisenhaus und später bei Pflegeeltern auf einer verlassenen Insel, bevor sie schließlich in die Stadt ziehen, um die Frauen, die sie wegegeben hatten, zu finden und zu vernichten. Gemeinsam oder getrennt ist ihre Reise vom Münzschließfach zu einem atemberaubenden, wilden Höhepunkt eine Achterbahnfahrt durch die unheimliche Landschaft eines Japan im späten zwanzigsten Jahrhundert. Nachdem sie ihre Zieheltern verlassen hatten zieht es beide ins Giftghetto, eine von Freaks und Strichern belebte Gegend. Während sich Hashi zu einem bisexuellen Rocksänger entwickelt, Star in dieser exotischen Halbwelt, sucht Kiku, seine Rache in Gesellschaft seiner Freundin, einem Modell, die ihre Wohnung in einen tropischen Sumpf für ihr Krokodil umgewandelt hat. Doch die Rachepläne die Kiku verolgt gehen weiter als blos seine Mutter zu finden … "Coin Locker Babys" nennt man in öffentliche Schließfächer abgelegte Neugeborene. Diese Praxis findet man häufig in Japan oder China vor. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass ein Baby dies überlebt. Coin Locker Babys ist eine surreale Coming-of-Age-Geschichte in einem Japan der nahen Zukunft, die Ryu Murakami als einen der einfallsreichsten Autoren der Welt etablierte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 712
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Autor und Klappentext
Titelseite
Buchanfang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Leseproben
Ryu Murakami - Das Casting
Notes
Ryū Murakami, Coin Locker Babys
E-Book
ISBN: 978-3-903061-15-6
Originaltitel: Koinrokkā beibīzu© 1980, Ryū Murakami
All rights reserved
© der deutschen Ausgabe: 2015, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Zeus E. Jungrecht
Umschlag: Jürgen Schütz
Umschlagfoto: © leungchopan – Fotolia.com
Printversion: Hardcover, Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-35-9
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag | www.twitter.com/septimeverlag
Ryū Murakami
Jahrgang 1952, ist neben seiner Tätigkeit als Filmemacher einer der interessantesten japanischen Schriftsteller der Gegenwart. Mit dem Akutagawa-Preis ist er Inhaber des wichtigsten Japanischen Literaturpreis.
2013 erschien sein Roman Das Casting, die Romanvorlage des Miike Kultfilm Audition, bei Septime.
Klappentext
»Ein Knockout...ein großes pulsierendes Gleichnis.«Washington Post
»Teuflisch und brillant.«Oliver Stone
»Die Kraft dieses Buches packte mich am.«Banana Yoshimoto
Hashi und Kiku wurde nach ihrer Geburt in Münzschließfächern zurückgelassen. Die beiden Jungs verbringen ihre Jugend zunächst im Waisenhaus und später bei Pflegeeltern auf einer verlassenen Insel, bevor sie schließlich in die Stadt ziehen, um die Frauen, die sie weggegeben hatten, zu finden und zu vernichten. Gemeinsam oder getrennt ist ihre Reise vom Münzschließfach zu einem atemberaubenden, wilden Höhepunkt eine Achterbahnfahrt durch die unheimliche Landschaft eines Japans im späten zwanzisgten Jahrhundert.
Nachdem sie ihre Zieheltern verlassen hatten, zieht es beide ins Ghetto, eine von Freaks und Strichern belebte Gegend. Während sich Hashi zu einem bisexuellen Rocksänger entwickelt, Star in dieser exotischen Halbwelt, sicht Kiku, seine Rache in Gesellschaft seiner Freundin, einem Modell, die ihre Wohnung in einen tropischen Sumpf für ein Krokodil umgewandelt hat. Doch die Rachepläne, die Kiku verfolgt, gehen weitr als bloß seine Mutter zu finden...
»Coin Locker Babys« nennt man in öffentliche Schließfacher abgelegte Neugeborene. Diese Praxis findet man häufig in Japan oder China vor. Es ist nahezu ausgeschlossen, dass ein Baby dies überlegt.
Coin Locker Babys ist eien surreale Coming-of-Age-Geschichte in einem Japan der nahen Zukunft, die Ryū Murakami als einen der einfallsreichsten Autoren der Welt etablierte.
Ryū Murakami
Coin Locker Babys
Roman | Septime verlag
Aus dem Japanischen von Ursula Gräfe
1
Die Frau drückte dem Säugling auf den Bauch und sog sein kleines Glied in ihren Mund. Es war so dünn wie die amerikanischen Mentholzigaretten, die sie gern rauchte, und schmeckte nach rohem Fisch. Sie wartete, ob das Kind anfangen würde zu weinen, aber da es sich nicht rührte, zog sie ihm die dünne Plastikfolie vom Gesicht. Sie legte einen Pappkarton mit zwei Handtüchern aus und bettete es hinein. Anschließend versiegelte sie den Karton mit Klebeband und wickelte eine Schnur darum. Auf den Deckel und die Seiten schrieb sie in großer Schrift einen falschen Namen und eine erfundene Adresse. Sie frischte ihr Make-up auf, doch als sie in ihr gepunktetes Kleid schlüpfen wollte, spannten ihre prallen Brüste so schmerzhaft, dass sie sie mit der rechten Hand massierte und etwas weißliche Flüssigkeit auf den Teppich tropfte. Ohne sie zu entfernen, zog sie ihre Sandalen an, griff nach dem Karton mit dem Kind und verließ die Wohnung. Während sie ein Taxi heranwinkte, dachte sie an das Spitzendeckchen, an dem sie häkelte. Wenn sie es fertig hatte, würde sie einen Topf mit Geranien daraufstellen. Es war ein außerordentlich heißer Tag und ihr war etwas schwindlig. Das Radio im Taxi meldete, dass die Temperaturen Rekordhöhe erreicht und unter Alten und Kranken bereits sechs Todesopfer gefordert hatten. Am Bahnhof angekommen, schob die Frau den Karton in eines der Münzschließfächer und wickelte den Schlüssel in eine Damenbinde. Um der staubigen Hitze zu entfliehen, ging sie in ein Kaufhaus, warf den Schlüssel dort in eine Toilette und rauchte eine Zigarette. Als sie sich etwas abgekühlt hatte, kaufte sie eine Strumpfhose, Chlorbleiche und Nagellack, dann trank sie einen Orangensaft. So durstig war sie gewesen! Wieder suchte sie die Toilette auf, stellte sich ans Waschbecken und begann, mit größter Sorgfalt den eben gekauften Nagellack aufzutragen.
Als sie ihren linken Daumennagel lackiert hatte, brach dem halb toten Baby in seinem dunklen Gefängnis der Schweiß aus. Er strömte aus allen Poren seines Körpers und kühlte ihn. Die Finger des Kindes zuckten, sein Mund öffnete sich und es begann zu schreien. Es war einfach zu heiß in dem feuchten, stickigen, zweifach versiegelten Karton. Die Hitze hatte den Blutkreislauf des Kindes beschleunigt und es damit geweckt. Sechsunddreißig Stunden nachdem der kleine Junge zum ersten Mal mit Luft in Berührung gekommen war, erlebte er in dem engen, dunklen Kistchen eine Art Wiedergeburt. Er schrie so lange, bis jemand ihn fand.
Man brachte ihn auf die Säuglingsstation in einem Polizeikrankenhaus. Einen Monat später erhielt er den Namen Kikuyuki Sekiguchi. Sekiguchi war der Name, den die Frau auf den Karton geschrieben hatte. Kikuyuki war die Nummer 18 auf der Namensliste für Findelkinder der Sozialstation von Nord-Yokohama. Als Geburtsdatum trug man den 18. Juli 1972 ein, den Tag, an dem man ihn gefunden hatte.
Kikuyuki kam in das Waisenhaus Unsere Liebe Frau von den Kirschblüten. Das Kirschblütenheim, wie es im Volksmund hieß, war von einem hohen Eisenzaun umgeben und grenzte an einen Friedhof. Zierkirschen säumten die Zufahrtsstraße. Kikuyuki, den die anderen Kinder Kiku nannten, wuchs unter der Obhut der Nonnen heran, die ihm ihre Gebete beibrachten.
»Du hast einen Vater im Himmel, der dich beschützt«, erklärten sie ihm außerdem, »und du musst an ihn glauben.« In der Kapelle hing ein Bild von diesem Vater. Er hatte einen Bart und stand auf einer Klippe am Meer, wo er andächtig ein neugeborenes Lamm gen Himmel hielt. Kiku stellte den Schwestern immer wieder die gleichen Fragen: Wo war er auf dem Bild und warum war der Vater ein Ausländer? Und sie erklärten ihm, dass das Bild vor seiner Geburt gemalt worden sei und der Vater außer ihm noch viele andere Kinder habe. Augen- und Haarfarbe würden für ihn keine Rolle spielen.
Die Kinder im Kirschblütenheim wurden nach ihrem Aussehen adoptiert – die hübschesten zuerst. Jeden Sonntag, wenn sie nach dem Gottesdienst im Freien spielten, kamen Paare, um sie zu begutachten. Kiku war kein hässlicher Junge. Gefragt waren aber eher Kinder, die ihre Eltern bei einem Verkehrsunfall verloren hatten. Die brauchten nicht einmal besonders hübsch zu sein. Und so blieb Kiku, auch als er längst laufen konnte.
Damals wusste er noch nicht, dass er sozusagen in einem Münzschließfach das Licht der Welt erblickt hatte. Das erfuhr er erst von einem Jungen namens Hashi – Hashio Mizouchi –, der auch zu den Ladenhütern gehörte.
»Hör mal«, sagte Hashi eines Tages im Sandkasten zu Kiku. »Wir beide sind die einzigen, die das Schließfach überlebt haben. Alle anderen sind tot. Nur du und ich nicht.« Hashi war mager und etwas kurzsichtig. Seine feuchten Augen blickten stets in eine unbestimmte Ferne, sodass Kiku immer das Gefühl hatte, er sähe durch ihn hindurch. Außerdem verströmte er einen leicht medizinischen Geruch. Anders als Kiku, dessen andauerndes Geschrei in dem dunklen, heißen Karton einen Polizisten alarmiert hatte, war es Hashis schwächliche Konstitution gewesen, die ihn gerettet hatte. Die Frau, die ihn ausgesetzt hatte, hatte ihn ungewaschen und nackt in einer Papiertüte in dem Schließfach deponiert. Wegen eines durch eine Eiweißallergie hervorgerufenen Ausschlags hatte sie ihn von oben bis unten mit einer medizinischen Salbe eingerieben und gepudert. Der Puder löste einen Hustenreiz bei dem Baby aus und es erbrach sich. Der Geruch nach parfümiertem Erbrochenen drang durch die Ritzen des Schließfachs, sodass der Hund eines zufällig vorübergehenden Blinden anschlug.
»Es ist ein großer schwarzer gewesen«, verkündete Hashi nimmermüde. »Deswegen sind das meine absoluten Lieblingshunde.«
Schließfächer sah Kiku zum ersten Mal auf einem Ausflug in einen Vergnügungspark vor der Stadt. Am Eingang zur Rollschuhbahn. Es war Hashi, der sie ihm zeigte. Ein Mann auf Rollschuhen öffnete eine kleine Tür und packte sein Jackett und seine Tasche hinein. Viel mehr als ein Regal ist das ja nicht, dachte Kiku. Er ging näher heran, um das Innere zu erkunden. Es war staubig und seine Hand wurde schmutzig.
»Sieht aus wie ein Bienenkorb, was?«, sagte Hashi. »Haben wir doch mal im Fernsehen gesehen, weißt du noch? In den Kästen brüten die Bienen ihre Eier aus. Sie haben eine Menge Eier, doch die meisten sterben ab. Aber wir sind ja keine Bienen, wir kommen aus Menscheneiern.«
Kiku stellte sich vor, wie der bärtige Vater auf dem Bild in der Kapelle ein schleimiges Ei nach dem anderen in Schließfächer legte. Nein, das konnte nicht sein. Er vermutete, dass die Eier von Frauen kamen. Und der Pater die ausgeschlüpften Babys dem Himmel präsentierte.
»Guck mal.« Hashi stieß ihn an.
Eine Rothaarige mit Sonnenbrille suchte mit einem Schlüssel in der Hand ihr Schließfach. Bestimmt waren es dicke Weiber wie dieses, die die Eier legten. Vielleicht war sie gerade dabei. Die Frau blieb vor ihrem Schließfach stehen und steckte den Schlüssel ins Schloss. Die Tür ging auf und runde rote Dinger kullerten heraus. Kiku und Hashi schrien auf. Panisch versuchte die Frau, sie mit beiden Händen aufzufangen, dennoch rollte eins davon den beiden Jungen vor die Füße. Aber es war kein Ei, sondern eine Tomate. Kiku zerstampfte sie. Außer dem Saft, der aus dem roten Ei auf seine Schuhe spritzte, war nichts darin, weder ein Bruder noch eine Schwester für ihn.
Wenn die anderen Kinder Hashi ärgerten, beschützte ihn Kiku. Hashi hasste es, berührt zu werden, vielleicht weil er so schwächlich war. Kiku war der einzige, den er an sich heranließ. Besonders Angst hatte er vor erwachsenen Männern. Der Bäcker, der dem Waisenhaus das Brot lieferte, hatte ihm einmal auf die Schulter geklopft und dabei gesagt: »Du riechst immer irgendwie nach Salbe, Kleiner«. Hashi war sofort in Tränen ausgebrochen. Kiku vermutete, dass sein ganzer Körper mit Tränen angefüllt war, und wusste, dass sein Freund in solchen Momenten nicht ansprechbar war. Wenn Hashi laut weinend, vor Angst am ganzen Körper schlotternd flehte, nicht mit ihm zu schimpfen, blieb Kiku einfach stumm und ohne eine Miene zu verziehen bei ihm stehen, bis er sich beruhigte. Deshalb wich Hashi ihm auch nicht von der Seite und folgte ihm sogar bis auf die Toilette, doch Kiku stieß ihn nie zurück. Denn auch er brauchte Hashi. Ihre Beziehung war wie die zwischen einem Körper und einer Krankheit. Durchleidet ein Mensch eine unüberwindliche Krise, flüchtet sich sein Körper in eine Krankheit.
In jedem Frühjahr, sobald die Kirschblüten aufbrachen, bekam Hashi einen Husten, der wie ein Sturm in seiner Brust wütete, aber in einem Jahr erwischte es ihn besonders schlimm. Asthma und Fieber schüttelten ihn. Seine Neigung, sich zurückzuziehen, verstärkte sich, da er nicht im Freien spielen konnte, und er entwickelte eine seltsame Leidenschaft dafür, »Haus« zu spielen. Dazu errichtete er auf dem Fußboden das vollkommene Modell einer Küche mit Plastikgeschirr, Spielzeugtöpfen, Bratpfanne, Spielzeugwaschmaschine, Kühlschrank und allem, was dazugehörte. Und wenn er sein kleines Reich fertig hatte, durfte nichts daran verändert werden. Berührte oder verschob jemand aus Versehen etwas, bekam er einen Wutanfall, den die anderen Kinder und die Nonnen ihm nie zugetraut hätten. Nachts schlief er neben seiner Miniaturküche und morgens, wenn er aufwachte, war er erst zufrieden, wenn er sich überzeugt hatte, dass nichts in Unordnung geraten war. Bis er irgendwann das Gesicht verzog, als wäre ihm alles unerträglich, und er leise vor sich hin fluchend sein Werk zerstörte. Nur kurz gab er sich mit einer Küche oder einem Wohnraum zufrieden. Bald schon vergrößerte er sein Terrain mittels Stoffresten, Garnspulen, Knöpfen, Reißzwecken, Fahrradteilen, Steinen, Sand und Glasscherben zu einem Miniaturreich. Als einmal ein Mädchen über einen Turm aus Garnspulen stolperte und ihn umwarf, stürzte sich Hashi auf sie und versuchte, sie zu erwürgen. Wozu ihm natürlich die Kraft fehlte. Dennoch regte er sich so auf, dass er die ganze Nacht hustete und hohes Fieber bekam.
Sein größtes Vergnügen bestand darin, Kiku durch sein Reich zu führen und ihm alles zu erklären: Hier ist der Bäcker, hier ein Gastank und da der Friedhof.
»Und wo sind die Schließfächer?«, fragte Kiku.
»Da«, sagte Hashi und deutete auf ein viereckiges Fahrradrücklicht mit einer kleinen Birne in einem orangefarbenen Plastikgehäuse. Den Metallrahmen hatte er tadellos poliert und die blauen und roten Elektrodrähte sauber aufgewickelt. Das Rücklicht war das Prunkstück in Hashis Reich. Allerdings empfand Kiku eine gewisse Gereiztheit über Hashis lebhafte Begeisterung angesichts seiner Schätze. Wenn Hashi sich fürchtete oder weinte, fühlte Kiku sich wie ein Patient, dem man eine Röntgenaufnahme zeigte, denn er erkannte in Hashi seine eigene tief verborgene Angst und Trauer. Hashis Tränen sollten seine Wunden heilen. Doch nun galten Hashis ganze Sorge, seine Tränen und Ängste allein seinem Miniaturreich und hatten nichts mit Kiku zu tun. Die Wunde hatte sich selbstständig gemacht, hatte es geschafft, sich zu verkapseln, und Kiku musste den Verlust irgendwie ausgleichen.
Eines Tages wurde er von einer Nonne zu einer Polioimpfung ins Gesundheitszentrum gebracht und ging auf dem Heimweg verloren. Einem Busfahrer zufolge stieg er an einer Haltestelle am Westeingang des Bahnhofs Yokohama in einen Bus, in dem er viermal die gesamte Tour bis zur Endhaltestelle am Yachthafen Negishi und zurück drehte. Auf die Frage, wohin er denn wolle, habe er nicht geantwortet und weiter aus dem Fenster gestarrt, woraufhin der Busfahrer ihn der Obhut der Polizei übergab. Damit fing es an. Drei Tage später verließ Kiku am frühen Nachmittag das Waisenhaus und winkte ein Taxi heran. »Nach Shinjuku«, flüsterte er dem Fahrer zu, und dort angekommen, befahl er: »Jetzt nach Shibuya«. Der Chauffeur, dem das seltsam vorkam, lieferte ihn beim dortigen Polizeirevier ab. Beim nächsten Mal versteckte sich Kiku im Wagen des Getränkelieferanten, wurde aber erwischt, bevor dieser das Gelände verließ. Eines Tages schaffte er es sogar bis nach Kamakura, indem er einem Ehepaar, das den Friedhof besuchte, vorlog, er käme aus Kamakura und hätte sich verirrt.
Nach diesen Vorfällen unterstellte man Kiku der besonderen Aufsicht einer jungen Nonne, die nie mit ihm schimpfte und sich große Mühe gab, ihn zu verstehen. Sooft es ihre Zeit erlaubte, lieh sie sich den Wagen ihres Vaters, fuhr mit dem Jungen durch die Gegend und versuchte, etwas aus ihm herauszubekommen.
»Was gefällt dir denn so sehr daran, herumzufahren? Du fährst gern Auto und Bus. Wie kommt das?«
»Weil die Erde sich dreht«, antwortete Kiku. »Die Erde bewegt sich, da wäre es doch seltsam, auf der Stelle zu bleiben.«
In Wirklichkeit hatte die Erde nichts damit zu tun. Kiku wusste selbst nicht warum, aber er ertrug einfach keinen Stillstand. An einem Fleck zu bleiben war ihm unmöglich. Neben ihm rotierte etwas mit rasender Geschwindigkeit. Der Boden bebte vom Lärm der Triebwerke. Blitze aussendend startete das Etwas in schwindelerregendem Tempo und ließ Kiku zurück. Er empfand große Enttäuschung, bereitete sich aber sofort auf den nächsten Start vor. Kerosindämpfe stiegen auf und die Rotation und die Explosionen ließen die Luft und den Boden erzittern. Mitunter sprang Kiku hoch, weil sich das unterirdische Beben auf seinen Körper zu übertragen und ihn in die Höhe zu schleudern schien. Inmitten des ganzen Aufruhrs still zu bleiben, ertrug er nicht. Mit dem zunehmenden Getöse vor dem Abflug steigerte sich auch Kikus Panik. Er musste etwas tun. Musste an Bord des gewaltigen Flugobjekts gelangen.
Einmal, auf einem Ausflug in einen Vergnügungspark, stieg Kiku in die Achterbahn ein, aber nicht mehr aus. Die anderen Kinder kreischten vor Vergnügen und Entsetzen, aber sein Gesicht blieb wie versteinert. Als der Betreiber die junge Nonne aufforderte, Kiku aus dem Wagen zu holen, fand sie ihn kreidebleich und schweißüberströmt in den Sitz gekauert. Er hatte am ganzen Körper eine Gänsehaut und die Schwester musste seine kleinen Finger einzeln von der Haltestange lösen. Der Junge war wie erstarrt. An diesem Tag wurde ihr klar, dass Kiku nicht einfach fasziniert von Fahrzeugen war, sondern unter einer psychischen Störung litt. Auch Hashi zeigte sich verhaltensauffällig und attackierte ein Kind, das sich den Aufbauten aus Spielzeug, Abfall und Krimskrams um sein Bett genähert hatte, mit einer abgebrochenen Spritze. Die Nonnen wussten keinen anderen Rat mehr, als beide Jungen zu einem Psychologen zu bringen. Er erklärte ihnen, dass elternlose Kinder häufig gewisse Ausprägungen von Autismus entwickelten, was ihnen ja sicher nicht fremd sei.
»Nervöse Störungen bei Kindern und Kleinkindern sind –falls es sich nicht um ererbte Geisteskrankheiten handelt – in der Regel auf die Beziehung zu den Eltern und damit zusammenhängende Faktoren zurückzuführen. Vermutlich ist das bei beiden Jungen der Fall. Wie Sie als Erzieherinnen wissen, kommt es bei solchen Kindern immer zu gewissen Störungen. Die kindliche Psyche entwickelt sich parallel zum Körper und muss regelmäßig von außen stimuliert, unterstützt und gefördert werden. Es ist ausgeschlossen, dass ein Kind sich aus eigener Kraft zu einem geglückten Individuum entwickelt. Beide Jungen leiden unter einem Frühstadium von Schizophrenie. Ob es sich bei ihnen um eine organische Fehlfunktion, einen neurologischen Schaden, eine Stoffwechselerkrankung oder um eine ererbte Störung handelt, kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sagen. Sehr wahrscheinlich handelt es sich bei beiden um einen extremen Fall von Autismus. Ich tippe auf ein frühkindliches Trauma, vermutlich bedingt durch den Verlust der Mutter innerhalb der postnatalen Phase von sechs Monaten. Solche Kinder neigen dazu, sich in illusionäre Welten zu flüchten, und sind kaum in der Lage, mit der Außenwelt zu kommunizieren, die sie als feindlich wahrnehmen, da sie ihr die Schuld an der Trennung von der Mutter geben. Also wollen sie sie zerstören, woraus sich wiederum Allmachtfantasien ergeben. Hashio Mizouchi verweigert so gut wie jeden Kontakt zu anderen und schafft sich eine Art eigene Miniaturwelt. Ich unterscheide zwei Arten von Autismus – eine positive und eine negative Ausprägung. Ein Patient, der sich von der Außenwelt abschottet, kann seelisch reich oder verarmt sein, wenn seine Welt leer ist. Hashio ist natürlich ein reicher Autist, denn er besitzt die Fähigkeit zur Kreativität. Kikuyuki Sekiguchi hingegen leidet unter der panischen Angst vor einem Stillstand. Sie treibt ihn dazu, ständig in Bewegung zu bleiben. Diesen Aktivitäten liegt jedoch keinesfalls der Drang nach einer wie auch immer gearteten Kontaktaufnahme zur Außenwelt zugrunde. Vielmehr sind sie der Versuch, zu sich selbst vorzudringen. Seine Vorstellung, dass etwas neben ihm mit lautem Getöse aufbricht, ist eigentlich Ausdruck seiner Angst vor innerer Spaltung. Das, was Hashio Mizouchi dazu veranlasst, seine Spielzeugwelt zu bauen, und das, was Kikuyuki Sekiguchi solche Angst macht, ist im Grunde das Gleiche. Was glauben Sie ist es? Es ist Energie. Nach Ihrem Anruf habe ich interessehalber ein wenig recherchiert. Zwischen 1969 und 1975 sind landesweit 68 Säuglinge in Münzschließfächern – der Terminus ist ›Coin Locker Babys‹ – entdeckt worden, allerdings waren so gut wie alle tot. Der größte Teil war nach seinem Ableben dort deponiert worden. Die Übrigen sind entweder im Schließfach erstickt oder später im Krankenhaus gestorben. Nur zwei dieser Kinder haben überlebt. Natürlich haben sie keine bewusste Erinnerung an das, was damals mit ihnen geschehen ist. Ich glaube, die unbewusste, postnatale Todesangst und ihr heftiger physischer Widerstand dagegen hat sich in ihre Gehirne eingegraben, in den Hypothalamus oder bestimmte Gedächtnisbahnen. Der gewaltige Energieaufwand, durch den die beiden überlebt haben, hat Spuren hinterlassen, die bei gewissen Anlässen die neuronalen Verknüpfungen stören. Das heißt, die Energie bricht so stark hervor, dass die beiden sie nicht mehr zu kontrollieren vermögen. Sie werden viele Jahre brauchen, um zu lernen, sie zu kanalisieren.«
Was also sollten sie tun, fragten die Schwestern. Die beiden würden bald eingeschult und kämen vielleicht für eine Adoption infrage. Hätten sie denn überhaupt eine Chance, sich normal zu entwickeln?
»Tatsächlich gibt es eine Behandlungsmethode, die ich für effektiv halte. Dabei wird die Tätigkeit des Gehirns, der Nervenzellen und des Stoffwechsels so verlangsamt, dass die Energie auf ein kontrollierbares Maß absinkt. In Amerika wendet man diese Therapie bei akuter Schizophrenie an. Unterstützt von Halluzinogenen. Der Patient kehrt in den Mutterschoß zurück, wo er einer absoluten Ruhe und Regelmäßigkeit ausgesetzt ist. Er hört Geräusche wie im Mutterleib – den Herzschlag der Mutter und das Rauschen von Körperflüssigkeiten. Er nimmt das gesamte komplexe Geräuschesystem der verschiedenen Organe, des Blutes und der Lymphflüssigkeiten wahr, dem ein Fötus ausgesetzt ist. Als die Einzelheiten dieser Methode bekannt wurden, äußerte Michael Goldsmith, ein Neurochemiker an einer Universität in Massachusetts und SF-Autor, eine interessante Beobachtung. Die Herztöne hätten große Ähnlichkeit mit Signalen, die ein Satellit abgebe, den die Raumfahrtbehörde zur Kontaktaufnahme mit Außerirdischen ins All geschossen habe. Das ist natürlich ein Zufall. Aber ich kenne diese Herzsimulationen, sie haben eine erstaunliche Wirkung. Wenn man sie in halb wachem Zustand hört, empfindet man überwältigende Ruhe und Glückseligkeit. Es steht mir nicht zu, mich über religiöse Empfindungen zu äußern, aber unter dem Zustand christlicher Glückseligkeit stelle ich mir genau so etwas vor.«
Ab dem folgenden Tag besuchten Kiku und Hashi regelmäßig die Klinik. Man verabreichte ihnen eine bestimmte Menge eines Schlafmittels und setzte sie ein bis zwei Stunden den Herztönen aus, die ein Embryo hört.
Der Behandlungsraum war ungefähr fünfzehn Quadratmeter groß und mit einer weichen Gummimasse ausgekleidet, damit die Patienten sich nicht verletzten, falls sie außer sich gerieten. Die Geräusche kamen aus Lautsprechern in den Wänden und an der Decke, die jedoch mit einem unauffälligen Stoff überzogen und nicht sichtbar waren. Kleine Lichtquellen in einer Fuge zwischen Decke und Wand sorgten für gleichmäßige Beleuchtung. Das einzige Möbelstück war eine ziemlich große Liege. Ihr gegenüber befand sich hinter einer dicken Glasscheibe ein großer Bildschirm. Nachdem Kiku und Hashi das mit Guavensaft vermischte Schlafmittel eingenommen hatten, setzte sich der Arzt zu ihnen auf die Liege. Der Raum wurde langsam, fast unmerklich abgedunkelt. Auf dem Bildschirm erschienen in endloser Wiederholung ein Südseestrand, an den die Wellen schlugen; Skifahrer, die durch Neuschnee stoben; eine Herde Giraffen, die in Zeitlupe vor einem Sonnenuntergang dahingaloppierte; ein weißes Segelboot, das die Wellen teilte; ein Korallenriff voll tropischer Fische; Vögel, Drachenflieger, Ballerinen und Trapezkünstler. Diese Bilder veränderten sich kaum wahrnehmbar: die Größe der Wellen, das Licht der untergehenden Sonne, die Farbe des Meeresbodens, die Geschwindigkeit des Segelbootes, die Landschaft und die Kulissen. Wenn den Jungen das Bewusstsein schwand, war das Zimmer bereits dunkel. Die bei ihrer Ankunft kaum hörbaren Geräusche wurden allmählich lauter und sehr viel lauter, sobald die beiden eingeschlafen waren. Als sie fünfzig bis achtzig Minuten später aufwachten, liefen vor ihnen noch immer die gleichen Bilder ab, sodass sie den Eindruck hatten, die Zeit wäre stehen geblieben. Die Behandlung begann vormittags um 10.30 Uhr, eine Zeit, zu der sich der Sonnenstand kaum merklich verändert. Hatten sie die Klinik bei Sonnenschein betreten und es begann während der Therapie zu regnen, spielte man ein paar Minuten bevor sie aufwachten, Regengeräusche ein und stimmte die Beleuchtung auf einen Regentag ab. Übrigens wussten Kiku und Hashi nicht, dass sie therapiert wurden. Die Nonne und der Arzt sagten ihnen, sie sähen sich nur Filme im Krankenhaus an.
Schon nach einer Woche zeigten sich die ersten Ergebnisse. Die beiden Kinder kamen nun selbstständig ins Krankenhaus und die Nonnen mussten sie nicht länger begleiten. Nach einem Monat ersetzte der Arzt das Schlafmittel durch Hypnose, um zu erkunden, wie sich die gewalttätige Energie im Unterbewusstsein der beiden verändert hatte.
»Was seht ihr, wenn ihr die Geräusche hört?«, fragte er.
»Das Meer«, erwiderten beide im Chor.
Kiku schilderte das Meer, als würde er von dem bärtigen Christus auf dem Bild in der Kapelle gen Himmel gehalten und von der Klippe darauf hinuntersehen. Es war ruhig und glitzerte. Er war in etwas sehr Weiches eingewickelt und ein kühler Wind wehte.
Nach etwa hundert Sitzungen bestellte der Psychologe die Nonnen zu sich.
»Die Therapie ist fast beendet. Sehr wichtig ist es, die beiden nicht merken zu lassen, dass sie sich verändert haben. Sie dürfen ihnen nichts von den Herztönen erzählen.«
Kiku und Hashi warteten im Krankenhausflur und sahen aus dem Fenster. Der obere Teil leuchtete golden, während darunter das grüne Blattwerk eines Gingkobaums im Wind flirrte. Als sich die Aufzugstür öffnete, drehten sich die beiden Jungen um. Eine Schwester schob einen ausgezehrten alten Mann mit einem Verband um die Brust und einem Schlauch in der Nase vorbei und unterhielt sich dabei mit einem Mädchen, das einen großen Lilienstrauß trug. Kiku und Hashi musterten den Mann. Seine blaugeäderte Haut war blass, aber seine Lippen waren feucht und rot. Seine Knöchel waren mit Lederriemen am Bett fixiert und aus den Infusionsnadeln in seinen Armen sickerte ein wenig Blut. Er öffnete die Augen. Als er die beiden Jungen bemerkte, verzog er die Lippen zu einem Lächeln. Sie lächelten zurück. In dem Moment traten die Nonnen aus dem Büro am Ende des Flurs und eine wiederholte die Worte des Psychiaters.
»Den beiden ist nicht bewusst, dass sie sich verändert haben. Sie glauben, die Welt hätte sich verändert.«
2
Im Sommer vor Kikus und Hashis Einschulung wurde ihre Adoption beschlossen. Die Nonnen übergaben sie an ein Ehepaar, das sich eigentlich Zwillinge gewünscht hatte.
Der Antrag war vom Sankt Maria-Verein für Nachbarschaftshilfe auf einer Insel vor der Westküste Kyūshūs gestellt worden. Die beiden Jungen weigerten sich, das Waisenhaus zu verlassen, bis man ihnen ein Foto von ihren künftigen Pflegeeltern zeigte, ein Ehepaar, abgelichtet vor dem Meer als Hintergrund.
Am Abend vor ihrer Abreise veranstalteten die Nonnen ein Abschiedsfest. Im Namen aller überreichte ein Kind den beiden Jungen zum Andenken ein Geschenk – jeweils ein Taschentuch, bestickt mit Kirschblüten und den Namen aller Kinder. Hashi fing an zu weinen. Kiku schlich sich unbemerkt in die Kapelle, wo es nach Staub und Moder roch, um noch einmal den Vater, der das Lamm gen Himmel hielt, zu betrachten. Er starrte auf das Bild, bis man ihn zum gemeinsamen Gebet holte.
Eine Nonne begleitete die Jungen im Shinkansen bis Hakata und übergab sie dort einem Fürsorgebeamten der Präfektur Nagasaki. In einem Dampfzug fuhren sie mit ihm zu einem kleinen Bahnhof, wo sie in einen Bus umstiegen. Kiku wunderte sich, dass der Mann einen schwarzen Anzug trug, obwohl es in dem Bus so heiß war, dass einem sogar nackt der Schweiß hinabgelaufen wäre. Aber Hashi deutete schweigend auf die Hände des Beamten. Sie waren voller Brandnarben. Der ist an Hitze gewöhnt, flüsterte er.
Nachdem der Bus eine lange gerade Straße hinaufgefahren war, kam das Meer in Sicht. Sie sahen eine rostige Fähre, ein Kap und sonnengebleichte Inseln. Wolken türmten sich am Horizont. Kaum am Hafen angekommen, rannten Kiku und Hashi zum Meer, das in der Hitze diesig vor ihnen lag. Sie kletterten auf die Uferbefestigung. »Mann, Kiku! Wie weit man sehen kann!« Als Hashi die Reusen betrachtete, gab einer der Fischer ihm einen Fisch mit runden Augen und rundem Bauch, der, nachdem er eine Weile gezappelt hatte, im Staub verendete. Kiku fuhr mit dem Finger über den scharfen Schwanz, fand, dass er stank, und warf den Fisch ins Meer.
Der Mann in Schwarz rief nach den beiden. Er hatte Fahrkarten und Eiscreme für die Jungen gekauft. Auf der Fähre war es so stickig, dass sie kaum atmen konnten. Außerdem stank es nach Öl. Der Kiosk war geschlossen und der Getränkeautomat war außer Betrieb, ebenso wie der Fernseher und der Ventilator. Der Beamte reichte ihnen das schon halb geschmolzene Eis. Die Plastiksitze in der Fahrgastkabine waren aufgerissen, gelber Schaumstoff quoll hervor und die Krümel lagen überall auf dem sandigen Boden verstreut. Etwas von dem Eis war auf die schwarze Hose des Beamten getropft. Der Mann zückte ein Taschentuch und wischte angeekelt daran herum.
»Seid ihr müde?«, fragte er Kiku und Hashi.
Den beiden war schlecht von dem Gestank nach Öl und dem Schaukeln des Schiffes. Sie leckten ihr Eis, um den stechenden Geruch loszuwerden.
»Ob ihr müde seid? Könnt ihr nicht antworten?«, schrie der Beamte sie an.
Erstaunt nahm Hashi sein Eis aus dem Mund. Er antwortete leise, als würde er aus einem Buch ablesen. »Wir sind aus dem Kirschblütenheim in Yokohama und fahren zu unserer neuen Mama und unserem neuen Papa.« Das Eis in seiner rechten Hand tropfte auf den Boden.
»Das habe ich nicht gefragt. Ob ihr müde seid, will ich wissen.«
Hashi fing an zu zittern. Seit jeher jagten erwachsene Männer ihm Angst ein. Den Tränen nah, wiederholte er: »Wir sind aus dem Kirschblütenheim in Yokohama und fahren zu unserer neuen Mama und unserem neuen Papa.«
Der Mann leckte das Eis ab, das auf seine vernarbte Hand getropft war, und lachte. »Mehr kannst du wohl nicht sagen? Wie ein Papagei.«
Daraufhin drückte Kiku sein Eis auf das Jackett des Fürsorgebeamten und rannte über das Deck, um ins Meer zu springen. Der Mann holte ihn ein.
»Dafür entschuldigst du dich!«, brüllte er dem Jungen ins Ohr. Sein Atem stank wie der Fisch, der gerade im Sand verendet war. Kiku lachte ihm ins Gesicht.
Der Mann gab ihm einen leichten Klaps auf die Wange. »Was gibt es da zu lachen? Entschuldige dich!«
Nun klammerte sich Hashi an das Jackett des Mannes und entschuldigte sich immer wieder, da die Nonnen ihm eingeschärft hatten, er müsse für Kiku sprechen, da dieser nicht gern rede. Der Mann zog sein Jackett aus und wusch es unter dem Wasserhahn in der Toilette. Kiku und Hashi legten sich auf die harten Sitze. Immer wieder hielten sie sich die Hände an die Nase, damit der süße Geruch nach Vanille den Ölgestank überlagerte. Irgendwann schliefen sie ein.
Die Insel hatte die Form eines Tieres. Als sie in den Hafen einliefen, war sie nur ein schwarzer Umriss vor der sinkenden Sonne und wirkte wie die von einem Lichtstreifen umgebene Silhouette eines Tigers.
Ihre Pflegeeltern holten sie am Pier ab. Vielleicht lag es an der Dunkelheit, aber Hashi dachte, ihre neue Mutter sei mit einem Kind gekommen. Doch Shuichi Kuwayama, ihr Mann, war wirklich sehr klein. Enttäuscht betrachtete Kiku seinen künftigen Vater, während der Beamte sie einander vorstellte. Kuwayama war nicht nur klein, er hatte auch dünne weiße Arme und Beine, hängende Schultern und eine eingefallene Brust. Er trug einen Bart und sein Haar war schütter. Er hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit dem Vater in der Kapelle.
»Lasst uns nicht hier stehen. Gehen wir in die Kantine«, quäkte der Vater. Hashi stieß Kiku in die Seite und lachte.
»Der spricht ja wie der Roboter in dem Raumschiff, der nicht rechnen kann, was Kiku?«
In der Hafenkantine bestellten die Kinder Reisomeletts, die Eltern und der Mann von der Fürsorge Nudeln und Sake.
Der Beamte schenkte Kuwayama Sake ein und erzählte ihm, dass Kiku ihm Eis auf die Jacke geschmiert habe. »Den müssen Sie hart anfassen!«
Die neue Mutter war vom Hals aufwärts dick gepudert, und weil sie so schwitzte, verlief der weiße Puder und sammelte sich in den Schlüsselbeinvertiefungen. Kazuyo Kuwayama war etwas über vierzig und sechs Jahre älter als ihr Mann Shuichi.
Nachdem Kazuyo sich von ihrem ersten Mann getrennt hatte, war sie mit einem Onkel auf die Insel gekommen, auf der damals noch Kohle gefördert wurde. Ihr Onkel war Bergmann. Zu der Zeit hatten über fünftausend Minenarbeiter auf der Insel gelebt, von denen die Hälfte ledig war. Kazuyo begann eine Lehre als Kosmetikerin und amüsierte sich großartig. Sie war grobknochig, hatte kleine Augen und eine etwas zu große Nase, aber es gab keinen Tag, an dem nicht einer der Bergleute mit ihr ausgehen wollte. Doch Kazuyo ließ sich nie mit einem von ihnen ein. Nicht etwa weil sie aus den schlechten Erfahrungen ihrer ersten Ehe gelernt hatte, sondern weil sie aufgrund der vielen Angebote etwas zu viel Selbstvertrauen entwickelte und überzeugt war, am Ende würde ein noch besserer Mann auftauchen. Die Männer machten ihr Komplimente, sagten, sie sei schön. Anfangs glaubte sie ihnen nicht. Bevor sie auf die Insel gekommen war, hatte ihr noch nie jemand gesagt, sie sei schön. In ihrem ganzen Leben nicht. Nach der Arbeit im Schönheitssalon ging sie mit einem Auserwählten essen, tanzen, ins Kino oder Pachinko spielen. Wieder zu Hause, betrachtete sich Kazuyo vor dem Schlafengehen lange im Spiegel. Sie rief sich all die Worte, die der Mann ihr zugeflüstert hatte, noch einmal ins Gedächtnis und versuchte, im Spiegel zu ergründen, was an ihr so schön war. Das war nicht leicht zu entdecken. Schließlich dachte sie, es müssten ihre Lippen sein. Oder ihre glatte weiße Haut. Dass Kazuyo sich keinen bestimmten Liebhaber nahm, lag daran, dass – ganz anders als vor ihrer Ankunft auf der Insel – immer mindestens drei Männer sie umschwärmten.
Der erste Mann, mit dem sie nach ihrer Scheidung schlief, war kein Bergmann, sondern ein Bohringenieur. Er war auch nicht ledig. Sie hatte ihn bei einer Tanzveranstaltung kennengelernt, die sie mit zwei jungen Bergleuten besucht hatte. Der Ingenieur hatte einen Wagen, und sie fuhren mit der Fähre hinüber nach Nagasaki und Sasebo. Als seine Frau von der Affäre erfuhr, sagte sie, sie sei überrascht, dass ihr Mann sich mit »so einer« eingelassen habe. Die Ehefrau war tatsächlich viel hübscher, dennoch hatte sich schon länger niemand so abfällig über Kazuyos Aussehen geäußert. Sie konnte es nicht glauben. Ab diesem Tag gewöhnte sie sich an, noch länger in den Spiegel zu schauen, ihren Mund und ihre feine weiße Haut zu betrachten.
Nach zwei Jahren kündigte Kazuyo im Schönheitssalon und fing als Bedienung in einer Bar auf der Insel an. Sie puderte sich das Gesicht weiß und malte sich die Lippen rot. Sie wusste noch genau, wie oft sie mit dem Ingenieur geschlafen hatte. Achtzehn Mal. Sie erinnerte sich, beim wievielten Mal sie sich in ihn verliebt hatte. Nämlich beim vierten Mal. In einem Hotel in Nagasaki, in dem über dem Bett ein runder Spiegel an der Decke hing. Der Ingenieur hatte ihr einen Cocktail mit Kaffeegeschmack bestellt, einen Cacao Fizz. An ihrem vierten Tag in der Bar spendierte ein Bergmann ihr einen Cacao Fizz. Kazuyo brach vor Wehmut in Tränen aus und schlief in einem Hotel auf der Insel mit ihm. Ein Monat verging und Kazuyo schlief jede Nacht mit einem anderen Mann. Einen Cacao Fizz brauchte sie dazu nicht mehr.
Die glücklichen Nächte, in denen die Männer nach dem Beischlaf ihre Schönheit gepriesen hatten, waren ein für alle Mal vorbei, als die Mine trotz eines drei Monate andauernden Protests geschlossen wurde. Bald verschwanden all die jungen Männer von der Insel und die Bevölkerung schrumpfte auf ein Zehntel zusammen. Danach kamen kaum noch Gäste in die Bar. Kazuyo war gerade erst dreißig geworden. Ihr Onkel wechselte zu einer Schiffswerft auf Shikoku, und Kazuyo ging mit ihm, um in einer Bar in Niihama zu arbeiten. Aber Shikoku war keine Insel, auf die man zwei Stunden mit der Fähre brauchte, und es gab dort kaum Männer, die bereit waren, ihre Schönheit zu preisen. Eines Abends, als Kazuyo sich, versunken in Erinnerungen an die Insel und die Männer, mit denen sie dort geschlafen hatte, im Spiegel betrachtete, entdeckte sie Flecken auf ihrer glatten weißen Haut unter den Augen, auf den Wangen und auf der Brust. Und als sie sie zählte, bemerkte sie auch ihre trockenen Lippen, die Falten und das schlaffe Fleisch. Die Familie ihres Onkels war zu beschäftigt mit ihrem neuen Leben, um sich mit Kazuyos Problemen auseinanderzusetzen, als diese nach Puder duftend aus dem Bad kam.
Kazuyo verließ Niihama. Nachdem sie zwei Jahre in Osaka und ein Jahr in Fukuoka gearbeitet hatte, kehrte sie erschöpft auf die Mineninsel zurück und nahm eine Stelle als Kellnerin in dem einzigen dort verbliebenen Gasthaus an. Dort begegnete sie dem Bergmann wieder, der ihr damals den Cacao Fizz spendiert hatte – Kuwayama. Er hatte inzwischen in einem Stahlwerk in Sasebo ein bisschen Geld verdient und eine kleine Fabrik auf der Insel gegründet. Er nahm Kazuyo mit in sein kleines Haus, das einen gestampften Boden und ein Blechdach hatte. Kazuyo beschloss, bei ihm zu bleiben, als er ihr mit zitternden Lippen sagte, sie sei schön. Kuwayama presste Bentō-Schachteln aus Styropor. Die Nachfrage stieg und er begann verschiedene Formen und Größen herzustellen. Er nahm einen Kredit auf und kaufte einen Schönheitssalon für Kazuyo. Als der Kredit zur Hälfte abbezahlt war, beschloss das Ehepaar, Kinder zu adoptieren.
Kiku und Hashi wurden in Schlafanzüge mit aufgedruckten kleinen Lokomotiven gesteckt und Hashi bekam vor Aufregung und Erschöpfung Fieber. Kazuyo machte ihm einen Eisbeutel, setzte sich neben ihn und fächelte ihm kühle Luft zu. Nachdem ihr Mann den Beamten verabschiedet hatte, machte er sich sofort wieder an die Arbeit. Eine fleischfarbene Motte, wie Kiku sie noch nie gesehen hatte, flatterte durch das Fenster ins Zimmer. Er sah nach draußen, wo es nichts zu sehen gab. Im Waisenhaus hatte er gern durch das Fenster die Lichter der Stadt und die Scheinwerfer der Autos betrachtet. Hier jedoch war es stockdunkel, und nur wenn er ganz genau hinschaute, sah er, wie die großen Blätter eines Baums sich im warmen Wind bewegten. Das Brummen von Kuwayamas Pressmaschine übertönte das Zirpen der Insekten.
»Es ist laut, aber mein Mann kann nicht schlafen, wenn er nicht genug gearbeitet hat«, sagte Kazuyo.
Kiku stampfte auf den Käfer, der hereingeflogen war.
»Man darf keine Lebewesen töten!«, belehrte ihn Kazuyo.
Kiku entdeckte in der Ferne ein kleines Licht. Er dachte, es sei ein Stern, aber er täuschte sich.
»Das ist ein Leuchtturm. Er leuchtet, damit die Schiffe, die nachts vorbeikommen, nicht an die Felsen stoßen.« Als das Licht sich drehte, erschien für einen Augenblick die bewegte Oberfläche des Meeres.
»Schlaf jetzt«, sagte Kazuyo. »Du musst doch müde sein.«
Aber Kiku verspürte plötzlich den Drang, laut zu schreien. Sich in eine riesige Rakete zu verwandeln und die Insekten, die Blätter, das blöde Fenster, die Maschine von diesem Kuwayama und den Leuchtturm in die Luft zu jagen. Er konnte den Duft der Sommernacht, die die sonnendurchglühten Bäume kühlte, nicht ertragen.
Seine Kehle wurde eng und er nahm seinen Mut zusammen, »Ich heiße Kikuyuki«, sagte er leise. »Hashi und die Schwestern nennen mich Kiku.« Mehr konnte er nicht sagen, denn die Tränen flossen. Es wunderte ihn selbst, dass er weinte, aber er konnte nicht anders. Kazuyo bewegte, ohne etwas zu sagen, weiter den Fächer. Kiku kroch ins Bett. Die frischen Laken wurden feucht von seinem Schweiß.
Als die beiden Jungen am nächsten Morgen aufwachten, brummte bereits Kuwayamas Maschine. Kazuyo gab ihnen neue Hemden, kurze Hosen und Turnschuhe und ging dann in ihren Salon.
»Ich bin zu Mittag wieder da«, sagte sie. »Bis dahin dürft ihr Fernsehen.«
Kiku und Hashi aßen Misosuppe und rohe Eier zu ihrem Reis und zählten dann die Boote auf ihren Hemden. Im Fernsehen gab es nur Kochsendungen, also schalteten sie es wieder aus und balgten sich auf den Tatami. Dann spielten sie Pfeilwerfen mit einer Ahle, die auf dem Tisch lag, und durchlöcherten dabei die Papiertüren. Anschließend liefen sie in den kleinen Garten, in dem Tomaten und Auberginen wuchsen. Dann sahen sie Kuwayama in der Werkstatt bei der Arbeit zu. Er bediente einen großen Eisenhebel und sein runder gebeugter Rücken glänzte vor Schweiß.
»Er sieht wirklich aus wie ein Roboter, oder?«
Der schmale, abschüssige, mit üppigen Kanna-Blumen gesäumte Weg kreuzte die Hauptstraße, die über die ganze Insel direkt zum Meer führte. Unter einem großen Baum waren drei sonnenverbrannte Kinder damit beschäftigt, Zikaden zu fangen. Als Kiku und Hashi näher kamen, beäugten die Kinder wie geblendet die neuen Hemden und Hosen der beiden.
»Was macht ihr da?«, fragte Hashi. Eins der Kinder hielt einen Käfig voller Zikaden hoch. Hashi nahm das Körbchen, aus dem es schnarrte und krächzte wie aus einem kaputten Radio, um zu schätzen, wie viele es waren. Die Kinder hatten eine Muschelschale mit Vogelleim an einen Stock gebunden. Kiku und Hashi starrten auf den Stamm, aber sie konnten beim besten Willen die Zikaden nicht von der Borke unterscheiden. Deshalb erschien es ihnen wie Zauberei, als das Zirpen plötzlich lauter wurde und die Zikaden wie Spielzeugvögel aufflatterten, als eines der Kinder sich dem Baum mit dem Stock näherte. Auf einem der höheren Äste schien eine riesige Ölzikade zu sitzen. Eines der Kinder übergab Kiku, der am größten war, die Rute. Er könne die Zikade aber nicht sehen, sagte er, und die Kinder deuteten mit ihren schmutzigen Fingern auf das große Insekt. Es sah aus wie ein Astloch. Kiku hielt den Atem an. Wenn er sich streckte, konnte er den Ast gerade so erreichen. Die Zikade schrillte laut vor sich hin. Er stieg auf einen herumliegenden Brocken Beton. Die Kinder zeigten ihm, wie er sich der Zikade in ihrem toten Winkel nähern konnte. Das Betonstück wackelte. Hashi schrie und Kiku stach mit der Rute zu, als wolle er die Zikade aufspießen. Als sie aufflatterte, berührte er ihre Flügel und brachte sie langsam zu Boden. Jubelnd nahmen die Kinder die zappelnde Zikade und wischten vorsichtig den Vogelleim ab. Hashi fragte, ob der Weg ans Meer führe. Nein, nur bis zu einer Klippe. Um an den Strand zu kommen, müssten sie die Hauptstraße entlanggehen und in den zweiten Weg einbiegen.
Kazuyos Schönheitssalon lag oberhalb der Bushaltestelle an der Hauptstraße. Sie sah die beiden und kam herausgelaufen. »Wo geht ihr denn hin?«, schrie sie. Kiku deutete, ohne zu antworten, in Richtung des Meeres.
»Aber haltet euch von der alten Mine fern.« Weder Kiku noch Hashi kannten das Wort Mine.
Der Weg, den die Kinder ihnen beschrieben hatten, war so zugewachsen, dass die beiden daran vorbeigingen. Stattdessen bogen sie in einen schmalen Pfad ein, von dem sie dachten, er wäre der richtige, der sich jedoch bald verzweigte. Nach einigen Windungen wussten sie nicht mehr, in welcher Richtung die Hauptstraße lag. Es wimmelte von Stechmücken und hohes Gras zerschnitt ihnen die Beine. Die beiden verzagten und hätten am liebsten um Hilfe gerufen, aber es machte nicht den Eindruck, als würde das etwas nützen. Hier hörte sie wahrscheinlich niemand. Wieder teilte sich der Weg. Rechter Hand lag ein dunkler Tunnel, und so gingen sie nach links. Eine Schlange huschte vor ihnen über den Weg. Die Jungen kreischten und rannten in Richtung des Tunnels, der einen leichten Bogen beschrieb, sodass der Ausgang am anderen Ende wie ein längliches Rohr aus Licht erschien. Im Tunnel war es kühl und der Boden war schlammig. Als ein Tropfen von der Decke Hashis Nacken traf, stieß er einen Schrei aus, der den Tunnel zum Einsturz hätte bringen können. Er rannte, stolperte und fiel. Weinend blieb er am Boden liegen. »Hör auf zu flennen!«, schrie Kiku. »Steh auf und komm weiter. Wir sind fast draußen.« Den stinkenden Pfützen ausweichend, steuerten sie auf den Ausgang zu. Doch als sie schlammbedeckt aus dem Tunnel kamen, war der Weg vor ihnen mit Stacheldraht und Gestrüpp versperrt. Doch auf der rechten Seite war ein Loch, gerade groß genug für ein Kind, und durch den Tunnel wollten die beiden auf keinen Fall zurück. An dem rostigen Stacheldraht zerrissen sie sich ihre neuen Schiffchen-Hemden. Und als Hashi nicht weiter wollte, drohte ihm Kiku mit der Schlange, die bestimmt noch hinter ihnen lauerte. Also arbeiteten sie sich auf Bäuchen und Ellbogen voran. Bald berührten sie Beton, das Gras endete und sie kamen auf die Füße. Die Szenerie vor ihnen hatte große Ähnlichkeit mit der Spielzeugstadt, die Hashi im Jahr zuvor errichtet hatte. Ruinen in Lebensgröße. Ruinen einer Stadt ohne menschliches Leben. Abgesehen von den Pflanzen, die aus den zerbrochenen Fenstern der grauen Bergarbeitersiedlung wucherten, konnte man der Illusion erliegen, dass gerade eben noch eine Sirene geheult hatte. Alle Bewohner hatten die Siedlung verlassen, und nur die beiden waren zurückgeblieben, um als Menschenopfer zu sterben. An einigen Wänden hingen noch Plakate. Das Kyūshū-Marine-Blasorchester führte den »River Kwai March«, »Anchors Aweigh« und »The Stars and Stripes forever« auf. Die beiden Jungen hielten kurz inne, doch als ihnen die unmenschliche Stille bewusst wurde, rannten sie zwischen den Häusern hindurch. Kein Laut außer ihren eigenen Schritten ertönte. Bei einem Dreirad, aus dessen ausgeblichenem Plastiksattel Unkraut spross, blieben sie stehen. Trotz der Stille hatten Kiku und Hashi das Gefühl, ihre Spielgefährten von eben, die Kinder mit den Zikaden, würden gleich erscheinen. Hashi berührte den Lenker und der Rahmen brach quiekend zusammen, wie ein Schwein, dem man einen Nagel durch den Kopf getrieben hatte. Aus den Bruchstellen sickerte eine schmierige Mischung aus Rost, Öl und Regenwasser. Das zerbrochene Dreirad war den Jungen unheimlich. Sie ließen die Häuser hinter sich, liefen über geborstenen Beton und dann eine brüchige Holztreppe voller Sand und Schmutz hinauf. Vor ihnen tauchte eine lange rotleuchtende Backsteinmauer auf, durch deren Ritzen die Sonne schien, und als die Jungen hindurchspähten, entdeckten sie eine Reihe von Bauwerken, die sie bisher nicht gesehen hatten. Einen trichterförmigen Turm, ein in längliche Fächer unterteiltes Betonbecken, das durch ein rundes Rohr mit dem Turm verbunden war, nackte Stahlskelette und von Efeu überwucherte Backsteinzylinder. Hashi kam das ganze irgendwie bekannt vor und er wollte Kiku fragen, hielt aber inne, weil dieser so blass aussah. Jetzt wusste er es, es sah aus wie die Graphik vom menschlichen Darm im Wartezimmer des Krankenhauses, in dem sie die Herztöne-Therapie gemacht hatten. Kiku erschauderte. Die menschenleeren Ruinen in dem Gewirr von Licht und Schatten glichen der Landschaft, in die ihn die gefürchtete riesige Rotationsmaschine katapultierte.
Sie ließen die Eingeweide aus Beton hinter sich und gelangten an eine halb verfallene Schule. Dicke fleischige Pflanzen mit spitzen Blättern, die sich jedoch als geborstene Maschinenteile entpuppten, hatten den Boden eines ausgetrockneten Springbrunnens durchbrochen. Vielleicht stammten sie von einem Gerät, mit dem man Schächte in den Meeresboden trieb. Um den Springbrunnen herum waren einst Blumenbeete gewesen. Nun hatte der Wind die Samen verweht und sie in der Erde, die sich in einer umgestürzten Toilette gesammelt hatte, erblühen lassen. Ein Teil des Schulgebäudes war mit wasserdichtem Kanvas abgedeckt. Mehrere der Drähte, die ihn hielten, waren gerissen und ein lautes Schlagen der Plane im Wind scheuchte einen Schwarm Krähen auf, der sich auf dem Dach niedergelassen hatte. Dieses Aufflattern erweckte den Eindruck, das Gebäude würde aufbrechen.
Wohin hatte es sie hier nur verschlagen? Hashi erinnerte sich an alles, bis zu dem Punkt, als er im Tunnel hingefallen war. Der Schlamm war auf seiner Haut und seinem Hemd getrocknet und er roch nach Öl und fauligem Wasser. Kiku bemerkte, dass die Sonne sank. Bei Dunkelheit waren diese Ruinen gewiss kein Spielplatz. Sie mussten wieder aus ihnen herausfinden. Zu den Kindern mit den Zikaden gelangen.
Sie überquerten einen Sportplatz, aus dem eine verbogene Turnstange ragte. Zahllose Stacheln der in der Sandgrube wuchernden Kakteen trieben auf dem grünen Wasser eines Schwimmbeckens. Drei hohle Strommasten dienten Hunderttausenden von weißen Termiten als Bau, und Wolken von durchsichtigen Flügeln formierten sich zu allerlei Trugbildern. Hinter diesem halb transparenten Vorhang lag eine Straße mit geborstenem Pflaster, gesäumt von Geschäften und Bars.
»Guck doch mal da, wie schön!«, rief Hashi. Offenbar hatte man alle Scherben der Neonschilder der Bars und Restaurants in einer Grube gesammelt, wo sie sich zu einem bunten, glitzernden Teppich ausbreiteten. Je nach Windrichtung änderten die winzigen Glassplitter ihre Position, brachen das Sonnenlicht in den verschiedensten Farben und verschmolzen sie zu kunstvollen Neongebilden. Kiku trat näher heran und hob eine Glasscherbe auf. Sie war leicht gebogen und Innen- und Außenseite fühlten sich verschieden an. Die Außenseite war rosa und glatt, die Innenseite gelb und rau. Statt zurück in die Grube warf er sie in den Staub. Als er ihr nachblickte, erschrak er, ging auf die Knie und kroch auf dem Boden herum.
»Kiku? Was ist los?«, fragte Hashi, der ein kaum beschädigtes Neon-S in der Hand hielt.
»Da sind Reifenspuren. Bei dem trockenen und weichen Boden können sie nicht alt sein. Es ist nur eine, also wahrscheinlich von einem Motorrad. Jemand ist hier durchgekommen. Ob hier jemand lebt?«
Die Spur endete am Rand des Vergnügungsviertels vor einem Kino. Piccadilly stand auf einem Schild. Kiku schaute sich um, fand aber keine weiteren Reifenspuren. Auch hatte das Motorrad nicht gewendet. Hashi betrachtete derweil ein halbes Plakat, das noch unter dem Eingang hing, und die Reste der Fotos in den Schaukästen. Das Plakat war über den Augen einer Frau abgerissen, und es waren nur noch Nase, Zunge, Kinn und darunter irgendwie separat ihre Brüste zu sehen. Andere Bilder zeigten einen fremdländisch wirkenden Mann mit gezückter Pistole und eine blonde Frau, die blutend auf dem Boden lag, die Nahaufnahme von einem Kuss und zwei Damen zu Pferde, die in einen Sonnenuntergang ritten. Hashi wischte gründlich und behutsam, um sie nicht zu beschädigen, mit seinem Hemdzipfel den Schmutz ab. Als er das Foto einer nackten Frau in die Tasche stecken wollte, zerfiel es. Kiku inspizierte die Fenster des Kinos. Alle waren mit Brettern zugenagelt.
Als Hashi unvermittelt nach oben sah, erstarrte er vor Schreck. Er wollte schreien, aber seine Kehle war wie zugeschnürt. Ein junger Mann mit freiem Oberkörper, nur mit einer Lederhose bekleidet, schaute aus dem ersten Stock des Kinos auf sie hinunter. Jetzt hatte Kiku ihn auch entdeckt. Der junge Mann sah von einem zum andern und ruckte mit dem Kinn. »Haut ab«, sollte das heißen. Die beiden Kinder konnten sich vor Angst nicht rühren. »Verschwindet«, sagte er nun mit tiefer Stimme. Hashi wollte losrennen und das Weite suchen, aber da Kiku sich nicht rührte, wusste er nicht, was er tun sollte. »Kiku!«, schrie er.
Kiku starrte den mageren jungen Mann mit dem langen Bart weiter an. »Endlich habe ich dich gefunden«, flüsterte er. »Hier bist du also. Der Mann, der mich in den Himmel bringen soll. Hat vielleicht die große Rotationsmaschine die Stadt zerstört?«
Der Mann zog sich aus dem Fenster zurück. Sie hörten, wie eine Tür geschlossen wurde. Kiku nahm allen Mut zusammen. »Wo ist das Motorrad?«, rief er.
Es kam keine Antwort. Hashi war den Tränen nahe und zerrte an seinem Ärmel. »Komm, wir gehen!« Kiku gab auf und setzte sich in Bewegung, aber als sie um die Ecke bogen, hörten sie ein lautes Scheppern. Kiku und Hashi wandten sich um. Aus dem ersten Stock des Kinos war eine dünne Eisenplatte gefallen. Knatternd raste ein silbernes Motorrad die Rampe hinunter an ihnen vorbei und verschwand in einer Staubwolke. Kiku hatte das Gefühl, dass der junge Mann ihm, als er an ihnen vorbeiraste, zugelächelt hatte. Das Motorradbrummen entfernte sich.
Als Hashi von Kazuyo zu seinem schlammverschmierten Hemd befragt wurde, gestand er, dass sie in der Ruinenstadt gewesen waren. Ihre Schimpftirade wollte kein Ende nehmen. Wussten sie nicht, wie gefährlich diese Ruinen waren? Zwei arbeitslose Bergleute, die in den leeren Häusern Wasserrohre klauen wollten, waren von einer Grubenotter gebissen worden. Ein Kind, das dort gespielt hatte, war in einen Schacht gestürzt. Die Planken, die die Schächte bedeckten, waren vermodert und die Gruben voller giftiger Gase. »Wenn ihr da hineinfallt, stürzt ihr dreitausend Meter tief und werdet von widerlichen Insekten und Schlangen gefressen«, zeterte Kazuyo. »In den unterirdischen Lagern sind noch Chemikalien, die euch, wenn ihr sie nur anfasst, in Nullkommanichts das Fleisch bis auf die Knochen wegfressen. Außerdem hausen noch immer Landstreicher in den Ruinen, die sich kleine Kinder holen. Wenn euch dort etwas passiert, kommt euch keiner zur Hilfe. Da könnt ihr schreien, wie ihr wollt, keiner wird euch hören.« Anschließend nahm sie ihnen noch einmal das Versprechen ab, nie wieder auch nur einen Fuß in die Nähe der Ruinenstadt zu setzen.
Kuwayama und Kazuyo kamen überein, den Schönheitssalon so lange zu schließen, bis Kiku und Hashi sich auf der Insel eingelebt hatten. Kazuyo drehte mit beiden eine Runde durch die Nachbarschaft und stellte sie allen vor. Sie kaufte ihnen Badehosen und ging mit ihnen an den Strand.
Durch das hohe Gras der Dünen rochen sie die salzige Luft und rannten jubelnd mit nackten Füßen auf das Wasser zu. Der Sand war heiß, eine Welle brach sich und begrüßte die beiden mit einem feinen Sprühregen. In kleinen Löchern im feuchten Sand lebten Krebse, und in den Tümpeln, die die Flut zwischen den Felsen zurückließ, zappelten winzige Fische, die es nicht zurück ins Meer geschafft hatten. Nie gelang es den Jungen, einen von ihnen zu fangen. Sie lernten das angenehm saugende Gefühl kennen, das entstand, wenn sie die Finger zwischen die buntgemusterten Tentakel der Seeanemonen steckten, und die Tiere sich zusammenzogen. Sie jagten die Einsiedlerkrebse, die in Scharen über die Reste ihres Mittagessens herfielen, und machten Wettrennen zum Meer. Auch die Kinder mit den Zikaden kamen zum Strand. Hashi winkte ihnen zu. Sie trugen Schwimmbrillen und hatten Harpunen dabei. Kurze Zeit später schoss eine Harpune aus dem Wasser, an ihrer Spitze etwas, das ihm wie ein Stück Plastik erschien. »Juhuu, ich hab einen Kraken!«, schrie der Junge mit der Harpune und stieg aus dem Wasser. Kiku und Hashi rannten, um sich den Fang anzusehen. Der Krake sah anders aus als der, den sie bei einem Ausflug mit dem Waisenhaus im Aquarium gesehen hatten. Er war braun, sodass man ihn kaum von einem Felsen unterscheiden konnte, wand sich und sonderte eine schwarze Flüssigkeit ab. Der im Aquarium war rötlicher und sein Kopf, seine Arme und seine Augen waren deutlich erkennbar gewesen. Der hier sah aus wie ein nasser Putzlappen. Als der Junge ihn von der Harpune zog, passte er nicht auf und der Putzlappen flüchtete in Richtung Meer. Flink bewegte er sich auf die Felsen zu. »Halt ihn fest!«, rief der Junge. Als Hashi die Hand ausstreckte, schlang sich der Putzlappen um seinen Arm. Hashi erstarrte vor Angst, während das schleimige, formlose Ding an seinem Arm hinauf auf sein Gesicht zukroch. Als er versuchte, es mit seiner freien Hand zu lösen, wechselte der Krake auf seinen anderen Arm. Dabei erreichte er mit einer Tentakel Hashis Schulter. Dieser wand sich so verzweifelt, dass es von der Ferne wirkte, als würde er einen Tanz vollführen. Kazuyo hörte seine Schreie und kam angerannt, als der Krake gerade dabei war, sich am Gesicht des am Boden liegenden Hashi festzusaugen. Kiku und die anderen Kinder wollten ihn abreißen, doch der Krake haftete so fest an Hashis Haut, als wäre er ein Teil davon, und ließ sich nicht lösen. Mit fliegenden Fingern riss Kazuyo sich die Bluse vom Leib, wickelte sich den trockenen Stoff um die Hand und löste einen Tentakel nach dem anderen. Dann schlug sie den in der Bluse gefangenen Kraken immer wieder auf die Felsen. Hashis Schulter und Hals waren rot und geschwollen, und auch die Saugnäpfe hatten Spuren hinterlassen. Er stand auf, blickte zwischen dem reglosen Kraken und Kazuyo hin und her und brach in Tränen aus. Kazuyo nahm ihn in die Arme. Ihre Brüste drückten sich an seine Seite und es kitzelte. Als er sein Gesicht an ihrer Schulter barg, schmeckte er Kazuyos salzige Haut.
Die roten Kanna-Blüten am Wegrand welkten. Sie wurden braun und rissig und zerfielen, wenn man darauftrat. Als ein Taifun die letzten Sommerblumen hinwegfegte und Früchte und Nüsse von den Bäumen riss, zeigte Kazuyo Kiku und Hashi, wie man in den Hügeln Maronen sammelte. Man musste auf die stacheligen Kugeln treten, um sie zu öffnen, und darin befanden sich dann drei Maronen unterschiedlicher Größe. Die in der Mitte war die größte, denn sie hatte die meiste Nahrung bekommen, während die übrigen abgestorben waren. »Seht ihr, wenn jemand auf Kosten anderer dick wird, ist er am Ende ganz allein«, erklärte Kazuyo den Jungen.
Einmal fand Kiku eine Hülse mit zwei gleich großen Maronen. »Das kommt selten vor«, sagte Kazuyo. »Die ist wie ihr beide.« Sie teilte die Schale und jeder bekam eine, die sie in die Taschen steckten.
Zweimal im Monat mietete sich Kuwayama ein kleines Boot und fuhr zum Angeln. Dazu brach er vor Morgengrauen auf. Es war kalt, aber die beiden Jungen mussten mit, auch wenn es ihnen noch so zuwider war. Auf dem Boot tranken sie heißen, gesalzenen grünen Tee und erlebten, wie die ersten Strahlen der Sonne das Meer färbten. Die Luft erwärmte sich langsam, und Fische mit scharfen, bläulichen Rückenflossen sprangen aus dem Wasser. Sie hatten transparentes violettes Blut. Die Jungen rochen an den trocknenden Schuppen, beobachteten, wie die goldenen Wellen ans Boot schlugen, und hörten das leise Fallen der auf dem Wasser schmelzenden Schneeflocken.
Als im Frühling in den Kohlfeldern Tausende weißer Schmetterlinge schlüpften, bekamen Kiku und Hashi jeder ein mit einer Schleife versehenes Paket von Kazuyo. Ihre Schulranzen.
3
Die alte Bettlerin lief quer über den Sportplatz. Sie schlief in einer Ruine der verlassenen Bergarbeitersiedlung und stillte ihren Hunger, indem sie Fisch von den Trockengestellen der Fischer klaute, an den Türen Reis erbettelte und mitunter Kartoffeln von den Äckern stahl. Sie lebte seit Langem auf der Insel, ihr Mann war Bergmann gewesen und bei einem Unfall ums Leben gekommen, bevor die Mine geschlossen wurde. Kinder hatte sie keine. Sie war aus einem Heim davongelaufen und in die alte Bergarbeitersiedlung zurückgekehrt. Man duldete sie stillschweigend, da sie niemandem Schaden zufügte. Sie würde ohnehin bald sterben.
Der Anblick der alten Frau bedrückte Hashi. »Immer wenn ich eine Bettlerin oder eine Landstreicherin sehe«, sagte er zu Kiku, »frage ich mich, ob sie vielleicht die Frau ist, die mich geboren hat. Wenn ich eine Frau sehe, die schmutzig, allein, ängstlich und mit hängendem Kopf um Essensreste bettelt, zittere ich. Bestimmt hat es ihr Unglück gebracht, mich auszusetzen. Mit so was kann niemand glücklich werden. Diese Frauen tun mir so leid, dass ich am liebsten Mama rufen und sie umarmen möchte. Aber wenn sie wirklich meine Mutter wäre, würde ich sie wahrscheinlich umbringen.«
Und als ihn, kurz nachdem sie in die Grundschule gekommen waren, ein Mitschüler hänselte, reagierte er sehr zornig. Die alte Bettlerin schlurfte gerade über den Schulhof. »He, Kuwayama«, rief der Junge. »Guck mal, da geht deine Mutter.« Hashi lief knallrot an und wollte sich auf den Jungen stürzen, worauf dieser erst recht übermütig wurde.
»He, Alte, tut mir leid, aber ich hab dich mit Hashis Mutter verwechselt!«, schrie er. Kiku prügelte ihn halb tot. Die beiden Jungen waren nie geschlagen worden, weder von Kuwayama noch Kazuyo oder den Nonnen. Dennoch hatte Kiku die Fäuste geballt und dem Jungen mit einem Kinnhaken zwei Zähne ausgeschlagen. Es ging ganz schnell, und da ihn dies offenbar nicht befriedigte, trat er auf den am Boden Liegenden ein, bis er das Bewusstsein verlor. Auch die, die über die Hänseleien gelacht hatten, verprügelte er und versetzte die ganze Klasse in Angst. Wahrscheinlich wirkte sein Verhalten besonders furchterregend, weil er für gewöhnlich ein sehr ruhiger Junge war. Niemand benahm sich je wieder feindselig gegenüber den beiden, doch Hashi empfand noch immer Traurigkeit beim Anblick der alten Bettlerin. Einmal holte die alte Frau lilafarbene Stofffetzen aus einem Mülleimer, aber als sie begriff, dass sie sie nicht anziehen konnte, schlang sie sich diese um die Schultern und Hüften und sie flatterten im Wind.
Immer wieder brachen Kiku und Hashi das Kazuyo gegebene Versprechen und unternahmen Erkundungszüge durch die Ruinenstadt. Mittlerweile waren sie in der vierten Klasse. Eines Tages warfen sie wie üblich nach der Schule ihre Ranzen durchs Fenster ins Haus und machten sich auf den Weg in die Ruinenstadt. Sie hatten eine grobe Karte davon angefertigt, auf der sie das verlassene Gebiet in vier Abschnitte gegliedert hatten: die Bergarbeitersiedlung, das Bergwerk mit den Schächten, die Gegend um die Schule und die verlassene Stadt. Sie nannten sie Zulu, Megado, Poton und Gazelle, nach ihren Lieblingscomics. Zulu war der Hauptmann einer finsteren Räuberbande aus dem All, Megado eine Raumstation auf der Venus, Poton ein Roboter, der in einer Flotte diente, die den dritten Stern im Sternbild des Schwans verteidigte, und Gazelle war ein edler Gesandter, Sohn von Superman und einer Chinesin. Die Bergarbeitersiedlung Zulu war an drei Seiten von dicht bewachsenen Hügeln umgeben, in denen es angeblich von Schlangen wimmelte. Deshalb hatten die Jungen es bisher nicht gewagt, dieses Gebiet zu erkunden. Mitunter hörten sie, wie der Wind durch die Häuser pfiff.
Doch eine Woche zuvor hatte Kiku, als er ein paar Ranken weghackte, eine steile Betontreppe entdeckt. Von oben hätten sie wahrscheinlich einen Blick auf die unerforschten Gebäude und das Meer. Und sie könnten ihre Karte vervollständigen. Bevor Kiku und Hashi die Treppe freihackten, hoben sie die Pflanzen sachte an, um sich zu vergewissern, dass keine Schlangen darunter waren. Bei jedem Geräusch fürchteten sie, von einer Grubenotter attackiert zu werden. Vorsichtig arbeiteten sie sich nach oben auf die freie Betonfläche vor, von der man einen Ausblick auf die zwölf siebenstöckigen Blocks hatte.