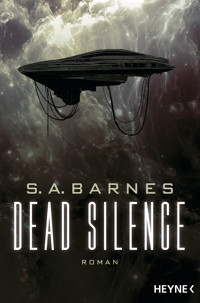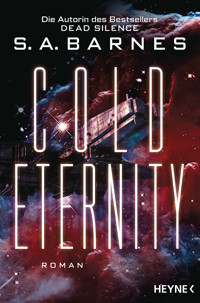
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Halley Zwick steckt in Schwierigkeiten. In der Art Schwierigkeiten, bei der falsche Ausweise, mächtige Politiker und mehr als eine Sorte Gesetzeshüter involviert sind. Sowohl die Guten als auch die Bösen sind hinter ihr her, aber Halley kann nicht länger sagen, wer eigentlich wer ist. Um allen zu entkommen, nimmt sie einen Job auf dem Raumschiff »Elysium Fields« an, wo die Reichen und Schönen Seite an Seite in ihren Kälteschlafkapseln liegen – und das seit Hunderten von Jahren. Doch dann geschieht etwas Merkwürdiges: Die Hologramme ihrer »Passagiere« warnen Halley, dass sie das Schiff unbedingt verlassen muss. Etwas Hungriges lauert im Dunkel der Laderäume, und möglicherweise ist es bereits zu spät …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Halley Zwick gerät in eine politische Intrige und steckt nun so tief in der Klemme, dass ihr nur ein Ausweg bleibt: Sie besorgt sich einen falschen Ausweis und taucht in einer Raumstation von zweifelhaftem Ruf unter, um sich vor Politikern, Gesetzeshütern und Auftragskillern zu verstecken. Sie kann nicht mit Sicherheit sagen, wer in diesem Spiel die Guten und wer die Bösen sind. Als man sie trotz aller Vorsichtsmaßnahmen doch entdeckt, nimmt sie in ihrer Verzweiflung einen mies bezahlten Job auf dem Raumschiff Elysium Fields an. Dort liegen die Reichen und Schönen Seite an Seite in ihren Kälteschlafkapseln – und das schon seit Jahrhunderten, weil dem ambitionierten Projekt schon vor langer Zeit das Geld ausgegangen ist. Halley soll regelmäßig durch die leeren Korridore patrouillieren und die uralte Technik im Blick behalten. Dazu gehören auch die Hologramme der »Passagiere«, die sich immer wieder versehentlich aktivieren. Sie warnen Halley, dass sie das Schiff unbedingt verlassen muss. Etwas Hungriges lauert im Dunkel der Laderäume, und bis Halley erkennt, dass sie nicht allein ist, ist es bereits zu spät …
Die Autorin
S. A. Barnes arbeitet tagsüber als Bibliothekarin in einer Highschool, wo sie Bücher empfiehlt, mit den Studierenden spricht und gelegentlich als Lesezeichen verwendete Cheesesticks entfernt. Nachts schreibt sie Romane. Für ihr Horror-SF-Debüt Dead Silence wurde sie 2022 mit dem Goodreads Choice Award in der Kategorie Science-Fiction ausgezeichnet. Zuletzt ist ihr Roman Ghost Station bei Heyne erschienen. S. A. Barnes lebt mit zu vielen Büchern, zu vielen Hunden und einem sehr geduldigen Partner in Illinois.
Mehr über S. A. Barnes und ihre Werke erfahren Sie auf:
diezukunft.de
S. A. BARNES
COLD ETERNITY
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Michael Pfingstl
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Die Originalausgabe
COLDETERNITY
erschien erstmals 2025 bei Nightfire / Tor Publishing Group
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
1. Auflage
Copyright © 2025 by S. A. Barnes
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com (Allexxandar) und iStockphoto (mik38)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-32943-3V003
www.heyne.de
Für alle, die sich getraut haben, bei Showbiz Pizza oder Chuck E. Cheese mal einen Blick hinter den Vorhang zu werfen.
Ihr seid meine Leute.
1
Raumstation EnExx17, SL 23
Vereinigte KolonienEnceladus, 2223
»Sieben Faden«, das fragliche Etablissement, liegt auf Level 23 der Station.
Ich war noch nie so weit unten, und als sich die Fahrstuhltüren öffnen, zögere ich. Theoretisch beherbergt die ovale Halle zahllose Handels- und Gewerbebetriebe, an denen die Bewohner der umliegenden Ebenen essen, trinken, sich neue Stiefel kaufen oder Dinge eintauschen können, die sie brauchen und die andere abzugeben bereit sind.
Viele Geschäfte sind jedoch mit schweren Sicherheitstüren verriegelt – alle verbeult – und scheinen dauerhaft geschlossen zu haben. Die Menschen stehen in kleinen Gruppen zusammen und unterhalten sich lautstark zwischen ihren Hustenanfällen oder kauern auf dem Boden, die Köpfe zueinander geneigt und die Hände nach der warmen Luft ausgestreckt, die aus den Lüftungsgittern strömt.
Und es ist dunkler hier. Die Beleuchtung flackert blau und weiß wie ein Stroboskop kurz vor dem endgültigen Zusammenbruch. Die Luft ist schlechter, irgendwie dicker, als könnte man regelrecht spüren, wie sich die Partikel in der eigenen Lunge festsetzen.
In den fünf Wochen auf EnExx17 habe ich mich nie weiter als ein paar Ebenen von meinem beschissenen Hostelzimmer auf Level 9 entfernt. Theoretisch sorgen die Securityleute überall für Ruhe und Ordnung. Doch im Moment scheint niemand von ihnen hier zu sein. Jedenfalls nicht, soweit ich es überblicke.
Aber ich habe keine andere Wahl.
Ein Warnton kündigt an, dass sich die Aufzugstüren gleich wieder schließen werden, als ich die Bar auf der anderen Seite der Halle entdecke, fast direkt gegenüber. Das Sieben Faden verfügt über einen der wenigen beleuchteten Eingänge und scheint geöffnet zu haben. Lautes Gelächter dringt zu mir herüber.
Ich ignoriere das nervöse Krampfen in meinem Bauch, steige aus dem Aufzug und ziehe die ausgefranste Kapuze noch ein Stückchen tiefer ins Gesicht. Dabei stoßen meine Finger gegen das geschwollene und empfindliche Gewebe um mein linkes Auge. Sengende Schmerzensblitze schießen über mein Gesicht.
Ich beiße die Zähne zusammen, nach einem Moment lässt das Brennen nach, und der gewohnte dumpfe Schmerz kehrt zurück.
Ein Grund mehr, die Sache in Angriff zu nehmen, Halley.
Ich gehe auf die Bar zu und bemühe mich, die goldene Mitte zwischen zielgerichteter Bewegung und, nun ja, Rennen zu finden. Ich bin kaum ein paar Meter weit gekommen, da spüre ich, wie sich zahllose Augenpaare auf mich richten und die Aufmerksamkeit mir die Illusion der Unsichtbarkeit raubt.
Ich gehöre nicht hierher, und das wissen sie.
Diese Menschen brauchen Hilfe.Bessere Bedingungen, sagt eine leise Stimme in meinem Kopf. Wenn du …
Das ist nicht dein Problem. Es liegt nicht mehr in deiner Macht, die Heldin zu spielen, schon vergessen?, unterbricht eine andere Stimme laut und spöttisch.
Gerade als ich mich der Kneipe nähere, kommt ein Mann aus dem Eingang gestolpert und stößt beinahe mit mir zusammen. Seine Augen sind glasig, sein Overall ist noch mit weißem Staub von seiner Schicht in der Entsalzungsanlage bedeckt.
Er starrt mich schwankend an, ich zucke zusammen und ziehe instinktiv den Kopf ein. Aber der Schrei des Wiedererkennens, die genuschelte Bemerkung bleiben aus.
Nach einem Moment taumelt er nach rechts und fixiert etwas an der Decke, das nur er sehen kann.
Ich ziehe eine Grimasse. Das ist kein Alkohol. Daze, wenn ich raten müsste. In einer Dosis, die ihn vergessen lassen könnte, dass er atmen muss. Wenn er nicht vorher eine Treppe hinunterstürzt oder irgendwo über ein Sicherheitsgeländer fällt.
Du kannst nichts dagegen tun, geh weiter.
Ich ducke mich in den Pub, und meine Schultern verkrampfen augenblicklich. Meine Kontaktperson sollte besser hier sein. Sie muss.
In der Kneipe ist es noch dunkler – wegen der Atmosphäre, aus Gründen der Privatsphäre, aber vielleicht auch, um Strom-Credits zu sparen. Es dauert einen Moment, bis sich meine Augen daran gewöhnt haben. Der verdreckte Boden hat keinerlei Ähnlichkeit mehr mit der einstmals glänzenden Metalloberfläche. Eine dünne Salzschicht knirscht bei jedem Schritt unter meinen Sohlen. Soll sie verschüttete Getränke aufsaugen? Oder ist das einfach die Salzlake, die ständig hereingetragen wird? Ich weiß es nicht.
Auf der anderen Seite des abgedunkelten Raums, in der Nähe der Bar, sitzt ein halbes Dutzend Oberflächenarbeiter, die geröteten Gesichter über ihre Bierkrüge gebeugt.
In einem der Separees sind die Vorhänge nur teilweise zugezogen, sodass ich einen Blick auf eine elegante Frau erhasche, die besser gekleidet ist als alle in sechs Ebenen Umkreis und deren kunstvoller Zopf so fest gebunden ist, dass er sich kaum bewegt, während sie am Holocomm mit jemandem streitet. Neben ihr liegt ein weiterer Salzarbeiter in einem verdreckten Overall, der Körper steif, die weit aufgerissenen Augen zur Decke gerichtet.
Definitiv Daze. Ich wusste es. Eine Dealerin mit ihrem nächsten Käufer.
Die Menschheit hat einen unauslöschlichen Drang, auf anderen herumzutrampeln und zwielichtige Orte zu erschaffen, an denen man den Kopf besser unten und die Augen bei sich behält. Selbst auf einer abgelegenen Raumstation wie dieser.
Ich zwinge mich, den Blick abzuwenden, bevor die Dealerin mich bemerkt. Ich kann keinen weiteren Ärger gebrauchen.
Ich drehe mich möglichst unauffällig im Kreis und mustere die anderen Kneipenbesucher. Nur wenige sitzen allein am Tisch, und die, die es tun, scheinen nicht auf jemanden zu warten.
Mein Herz beginnt zu pochen. Die Annonce auf einem versteckten Bereich des Intranets von EnExx17 klang auch zu schön, um wahr zu sein.
Aufseher/Sicherheits-Supervisor für auf Dock liegendes Schiff gesucht.Keine Erfahrung erforderlich.Geringes Gehalt, aber Unterkunft und Verpflegung inbegriffen.Mussmit isolierter Arbeitsumgebung und begrenztem Kontakt zur Außenwelt zurechtkommen können.
Unterkunft und Verpflegung ohne neugierige Blicke klangen verlockend. Vielleicht zu verlockend. Aber mein müdes Gehirn suchte und fand eine Erklärung: wahrscheinlich irgendein Reicher mit mehr Schiffen als Verstand, der nicht will, dass sein Baby hier draußen monatelang leer bleibt, ohne dass jemand außer dem gelangweilten Quartiermeister ab und zu nach dem Rechten sieht. Ich war nicht begeistert von dem niedrigen Gehalt, denn ich konnte nicht ewig so leben, und Credits waren das Einzige, was mich irgendwann hier rausholen würde. Und sei es nur, um nach Hause zurückzukehren.
In meinem früheren Leben wäre die Vorstellung, auf eine Anzeige in einer Schwarzmarktbörse zu antworten – von der ich nur erfahren hatte, weil ich andere Hostelbewohner darüber reden hörte –, genauso bizarr gewesen, wie nackt im Großen Saal des Neuen Parlaments zu tanzen. Und genauso wahrscheinlich.
Aber das war mein altes Ich. Das neue Ich muss essen. Und einen sicheren Platz zum Schlafen finden.
Ich ignoriere den Protest meiner Rippen und atme einmal tief durch, um meine Nerven zu beruhigen.
Ich bin wahrscheinlich zu früh dran, das ist alles. Ich wollte vor meiner Kontaktperson ankommen, um auf der sicheren Seite zu sein. Sicher wovor, weiß ich nicht, da ich außer der Initiale K keinerlei Informationen darüber habe, wen ich hier treffen werde.
Ich steuere auf den nächsten leeren Tisch mit Blick auf die Tür zu.
»Hey«, ruft die Barkeeperin, als ich mir einen Stuhl heranziehe. »Kein Getränk, kein Tisch.« Sie deutet auf etwas hinter mir. Auf ihren Arm sind verblüffend realistisch aussehende Nieten und Metallplatten tätowiert, und ich muss mich zusammenreißen, sie nicht anzustarren wie ein Kunstwerk.
Ich drehe den Kopf und folge ihrer Blickrichtung.
KEINGETRÄNK, KEINTISCH, flackert ein halb durchgebranntes Display an der Wand. Hier draußen auf EnExx17 pfeift wirklich alles aus dem letzten Loch.
Ich berühre meine Kapuze, um mich zu vergewissern, dass sie noch an Ort und Stelle ist, und gehe zur Bar. Bleibe auf Abstand zu den anderen Gästen, die über den Tresen gebeugt auf ihren Hockern sitzen.
»Tee, bitte.«
Die Barkeeperin zieht eine Augenbraue hoch, sagt aber nichts.
Einen Moment später hat sie einen meiner letzten Hardcredits, und ich halte einen plumpen Becher mit einem recycelten Teebeutel darin in der Hand. Die Ränder des grauen und nach dem Wiederbefüllen nicht gerade kunstvoll wieder zusammengenähten Dings sind leicht ausgefranst. Es schwimmt in der Tasse wie ein Fertigknödel nach dem Verfallsdatum.
Es gab eine Zeit, da hätte ich den Tee angewidert weggeschoben.
Heute halte ich die Tasse fest, umfasse ihre Wärme und atme tief ein, als könnte allein der Duft das knurrende Loch in meinem Magen füllen.
Ich gehe zurück an meinen Tisch, behalte den Eingang im Auge und warte darauf, dass K – wer auch immer er oder sie ist – kommt.
Ich bin so damit beschäftigt, die Tür zu beobachten, dass ich beinahe übersehe, wie die Barkeeperin auf mich zukommt. Ihre metallischen Beinprothesen glänzen selbst in der schummrigen Kneipenbeleuchtung, während sie sich geschmeidig auf meinen Tisch zubewegt. Die Tattoos auf ihren Armen passen perfekt dazu.
Ich blicke auf und halte meine Hand über die Tasse. Ich kann mir kein Refill leisten.
Ihr Mund verzieht sich, als sie die blauen Flecken auf meinem Gesicht sieht. »Sind Sie diejenige, die einen Anruf erwartet?«, fragt sie.
»Oh.« Ich setze mich aufrechter hin und nehme meine Hand von der Tasse. »Nein, ich bin hier verabredet.«
»Dann ist das hier für Sie.« Sie hält mir mit vorwurfsvoller Miene eine grün blinkende Scheibe hin – ein Holocomm mit einem wartenden Teilnehmer am anderen Ende der Verbindung.
Bevor ich etwas erwidern kann, knallt sie es auf meinen Tisch und verschwindet klickend wieder hinter der Bar.
Ich starre das Holocomm einen Moment lang an und überlege, was passiert sein könnte. Wenn der Anruf für mich ist, will K vielleicht absagen?
Nein. Nein, nein, nein! Verzweiflung reißt ein hässliches Loch in die Ruhe, an die ich mich geklammert habe. Dieses Treffen muss klappen.
Ich strecke den Arm und tippe auf die mittlere Taste. Das grüne Licht leuchtet auf, und über dem Holocomm erscheint eine flimmernde Silhouette, Schultern mit einem unscharfen Kopf darüber, der von mir wegschaut. Die Verbindung ist furchtbar, instabil und verrauscht, sodass ich kaum mehr als das erkennen kann. Am anderen Ende der Leitung rumpeln Maschinengeräusche im Hintergrund.
»Hallo?«, frage ich schließlich.
Die Gestalt dreht sich zu mir um, die Bewegung lässt die Projektion noch unschärfer werden, dann setzt sich das Bild wieder zusammen. Es ist ein Mann, sein struppiges dunkles Haar ist von silbernen Strähnen durchzogen, und seine Augen sind so hell, dass sie beinahe durchsichtig wirken. Die dunklen Ringe darunter sind jedoch deutlich sichtbar, ebenso wie die Bartstoppeln an seinem Kinn, die von mehreren Tagen – oder Wochen – Nichtrasur zeugen. Er ist mindestens zehn Jahre älter als ich, Ende dreißig oder sogar Anfang vierzig.
»Endlich!«, ruft er über die Hintergrundgeräusche hinweg. »Sie sind diejenige, die auf meinen Post geantwortet hat?«
Ich spüre, wie sich Köpfe in meine Richtung drehen, und zucke zusammen. Ich ziehe das Holocomm näher heran und stelle hektisch den Ton leiser. Hätte ich gewusst, dass er anrufen würde, hätte ich eine Kabine reserviert. »Ja«, sage ich mit gedämpfter Stimme. »Aber ich dachte, wir hätten vereinbart, dass wir uns treffen …«
»Hören Sie, ich kann gerade nicht weg, und das hier ist die nächstbeste Lösung.« Er fährt sich mit der Hand durch sein ohnehin schon zerzaustes Haar. »Ich brauche jetzt sofort jemanden. Ich bin mitten in einer grundlegenden Systemüberholung und habe keine Zeit, mich mit diesem Mist aufzuhalten. Ich muss die Frist einhalten und kann schließlich nicht an zwei Orten gleichzeitig sein. Diese verdammten Aufsichtsratsregeln sind einfach lächerlich …«
»Was genau wäre dieser Mist?«, unterbreche ich ihn.
Er hält überrascht inne. »Was ich in dem Post geschrieben habe: Sie machen Rundgänge und behalten alles im Auge. Dokumentieren die erforderlichen Reparaturen. Geben mir Bescheid, wenn jemand vorbeikommt. Berichten den Spießern vom Aufsichtsrat, damit sie wissen, dass jemand da ist und aufpasst. Das war’s. Ein Bot könnte das machen, wenn sie nicht so paranoid wären.« Er gibt ein spöttisches Geräusch von sich und schüttelt den Kopf. »Ich habe noch nie so verdammte Anfänger gesehen.«
Letzteres klingt, als wäre es in seinen Augen das weit größere Vergehen.
»Ich brauche jemanden, auf den ich mich verlassen kann«, fährt er fort und blickt auf etwas hinter sich, das nicht im Bild zu sehen ist. Metall schlägt auf Metall, und er flucht leise. »Jemanden, der nicht mittendrin in Panik gerät und sich verpisst wie der Letzte.« Seine Stimme ist gedämpft, aber die Verachtung klingt laut und deutlich durch. »Hat sich bei der letzten Nachschublieferung auf dem Transporter versteckt.«
Panik? Warum sollte jemand bei dem Job in Panik geraten?
Ich öffne den Mund, um genau diese Frage zu stellen, aber er redet weiter und sieht wieder mich an. »Wie war noch mal Ihr … Ähm, ich habe ihn hier irgendwo.« Er schaut finster auf etwas unterhalb des Bildausschnitts.
Ich räuspere mich. »Halley. Halley Zwick.«
»Ja, genau!« Er grinst. »Wie bei ›Fireman Flick und Spaceman Zwick‹!«
Das ist das Problem, wenn man an zweifelhafter Stelle nach Hilfe sucht: Man bekommt genauso zweifelhafte Hilfe. Zum Beispiel jemanden, der es lustig findet, dir auf Basis deines – zugegebenermaßen falschen – Nachnamens einen auf einer Cartoonfigur basierenden Vornamen anzudichten. Wahrscheinlich sollte ich dankbar sein, dass er mich nicht zu Halley Mouse oder Halley McDonald gemacht hat. Wobei Letzteres zumindest ein echter Name sein könnte.
»Genau so«, erwidere ich knapp.
Sein Lächeln verblasst ein wenig, verdrängt von bohrender Neugier.
»Mir ist aufgefallen, dass Sie keinerlei VK-Daten angegeben haben«, sagt er leichthin. »Halley, oder?«
Ich versteife mich und widerstehe dem Drang, mich in die Schatten hinter mir zurückzuziehen. Ich kann nicht sagen, ob er mich erkannt hat. Trotz der Schwellung in meinem Gesicht und den Schritten, die ich unternommen hatte, um mein Aussehen zu verändern. Meine Haare sind abgeschnitten und mit einer billigen Tönung zu einem schmutzigen Rotbraun gefärbt, dazu violette Kontaktlinsen ohne Comm-Interface. Nichts ist ausgeschlossen, schon gleich gar nicht nach dieser verdammten Pressekonferenz: meine Mutter in einem kuscheligen, schnittlosen hellblauen Sweater, den ich noch nie an ihr gesehen habe und den sie niemals freiwillig getragen hätte, ihr Haar ungezwungen auf die Schultern fallend, mein Vater mit zerknittertem Hemd und locker sitzender Krawatte. »Komm nach Hause, Katerina, bitte.«
Sie waren der Inbegriff besorgter Eltern, wenn man sie nicht kannte. Aber ich kenne sie.
Ich zwinge mich, ruhig zu bleiben, und verwandle mein Gesicht in eine teilnahmslose Maske, wie ich es schon lange vor meiner Ankunft hier verinnerlicht habe.
»Ja, ich heiße Halley«, bestätige ich. Und sonst nichts. Soll er mein Schweigen doch interpretieren, wie er will. Als ob jemand, der sich selbst nur mit einem einzigen Buchstaben ausweist, ein Recht auf erschöpfende Informationen hätte. Ich werde ihm bestimmt nicht helfen, indem ich die Lücken freiwillig fülle.
»Okay. Sieht aus, als hätte jemand Ihnen übel mitgespielt, was?« K mustert mich und deutet vage auf sein Gesicht. Ich bereite mich auf weitere Fragen vor, doch er scheint es sich anders zu überlegen und schüttelt den Kopf. »Hören Sie, es ist ein einfacher Job. Sie drehen Ihre Runden, passen schön auf und halten den Aufsichtsrat auf dem Laufenden. Mit den Bewohnern und dem ganzen Zeug haben Sie nichts zu tun, aber Sie halten die Ohren offen, ob es irgendwelche Vorwarnzeichen gibt. Das System reagiert manchmal recht langsam, und jede Minute zählt, wenn …«
»Moment, Moment. Bewohner?«, unterbreche ich und beuge mich vor. Das Herz rutscht mir in die Hose. »In Ihrem Post stand, das Schiff wäre leer.« Eigentlich hieß es nur, dass es auf Dock liegt, und ich bin davon ausgegangen, dass das leer bedeutet, aber trotzdem.
Er verzieht das Gesicht. »Ist es auch. Streng genommen.«
Streng genommen? Das reicht mir nicht.
»Mr. K oder wie auch immer Sie heißen«, beginne ich.
»Karl«, wirft er ein.
»Schön, Karl. Das Schiff hat entweder Passagiere oder nicht.«
»Es ist beides. Irgendwie«, weicht er aus.
»Okay«, zwinge ich mich zu sagen und greife nach dem Holocomm. »Ich denke, es ist an der Zeit, das Gespräch zu beenden.«
»Bewohner ist der Begriff, den der Aufsichtsrat bevorzugt«, antwortet er hastig. »Aber es ist nicht so, wie Sie denken.«
»Aufsichtsrat? Sie erwähnen ständig einen Aufsichtsrat.« Klar, Konzerne, die so groß sind, dass sie eigene Schiffe besitzen, haben meistens auch einen Aufsichtsrat. Aber für die Instandhaltung derselben ist eine entsprechende Abteilung zuständig.
Seine Unsicherheit ist deutlich zu sehen. »Es ist die Elysian Fields«, sagt er schließlich verdrossen.
Ich lasse mich überrascht in meinen Stuhl sinken, bevor ich es verhindern kann. »Das ist ein Scherz, oder? Die gibt es noch?«
Verärgerung huscht über sein Gesicht. »Warum fragen das alle? Das Ding geht nirgendwohin.«
Ich ziehe die Augenbrauen hoch.
Er stößt einen entnervten Laut aus. »Ja, okay. Außer auf seinem vorprogrammierten Kurs …«
Also kein Dock. Aber auch kein normales Schiff. Ich verstehe, dass er das nicht in einem Post auf einem illegalen Stellenportal erwähnen wollte.
»Ich erinnere mich, dass sie vor dreizehn, vierzehn Jahren geschlossen wurde«, sage ich. Meine Klasse muss eine der letzten Gruppen gewesen sein, die dort waren. Damals war ich zwölf.
»Richtig, für Touristen. Aber die Winfeld-Stiftung stellt sicher, dass alles weiterhin funktioniert.« Er wirft einen angewiderten Blick über die Schulter. »Gerade noch so.«
Die Elysian Fields ist ein Relikt aus grauer Vorzeit. Inzwischen wahrscheinlich über hundertfünfzig Jahre alt. Ich weiß nicht mehr genau, wann sie gestartet ist. Es war in den frühen Tagen der Systemerschließung. Auf dem Mars und dem Mond wurden schnell wachsende Kolonien gegründet, und es gab einen unglückseligen Versuch auf der Venus. Nicht zu vergessen die ersten Wohnstationen. Es lebten mehr Menschen im Weltraum als je zuvor.
Und sie starben auch dort. Durch Unfälle wie auf Venusia II oder aus ganz normalen Gründen wie Alter und Krankheit.
Was die nie zuvor in Betracht gezogene Frage aufwarf, was man mit den Verstorbenen machen sollte. Bei großen Kontaminationsereignissen wie der Tragödie auf dem Ferris-Außenposten war das Protokoll damals dasselbe wie heute: Die Toten, ihre Habitate und Ausrüstung wurden zu Asche verbrannt. Bei Einzelpersonen war es allerdings komplizierter. Einäscherung verschmutzte die kostbare Atemluft. Beerdigung innerhalb der Wohnkuppeln kostete wertvolles Land, das für den Anbau von Ackerfrüchten oder für Habitate genutzt werden konnte. Ins-All-Schießen schuf Minenfelder aus winzigen menschlichen Projektilen im Orbit der Stationen, was es für Schiffe schwierig machte, kollisionsfrei zu landen. Und manchmal auch extrem gruselig.
In diesem narrativen Raum wurde Zale Winfeld, Milliardär und Tech-Genie, zum Helden. Winfeld hatte im fortgeschrittenen Alter eine dieser »Bekehrungserfahrungen« gemacht, nur dass er, anstatt Gott zu finden, glaubte, Gott hätte ihn gefunden. Er habe eine Vision gehabt, sagte er. Gott habe ihn auserwählt, das Wort von der neuen, kommenden Welt zu verbreiten. Also kaufte er ein ehemaliges Lazarettschiff und ließ es auf den neuesten Stand der Kryotechnik umbauen. Laut Winfeld war der Tod nur vorübergehend, bis die Technologie so weit wäre und jedem ewiges Leben ermöglichte. Den Tod zu besiegen, das sollte sein großes Vermächtnis werden. Natürlich gegen Bezahlung.
Ironisches Detail: Winfeld selbst bekam keine Gelegenheit mehr, von seiner Innovation zu profitieren. Er verschwand nicht lange, nachdem seine drei Kinder (und seine vierte Frau) bei einem Shuttle-Unglück ums Leben gekommen waren. Seine Firma behauptete zwar verzweifelt, er habe sich nur aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen. Aber hartnäckige Gerüchte besagten, dass er Selbstmord begangen hatte, weil er nicht bereit war, ohne seine Familie »gerettet« zu werden.
Schließlich wurde das Schiff fast ein Jahrhundert später in ein öffentliches Denkmal und eine Bildungsstätte (aka Einnahmequelle) umgewandelt. Ein Schulkinderausflug mit Geschichtsstunde und einer Prise morbidem Gaffen. Nicht allzu ungewöhnlich, wenn man bedenkt, dass die Menschen vor ein paar Jahrhunderten auf den Friedhöfen der Erde Picknicks machten und mumifizierte Leichen in Museumsvitrinen anstarrten.
Trotzdem seltsam.
Ich erinnere mich, wie ich durch die Scheibe eines Kryotanks auf eine gealterte Popikone blickte, die schon tot war, bevor meine Großmutter überhaupt geboren wurde. Ihre hellbraunen Wangen waren so perfekt erhalten, dass ich Spuren von Make-up und den zarten Flaum auf ihrer gefrorenen Haut erkennen konnte. Glasvitrinen in ihrem »Zimmer« beherbergten paillettenbesetzte Tour-Outfits, Gitarren und Kopien der Ringe aus ihrer berüchtigten Ehe mit einem Vid-Darsteller, die weniger als eine Woche hielt. Um uns herum wirbelten Holos ihres jungen Selbst, während die Jungs aus meiner Klasse erfolglos versuchten, durch den mattierten Teil der Scheibe ein Stückchen nackten Intimbereich der Leiche zu erspähen. Oder, da es ja angeblich nur vorübergehend war, Beinahe-Leiche.
Die »Show«, in der KI-Versionen von Winfelds verstorbenen erwachsenen Kindern uns auf dem Schiff willkommen hießen und die Vorzüge eines Besuchs auf der Elysian Fields anpriesen, war besonders unheimlich. Selbst jetzt läuft es mir bei der Erinnerung daran kalt den Rücken herunter.
Die meisten »Toten-Schiffe« all der Winfeld-Imitatoren haben schon vor langer Zeit dichtgemacht, vor allem, seit sich die Bio-Einäscherung als praktische Lösung durchgesetzt hat.
Aber die Elysian Fields gibt es anscheinend immer noch.
»Das Upgrade rechtzeitig abzuschließen und gleichzeitig ihre dämlichen Sicherheitsanforderungen einzuhalten, ist schlicht unmöglich. Aber der Aufsichtsrat weigert sich, jemanden einzustellen, der mir dabei hilft, also hole ich Sie an Bord. Inoffiziell«, spricht Karl weiter.
Illegal, meint er. Die Elysian Fields ist ein Erdenschiff der ehemaligen Vereinigten Staaten, also gilt das Erdrecht. Und das bedeutet, dass ein VK-Ausweis mit den darauf hinterlegten Referenzen zwingend erforderlich ist und Erdenbürgerschaft zumindest sehr erwünscht. Eine weitere Methode, wie die alten Regierungen versuchen, den Fortschritt aufzuhalten, indem sie hohe Geldbußen und sogar kurze Gefängnisstrafen für Arbeitgeber verhängen, die sich nicht an die Regeln halten. Die Winfeld-Stiftung würde dieses Risiko niemals eingehen.
Karl anscheinend schon.
»Falls wir erwischt werden, werde ich natürlich sagen, dass die von Ihnen eingereichten Referenzen offensichtlich gefälscht waren«, fährt er gelassen fort.
So läuft der Hase also.
Das Fälschen von VK-Referenzen bedeutet automatisch eine zehnjährige Strafzeit in einem der Asteroiden-Bergbaucamps, weshalb ich diesen Weg eigentlich vermeiden wollte. Bisher habe ich mit nichts, was ich getan habe, gegen die Regeln verstoßen, sondern sie nur … ein bisschen sehr verbogen. Ich will immer noch mein altes Leben zurück. Eines Tages.
»Natürlich«, erwidere ich trocken.
»Aber ich bin sicher, dass wir beide es vorziehen würden, wenn es gar nicht erst so weit kommt«, beendet er den Satz.
Falls doch, stünde sein Wort gegen meines, und Karl wäre wahrscheinlich überrascht, wer alles bereit ist, für mich zu kämpfen. Und sei es nur, um mich wieder unter Kontrolle zu haben. Wie dem auch sei: Karl will keinen Ärger und ich auch nicht.
Und der Hauptvorteil dieser Vereinbarung bleibt bestehen: Ich hätte ein Versteck, wo mich niemand finden oder auch nur ernsthaft nach mir suchen würde. Auch nicht das riesige Kontaktnetzwerk meines ehemaligen Arbeitgebers. Ich müsste nicht mehr mit dem Rücken an die Tür gelehnt schlafen – was ohnehin nichts bringt, wie ich mittlerweile weiß. Instinktiv berühre ich mit dem Finger die Schwellung unter meinem Auge.
Ein weiteres lautes metallisches Kreischen auf Karls Seite der Verbindung. »Ich muss Schluss machen. Wenn Sie glauben, dass Sie es schaffen, ohne durchzudrehen wie der letzte Typ, haben Sie den Job. Siebenhundertfünfzig Credits. Ich erwarte eine Trinkwasserlieferung von EnExx17 in, äh, zwölf Stunden. Wenn Sie …«
»Siebenhundertfünfzig Credits pro Stunde? Das ist nach VK-Regeln gerade mal Mindestlohn.«
Er schnaubt genervt. »Siebenhundertfünfzig Credits pro Tag.«
Ich starre ihn entgeistert an. Bei Siebenhundertfünfzig Credits pro Tag würde es sechs, fast sieben Monate dauern, bis ich genug für den Rückflug in die Zivilisation gespart hätte. Viel länger, als ich vorgehabt hatte, im Nirgendwo zu verschwinden. Und das auch nur dann, wenn ich in der ganzen Zeit nichts ausgebe.
»Unterkunft und Verpflegung sind enthalten«, erinnert mich Karl. »Und was die VK-Regeln angeht, können Sie mich gerne anzeigen.« Er grinst.
»Tausendzweihundert«, sage ich schnell.
Wieder ein lautes Krachen irgendwo in Karls Umgebung. »Tausend Credits. Mein letztes Angebot. Falls Sie annehmen, seien Sie in zwölf Stunden auf dem Transportschiff. Terminal B, Gate 34.«
Die Projektion verschwindet, und die Verbindung wird unterbrochen, noch bevor ich etwas erwidern kann.
Ich lehne mich in meinem Stuhl zurück und starre auf die Stelle, an der das Hologramm eben noch war. Karls Angebot ist absolut lächerlich, ganz zu schweigen davon, dass es illegal ist. Aber wenn ich ablehne, findet er mit Leichtigkeit Ersatz. Als ich meine Informationen an ihn geschickt habe, stand der Antwortenzähler in der oberen Ecke des Posts bereits auf über Hundert und tickte munter weiter.
Als dann die Einladung zu einem Vorstellungsgespräch im Sieben Faden kam, war ich überrascht. Überrascht und erleichtert. Falls das Wort Erleichterung die Wärme in den Muskeln, die sich seit Monaten das erste Mal wieder entspannen, und das schwindelerregende Gefühl eines echten, tiefen Atemzugs angemessen vermittelt.
Es war einer dieser Momente, in denen man merkt, wie angespannt man die ganze Zeit über war und endlich einen Ausweg aus einer Situation sieht, die sich wie ein Sechshundert-Tonnen-Barock-Cruiser auf der Brust angefühlt hat.
Aber … ein einsames Schiff voller Toter, ganz allein? Bis auf einen Typen, der seinen potenziell kriminellen Charakter bereits eingeräumt hat, als er dieses Jobangebot ausgeschrieben hat?
Mir läuft es kalt den Rücken runter. Nicht gerade ideal.
Doch so gruselig es auch ist, ich war zumindest schon einmal auf der Elysian Fields. Und der Job klingt simpel.
Außerdem bin ich nicht sicher, ob ich eine Alternative habe.
Erst vor zwei Nächten wurde ich unsanft geweckt, als fremde Hände mich von meiner dünnen Matratze herunterzerrten. Ein Schlag seitlich gegen den Kopf ließ mir schwindlig werden, eine Faust packte mich an den Haaren und drückte mich zu Boden, während jemand knurrte: »Sei still, wenn du weißt, was gut für dich ist.«
Ich war wie betäubt, während eine leise Stimme in meinem Kopf hartnäckig protestierte, dass das unmöglich passieren konnte, auch wenn ich mehr oder weniger damit gerechnet hatte. Ich war doch so vorsichtig!
Meine Angst, so scharf und grell wie die Schneide eines Messers, das in der Dunkelheit aufblitzt, fühlte sich unwirklich an. Nicht wie der verschwommene, gesichtslose Schrecken eines Albtraums, sondern aus schierem Unglauben darüber, dass das Leben mein falsches Sicherheitsgefühl überrollte wie ein Hochgeschwindigkeitszug.
Als meine Betäubung wenige Sekunden später wieder nachließ, bäumte ich mich auf, trat und schlug um mich. Ich ließ mich nicht so einfach verschleppen. Und wenn sie mich töten wollten, würde ich es ihnen nicht leicht machen.
Der Kampf brachte mir eine wahrscheinliche Fraktur der Augenhöhle, eine Gehirnerschütterung und mehrere gebrochene Rippen ein. Das Auto-Doc-Holo konnte ohne weitere persönliche Informationen, die ich nicht preisgeben wollte, nur eine 75%ige Diagnose stellen.
Doch ich wurde nicht aus dem Raum gezerrt und habe auch kein Messer zwischen die immer noch schmerzenden Rippen bekommen.
Dafür hat der Kerl alle meine Hardcredits mitgenommen. Ohne meinen VK-Ausweis bin ich auf einen physischen Guthabenchip angewiesen, auf dem der Großteil meines Geldes gespeichert ist. Nachdem er den gefunden hatte – schlecht versteckt in der Spitze meines Stiefels, wie ich jetzt weiß –, verschwand er wieder.
Ein schlichter, hässlicher Raubüberfall. Beruhigend in seiner Alltäglichkeit, wenn auch sonst nichts.
Oder sie wollten es nur so aussehen lassen.
Ich versuche, die leise Stimme in meinem Hinterkopf zu ignorieren.
Es ist ja nicht so, dass mein Guthabenchip ein großes Geheimnis wäre. Die rosafarbene Narbe an der Stelle auf meinem Handrücken, wo früher mein VK-Implantat war, ist ein untrügliches Zeichen dafür, dass ich ein anderes Zahlungsmittel benutzen muss. Was mich zu einem offensichtlichen Ziel für Kriminelle macht, die aufmerksam genug hinschauen.
Das Problem ist nur, dass ich mir nicht sicher sein kann.
Du hast die Linie auf seinem Handgelenk gesehen.Wie viele Leute tragen eine solche Tätowierung?
Ich weiß nur nicht, was genau ich gesehen habe. Vielleicht war es der Schlussschnörkel am Ende eines bekannten lateinischen Ausspruchs, der unter dem Ärmel des Eindringlings hervorlugte, während er mich festhielt. Oder auch nicht.
Das Gehirn ist in Stresssituationen notorisch unzuverlässig, und es war nur ein flüchtiger Eindruck. Vielleicht habe ich mich von meinen Sorgen überwältigen lassen und die Lücken mit meinem Worst-Case-Szenario gefüllt.
Mit etwas, das aussieht wie »mors mihi lucrum«?Im Ernst?
Die Erinnerung – der kalte Metallboden, der gegen mein Gesicht drückte, der beißende Schweißgeruch des Mannes, der seine raue Hand in mein Haar gekrallt hatte – erfüllt mich mit einem Blitz aus purer, gleißender Angst.
Wenn sie es waren …
Ich weigere mich, den Gedanken weiter zu verfolgen, und schüttle den Kopf. Es spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass ich nicht so unsichtbar bin, wie ich gedacht hatte. Und wenn mich schon Kriminelle so leicht finden können, was ist dann erst mit den Profis, die möglicherweise nach mir suchen?
Das Risiko kann ich nicht eingehen.
Ich stehe auf und greife nach dem Holocomm. Das Leben ist voller schwerer Entscheidungen, doch das hier ist keine davon. Von Toten habe ich nichts zu befürchten, und ein halbseidener Typ ist nichts im Vergleich zu einer ganzen Raumstation voll davon.
Ich ziehe meine Jacke fester um mich und gehe zur Theke. Die Barkeeperin ist mit einem anderen Gast beschäftigt, einem Mann, der über den Tresen gebeugt dasteht, das Gesicht von mir abgewandt. Er ist ganz in Schwarz gekleidet, was hier draußen ungewöhnlich ist. Sein Hemd und seine Hose sind makellos. Nicht ein einziger Salzfleck ist darauf zu sehen.
Wie, sagen wir, die Uniform eines Untersuchungs-und-Vollstreckungs-Agenten der VK. Nur ohne all den Schnickschnack, ohne Tressen und Divisionsabzeichen, damit er weniger auffällt.
Scheiße. Ich schnippe das Holocomm auf den zerkratzten Tresen, drehe mich um und gehe zur Tür. Schnell.
»Hey«, ruft mir die Barkeeperin hinterher.
Ich erstarre, mein Herz zappelt in meiner Brust wie ein kleines verängstigtes Tier.
»Ja?«, zwinge ich mich zu sagen, ohne mich umzudrehen. Niemals umdrehen.
»Dieser Typ hat hier schon öfter Leute interviewt«, sagt sie voller Abscheu. »Ich habe nie einen davon zurückkommen sehen.«
Weil sie in Panik geraten und mitten in der Nacht abhauen. Zumindest beim Letzten war es so. Wenn stimmt, was Karl gesagt hat.
Ich nicke. »Danke«, sage ich und gehe weiter, halb in Erwartung eines Schreis aus der Kehle des potenziellen UV-Agenten oder, schlimmer noch, einer Hand, die mich an der Schulter packt. Aber ich schaffe es unbehelligt bis in die Halle.
Vorerst.
Doch egal, ob die Sache mit der Elysian Fields klappt oder nicht, hierher werde ich so oder so nicht zurückkommen.
2
Terminal B, das Transportdeck, ist ein einziges Chaos aus Farben und Geräuschen. An der Decke flackern versagende Lichtröhren in kränklichem Gelb und stumpfem Graublau. Dutzende von Stimmen überlagern sich in ebenso vielen Sprachen und konkurrieren mit den Flugkapitänen, die die letzten Passagiere aufrufen. Essensverkäufer buhlen um Aufmerksamkeit für ihre heißen und (theoretisch) frischen Waren. All dies immer wieder unterbrochen von den monotonen Abflugs- und Ankunftsansagen aus dem Stationscomm, was alles zusammengenommen einen Lärm erzeugt, dass sich die Luft um mich herum anfühlt, als müsste sie eigentlich fest sein.
Ich senke den Kopf und halte so unauffällig wie möglich nach UV-Agenten Ausschau. Den von der Bar habe ich nicht mehr gesehen. Aber jetzt, wo ich hier bin, so kurz vor der Flucht, erscheint es mir geradezu unausweichlich, dass sie zu Dutzenden in den Schatten lauern und nur darauf warten, mich zu ergreifen.
Ich presse den losen Kragen meines Sweaters über meine Nase, um den Geruch abzuhalten. Hier oben stinkt es, trotz der höheren Ebene. Über dem Duft der am Spieß rotierenden Sojawürstchen mit Speckgeschmack, der süß-salzigen Teriyaki-Nudeln vom Stand ein Stück weiter weg und des Kuchen-Frittieröls irgendwo hinter mir liegt ein starker Geruch nach faulen Eiern und altem Fisch. Ich muss fast würgen und presse den Stoff noch fester auf meinen Mund, als würde das helfen, die Atemluft zu filtern. Aber diesem Geruch kann man nicht entkommen, nicht hier. Das ist die Lake.
Riesige Fässer davon werden zu den verschiedenen Transportschiffen gekarrt, die sie zu nahe gelegenen Stationen fliegen. Die meisten aber gehen zu größeren Depots, die sie an teilweise weit entfernte Orte bringen. Sogar bis zur Erde.
Auch Trinkwasser rollt auf rumpelnden Wagen vorbei. Die Fässer sind groß und durchsichtig, um die Qualität des Produkts zu unterstreichen. Auf allen prangt das EnExx17-Emblem – genauso wie auf den Uniformen der gut bewaffneten Sicherheitsleute, die jede Ladung begleiten.
Nicht, dass sich hier irgendjemand dafür interessieren würde. Sauberes Wasser ist auf dieser Station kein Thema. Es ist der Grund, warum die meisten der Arbeiter den Job angenommen haben. Es ist eine Art Zusatzleistung zum normalen Lohn. Auch wenn es die Leute auf andere Art teuer genug zu stehen kommt.
Erschöpft aussehende Salzer unterhalten sich in kleinen Gruppen, während sie darauf warten, zu einer anderen EnExx-Station geflogen zu werden. Einige haben ihre Familien dabei, auch Kinder sind darunter. Sie tragen anständige Kleidung vom Tauschmarkt, aber sie sind zu leise, zu dünn. Ihre aschfahle Haut zeugt von zu viel Zeit in den unteren Etagen, ohne Zugang zum begrenzten Sonnenschein oder gar den Sonnenlichtern in den simulierten Außenbereichen, die angeblich für alle da sind. Ihre knubbeligen Gelenke zeichnen sich deutlich unter der Kleidung ab, was bedeutet, dass sie nicht genug Nährstoffe über echtes Essen bekommen und stattdessen auf VitaPlex angewiesen sind. Entweder wird keines geliefert, oder die höheren Führungskräfte teilen es nicht. Und niemand von den Verantwortlichen kümmert es.
Oder sie werden dafür bezahlt, nicht hinzusehen.
Eines der Kinder, ein Junge von etwa acht Jahren, zeigt auf den Kuchenverkäufer hinter mir. Der Vater drückt die Hand des Jungen wieder nach unten und sagt leise etwas zu ihm.
Ich kann die Worte zwar nicht hören, aber das muss ich auch nicht.
Meine Augen brennen, und ich muss den Blick abwenden. In meiner Tasche, die ich fest unter den Arm geklemmt halte, sind nur ein paar Kleidungsstücke und Toilettenartikel, nichts von Wert. Wenn ich das Geld hätte, würde ich dem Jungen und seinen Schwestern Kuchen kaufen. Das würde mich zwar nicht annähernd von meiner Verantwortung reinwaschen, aber ich habe das Geld so oder so nicht. Nachdem ich meine Bezahlung für die Nächte, die ich nun nicht mehr im Hostel verbringen werde, von der feindseligen Managerin zurückgefordert hatte – sie behauptete irgendetwas von einer Kaution und wollte die Credits behalten, bis ich auf mein ramponiertes Gesicht deutete und ihr sagte, dass ich gerne publik machen könnte, welche Art Etablissement sie hier betreibt (was ich natürlich nicht konnte, aber das wusste sie ja nicht) –, reichte es gerade für ein Ticket von hier weg.
Ich greife in meine Hosentasche und schließe die Hand um den abgenutzten blauen Plastikchip, in den die Kennung meines Transporters geritzt ist. Denn ich habe keinen VK-Ausweis mehr, auf den ich das Ticket laden könnte. Eine weitere Erinnerung an meinen derzeitigen Status: den einer Nicht-Person.
Es war die beste Wahl, die ich hatte. Die einzige Wahl, die mir noch blieb.
Wenn du dich zusammengerissen hättest und geblieben wärst, mitgespielt hättest wie ein anständiges Teammitglied …
Schuldgefühle überrollen mich, und ich wende mich ab, suche nach irgendetwas anderem, mit dem ich mich ablenken kann. Ein ramponiertes Display, auf dem weiße Linien über die Transporternummern und Abflugzeiten flimmern, hängt schief an der gegenüberliegenden Wand.
Es ist fast unmöglich, die Anzeige zu lesen, aber das spielt keine Rolle. Hauptsache, sie bietet meinen Augen für den Moment Zuflucht.
Bis eine Liste von Namen darauf erscheint, jeder davon mit dem Zusatz VERMISST.
Grigory Eachairn
Julia Jordan
Caspian Ahmad
Shikoba Ludwig
Johannes Salvi
Trinity Boothe Hopkins
Astra Sandberg
Giannina Ngo
Und jedes Bild wird von dem Refrain begleitet: Bitte melden Sie jede Sichtung! Hohe Belohnung! Wir wollen, dass unsere Kinder/Eltern wieder nach Hause kommen!
Familien auf der Suche nach geliebten Mitgliedern, die auf EnExx17 verschwunden sind. Sie müssen wirklich sehr verzweifelt sein, wenn sie sich auf diesem Weg an die Leute wenden.
Manche davon sind wahrscheinlich Ausreißer. Eine Handvoll könnte auch Opfer von Menschenhändlern geworden sein, wenn man die Zahl der Transporter bedenkt, die hier stündlich ablegen. Aber aufgrund meiner bisherigen Erfahrung auf EnExx17 würde ich wetten, dass ein guter Prozentsatz im Daze-Rausch in die unteren Ebenen hinabgestiegen und nie wieder aufgetaucht ist. Irgendwann werden sie für tot erklärt und manchmal viele Monate – oder Jahre – später als muffig riechender Knochenhaufen in einem vermeintlich versiegelten Tunnel gefunden.
Ich kann den Blick nicht mehr von dem Display abwenden. Während ich die Gesichter über mir flackern sehe, denkt sich ein Teil meines Gehirns automatisch mögliche Programme und Initiativen aus, mit denen sich das Problem lösen ließe. Von der Einführung einer Reha-Einrichtung auf der Station (natürlich VK-finanziert), bis hin zu strengeren Auflagen für Frachtunternehmen, die versucht sein könnten, mit Menschen als Ware noch ein bisschen Extravermögen zu verdienen.
Bis mein eigenes Gesicht erscheint. Genau dort, auf dem Display über mir.
Meine Lunge krampft, und ich kann mich nicht mehr bewegen. Der Lärm des Terminals verschwindet, zurück bleibt nur ein hohes Summen in meinen Ohren.
Wer … Wie haben sie …
Es dauert einen Moment, bis mein stotterndes Gehirn wieder in der Lage ist, Informationen zu verarbeiten, doch schließlich sickern mehr Details durch. Der Name neben dem Gesicht. Der letzte bekannte Aufenthaltsort, hier auf EnExx17, irgendwo auf SL-19. Die Kontaktdaten ihres Bruders.
Ich blase mit einem leisen Rauschen meinen angehaltenen Atem aus. Das bin nicht ich. Ich habe nicht mal einen Bruder.
Dieses Mädchen, Sarai, ist einige Jahre jünger und sieht meinem früheren Ich mit den blonden Haaren und den blauen Augen nur oberflächlich ähnlich. Mein paranoider, übermüdeter Verstand hat die Lücken lediglich falsch gefüllt.
Außerdem würde dein Gesicht nicht auf diesem Display für panische Familien erscheinen. Sondern auf dem Holocomm jedes Sicherheitsbeamten und UV-Agenten auf der gesamten verfluchten Station.
Jesu, ich muss schleunigst hier weg.
»Hey, Kleine, bewegst du dich auch mal?«, schreit ein Mann hinter mir auf Russisch.
Die Schärfe seines Tonfalls schafft es tatsächlich, den Lärm um mich herum und in meinem Kopf zu übertönen. Ich drehe mich um.
Der Erste Maat, bei dem ich mein Ticket gekauft habe, ein breiter Kerl mit Glatze und beeindruckendem Bart, steht wild gestikulierend da. Seine weit ausholenden Bewegungen sind in jeder Sprache verständlich. Die kleine Gruppe wartender Passagiere, darunter auch der Vater mit seinen Kindern, ist verschwunden. Vermutlich bereits an Bord gegangen.
»Immer mit der Ruhe, Väterchen, ich komme ja schon!«, schreie ich ohne Nachdenken auf Russisch zurück.
Seine Augenbrauen heben sich.
Ich ignoriere seinen überraschten Gesichtsausdruck und gehe mit laut über den verdreckten Boden knirschenden Stiefeln an ihm vorbei die Laderampe hinauf.
»Alles klar, Dewotschka«, murmelt er hinter mir.
Das Innere des Schiffs sieht genauso aus wie bei jedem anderen Transporter, mit dem ich bisher gereist bin. Das heißt, genauso wie bei dem, mit dem ich hergekommen bin. Ein ehemaliger Frachtraum, der zu einem Passagierbereich umgebaut wurde, weil niedrigere Lizenzgebühren die Beförderung von Menschen profitabler als die von Waren gemacht haben. Etwa dreißig Sitze von unterschiedlicher Farbe und unterschiedlichem Alter sind wahllos in schiefen »Reihen« auf den Metallboden geschraubt. Eine Handvoll unregelmäßig angeordnete, in die Seitenwände eingelassene Fenster lassen ein bisschen zusätzliches Licht herein und bieten etwas, das man mit viel gutem Willen als Aussicht bezeichnen könnte. Alle anderen Passagiere haben ihre Plätze bereits eingenommen und unterhalten sich leise, Taschen werden raschelnd an ihren Platz geschoben, Sicherheitsgurte klicken.
Ich steuere auf den einzigen freien Sitz zu. Er ist direkt an die Seitenwand gequetscht und damit der erste, der im Fall eines Risses im Rumpf nach draußen gesaugt würde. Und wahrscheinlich nicht ganz legal. Ein Mann, ein EnExx-Manager der mittleren Ebene, wie man an dem blitzsauberen beigen Overall und dem Buchstabencode auf der Brust erkennen kann, sitzt auf dem Platz direkt daneben und versperrt mir den Weg. Er hat die Augen geschlossen und die Hände auf seinem Schoß gefaltet.
Ich kenne den Trick. Er will die »Reihe« für sich allein. Das geht aber nicht, wenn nur noch ein einziger Platz frei ist.
»Entschuldigen Sie«, sage ich mit leiser, aber fester Stimme. »Ich muss hier durch.«
Er zuckt mit keiner Wimper.
»Sir?«, versuche ich es noch einmal.
Wieder nichts.
Mein Temperament flammt auf. Ich will weg von hier, und dieser Typ scheint fest entschlossen, mir das Leben schwer zu machen. Seine Mitarbeiter hassen ihn wahrscheinlich. Ein selbstgefälliges Arschloch, das glaubt, besser als alle anderen zu sein, nur weil es ein winziges Stückchen der Welt regiert. Vor allem besser als eine nervige Frau in abgetragenen Klamotten vom Tauschmarkt, die glaubt, sie hätte ein Recht auf den Platz, der in seiner Gedankenwelt ihm allein gehört.
Na schön.
»Sir, ich glaube nicht, dass Sie sich in der Öffentlichkeit an dieser Körperstelle berühren sollten.« Nicht zu laut, ich will schließlich kein Aufsehen erregen. Er soll nur glauben, dass ich es könnte.
Mittelmanagementarschloch fährt hoch, reißt die Augen auf und die Hände von seinem Schoß weg, als stünden seine Oberschenkel unter Strom. »Tue ich gar nicht!«, schimpft er los.
Ich lächle höflich. »Entschuldigung. Mein Fehler.«
Er starrt mich an und windet sich schließlich schnaubend aus seinem Sicherheitsgurt.
Das funktionierte besser, als ich noch einen knackigen Anzug mit Abzeichen am Revers trug, dazu den VK-Ausweis auf dem Handrücken – den manche als Freibrief für Missbrauch und Misshandlung ansahen – statt der immer noch verheilenden Narbe von der Entfernung desselben.
Es klappt trotzdem.
Mit grimmiger Genugtuung trete ich zurück, damit er aufstehen und aus dem Weg gehen kann. Da höre ich in dem unbehaglichen Schweigen, das sich manchmal über zu dichte Menschenansammlungen legt, eine Frauenstimme hinter mir, klar, sanft und professionell.
»… zu Beginn von Woche sechs der Anhörung. Der neu gewählte Premierminister der Vereinigten Kolonien, Bierhals, hat die Anschuldigungen wiederholt bestritten, sie wörtlich als lächerliche Verleumdungskampagne bezeichnet, um seinen guten Namen in den Schmutz zu ziehen.«
Ich erstarre, mein Gehirn schreit mir widersprüchliche Befehle zu: Duck dich!
Tu so, als ob alles in Ordnung wäre!
Ich schaffe es, mich umzudrehen, um herauszufinden, woher die Frauenstimme kommt.
An die Trennwand am vorderen Ende der »Fluggastkabine« wurde ein alter, an den Rändern anscheinend von silbernem Klebeband zusammengehaltener Vid-Screen geschweißt. Offenbar ein Extra des Reiseveranstalters. Im Moment zeigt er ein fragmentiertes, immer wieder springendes Bild der SNN-Politkorrespondentin Lanna Charles. Es ist zwar kein Holo, aber auch so schon schlimm genug.
Mein Herz pocht sofort vor Angst.
Werden sie Archivmaterial einblenden, irgendeinen Mitschnitt mit meinem Gesicht im Hintergrund? Schlimmer noch, was, wenn sie die Pressekonferenz wiederholen?
»Setzen Sie sich jetzt oder nicht?«, fragt Managerarschloch unangenehm laut.
Ich drehe mich automatisch zu ihm und seinen rot glühenden Wangen um. Die anderen Passagiere starren ihn an. Und mich.
Setz dich. Halley Zwick hat keinen Grund, sich für diese Geschichte zu interessieren. Los, runter mit dir!, fährt die vertraute, gereizte Stimme in meinem Kopf mich an.
Ich kehre dem Bildschirm den Rücken zu, tue, als gäbe es ihn nicht, und quetsche mich an Managerman vorbei. Dann stelle ich meine Tasche ab und zwinge mich, meinen Platz einzunehmen. Neben mir lässt sich Mittelmanager mit einem lauten Schnauben in seinen Sitz zurückfallen, zieht ein Holocomm heraus und ruft seine Nachrichten auf. Durch Schicksal oder Pech habe ich zwischen den Kopfstützen der Sitze vor mir freie Sicht auf den Vid-Screen, der unweigerlich meinen Blick auf sich zieht.
»… ein Vertreter des Justizministeriums hat angedeutet, dass die Möglichkeit einer strafrechtlichen Verfolgung von Bierhals wegen mutmaßlicher Anstiftung zum Aufruhr nicht ausgeschlossen werden kann«, fährt Lanna fort. »Er soll Leute in die Menge eingeschleust haben, die sich als Unterstützer seines Rivalen Rober Ayis ausgaben und die Gewalt angestachelt haben, die schließlich zu siebenundzwanzig Verletzten und drei Todesopfern führte. Jedenfalls haben die Vereinigten Kolonien der Station aufgrund des Vorfalls den Status als Beitrittskandidat entzogen. Und der Vorfall hat, wie anonyme Quellen durchblicken ließen, Ayis sehr wahrscheinlich die Wahl gekostet.«
Ayis erscheint auf dem Schirm, mit rotem Gesicht und wild gestikulierend. Ich kann seine Rede nicht hören, aber das ist auch nicht nötig. Es wird um die Missetaten der VK und der veralteten Regierungen der Erde gehen sowie darum, dass jede Station sich selbst an oberste Stelle setzen muss. »One«, wie er sein Programm zur Selbstversorgung der Raumstationen nennt.
Dann wird auf Premierminister Mather Bierhals geschnitten. Jung, gut aussehend und mit bescheidenem Lächeln – zeig nicht immer so viele Zähne, Math –, winkt er der Menge wohlwollend zu. Er bleibt kurz stehen, schüttelt Hände und spricht mit Kindern, wie er es immer tut, um die Sympathien von Presse und Zusehern auf sich zu lenken. Einige Kinder begrüßen ihn mit Weizenbündeln, die in den Ackerkuppeln angebaut wurden. Jugendliche halten Holos ihrer Kunstprojekte hoch, die von Mathers neuem Programm »Kunst ist für alle da« gesponsert werden.
Der Gegensatz ist frappierend. Unter all der Niedergeschlagenheit und Erschöpfung schwillt Stolz in mir. Nur ein bisschen. Die Kamera fängt ein, wie Mather sich mit einem Mädchen unterhält, er nickt und hört konzentriert zu, während sie spricht. Das ist seine Gabe: den Menschen das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden. Hinter ihm folgt sein Team, das diskret Notizen zu jedem Gespräch macht.
Ein seltsamer, dumpfer Schmerz macht sich in meiner Brust breit. Mather zu beobachten, sein Team zu beobachten, ist, als würde ich jemanden, den ich einmal gut gekannt, zu dem ich aber keinen Kontakt mehr habe, am anderen Ende einer belebten Shuttlestation stehen sehen. Ich bin nicht länger Teil seines Lebens.
Ich reiße meinen Blick los und wende mich dem zu, was im Hintergrund des Videos zu sehen ist. Sieht aus wie die Columbia-Hills-Kolonie, wenn ich die pseudogriechischen Architekturelemente in den gedruckten Häusern hinter Bierhals betrachte. Das war damals eine große Sache, eine Abkehr vom praktischen, aber sterilen Hab-Stil, der in den Wohnkuppeln so viele Jahre lang vorherrschend war. Eines von Bierhals’ Verdiensten als Abgeordneter des Neuen Parlaments war, Habitate mehr wie ein echtes Zuhause aussehen zu lassen. Anschließende Studien haben gezeigt, wie sich die geistige und körperliche Gesundheit danach verbesserte.
Theoretisch. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts mehr.
»Vieles wird von den Ergebnissen der laufenden Untersuchung durch den Ausschuss des Neuen Parlaments abhängen. Und der Suche nach Zeugen«, fährt Lanna fort, »was sich angesichts der hohen Fluktuation in der neuen Bierhals-Administration als schwierig erwiesen hat. Manche behaupten, es handele sich gar um eine Verschwörung, die verhindern soll, dass ehemalige Mitarbeiter aussagen.«
Ich spüre die Hitze eines unsichtbaren Scheinwerfers auf mir, den nur ich sehen kann, und lasse mich noch tiefer in meinen Sitz sinken. Plötzlich bin ich dankbar, den Platz direkt an der Außenhülle zu haben. Er fühlt sich geschützter an, weniger sichtbar.
»Hier gibt es beim besten Willen keine Verschwörung, Lanna. Ein Personalwechsel in den ersten Tagen einer neuen Administration ist völlig normal.« Die neue Stimme lässt mich augenblicklich erstarren. Sie hört sich an wie die in meinem Kopf.
Niina.
Abgesehen davon, dass die echte Niina viel trockener klingt. In ihrer Stimme schwingt ein winziger Hauch Irritation mit, der dazu führt, dass man sie sofort zufriedenstellen, sie besänftigen und ihre Zustimmung gewinnen möchte.
Oder vielleicht bin das nur ich.
Zwischen den Sitzen hindurch erhasche ich einen kurzen Blick auf sie. Wie immer strahlt Niina unerschütterliches Selbstvertrauen aus, von dem präzisen Haarschnitt – rundum exakt auf Kinnhöhe –, bis hin zu den kühn geschwungenen schwarzen Augenbrauen. Sie sieht aus, als wäre sie noch nie in ihrem Leben gestresst oder besorgt gewesen. Wie jemand, der seinen Wert kennt, der weiß, welche Macht er hat, und sich keine Mühe gibt, es zu verbergen.
Sie ist exakt so, wie ich einmal sein wollte. Und sie ließ mich glauben, dass genau das möglich wäre.
Ein weiterer Sehnsuchtsschmerz umklammert mein Herz, stärker diesmal, bis ich ihn entschlossen wegdrücke.
Niina hatte ihre Gründe für das, was sie getan hat, und keiner davon hatte etwas mit mir zu tun.
Er ist im Moment zwar nicht zu sehen, aber Harrison Butler, mein Ersatz, ist sicher nicht weit. Bereit, mit Fakten, Kontaktinformationen oder auch bei Niinas aktueller Nikotinfixierung auszuhelfen. Er ist ein hochgewachsener, kameratauglicher Harvard-Absolvent, der gerne Anzüge mit zweireihigem Sakko trägt und tut, was man ihm sagt.
Gut für ihn.
»Der Wahlkampf ist vorbei, jetzt geht es ans Regieren, und manche Leute sind dafür nun mal nicht geeignet. Daher mussten wir einige Anpassungen vornehmen.« Niinas Augen scheinen sich direkt in mich zu bohren, und eine verwirrende Mischung aus Demütigung und Wut lässt mich rot werden. Ich muss den Blick abwenden und mustere die knotige Schweißnaht um das Sichtfenster neben mir, bis ich mich wieder unter Kontrolle habe.
»Das war Bierhals’ Stabschefin, Niina Vincenzik«, sagt Lanna gerade. »Sie hat angedeutet, dass alle Mitglieder des Wahlkampfteams angehalten waren, bei Vorladung auszusagen. Doch es ist schwer, wie einige Stimmen anmerkten, Leute vorzuladen, die nicht auffindbar sind.«
Ich mache mich auf einen Ausschnitt aus der Pressekonferenz gefasst, wie meine Eltern mich »anflehen«, doch wieder nach Hause zu kommen.
Zum Glück leitet die Moderatorin zu einer anderen Story über. Diesmal geht es um eine Getreidekrankheit, die große Teile der Ernte in der New-Boston-Kuppel vernichtet hat, was zu einer Hungersnot auf dem Mond führen könnte, wie man nun fürchtet. Bevor ich es verhindern kann, habe ich schon eine To-do-Liste im Kopf: Kontaktaufnahme mit dem Gouverneur von New Boston, um die dortigen Lebensmittelvorräte überprüfen zu lassen, Aufforderung an unsere Medienkontakte, mehr Aufmerksamkeit auf die drohende Krise zu lenken. Schließlich können sich Menschen nicht für etwas interessieren, von dem sie nichts wissen. Und so lange beim VK-Verbindungsbüro an die Tür klopfen (bildlich gesprochen), bis ich jemanden dazu gebracht habe, die geizigen Bastarde auf der Erde in der RusAmerSino-Allianz um Hilfe zu bitten. Die Bewohner von New Boston zahlen Steuern wie jeder andere auch und …
Nein.
Das ist nicht mehr deine Aufgabe. Nicht mehr dein Platz.
Die Verzweiflung, gegen die ich während der letzten sechs Wochen angekämpft habe, packt mich und zieht mich in die Tiefe.
Es spielt keine Rolle. Nichts davon. Es ist alles Schwachsinn. Machtpolitik und Manipulation. Die Welt ist ein Spiel, und gewinnen kann nur, wer betrügt. Und ich bin endgültig raus aus diesem Spiel, ob zum Guten oder zum Schlechten.
Ich drehe mich weg von dem Bildschirm, hin zur Seitenwand – umso besser, wenn ich als Erste ins All gesaugt werde –, und ziehe mir den zerlumpten Kragen meines Sweaters übers Gesicht, um so zu tun, als würde ich schlafen.
Erschöpfung hilft erstaunlich gut gegen meine ganz persönliche Art von angstbedingter Schlaflosigkeit. Vielleicht liegt es aber auch daran, wieder unterwegs zu sein und das beruhigende Brummen der Maschinen unter meinen Füßen zu spüren, das eine gelungene Flucht verheißt. Schon wieder.
Ich bemerke die Anspannung in meinem Bauch und meinen Schultern erst, als der Transporter das Dock der EnExx17 verlässt und sich die Knoten dort lösen. Keine überraschenden Kontrollen oder sonstige Verspätungen, keine Unterbrechungen durch UV-Beamte, die das Schiff durchsuchen wollen.
Es heißt ja, wenn man sich verirrt hat, soll man bleiben, wo man ist, damit die Suchteams einen finden können. Ich hoffe, das Gegenteil trifft genauso zu.
Ich wache abrupt auf. Mein Nacken ist steif, meine Knie schmerzen wegen der Enge, und ich habe das vage Gefühl, dass ich gerade eine Ansage aus dem Schiffscomm verpasst habe. Der Vid-Schirm ist, Gott sei Dank, dunkel.
Ein kurzer Blick in die Kabine zeigt, dass ich es tatsächlich geschafft habe, mehrere Stopps zu verschlafen, auch den des Managers neben mir. Sein Sitz ist leer, die Gurtenden liegen einfach auf dem Boden, als gingen sie ihn nichts an.
Arschloch. Ich beuge mich nach unten, hebe sie auf und lege sie für den nächsten Fluggast auf den Sitz.
Ein Keuchen auf der anderen Seite der Kabine erregt meine Aufmerksamkeit. Leute beugen sich tuschelnd an die Fenster dort.
Oh, Scheiße.
Meine Hände werden taub. Werden wir angehalten? Jetzt? Hier draußen? Aber als ich mich unter den Blicken der übrigen Passagiere aufrichte und aus dem Fenster schaue, sehe ich nur eine riesige Wand aus Metall, die näher und näher kommt.
Ein anderes Schiff. Und zwar ein großes. Die Frachtraumtüren stehen offen, die Verbindungsbrücke bewegt sich bereits ruckelnd auf uns zu.
»Seht ihr«, flüstert ein Salzarbeiter seinen Kollegen zu. »Ich hab’s euch ja gesagt.«