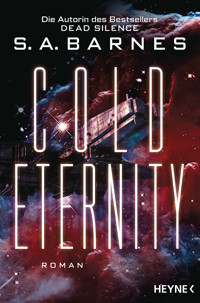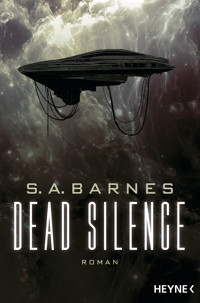9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die Psychologin Dr. Ophelia Bray wird auf das Raumschiff Resilience geschickt, das im Auftrag der Montrose Corporation unterwegs ist, Planeten nach Rohstoffen abzusuchen. Bei der letzten Mission verschwand ein Crewmitglied unter seltsamen Umständen. Ophelia soll herausfinden, ob mehr hinter der Sache steckt als ein tragischer Unfall. Als die Resilience auf dem Planeten Lyria 393-C landet, entdeckt die Crew neben uralten Ruinen einer Alien-Zivilisation eine Station, die scheinbar überstürzt verlassen wurde. Noch während Captain Severin diesem Rätsel nachgeht, kommt es zu einem brutalen Todesfall. Für Ophelia und die Mannschaft der Resilience beginnt ein Kampf ums Überleben – doch die Geister der Station lassen niemanden so einfach gehen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Die Psychologin Dr. Ophelia Bray wird auf das Raumschiff Resilience geschickt, das im Auftrag der Montrose Corporation unterwegs ist, fremde Planeten nach Rohstoffen abzusuchen. Bei der letzten Mission verschwand ein Crewmitglied unter ungeklärten und seltsamen Umständen. Ophelia soll herausfinden, ob mehr hinter der Sache steckt als ein tragischer Unfall. Als die Resilience auf dem Planeten Lyria 393-C landet, entdeckt die Crew direkt neben den uralten Ruinen einer Alien-Zivilisation eine Station der Konkurrenzfirma, die anscheinend überstürzt verlassen wurde. Noch während Captain Severin herauszufinden versucht, was mit den Leuten passiert ist, kommt es zu einem brutalen Todesfall. Für Ophelia und die Mannschaft der Resilience beginnt ein Kampf ums Überleben – doch die Geister der Station lassen niemanden so einfach gehen …
Die Autorin
S. A. Barnes arbeitet tagsüber als Bibliothekarin und schreibt nachts Romane, die sie bisher unter Pseudonym veröffentlicht hat. Für ihr Horror-SF-Debüt Dead Silence wurde sie 2022 mit dem Goodreads Choice Award in der Kategorie Science-Fiction ausgezeichnet. S. A. Barnes lebt mit zu vielen Büchern, zu vielen Hunden und einem sehr geduldigen Partner in Illinois.
Mehr über S. A. Barnes und ihre Werke erfahren Sie auf:
diezukunft.de
S. A. BARNES
GHOST STATION
Roman
Aus dem Amerikanischenvon Michael Pfingstl
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Titel der Originalausgabe:
GHOSTSTATION
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe 02/2025
Redaktion: Sven-Eric Wehmeyer
Copyright © 2024 by S. A. Barnes
Copyright © 2025 dieser Ausgabe und der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: DASILLUSTRAT, München,unter Verwendung von Motiven von Shutterstock.com(Liu Zishan, 3Dsculptor und Vadim Sadovski)
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN 978-3-641-32544-2V002
www.diezukunft.de
Für Allison Klemstein, Nathan Klemstein, Grace Barnes, Josh Barnes und Benjamin Oldenburg. Es ist mir eine unendliche Freude, Teil eures Lebens zu sein. Ich bin so stolz auf euch!
In Liebe,Tante Stacey
PS: Manche von euch werden warten müssen, bis sie älter sind, bevor sie dieses Buch lesen. Viel älter. Wenn ihr es dann tut und danach Albträume habt, weckt bitte eure Eltern nicht. Das wäre schlecht fürs Weihnachtsfest.
1
Nova Kälteschlaf Lösungen, Personalabteilung
New ChicagoErde, 2199
Die Demonstranten draußen werden lauter. Ihre Sprechchöre klingen immer noch weit weg, aber irgendwie klarer als zuvor. Vielleicht liegt es aber auch nur an Ophelias schlechtem Gewissen.
»Montrose tötet!« scheint ihr Lieblingsruf zu sein. Nicht wenige brüllen auch »Scheiß Brays!«, ein nicht totzukriegender Klassiker, wenngleich normalerweise nicht gegen Ophelia persönlich gerichtet.
Doch dieses Mal hat sie es eindeutig verdient.
Sie zuckt zusammen.
»Bitte halten Sie still«, sagt der junge Techniker höflich. Der Griff seiner Handschuhe an ihrem Unterarm verschiebt sich ein wenig, dann führt er die Nadel in den immer noch leicht schmerzenden Port an ihrem Handrücken ein.
»Sorry.« Sie versucht ein Lächeln und zieht den rauen Stoff des Einwegkittels enger um sich. Ophelia liegt auf einem mobilen Untersuchungsbett, unter dem Kittel ist sie nackt, und der Luftzug an ihrem entblößten Hals ist kurz davor, ihre Zähne klappern zu lassen.
Aber das ist in Ordnung. Bald wird ihr noch viel, viel kälter sein.
»Gut«, sagt der Techniker einen Moment später und lässt ihren Arm los. Seine sterilen Handschuhe machen beim Ausziehen ein schmatzendes Geräusch. »Es wird ein paar Minuten dauern, bis die Wirkung einsetzt. Ich bin gleich wieder da.«
Auf seinem digitalen Namensschild steht: »RAYON. Sagen Sie einfach Ray!« Dahinter leuchtet ein Smiley. Ray begegnet ihrem Blick nicht, als er sich auf seinem Rollhocker zurücklehnt und aufsteht, um den kleinen Vorbereitungsraum zu verlassen.
Scham steigt in Ophelia auf, und sie schließt die Augen für ein kleines, selbstsüchtiges Gebet.
Bitte, bitte lass es funktionieren. Es muss.
In der Stille, die nur vom Rattern von Metallrädern auf dem Flur sowie den Sprechchören draußen unterbrochen wird, lässt Ophelias QuickQ ein freundliches Blubb vernehmen. Erleichtert über die Ablenkung – vielleicht ist es ja ein Anruf ihrer jüngeren Schwester –, öffnet Ophelia die Augen.
Aber es ist das Gesicht ihres Onkels, das blau eingerahmt auf ihrem implantierten Interface erscheint. Als hätte er ihre Verzweiflung gerochen.
Scheiße. Ophelia schluckt schwer. Der gute Onkel Dar, gekommen, um mir den Todesstoß zu versetzen.
Aufgrund ihrer Privatsphäre-Einstellungen kann sie Darwin sehen, er sie aber nicht, was die Sache zumindest ein bisschen erleichtert. Das kunstvoll silbern melierte Haar über seiner unnatürlich glatten Stirn ist perfekt gescheitelt. Er ist ganz der schneidige, gut aussehende CEO eines großen Familienunternehmens, der mit seinem privaten Lufthover »spontan« Flüchtlinge aus dem Lager im Grant Park rettet.
Bis er den Mund aufmacht.
»Ich weiß, dass du mich hören kannst, du kleines Miststück«, sagt er durch sein umgängliches Lächeln hindurch. »Ich wollte nur vernünftig bleiben.«
Nein, er hat versucht, bestimmte Strippen bei ihrem Arbeitgeber zu ziehen, was überraschenderweise nicht funktioniert hat. Wahrscheinlich lag es daran, dass Ophelias Familie und ihr Arbeitgeber in gnadenlosem Konkurrenzkampf stehen und einander nur äußerst ungern einen Gefallen tun. Dann lieber Erpressung, Industriespionage sowie Verbreitung von Gerüchten über unappetitliche sexuelle Vorlieben unter den Führungskräften. Und das sind nur die Punkte, von denen Ophelia weiß.
»Du musst wenigstens dieses eine Mal an deine Familie denken. Komm heim nach Connecticut und verhalte dich ruhig, bis die Wogen sich geglättet haben. Diese Carruthers-Frau schnüffelt wieder herum, und du machst alles nur noch schlimmer.« Darwin schnaubt verächtlich. »Jazcinda. Was ist das überhaupt für ein Name?«
Der Name einer hoch angesehenen News-Streamerin. Ihr Channel ist eher der Boulevardpresse zuzurechnen, aber Jazcindas Reportagen sind stets grundsolide. Absolut seriös. Solange man sich keine Sorgen machen muss, dass sie einem das eigene Leben auf den Kopf stellen.
Ophelias Pulssensor gibt ein warnendes Blöken von sich.
Darwin atmet scharf ein und ruckt missbilligend mit dem Kopf. »Ich habe von Anfang an gewusst, dass du nur Ärger machen würdest. Wir hätten dich einfach dort lassen sollen.«
»Ist alles in Ordnung, Dr. Bray?« Ray taucht in der Tür auf und wirft einen fragenden Blick auf Ophelia, dann auf den Vitalmonitor an der Wand. Er ist sehr jung, möglicherweise nur ein paar Jahre älter als ihre siebzehnjährige Schwester. Sein Haaransatz weist diesen kecken Schwung auf, der zwingend eine Veränderung des Erbguts erfordert. Niemand hat von Natur aus einen so perfekten Neunzig-Grad-Winkel.
Ophelia setzt ein genauso beruhigendes wie falsches Lächeln auf. »Natürlich.«
»Geh verdammt noch mal ran, Ophelia!«, brüllt Darwin aus ihrem Implantat. »Du ziehst nur noch mehr ungebetene Aufmerksamkeit auf dich und machst alles noch schlimmer.«
Ihre Halsadern pochen, ihre Hände zittern. Aber es sind nur die Überreste einer Angst aus ihrer Kindheit. Das ist alles. Ophelia erinnert sich noch lebhaft, wie Onkel Darwin sich zu ihr herunterbeugte, um sie wegen irgendeines Fehlverhaltens anzuschreien, egal ob besagtes Fehlverhalten stattgefunden hatte oder nicht. Sie spürt noch immer seinen warmen Speichel auf der Wange, vermischt mit dem bitteren Geruch der letzten Phytopille.
Aber das ist schon lange her. Ophelia ist jetzt erwachsen und weit außerhalb seiner Reichweite. Er wird kaum seinen privaten Sicherheitsdienst herschicken, um sie zu holen. So verzweifelt ist er nicht. Oder so dumm. Dessen ist sie sich ziemlich sicher.
Trotzdem ist es besser, die Sache hinter sich zu bringen.
»Stimmt etwas nicht?«, fragt sie Ray.
Er schüttelt den Kopf und tritt ein. »Ich muss Sie lediglich bitten, alle Kommunikationsimplantate zu deaktivieren«, erwidert er und schließt die Tür hinter sich. »Damit es nicht zu Störungen kommt. Sie werden sie da draußen sowieso nicht benutzen können. All Ihre Nachrichten und Kontakte werden auf das Ihnen zugewiesene Handgelenkcomm übertragen.«
Ophelia setzt sich eilig auf. »Kein Problem.« Sie ruft sich den sechsstelligen Deaktivierungscode für ihr Implantat ins Gedächtnis, während Darwin im Hintergrund weiterbrüllt. Sie hat ihr QuickQ nur in der Hoffnung aktiviert gelassen, dass ihre jüngere Schwester Dulcie – Halbschwester, genau genommen – sich melden würde. Ophelia wird nächsten Monat Dulcies achtzehnten Geburtstag verpassen, auf dem sie »ohne all die Schwachköpfe feiern« wollten, »als ob sie wieder jung wären«.
Aber wie es scheint, ist Dulcie immer noch wütend. Oder die Familie hat sie in die Mangel genommen, was die wahrscheinlichere Möglichkeit ist. Gegen die Brays kommt niemand an.
Der Deaktivierungscode erscheint direkt über Darwins Mund, erst verschwommen, dann immer deutlicher. Ophelia blinzelt zweimal zur Bestätigung, und Onkel Darwin verschwindet.
Wenn es im echten Leben nur so einfach wäre. Wahrscheinlich – nein, definitiv – denkt ihr Onkel gerade genau das Gleiche.
»Sie sollten jetzt langsam schläfrig werden«, spricht Ray weiter. »Und dann …«
Schnelle Schritte auf dem Flur, und sie werden lauter, als würden sie näher kommen.
Ophelia krallt die Finger in die Matratze des Untersuchungsbetts. Als die Schritte innehalten und die Tür zum Vorbereitungsraum aufschwingt, setzt ihr Herz einen Schlag lang aus.
Aber es ist kein maskierter Söldner mit Pinnacle-Logo auf der Brust, wie sie halb erwartet hat, sondern ein weiterer in Weiß gekleideter Techniker. Und er befindet sich in Begleitung einer vertrauten Gestalt, die mit ihren breiten Schultern ein bisschen aussieht wie die Football-Spieler von damals. Die Kopfhaut ist braun und glatt rasiert.
»Julius!« Ophelia sackt erleichtert in sich zusammen und grinst ihn mit einer Mischung aus Freude und Verwirrung an. »Was machst du hier? Ich hab dir doch gesagt, dass nichts passieren kann.«
Julius winkt ab. »Als ob ich dir diesen Quatsch geglaubt hätte.« Er sieht gehetzt aus. Der Knoten seiner altmodischen Krawatte ist gelockert, und der Hemdkragen über seiner leuchtend gelben Weste sitzt schief.
Sie haben gestern Abend bei ihm in der Wohnung eine Abschiedsparty gefeiert. Zu dritt. Oder zu viert, wenn man Marlix mitzählt, Julius’ und Jonathans bereits schlafende Tochter. Das ist jetzt noch keine sechs Stunden her. Es wurde ein wenig zu viel synthetischer Tequila getrunken (Julius und Jonathan) und viel zu viel von einem widerlichen medizinischen Getränk mit Traubengeschmack (Ophelia).
Sie und Julius hatten mit ein paar Jahren Abstand voneinander das Ausbildungsprogramm für Psychologie und Verhaltensevaluation bei Montrose durchlaufen. Aber seit dem Tag, als ihr das schmuddelige kleine Sprechzimmer gleich neben dem von Julius zugewiesen wurde, sind sie nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde. Außerdem hatte er sie nicht ein einziges Mal nach ihrer Familie gefragt oder auch nur angedeutet, dass er wusste, wer die Brays waren.
Jeder wusste das.
»Es tut mir leid, Sir, aber dies ist eine private Einrichtung und…«, beginnt Ray.
»Erstens heißt es Doktor«, unterbricht Julius.
Ophelia versucht, nicht mit den Augen zu rollen. Er legt immer dann Wert auf seinen Titel, wenn er jemanden beeindrucken will. Oder mit etwas durchkommen, das ihm nicht zusteht.
»Zweitens bin ich ihr Notfallkontakt und ihre Vertrauensperson.« Er deutet auf Ophelia. »Ich bin hier, um sie zu unterstützen.«
Ophelia zieht die Augenbrauen hoch. Das klingt… etwas anders als gestern Abend. Ein kleiner, wärmender Funke flammt in ihrer Brust auf. Julius mag nicht mit ihrer Entscheidung einverstanden sein, aber er ist hier. Ein eindeutiges Zeichen für echte Freundschaft und …
Julius strafft seine Krawatte und streicht den schiefen Hemdkragen glatt. »Könnten wir uns bitte einen Moment unterhalten?«, fragt er mit seiner Das-ist-keine-Frage-Stimme. »Allein.«
Die beiden Techniker sehen sich verunsichert an.
Der Funke erlischt, ersetzt durch ein rasselndes Grauen, das sich in Ophelia aufbäumt wie eine Klapperschlange.
Was ist los? Die Worte liegen ihr auf der Zunge, doch Ophelia schluckt sie hinunter. Eine alte Gewohnheit. Sprich nie vor Fremden. »Schon in Ordnung«, sagt sie zu Ray.
Ray blickt zwischen ihr und Julius hin und her. »Eine Minute«, warnt er. »Es ist nicht gut, die Vorbereitungssequenz zu unterbrechen.«
Ray und der andere Techniker verlassen den Raum. Ray schließt die Tür, aber nicht ganz, was irgendwie süß ist. Als Angestellter einer Einrichtung für Kälteschlaf hat Ray wahrscheinlich schon einiges erlebt.
»Was ist denn los?«, fragt Ophelia schließlich. »Stimmt was nicht? Hat Marlix …«
»Ich konnte letzte Nacht nicht schlafen, nachdem du weg warst«, unterbricht Julius, während er in dem winzigen Raum auf und ab geht und sich mit einer Hand über den kahl rasierten Kopf streicht.
»Das kommt vom synthetischen Tequila.«
»Nein.« Julius bleibt kurz stehen und sieht ihr fest in die Augen, bevor er sich wieder in Bewegung setzt. »Du musst mir zuhören. Ich wollte nichts sagen, weil Jonathan meinte, dass es allein deine Entscheidung ist. Aber ich muss sicherstellen, dass du es weißt.« Er bläst erschöpft die Luft aus. Sein Atem riecht nach frischer Zahnpasta und altem Alkohol.
Ophelia sieht ihn nervös an. Julius ist normalerweise nicht der Typ, der sich leicht aus der Fassung bringen lässt.
»Du musst das nicht tun«, sagt er hastig, holt tief Luft und beruhigt sich ein wenig. »Diese … Situation wird sich von selbst erledigen. Die Ethikkommission hat dich entlastet. Niemand gibt dir eine Schuld.«
Das stimmt nicht ganz. Ophelia gibt sich selbst die Schuld. Sie hätte es kommen sehen müssen. Jede Nacht spielt sie die Ereignisse in Gedanken durch. Und im Nachhinein betrachtet gab es genug Warnzeichen.
»In der Klageschrift der Familie wegen fahrlässiger Tötung steht etwas anderes«, ruft sie Julius ins Gedächtnis. Der Kloß in ihrem Hals lässt ihre Stimme noch schroffer klingen.
»Das ist Blödsinn und nur deshalb überhaupt möglich, weil du bist, wer du bist.«
Vielleicht, vielleicht auch nicht. So oder so, das Ergebnis bleibt das gleiche: ein auf Hochglanz polierter Holzsarg vor der St. Patrick’s Cathedral.
»Das spielt keine Rolle. Du hast Paulsen gehört«, entgegnet sie. Julius war bei der virtuellen Besprechung mit Richter Paulsen, dem CEO von Montrose, dabei. Sein Ton war düster und sein Ärger unüberhörbar. Ophelia vermutete, dass er sie auf der Stelle gefeuert hätte, wenn sie keine Bray wäre, egal was die Ethikkommission beschlossen hatte. Wahrscheinlich würde er es später nachholen – vor weniger Zeugen.
Sie konnte es ihm nicht verübeln. Niemand mag Mahnwachen vor dem Firmensitz, Mediendrohnen und Streamer, die mit leuchtenden Augen live berichten. Selbstverständlich wäre alles völlig anders verlaufen, wenn Ophelia keine Bray wäre. Die Öffentlichkeit hätte kaum Notiz genommen. Leider. Nur ein weiterer Selbstmord aufgrund von Eckhart-Reiser-Syndrom.
»Sie wollen Schlagzeilen, und zwar spannende, und die garantiert mein Name nun mal. Egal wie die Mission ausgeht. Läuft sie gut, haben wir wahrscheinlich alle was davon.« Die Welt fängt an, unscharf zu werden, Ophelias Kopf schwirrt. Das liegt an dem Zeug, das Ray ihr gegeben hat. Aber über eines ist Ophelia sich absolut im Klaren: Sie braucht diesen Job. Sie muss Menschen helfen, muss etwas bewirken. Das ist es, was sie ausmacht. Weit mehr als ihr Nachname oder ihre DNS. Manchmal ist es das Einzige, was sie nachts einschlafen lässt, ohne dass die Schuldgefühle sie auffressen.
Dieser unerbittliche Drang, es besser zu machen, über jeden Einwand erhaben zu sein, ist manchmal anstrengend. Aber die Alternative ist unvorstellbar. Als Montrose sie vor acht Jahren eingestellt hat, war es schon schwer genug für Ophelia, als Fachkraft für psychische Gesundheit ernst genommen zu werden. Wahrscheinlich war das Ganze ohnehin eher ein Mittelfinger an den Bray-Konzern als irgendetwas anderes. Sollte Montrose sie feuern, dürfte es so gut wie unmöglich sein, irgendwo anders eine Stelle zu finden. Und in der Zwischenzeit wütet ERS weiter. Das kann Ophelia nicht zulassen. Im Gegenteil: Sie muss es mit allen Mitteln verhindern.
Selbst wenn das bedeutet, achtzehn Monate vor Ort mit einem E&G-Team zu verbringen, was eigentlich nicht zu Ophelias Aufgabenbereich gehört. Aber sie und ihre Kolleginnen und Kollegen in der Abteilung für psychologische und verhaltensbezogene Evaluation drängen schon seit Jahren auf ein früheres Eingreifen. Mit der Behandlung zu warten, bis die Teams auf die Erde zurückkehren, macht es viel schwieriger, den Verfall umzukehren. Bei einem gebrochenen Arm warten wir auch nicht. Warum dann bei einem gebrochenen Geist?
Dieser Satz in dem gemeinsamen verfassten Vorschlag stammt aus Ophelias Feder. Es war ihr Beitrag, und sie ist sehr stolz darauf. Anscheinend gehört die bevorstehende Mission zur Kategorie Sei-vorsichtig-mit-deinen-Wünschen. Oder eher Hochmut-kommt-vor-dem-Fall?
Wenn ihr Job auf dem Spiel steht und Ophelia selbst psychiatrische Betreuung vor Ort empfohlen hat, wie könnte sie da Nein sagen?
Julius gibt ein missbilligendes Geräusch von sich. »Sie benutzen dich.«
Ihr Temperament, das sie bisher im Zaum gehalten hat, blitzt kurz auf. »Das hast du alles schon gesagt, mal mit diesen Worten, mal mit jenen. Aber weshalb bist du hier? Denn ehrlich gesagt fühle ich mich im Moment nicht besonders gut unterstützt von meiner sogenannten Unterstützungsperson.«
Julius antwortet nicht sofort. Stattdessen setzt er sich neben sie auf das Untersuchungsbett und schaut zur Tür, als wolle er sich vergewissern, dass der Spalt in der Zwischenzeit nicht größer geworden ist. »Ist dir schon mal in den Sinn gekommen, dass Montrose dir eine Falle stellen könnte?« Er sieht ihr nicht in die Augen, sein Blick ist auf den Boden gerichtet.
Sie schaut ihn stirnrunzelnd an. »Wovon redest du?«
Er beugt sich näher heran, seine Stimme ist ein eindringliches Flüstern. »Ich meine, dass sie der PVE-Abteilung ohnehin schon für alles die Schuld geben. Steigende Patientenzahlen, ausbleibende Ergebnisse, unzureichende Behandlung.«
»Das hier ist keine Personalversammlung, Julius«, sagt Ophelia. Ihr wird allmählich leicht schwindlig.
Er ignoriert sie und fährt fort: »Und jetzt, nach… dem, was passiert ist, bieten sie dir diese ›Chance‹? Eine Aufgabe, bei der du keinerlei Unterstützung haben wirst, nur dich selbst. Ein E&G-Team, das es dir verdammt übel nehmen wird, dass du in sein Revier eindringst, ob sie nun trauern oder nicht. Menschen zu helfen, die das nicht wollen, ist unmö…«
»Woher willst du das wissen, kennst du sie etwa?«, unterbricht Ophelia.
»Du bist eine der klügsten Personen, die ich kenne, Phe. Denk doch mal nach.« Er nimmt ihre Hand. Sie kann die Berührung beinahe spüren, trotz der seltsamen Taubheit, die sich in ihrem Körper ausbreitet. »Montrose will jeden Medienrummel vermeiden. Dich auf diese Mission zu schicken, wirkt nach außen einsichtig und vorausschauend, und sollte etwas schiefgehen, können sie behaupten, sie würden dich nicht ohne Grund feuern. Es wird heißen, dass Ophelia Bray versagt hat.«
Seine Worte, so hypothetisch sie auch sind, treffen sie wie ein Schlag in die Magengrube. Hat er vielleicht sogar recht? Der Gedankengang klingt kompliziert und wie eine Verschwörungstheorie, aber das heißt nicht, dass er falschliegt. Im Gegenteil, das Ganze klingt wie aus dem Handbuch für Montrose-Führungskräfte abgeschrieben: Nichts ist jemals deren Schuld.
Die Ungewissheit, die Ophelia seit dem Moment verspürt, in dem sie sich für diese Mission gemeldet hat, flammt wieder auf und brennt wie Säure in ihrem Magen.
Aber… es spielt keine Rolle. Sie muss etwas tun, um ihren Fehler wiedergutzumachen, um ihre Karriere zu retten. Und das ist die beste – nein, die einzige Möglichkeit, die sie hat.
Sie atmet langsam ein und wieder aus und stellt sich vor, dass sich ihre Zweifel in weißen Nebel auflösen, der einfach verschwindet wie warmer Atem in kalter Luft. Der Schmerz in ihrem Magen lässt ein wenig nach.
»Ich danke dir, Julius.« Die Worte kommen leise und undeutlich aus ihrem Mund. »Dass du dir Gedanken machst. Aber ich komme zurecht.«
Er drückt ihre Hand. »Ich mache mir nur Sorgen. Sorgen um dich.« Er hält inne und senkt seine Stimme noch weiter. »Wir könnten einfach von hier verschwinden. Uns Jonathan und Marlix schnappen und ein paar Wochen Urlaub machen. Was hältst du davon?«
Ophelia lacht. »Den wir auch bestimmt genehmigt bekommen würden.« Sie schüttelt den Kopf. »Du klingst wie meine Familie«, sagt sie neckend.
Es ist nur eine Kleinigkeit, ein winziges Zucken seiner Finger, das sie wahrscheinlich gar nicht bemerkt hätte, wenn er nicht ihre Hand halten würde.
Ophelia hat das Gefühl, als würde sie fallen, kopfüber und mit einem harten Aufschlag. »Moment«, sagt sie. »Moment.« Die Medikamente, die durch ihre Adern fließen, verlangsamen ihre Gedanken, und plötzlich kann sie auch ihre Lippen kaum noch spüren.
»Hast du … Hat mein Onkel …« Sie bringt die Worte kaum heraus, weil allein der Gedanke so absurd ist. Und doch würde es zu ihrer Familie passen wie die Faust aufs Auge.
Julius braucht das Ende des Satzes gar nicht zu hören. »Ich halte es nun mal für eine ziemlich schlechte Idee, davon muss mich nicht erst jemand überzeugen«, sagt er und hebt abwehrend das Kinn. »Du willst so verzweifelt wiedergutmachen, was passiert ist, dass du nicht mehr klar denken kannst.«
Kein Dementi.
Ophelia reißt ihre Hand los, und ein gähnender Abgrund tut sich in ihr auf. Wut und das Gefühl von Verrat kochen in ihr hoch und kämpfen um die Vorherrschaft. »Hast du unten auf dem Parkplatz gewartet, bis Darwin dich hochschickt?« Ihre Stimme zittert, als sie das fragt.
Er verzieht das Gesicht, was in Kombination mit seinem perfekt getimten Auftauchen Antwort genug ist. »Hör zu, Familie ist hart«, sagt er hastig. »Das weiß ich. Und ich weiß, dass du und dein Onkel nicht immer gut miteinander auskommen.«
Sie kann Darwin in diesem Satz hören, der so leicht und beiläufig klingt, als ginge es um dem Wunschknochen in dem Sojatruthahn, um den sie sich beim letzten Thanksgiving gestritten haben. Ophelias Temperament explodiert wie eine vergrabene Kiste Dynamit, über der jemand ein Lagerfeuer angezündet hat.
»Was hat er dir versprochen?«, fragt sie und betont jedes einzelne Wort. »Mein Onkel.«
»Er hat einige gute Argumente, Phe«, erwidert Julius. »Ich glaube, er will dir wirklich helfen.«
»Was hat er dir versprochen?«, knirscht sie zwischen den Zähnen hervor.
Julius atmet tief ein, als würde er sich für die Worte schämen, die gleich kommen. Schließlich antwortet er: »Er sagte, dass sie vielleicht ein paar Strippen ziehen können. Für eine weitere Lizenz für eine künstliche Schwangerschaft.«
Oh. Das Geräusch ist leise und nur in ihrem Kopf, eine instinktive Reaktion der Überraschung. Irgendwie hatte Ophelia bis zuletzt gehofft, dass es sich um ein Missverständnis handelt, einen gut gemeinten Fauxpas.
Julius erkennt die Veränderung an ihrem Gesichtsausdruck. »Du weißt, wie schwer es ist, und wir versuchen schon seit einer Ewigkeit, diese Genehmigung …«
»Ray!«, ruft Ophelia.
»Aber, Phe, das war nicht der Grund. Ich habe mich nur darauf eingelassen, weil es mir wichtig ist«, beschwichtigt Julius.
Ray erscheint sofort an der Tür.
»Wir sind hier fertig. Bitte begleiten Sie Dr. Ogilvie nach draußen.« Ophelia mobilisiert jede Unze Bray-Autorität in ihrer Stimme. Die Medikamente helfen nicht gerade dabei. »Und ändern Sie meinen Notfallkontakt.«
Schmerz blitzt in Julius’ Gesicht auf, was Ophelia nur noch wütender macht. Er verrät sie, opfert eine jahrelange Freundschaft und hat dann noch die Frechheit, von ihrer Reaktion verletzt zu sein?
Ray nickt. Zum Glück. »Hier entlang, bitte«, sagt er und weist Julius den Weg zur Tür. Und zum Glück fragt Ray nicht, wer diese Kontaktperson sein soll, denn die vertrauenswürdigen Freunde scheinen Ophelia soeben ausgegangen zu sein.
Julius hebt kapitulierend die Hände, dreht sich um und geht. In der Tür bleibt er noch einmal stehen. »Phe, ich habe es nicht nur deswegen getan. Du kennst mich, du weißt, dass ich dich liebe, und ich meine es ernst. Ich glaube, mit dieser Mission stimmt etwas nicht. Bitte.«
Für einen Moment kehrt Ophelias bohrende Unsicherheit zurück. Sie möchte ihm glauben, möchte glauben, dass er vor allem zu ihrem Vorteil gehandelt hat. Vielleicht stimmt tatsächlich etwas nicht. Vielleicht ist die ganze Sache eine Falle, vielleicht soll Ophelia versagen.
Oder vielleicht kann ihre Familie sehr, sehr überzeugend sein, wenn sie es will.
Ophelia weiß, welche Möglichkeit sie für die wahrscheinlichere hält.
»Sieh zu, dass du bekommst, was Darwin dir versprochen hat«, sagt sie. »Du hast es dir verdient.«
2
Drei Monate später
Vor Ophelias Gesicht schweben Wolken aus weißem Dampf. Sie kann ihren Atem sehen – ein Zeichen, dass ihre Augen offen sind und sie selbst zumindest halbwegs bei Bewusstsein ist. Licht fällt durch das beschlagene Sichtfenster im Deckel ihres Kälteschlaftanks herein. Die Seiten sind blässlich-blau beleuchtet. Sie ist wach. Wacher als beim letzten Mal, wann auch immer das war.
Das Letzte, woran sie sich erinnert, ist … Julius.
Bei der Erinnerung an seinen verletzten Blick auf der Türschwelle des Vorbereitungsraums steigt glühende Wut in ihr auf, doch schon nach einem Moment kühlt sie zu altvertrauter, bitterer Enttäuschung ab.
Es war alles so verdammt erwartbar. Sie hätte es kommen sehen müssen. Julius – oder irgendwen – hinter ihre Mauern zu lassen, war ein Fehler. Ihre Familie wird immer einen Weg finden, es auszunutzen. Ophelia weiß das.
Aber es spielt keine Rolle, nicht jetzt. Da war noch mehr, nach Julius. Sie konzentriert sich, und die Erinnerung kehrt zurück.
Ray, wie er ihren unter all den Sensoren und Schläuchen kaum zu sehenden Arm hält. Nicht um sie zu trösten, sondern um ihn festzuhalten und ihr zu sagen, dass sie sich in den Schlaftank legen und einen tiefen Atemzug nehmen soll.
Es fühlte sich an, als würde sie sich in einen Sarg quetschen. Die Seitenwände des Tanks drückten gegen ihre Schultern. Ihr Körper rebellierte instinktiv gegen jeden rationalen Gedanken, weigerte sich, zu entspannen, sich hinzulegen und auszustrecken.
Aber sie gehorchte und nahm einen tiefen Atemzug – den letzten für die nächsten Monate. Dann breitete sich eine sengende Kälte von ihrem linken Arm aus, so intensiv, dass es sich anfühlte, als würde sie bei lebendigem Leib verbrannt.
»Auf dass die Bettwanzen nicht beißen«, sagte Ray ganz in der Tradition aufbrechender E&G-Teams.
Und dann … nichts. Nicht einmal das mehr oder weniger beruhigende Gefühl, wie sie das Bewusstsein verliert.
Ophelia versucht zu blinzeln, doch ihre Lider reagieren kaum. Einmal, das war’s. Dann bleiben sie geschlossen und lassen sie im Dunkeln zurück.
Ein Tropf-Tropf-Tropf irgendwo im Tank, unangenehm wie ein Zeigefinger, der nicht der ihre ist und hartnäckig an ihre Stirn tippt.
Ein Rasseln in ihrer trockenen Kehle lässt sie aufschrecken. Ihr Mund fühlt sich kalt an, ihre Zunge wie ein Stück halb aufgetautes Fleisch. Fremd, klobig, im Weg.
Panik kratzt an ihrer medikamenteninduzierten Gelassenheit. Ihre Hände und Beine scheinen nicht zu existieren, außer dass Ophelia sie vage spüren kann. Als sie erneut versucht, die Augen zu öffnen, flattern ihre Lider kurz, bleiben aber geschlossen. Den eigenen Körper nicht kontrollieren zu können, wenn der Geist wach ist, ist ein entsetzliches Gefühl. Wie lebendig begraben in einem Sarg aus Fleisch und Knochen.
Das ist normal. Alles ganz normal, schärft sie sich ein.
Ophelia ist mit dem Aufwachprozess vertraut. Ihre Patienten reden ständig darüber. Aber ihn am eigenen Leib zu erfahren, ist etwas vollkommen anderes. Das einzige andere Mal war sie so jung, dass …
Sie bricht den Gedanken ab, bevor er zu weit führt. Konzentrier dich auf die Gegenwart.
Nach ein paar Sekunden erzwungener, gleichmäßiger Atmung kehrt das Gefühl für ihren Körper allmählich zurück, die Panik schwindet und gibt ihr Raum zum Denken. Und als Ophelia ein weiteres Mal versucht, die Augen zu öffnen, gehorchen ihre Lider.
Alle Sensoren, Schläuche und Drähte wurden entfernt. Zumindest die, die Ophelia sehen kann. Das System ist also gerade dabei, sie zurückzuholen. Das unangenehme Ziehen in ihren Beinen kommt wahrscheinlich von der künstlichen Gravitation. Nach Monaten in der Waagrechten hat sich ihr Tank aus der Kälte-Tiefschlafphase in die Senkrechte gedreht. Trotzdem schmerzen ihre Knie, als hätte sie monatelang auf Beton strammgestanden.
Sie versucht, eine bequemere Position zu finden, die dicke Schicht Bio-Gel schmatzt auf ihrer Haut, aber die straff sitzenden Riemen an ihren Schultern und der Brust lassen kaum eine Bewegung zu. Der unterste Riemen, der über den Oberschenkeln, ist etwas lockerer, was wahrscheinlich auch der Grund ist, warum es sich so anfühlt, als würden ihre Kniescheiben gegen den Tankdeckel drücken. Sie spürt die typischen Nadelstiche in Zehen und Fußsohlen, mit denen die Durchblutung auf Normalniveau zurückkehrt.
Jeden Moment wird jemand kommen, den Deckel öffnen, Ophelia ein Handtuch reichen und ihr nach draußen helfen. So ist der Ablauf. Die einzige Person, die alleine aufwacht, ist der Kommandant, das Teammitglied mit der meisten Reiseerfahrung.
Ophelia verhält sich ganz still und lauscht auf das leise Geräusch von Schritten. Doch alles, was sie hört, ist dieses Tropfen. Aber das Licht im Sichtfenster ist immer noch da. Also ist sie irgendwo. Sie muss nur warten und ruhig bleiben.
Konzentrier dich auf etwas anderes, Phe. Das Team.
Erkundungs- und Gewinnungsteam Nummer 356, eines der erfolgreichsten E&G-Teams überhaupt, operiert von der Resilience aus, einem Forschungsschiff für kurze Reisen der Aischylos-Klasse, maximale Besatzung zehn Personen. Modifizierte StarPlus-Triebwerke, allerdings noch nicht mit den neuesten Upgrades. Daher der lange Kälteschlaf. Somnalia-VII-Kälteschlafsystem, vor zwei Jahren installiert.
Ethan Severin, Kommandant. Achtunddreißig, geschieden, keine Kinder. Aufgewachsen in den Tunneln der Lunar-Valley-Kolonie. Verlust zweier Geschwister beim Einsturz von ’76. Unterstützt seine Mutter und die verbliebenen Schwestern, die weiterhin in der Kolonie leben, jetzt allerdings in einem Haus unter der Hauptkuppel. Nach zwölf makellosen Dienstjahren für den Montrose Award für herausragende Leistungen vorgeschlagen. Was sich mit dem letzten Einsatz allerdings geändert hat.
Birch Osgoode, Pilot. Achtundzwanzig, Single, keine Kinder. Als einziger Sohn der Eltern auf der Alterra-Station geboren und aufgewachsen. So unauffällig, dass er kaum zu existieren scheint. Seine Akte enthielt nur die Biografie und die Eckdaten seiner Arbeitslaufbahn. Wahrscheinlich während einer der großen Expansionsphasen eingestellt, als weder Zeit noch Interesse für ausführliche Recherchen vorhanden waren.
Kate Wakefield, Ingenieurin. Zweiunddreißig und in einer Lebensgemeinschaft mit Vera Wakefield, zwei Adoptivkinder. Tochter britischer Flüchtlinge, die in die USA kamen, als der größte Teil der Insel ’83 überflutet wurde. Eine kleinere Auseinandersetzung in einer Kneipe in ihrer Heimatstation Brighton, die zu einer Verhaftung wegen Körperverletzung führte, die Anklage wurde jedoch fallen gelassen. Ansonsten blitzsaubere Akte. Ein Zwillingsbruder, Donovan Wakefield, der derzeit versucht, sich als Farmer auf einem Trappisten-Außenposten durchzuschlagen.
Suresh Patel, Inventarisierungsspezialist. Siebenundzwanzig, Single, keine Kinder. Aufgewachsen in New York auf der Erde. Drei Beschwerden aus früheren Teams wegen nicht näher bezeichneten »unangemessenen Verhaltens« – ein Montrose-Totschlagbegriff, der von anstößigem Humor bis hin zu tätlicher sexueller Belästigung alles bedeuten kann. Nichts mehr, seit er bei Nummer 356 ist.
Liana Chong, wissenschaftliche Koordinatorin. Dreiundzwanzig, ledig, keine Kinder. Angehende Astrobotanikerin. Arbeitet in einem E&G-Team, um Geld für ihre Doktorarbeit anzusparen.
Und schließlich Ava Olberman, Systemmanagerin. Streng genommen gehört sie nicht mehr zum Team, aber ihre Abwesenheit ist genauso bedeutsam, als wäre sie noch da. Avas Ehemann, Deacon, war bereits verstorben. Sie hinterlässt eine Tochter, Catrin.
In einer idealen Welt hätte Ophelia zuerst ein Einzelgespräch mit jedem Teammitglied geführt, um eine Basis zu haben, bevor sie die Erde verlässt. Doch nach dem unerwarteten Ende der vorangegangenen Mission und der plötzlichen Veränderung in Ophelias Status war das logistisch unmöglich gewesen.
Daher wird sie ihnen heute zum ersten Mal begegnen. Vorausgesetzt, jemand kommt und öffnet Ophelias Tank.
»Hallo?«, ruft sie und zuckt sogleich zusammen, als ihre Stimme in der Enge gefühlt doppelt so laut widerhallt. »Ist jemand da?«
Das Ganze könnte auch ein Scherz sein. E&G-Teams sind bekannt dafür, Neuankömmlinge zu schikanieren. Andererseits erscheint es unwahrscheinlich, dass sie sich die Mühe machen, da Ophelia bestenfalls vorübergehend hier sein wird. Außerdem trauert das Team gerade um ein totes Mitglied. Dass sie zu Scherzen aufgelegt sind, scheint da kaum vorstellbar.
Es könnte natürlich auch eine Message sein: Wir wollen dich hier nicht, und das lassen wir dich spüren. Wenn das der Fall wäre, müsste allerdings jemand hier sein und überprüfen, ob die Message auch ankommt.
Ophelia hält für einen Moment den Atem an, um besser hören zu können, aber weder kichert jemand, noch ist das Scharren von Füßen zu vernehmen. Nur Stille.
Ein erster Anflug von Grauen durchfährt sie, wie das Läuten einer unheilverkündenden Glocke. Hat Nova es vermasselt? Fehler passieren, falsche Berechnungen kommen schon mal vor. Auch bei Kälteschlaf-Reisen. Selten, aber dennoch.
Oder wurde sie in irgendeinem Lagerhaus versteckt, bis ihr Onkel sich entschieden hat, was mit ihr geschehen soll? Mit diesem Gedanken kehrt Ophelias anfängliche Panik zurück, stärker als zuvor. Sie stemmt sich gegen die Gurte, die sie festhalten.
»Holt mich hier raus!«, schreit sie und ignoriert den Widerhall ihrer Stimme. »Sofort!« Kalter Schweiß, der nichts mit Ophelias Körpertemperatur oder der Auftaustufe ihres Tanks zu tun hat, legt sich auf ihre Haut. Ein kribbelndes Gefühl vertreibt allmählich die Taubheit aus ihren Händen und Füßen.
Für immer in einem Kälteschlaftank gefangen. Wie lange wird es dauern, bis sie stirbt? Bis sie spürt, wie der Flüssigkeitsmangel ihre Eingeweide austrocknen lässt? Oder wird vorher der Sauerstoff zu Ende gehen?
Ophelias Atemzüge werden kürzer, ihre Lunge zieht sich zusammen, und der Schwindel in ihrem Kopf lässt weiße Punkte vor ihrem Gesichtsfeld tanzen.
Erst dann, während Ophelias Verstand mögliche Todesszenarien durchspielt, gelingt es dem winzigen rationalen Teil ihres Gehirns, durchzubrechen. Die Notentriegelung. Jeder Tank hat eine. Ray hat sie heute Morgen erwähnt. Ophelia hat sogar ein E-Dokument unterschrieben, in dem ein Diagramm des Auslösehebels abgebildet war und wo er sich befindet. Dass sie Kenntnis genommen und alles verstanden hat. (Damit Nova nicht dafür verantwortlich gemacht werden kann, wenn sie an Ort und Stelle erstickt, so die Idee dahinter.)
Ophelia stemmt sich erneut gegen die Gurte, bis sie ihren rechten Arm bewegen kann, und tastet. Der Hebel muss hier irgendwo sein, an der Unterseite des Tankdeckels.
Komm schon, komm schon, komm schon.
Sie spürt eine Vertiefung, ihre Fingerspitzen ertasten den Hebel und rutschen ab, als sie daran zu ziehen versucht. Beim zweiten Versuch klappt es.
Die Reaktion erfolgt sofort. Die Gurte um ihre Schultern und Beine ziehen sich so ruckartig in die Seitenwände zurück, dass Ophelia ohne das Bio-Gel Hautabschürfungen davongetragen hätte. Der Deckel des Tanks springt auf, und Luft strömt herein. Aber Ophelia hat keine Zeit, zu jubilieren oder auch nur mehr als eine Sekunde der Erleichterung zu verspüren. Denn befreit von den Fesseln folgt ihr immer noch schwacher Körper unverzüglich der Schwerkraft – sie kippt nach vorne, rutscht aus dem Tank und schlägt mit einem nassen Klatschen der Länge nach hin.
Benommen liegt sie eine Sekunde lang da, spürt die Kälte des Bodens unter ihrer Wange. Schließlich zwingt sie ihre zittrigen Arme zur Mitarbeit, stützt sich auf die Hände und sieht sich um.
Die automatische Deckenbeleuchtung ist angesprungen, das grellweiße Licht schmerzt in ihren Augen. Ein Stapel in Plastik eingeschweißter Handtücher mit dem Nova-Logo liegt auf der am Boden festgeschraubten Metallbank vor ihr. Dahinter glaubt sie zehn Spinde zu erkennen, von denen sechs beschriftet zu sein scheinen. Auch wenn sie die Schilder im Moment nicht lesen kann, weil sie immer noch gegen die plötzliche Helligkeit anblinzelt. Ein kleines Guckloch an der hinteren Wand, nicht größer als ihr Kopf, gibt den Blick auf die Dunkelheit des Weltraums dahinter frei.
Sie ist also auf dem Schiff, der Resilience. Im Kälteschlafraum. Genau da, wo sie sein sollte.
Auf die Erleichterung folgt sofort das Gefühl von Scham, wie in dem altbekannten Traum, in dem man zu einer Prüfung antritt – oder dem ersten Tag im neuen Job –, um dann mit Entsetzen festzustellen, dass man splitterfasernackt ist und alle einen anstarren.
Abgesehen davon, dass dies die Realität ist.
Ophelia setzt sich auf, ihre Muskeln und Gelenke protestieren, und sie verschränkt instinktiv die Arme vor der Brust. Aber anders als in dem Albtraum ist niemand hier, um ihre Erniedrigung zu bezeugen.
Links und rechts der Spinde befindet sich je eine Tür, beide stehen offen, die Korridore dahinter scheinen leer zu sein. Auch hier ist alles still. Keine Stimmen. Keine Schritte. Nichts.
Die einzigen Geräusche sind das tiefe Dröhnen der Triebwerke unter ihren Füßen und das gedämpfte Rauschen des Umweltsystems, das erwärmte und atembare Luft in den Raum bläst. Es riecht nach verbranntem Staub, heißem Metall und altem Sojakonzentrat.
Wo sind alle?
Ophelia greift fröstelnd nach einem der Handtücher auf der Bank vor ihr. Schon von dieser kleinen Anstrengung außer Atem, reißt sie mit zitternden Fingern die Plastikfolie auf und wickelt den weißen, genoppten Stoff um sich.
Mit einer Hand auf dem Handtuch und der anderen auf der Bank schafft Ophelia es nach ein paar Versuchen, auf wackligen Beinen zu stehen. Aber da ist ein Kribbeln auf der entblößten Haut an ihrem Rücken: das bohrende Gefühl, dass jemand sie beobachtet.
Ophelia wirbelt herum und verliert fast das Gleichgewicht dabei.
In diesem Moment sieht Ophelia es. Besser gesagt, sie.
Zwei Tanks, direkt neben ihrem, die zum Aufwachen in die Senkrechte gedreht sind. Aber ihrer ist der einzige, dessen Deckel sich geöffnet hat. Die anderen beiden sind nach wie vor fest verschlossen.
Das Gefühl, dass etwas nicht stimmt, kehrt sofort zurück, dringlicher als je zuvor. Ihr hochschnellender Puls erschüttert Ophelias Körper wie ein Erdbeben.
Ich sollte nicht als Erste aufwachen. Niemals.
Vorsichtig nähert sie sich den beiden Tanks. Angst macht sich in ihr breit, greift wie ein dunkler Schatten um sich. Zuerst ist Ophelia nicht sicher, warum, denn die Tanks sehen unbeschädigt aus.
Dann macht es Klick: Sie sind dunkel. Alle Statusleuchten und Anzeigen auf dem Gesundheits- und Vitalwertemonitor des Insassen sind abgeschaltet. Leer. Tot.
Ophelia geht näher heran und späht durch das runde Sichtfenster im Deckel des näher stehenden der beiden Tanks. Ihr Atem stockt: Die Innenbeleuchtung ist ebenfalls dunkel, aber die Helligkeit der grellen Deckenlichter reicht aus, dass sie schemenhaft eine Nase, ein Kinn, eine Ohrmuschel und spitz zulaufende Koteletten erkennen kann.
Jemand ist in dem Tank.
»Nein, nein, nein«, keucht sie und weicht instinktiv zurück. Das kann nicht sein.
Sie zwingt sich, wieder näher ranzugehen, stellt sich auf die Zehenspitzen und schaut in den zweiten Tank. Auch hier ist alles dunkel, die Insassin hat sich vom Sichtfenster weggedreht, als schlafe sie und wolle nicht geweckt werden. Oder als wäre ein Fehler bei der Aufwachsequenz passiert und die unweigerlich folgenden Krämpfe hätten sie in diese Position gedreht.
Ein glänzender schwarzer Zopf liegt oberhalb der zarten Ohrmuschel seitlich auf dem Kopf. Möglicherweise Liana Chong, wenn Ophelia die Fotos der Besatzung richtig in Erinnerung hat.
Sie taumelt einen Schritt nach hinten und zieht das Handtuch fester um sich. Das Somnalia-VII-System entscheidet nach Lebensfähigkeit. Das heißt, es weckt die Besatzung in der programmierten Reihenfolge, es sei denn, es gibt … Probleme. In diesem Fall priorisiert es die Insassen, deren Überlebenschancen die besten sind.
Ophelia steht vor den ersten drei Tanks, von deren Insassen nur einer – sie selbst – überlebensfähig war. Und das bedeutet, dass die Insassen der anderen drei Tanks, die sich noch in der Waagrechten befinden, wahrscheinlich ebenfalls tot sind. Das System hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, einen Weckversuch zu unternehmen.
Die Mission ist gescheitert, bevor sie überhaupt begonnen hat. Noch schlimmer ist, dass Ophelia sich ganz allein auf der Resilience befindet. Die Leere des Weltraums jenseits des winzigen Sichtfensters auf der anderen Seite des Raums scheint sie zu erdrücken, als wollte sie das Schiff und Ophelia zerquetschen.
Allein. Verloren. Auf einem Schiff, das sie weder steuern noch bedienen kann.
Panik schneidet wie eine Klinge in ihre Brust. Ophelia stolpert zu einem der aufrecht stehenden Tanks und tastet mit zitternden Händen über das Bedienfeld. Wegen der Möglichkeit eines Stromausfalls verfügen die Dinger über eine Wiederhochfahrfunktion. Sie jagt einen Stromstoß durch das System, der einen Neustart des Tanks – und des Menschen darin – bewirken soll.
Falls Ophelia sich noch daran erinnern kann, wie die Prozedur funktioniert. Ihr Gehirn ist ein einziger Knoten aus Angst und Entsetzen, ihre Gedanken verweigern sich jedem rationalen Zugriff.
Dann bleibt ihr Blick an einem kleinen Aufkleber über dem Bedienfeld hängen. Drei nummerierte Schritte, geschrieben in roter, quälend kleiner Schrift, mit einer ebenso mikroskopisch kleinen Abbildung des Bedienfelds. Die fett gedruckte Überschrift lautet: NOTSTARTSEQUENZ.
»Bitte, bitte, bitte«, flüstert sie und wischt sich mit dem Handtuchrand das Bio-Gel aus den Augen, bis sie die Worte entziffern kann.
1.Nur im Fall von Systemversagen anwenden. Fehlerhafte Anwendung der Neustartfunktion kann zum Tod führen.
(Nova Kälteschlaf Lösungen und Podrata Systems, Hersteller von Somnalia VII, haften nicht für Anwendungsfehler.)
2.Vergewissern Sie sich, dass der Tank versiegelt ist.
3.Geben Sie die folgende Sequenz ein:
Auf der Grafik ist eine verwirrende Anordnung nummerierter Pfeile zu sehen, die anzeigen, welche Tasten in welcher Reihenfolge gedrückt werden müssen. Ophelia folgt der Anleitung, so gut sie kann. Als sie die letzte Taste gedrückt hat, hält sie den Atem an und lauscht auf einen Hinweis, dass irgendein Ablauf in Gang gesetzt wird.
Aber das Bedienfeld bleibt dunkel, kein Summen von Gebläsen oder dergleichen, kein Stromstoß. Kein Herz, das sich selbst wieder in Gang setzt.
Weil Ophelia es falsch gemacht hat? Hat sie die Sequenz zu langsam eingegeben?
Sie atmet tief ein und versucht es noch einmal, so schnell wie möglich, aber dennoch präzise.
Immer noch nichts.
Sie schlägt mit der flachen Hand auf den Deckel, was nichts außer einem Brennen in ihren Fingern bewirkt. »Scheiße!«
Für den unwahrscheinlichen Fall, dass nur dieser eine Tank defekt ist, geht sie weiter zum nächsten. Doch ihre Hoffnung schwindet – wie Materie, die in ein schwarzes Loch gesaugt wird, schnell, gewaltsam, unentrinnbar.
Ophelia startet die Sequenz, einmal, zweimal. Das gleiche Ergebnis wie zuvor.
Der Adrenalinstoß, der sie bisher auf den Beinen gehalten hat, lässt abrupt nach, und ihre Knie knicken ein.
»Scheiße. Scheiße!«, murmelt sie auf dem Boden liegend, das Rauschen des Blutes in ihren Ohren übertönt alles außer ihrem eigenen panischen Atem. Was soll sie jetzt tun? Funktioniert das Schiff überhaupt, wenn niemand die Koordinaten eingibt? Sie hat keine Ahnung.
Da spürt Ophelia eine Veränderung in ihrer direkten Umgebung, einen Luftzug.
Im nächsten Moment legen sich Hände um ihre glitschigen Arme und ziehen sie auf die Beine. Ophelia will schreien, aber ihre Kehle schnürt sich zusammen – sie kann nicht schreien, darf nicht. Sie windet sich stumm im Griff der fremden Hände, kann sich halb befreien, stößt sich das Knie an der Bank vor ihr und dreht sich zu ihrem Angreifer um.
Ein Mann im orange-grauen Overall eines E&G-Teams starrt auf sie herab. Sein dunkles Haar ist ungekämmt und zu lang. Die Enden sind zerzaust, und er hat sich seit Tagen nicht mehr rasiert. Doch Ophelia erkennt ihn trotzdem. Anhand des Fotos in seiner Akte.
Der Kommandant der Mission. Ethan Severin.
Sie schüttelt den Kopf. Das alles ergibt keinen Sinn.
»Was geht hier vor?«, fährt er sie mit starrem Blick an. »Sind Sie verletzt?«
»Ich …« Ophelia ruckt mit dem Kinn in Richtung der Tanks. »Tot«, krächzt sie und richtet sich zitternd auf. Wie kann es sein, dass er das nicht längst weiß? »Irgendetwas … jemand … der Kälteschlaf …«
Severin wirft einen Blick auf die anderen Tanks, und sein Gesichtsausdruck verwandelt sich sofort. Aber nicht in Trauer oder Sorge oder gar geistiger Verwirrung. Nein, Severin ist stinksauer. Sein Mund ist ein dünner Strich, daneben je ein kantiges Grübchen, wie die Umkehrung eines Lächelns.
Ophelia weiß nicht, was sie erwartet hat, aber bestimmt nicht, dass Severin einen Schritt um sie herum macht und den Deckel des nächstbesten Tanks aufreißt.
»Nein!«, schreit sie. Der einzige Grund, warum die Leichen noch nicht zu verwesen begonnen haben, ist die Versiegelung des Tanks, und in dem Moment, wo diese wegfällt …
Severin greift in den Tank und holt einen Arm heraus, gefolgt von einem ganzen Körper in einem orange-grauen Overall.
Suresh Patel, der sich sofort von Lachen geschüttelt vornüberbeugt.
Ganz und gar nicht tot.
Ophelia wankt einen Schritt zurück. Die beiden leben?
»Heilige Scheiße, Sie hätten Ihr Gesicht sehen sollen!«, gackert Suresh. Seine hohen Wangen leuchten rot, die Haare hat er sich silbern gebleicht und mit Glitzerspray behandelt, sodass sie aussehen wie ein von Raureif überzogenes Grasbüschel – der neueste Trend.
Severin stößt ihn mit einem lauten Krachen gegen die Wand in seinem Rücken. »Was zum Teufel ist in Sie gefahren?«
Suresh reckt trotzig das Kinn. »Es war nur ein Scherz.«
»Aber die Lichter … ihre Vitalwerte«, stottert Ophelia, die immer noch zu verstehen versucht, was passiert ist.
Der Tank neben Suresh öffnet sich, und Liana – Ophelia hatte richtig vermutet – klettert mit verlegenem Gesichtsausdruck heraus. Sie winkt schüchtern zur Begrüßung. »Ein Hack. Ein Stück Papier im Schließmechanismus genügt, dass der Tank sich nicht versiegelt. Es war ein dummer Scherz.« Sie zieht eine Grimasse.
Liana hat recht, wie Ophelia mit Verspätung feststellt. Keiner der Deckel hat beim Öffnen das charakteristische Zischen von sich gegeben, so wie ihrer es getan hat.
Ein Stück Papier? Das ist alles? Ein Schwindelgefühl lässt Ophelia zur Bank stolpern. Sie lässt sich darauf plumpsen, während die Panik noch unter ihrer Haut kribbelt. Doch dann schlägt das Gefühl in Wut um. Sie hätte Suresh mit dem Neustart töten können. Die Warnung steht ausdrücklich auf dem Tankdeckel.
Sie ballt die Fäuste, und ihre Muskeln spannen sich, bereit, jemanden zu verprügeln – egal wen.
»Das hier ist etwas völlig anderes als Bio-Gel in ihrer Schlafkoje oder Spinnen in ihrem Schutzanzug!«, bellt Severin Suresh an. »Sie hätten das ganze System kurzschließen, sich selbst oder Dr. Bray töten können. Haben Sie daran gedacht, was passiert, wenn wir ohne Kälteschlaf nach Hause fliegen müssen?«
Nicht alle würden überleben. Es gibt nicht genug Notrationen für das ganze Team, um eine so lange Strecke im Wachzustand zurückzulegen. Dann noch die Belastung für die Triebwerke und die Umweltsysteme …
Suresh stößt sich von der Wand ab und reckt den Hals, bis seine Nase nur noch wenige Zentimeter von der des um einiges größeren Severin entfernt ist. »Es war Ihre Idee«, sagt er und schnippt in Richtung Ophelia. »Sie waren derjenige, der sie hier haben wollte. Und Sie waren derjenige, der gesagt hat, dass wir sie wie ein Teammitglied behandeln sollen. Also haben wir genau das getan.«
Die beiden sind kurz davor, sich zu prügeln, und genau das muss Ophelia verhindern. Sie reißt sich zusammen, schluckt ihre Wut hinunter und atmet einmal tief durch. Ganz der Profi, der sie ab jetzt sein muss.
»Schon okay«, sagt sie und steht von der Bank auf. »Mir ist nichts passiert. Niemandem ist etwas passiert. Warum beruhigen wir uns nicht alle und deeskalieren die …«
»Gehen Sie zurück auf Ihre Posten, beide«, unterbricht Severin, ohne Ophelia anzusehen. »Jetzt.«
»Ja, Sir.« Mit rotem Kopf und gesenktem Blick steigt Liana eilig von der Plattform ihres Tanks herab und flüchtet in den Korridor hinter Ophelia.
Suresh verharrt noch kurz in seiner Haltung, die Nase steil nach oben gerichtet wie jemand, der sein Gegenüber zum ersten Schlag provozieren möchte. Dann dreht er sich weg und rollt mit den Augen. »Nur ein Scherz«, wiederholt er halblaut und stakst mit in die Hosentaschen gesteckten Händen Richtung Korridor.
»Kapsel-Dienst. Die ganze Woche«, erklärt Severin.
Suresh dreht sich um, den Mund erschrocken geöffnet. »Ist das Ihr Ernst?«
Ophelia zieht eine Grimasse. Kapseln – die kleinen Pakete voller menschlicher Ausscheidungen, die regelmäßig von der Toilette in einen Auffangbehälter außerhalb des Habitats gebracht werden müssen – sind theoretisch versiegelt. Theoretisch, denn die Versiegelung ist nicht immer so dicht, wie man es sich wünschen würde. Und der Inhalt, der entsteht, wenn das Team zum ersten Mal seit Monaten wieder feste Nahrung zu sich nimmt, ist alles andere als appetitlich. In der Regel wechselt sich die Besatzung jeden Tag mit der Aufgabe ab, damit niemand zu viel abbekommt.
»Das ist nicht nötig«, sagt Ophelia eilig, wobei ihre Stimme vom langen Nichtgebrauch immer noch rau klingt. Die Bestrafung würde es ihr nur noch schwerer machen, das Vertrauen des Teams zu gewinnen. »Es ist ja nichts passiert.«
Außer ihrem Wunsch, Suresh windelweich zu prügeln, vielleicht.
Das lenkt Severins Aufmerksamkeit wieder auf Ophelia. Der Blick seiner dunklen Augen bohrt sich in sie. Eine Einschüchterungstaktik, wie sie im Buch steht. Zum Glück ist Ophelia solch bleierne Blicke und noch bleierneres Schweigen schon so lange gewohnt, dass beides wirkungslos an ihr abperlt.
Sie schaut nicht weg und schweigt einfach.
»Mein Schiff, mein Kommando«, sagt Severin und spuckt jede Silbe aus wie einen Befehl. Dann wendet er sich wieder Suresh zu. »Die ganze Woche.«
Ophelia sieht die Widerworte in Sureshs Gesichtsausdruck, dem hässlich verzogenen Mund, den zusammengekniffenen Augen. Aber dann merkt er, dass sie ihn beobachtet, und zuckt mit einem gezwungenen Grinsen die Achseln. »Von mir aus.«
Suresh schlendert betont langsam davon, doch seine Schultern sind steif vor Anspannung.
»Ziehen Sie sich an, Dr. Bray«, sagt Severin, als sie allein sind. »Wir sehen uns auf der Brücke.« Dann geht auch er.
3
Kein sehr vielversprechender Einstieg, Dr. Bray.
»Scheiße«, murmelt sie und schrubbt sich vor dem ihr zugewiesenen Spind mit dem Handtuch die Haut trocken. Der rechteckige, bruchsichere Spiegel an der Spindtür fällt ihr ins Auge. Ihr rotes Haar ist noch dunkler als sonst und hängt in Strähnen herunter, dank des Bio-Gels. Das grelle Deckenlicht lässt ihre Haut noch blasser erscheinen, als wäre ihr Blut noch immer nicht restlos aufgetaut.
Die Patienten in Ophelias Praxis stellen ihr Temperament und ihre Geduld ständig auf die Probe. Manchmal, weil sie den Schmerz, den sie empfinden, jemand anderem zufügen wollen. Manchmal aber auch, weil sie sich einfach nur ärgern, dass sie überhaupt zu ihr geschickt wurden.
Sich tot zu stellen, ist allerdings ein bisschen extrem.
Ophelia wirft das Handtuch in den in die Spindwand eingebauten Recycler.
Und Severin? Mein Team, mein Kommando.
Die Erinnerung lässt Ophelia mit den Zähnen knirschen. Er hat natürlich nicht unrecht. Aber warum psychologischen Beistand vor Ort anfordern und dann nicht einmal so tun, als würde er ihr zuhören?
Sie holt einen Stapel plastikversiegelter Päckchen aus dem Spind. Nachdem sie sich mühsam ein T-Shirt und eine Kompressionshose über ihre immer noch feuchte Haut gestreift hat, schüttelt sie den orange-grauen Overall aus, bis sich die Arme und Beine entrollen. Die Stellen, wo sie gefaltet waren, zeichnen sich überdeutlich ab.
Technisch gesehen ist der Missionsleiter nicht ihr Chef, genauso wenig wie sie seiner ist. Sie hat die Befugnis, jeden vom Dienst abzuziehen – auch ihn. Aber er ist für den Erfolg der Mission und die Sicherheit aller verantwortlich. Und er kann ihr die Arbeit schwer machen, indem er ihre Autorität untergräbt.
Oder indem er sie ein wenig zu sehr unterstützt, je nachdem, wie man es betrachtet. Die Strafe für Suresh, auch wenn sie durchaus angemessen ist, macht Ophelias Aufgabe nur schwieriger. Lässt sie schwach und inkompetent aussehen. Noch schlimmer ist, dass sie in die Rolle der Außenseiterin, der Bösen gedrängt wird. Eine Rolle, die Teammitglieder ihr ohnehin gerne zuweisen.
Julius hatte recht. Es ist ein Flüstern in ihrem Hinterkopf, eine Personifikation ihrer Zweifel und Ängste.
Nein. Ophelia steigt in ihren Overall und schüttelt nachdrücklich den Kopf. Julius hatte vielleicht recht damit, dass das Team sie nicht haben will. Das ist nichts Neues, selbst auf der Erde nicht. Niemand will von seinem Arbeitgeber eine Therapeutin auf den Hals gehetzt bekommen.
Trotzdem war es die beste Möglichkeit für Ophelia. Sie ist jetzt hier, und das ist das Wichtigste. Sie muss ihre Kräfte darauf verwenden, etwas zu bewirken, den Menschen auf diesem Schiff zu beweisen, dass sie es kann.
Vorausgesetzt, es gelingt Ophelia, ihr Vertrauen zu gewinnen.
Der Reißverschluss des Overalls klemmt auf halber Höhe, und sie zerrt frustriert daran.
Atme, Ophelia. Der Gedanke, dass Julius genau das zu ihr sagen würde, wenn er jetzt hier wäre und sie noch mit ihm reden würde, schießt ihr durch den Kopf, aber sie verdrängt ihn.
Sie hält einen Moment lang inne, schließt die Augen und konzentriert sich auf ihren Atem, bis er sich verlangsamt und wieder gleichmäßiger wird. Die Anspannung in ihren Schultern lässt nach. Ich schaffe das. Sie brauchen mich, auch wenn sie es nicht wahrhaben wollen. Noch nicht.
Zumindest sieht der sogenannte Scherz mit den Schlaftanks stark nach einem Hilferuf aus. Dass Suresh und Liana sich bei ihrem ersten Einsatz nach Avas Tod tot stellen, dürfte kaum Zufall sein.
Ophelia ist sicher, dass sie jede Verbindung zwischen den beiden Ereignissen abstreiten würden, aber das bedeutet nicht, dass die Verbindung nicht existiert. Die Abwesenheit von Ava belastet sie unbewusst, und das macht alles nur noch schwieriger für das Team – bei diesem Auftrag und bei jedem weiteren.
Jahrzehntelang wurden durch die Decke gehende Fallzahlen von Depression, Angstzuständen, Schlafmangel, häuslicher Gewalt, Gewalt am Arbeitsplatz und Drogenmissbrauch festgestellt. Bis die Entdeckung des Eckhart-Reiser-Syndroms und des zugehörigen auslösenden Ereignisses die medizinische Community zu der Einsicht gezwungen hat, dass es sich nicht um Einzelfälle, sondern um ein grundlegendes Problem handelt.
Der Mensch ist nicht für das Leben und Arbeiten im Weltraum gemacht. Der Schlaf-Wach-Rhythmus gerät aus den Fugen, wenn sich Menschen zu lange in einer künstlichen Umgebung aufhalten. Noch schlimmer trifft es E&G-Teams, die von Planet zu Planet springen, deren Tag-Nacht-Zyklen nicht mit dem der Erde übereinstimmen. Kommen dann zur normalen Arbeitsbelastung noch Isolation, Stress – beispielsweise durch Verlust und Trauer –, schlechte Ernährung sowie fehlende Privatsphäre hinzu, gibt das einen schönen bunten Strauß von verschlimmernden Faktoren.
Gesprächstherapie, Medikamente und regelmäßiger Sport sind Standard-Hilfsmaßnahmen. Aber auch ein besserer Schlaf, das heißt tief, lange und ohne Unterbrechungen, kann einen enormen Unterschied machen.
Die neuen iVR-Bänder, die Ophelia bei dieser Mission testen soll (eine tragbare Version der Montrose-Technologie, die auch auf der Erde verwendet wird), werden dazu beitragen, die physiologische Belastung zu verringern, die durch den Aufenthalt im All entsteht. Hoffentlich. Aber Versuch und Irrtum, besonders am Anfang, sind unvermeidlich.
Besser, sie fängt gleich damit an.
Ophelia öffnet die Augen und fühlt sich bereits ruhiger, geerdeter. Sie kennt ihre Aufgabe, sie hat die nötige Ausbildung und Erfahrung, um diesen Leuten zu helfen. Sie wird hier etwas bewirken. Sie ist keine Versagerin.
Sie zieht den Stoff des Overalls enger um ihren Körper und widmet sich wieder dem Reißverschluss, der sich diesmal problemlos zuziehen lässt.
Da, siehst du?
Sie tritt von ihrem Spind zurück, will die Tür schließen und hält dann inne, ihre Hand auf dem kühlen Metall. Ein Standard-Handgelenkcomm liegt auf der auf Kopfhöhe angebrachten Ablage. Klobiges Display, dickes schwarzes Armband, nur begrenzte Sprach- und Textübertragung. Ein eher kümmerlicher Ersatz für ihr QuickQ-Implantat, aber wenn man sich auf Weltraumreisen begibt, ist die Kommunikationstechnologie nun mal ein paar Hundert Generationen hinterher. Ophelia muss sich genauso wie alle anderen Besatzungsmitglieder darauf verlassen, dass das Schiff die Nachrichten von zu Hause empfängt und sie dann an diese vorsintflutlichen Dinger weiterleitet.
Das Display blinkt gelb, es warten also bereits Nachrichten auf sie.
Bestimmt von ihrem Onkel. Und von Julius vielleicht, falls er inzwischen verstanden hat, wie weit er übers Ziel hinausgeschossen ist. Sie sollte ihm verzeihen. Gerade Ophelia weiß, wie »überzeugend« ihre Familie sein kann – so überzeugend wie ein Messer an der Kehle. Außerdem ist es nicht so, dass sie ihm je wieder vertrauen würde. Es besteht also keine Gefahr.
Mit einem Seufzer nimmt sie das Comm von der Ablage und schließt das dicke Armband um ihr Handgelenk. Sie scrollt durch ihre Nachrichten, löscht drei von ihrem Onkel, von denen die meisten gleich nach Abschalten ihres Implantats eingegangen sind. Unter einer Nummer, die sie nicht kennt, versucht ein anscheinend leicht verwirrter Arzt, einen ehemaligen Montrose-Mitarbeiter an sie zu überweisen, und begreift offensichtlich nicht, dass Ophelia im Moment nicht zur Verfügung steht. Sie leitet den Anruf an Emery weiter, ihre Vertretung, und klickt auf den nächsten.
Diesmal eine bekannte Nummer: Dulcie, ihre jüngere Schwester. Die Nachricht ist kurz. »Ach ja, gut, glaube ich.« Einen Moment lang ist es still, dann seufzt sie. »Ich vermisse dich.« Danach endet die Verbindung.
Ophelias Augen brennen. Dulcie ist nicht nur ihr liebstes Familienmitglied, sondern möglicherweise ihr Lieblingsmensch überhaupt. Aber sie tut das hier genauso für Dulcie wie für sich selbst. All die schlechte Presse über die ältere Schwester kann nicht gut für eine Siebzehnjährige sein.
Sie räuspert sich und blinzelt ihre Tränen weg. Dann speichert sie die Nachricht und ruft die nächste auf.
Eine weitere unbekannte Nummer, diesmal ohne Transkript. Wahrscheinlich wieder der Arzt von vorhin.
Eine blecherne Stimme tönt aus dem Gerät. »Dr. Bray, hier ist Jazcinda Carruthers vom Wahrheits-Channel. Ich hatte gehofft, mit Ihnen sprechen zu können.«
Ophelias Herz setzt einen Schlag lang aus. Jazcinda hat sich noch nie direkt an sie gewandt. Ihre Kontaktinformationen sind kein Geheimnis, das geht in ihrem Beruf auch gar nicht. Aber bisher hat die Phalanx von Montrose-Anwälten alle Journalisten unter Berufung auf das Recht auf Privatsphäre erfolgreich von ihr ferngehalten. Hat sich das etwa geändert? Oder weiß Jazcinda etwas, das sie dazu bringt, das Risiko einzugehen?
»Aber wie es scheint, bin ich leider zu spät dran. Oder eineinhalb Jahre zu früh.« Jazcinda lacht ein selbstironisches, künstliches Lachen, das darauf abzielt, Ophelias Vertrauen zu gewinnen. Nach dem Motto: Sehen Sie, ich bin auch nur ein Mensch. Ophelia arbeitet selbst des Öfteren mit einer ähnlichen Technik.
»Falls Sie sich mit mir in Verbindung setzen möchten, hier ist mein Kontakt.« Auf dem Display blinken Informationen auf. Ein kurzes Zögern, dann fügt Jazcinda hinzu: »Ich hoffe, bald von Ihnen zu hören.«
Ophelia will die Nachricht sofort löschen, doch irgendetwas hält ihren Finger im letzten Moment davon ab, über das Display zu wischen. Lieber die Gefahr im Blick behalten, als ihr den Rücken zukehren. Das war die meiste Zeit ihres Lebens ihre Philosophie, und bisher hat sie Ophelia gute Dienste geleistet.
Außerdem ist sie mehrere Millionen Kilometer davon entfernt, sich jetzt damit auseinandersetzen zu müssen.
Während sie noch über das Wie und Warum von Jazcindas Kontaktversuch nachdenkt, wird bereits die nächste Nachricht abgespielt. Diesmal ist es wieder eine bekannte Nummer, aber nicht die von Julius.
»Ophelia, hier ist deine Mutter.« Ihre leise, schwache Stimme klingt durch das Comm sogar noch schwächer. Aber vielleicht bildet Ophelia sich das nur ein.
Schalt das Ding einfach aus und lösch die Nachricht. Das kann nichts Gutes bringen, und das weißt du. Aber es ist schwierig, ja fast unmöglich, sich von seiner Sehnsucht nach elterlicher Akzeptanz zu lösen. Sie wird schon so früh im Gehirn eines jeden Menschen verankert.
»Ich mache mir Sorgen um dich«, spricht ihre Mutter weiter. Im Hintergrund klirren Gläser, und jemand lacht etwas zu laut. Sie ist also auf irgendeiner Party, wahrscheinlich auf einer Benefizveranstaltung, und versucht auf Weisung ihres Bruders – Ophelias Onkel Darwin –, ihr die Hand zu reichen. Zu spät, natürlich.
»Ich weiß, warum du glaubst, das tun zu müssen«, fährt sie fort. »Und es … tut mir leid.«
Ophelia rollt mit den Augen. Ihrer Mutter tut es immer leid, sagt sie zumindest, doch irgendwie scheinen ihren Worten nie Taten zu folgen.
»Aber ich denke, es ist zu riskant.« Ihr Tonfall wechselt von leise bedauernd zu streng und spitz, einem verspäteten Versuch, Autorität auszuüben. »Flieg nicht zu diesem Planeten.«
Ophelia seufzt und wartet auf eine Warnung vor Jazcinda, die Ermahnung, ihre Familie zu schützen und nach Hause auf das Anwesen in Connecticut zu kommen. Es ist der Mund ihrer Mutter, der spricht, aber es sind die Worte ihres Onkels. Ein gekonntes Puppenspiel.
»Ich weiß, es ist Jahre her, dass du einen … Zwischenfall hattest«, fährt ihre Mutter fort, und Ophelias Augen weiten sich. »Aber du musst bedenken, dass diese Umgebung wie ein Trigger …«
Großer Gott. Mit glühenden Wangen schlägt Ophelia auf das Comm und bringt ihre Mutter zum Schweigen. Gleichzeitig unterdrückt sie das dringende Bedürfnis, sich umzusehen, ob jemand mitgehört hat.
Unglaublich. Sie müssen wirklich sehr verzweifelt sein, wenn sie das ausgraben.
Ophelia schüttelt den Kopf und knallt mit stumpfer Genugtuung die Spindtür zu. Sie hatte recht, wie sie mit einem vertrauten Gefühl der Enttäuschung feststellen muss. Wieder einmal.
Ophelia folgt den roten Pfeilen, die leicht schief auf die grauen Metallwände geklebt sind und auf Englisch, Mandarin, Russisch und Japanisch das Wort BRÜCKE vermelden. Die rote Schrift auf weißem Hintergrund passt gut zum Montrose-Logo, das ebenfalls überall prangt. Theoretisch ist das Logo die abstrakte Darstellung eines Berges mit einer Rose davor: ein großes Dreieck, davor ein kleineres, das auf dem Kopf steht, mit einer gepunkteten Linie darunter, die den Stiel symbolisieren soll.
Allerdings sieht Ophelia jedes Mal, wenn sie das Logo betrachtet, nur ein kleines Dreieck, das auf ein größeres pinkelt. Wahrscheinlich ist es nur gut, dass der Rorschachtest aus der Mode gekommen ist.
Je näher sie der Brücke kommt, desto leiser wird das Brummen der Triebwerke, ersetzt von leisem Stimmengewirr ein Stück vor ihr. Ophelia ist angespannt, und etwas drängt sie, sich zu beeilen, aber sie geht langsam und bedächtig. Von Severin wird sie sich bestimmt nicht hetzen lassen.
Der Korridor endet an einer Schwelle und gibt den Blick auf einen eher kompakten Raum frei. Vier gepolsterte Drehstühle, drei davon besetzt, stehen zwischen Konsolen und Wandtafeln voller Touchscreens und Displays. Die Luft, die Ophelia entgegenweht, ist etwas wärmer als im Rest des Schiffs – aufgeheizt von all den Geräten auf der Brücke. Auf den Bildschirmen blinken Zahlen und Codes, begleitet von leisen Signal- und Hinweistönen, aber nichts, was GEFAHR! schreit. Das ist auch gut so, denn Ophelia hat keine Ahnung, was zu tun wäre, wenn. Es sei denn, es gibt irgendwo einen großen roten Alarmknopf.
Die Kanten der Konsolen sind vom vielen Gebrauch abgenutzt, und der Boden ist zerkratzt, die Resilience ist eindeutig ein Arbeitsschiff. Doch die Brücke macht einen aufgeräumten Eindruck, frei von Ablenkungen, was Ophelia gut zu Severin zu passen scheint: rein äußerlich nicht gerade imposant, aber dennoch einschüchternd. Ophelia spürt einen Druck wie von einem Kraftfeld, das sie daran erinnert, dass sie nicht hierhergehört.