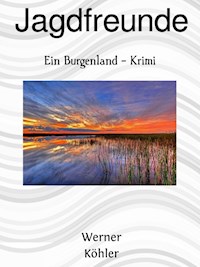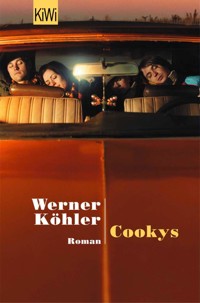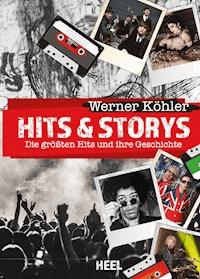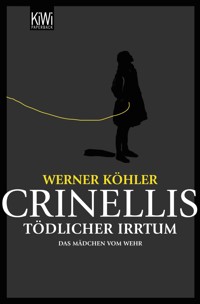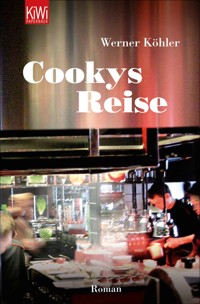
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein lebenspralles Roadmovie über das Vatersein und ein mitreißender Roman über die Leidenschaft fürs Kochen Das Gourmet-Restaurant des Erzählers Gert Krüger, genannt Cooky, läuft ebenso gut wie seine übrigen gastronomischen Unternehmungen. Doch plötzlich der Schock: Der hochdekorierte Sternekoch verliert seinen Geschmackssinn. Und als wäre das allein nicht schlimm genug, zieht auch noch sein pubertierender Sohn Maximilian bei ihm ein, um eine Ausbildung zum Koch zu machen. Der Junge ist bei der Mutter aufgewachsen und Gert völlig fremd. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis die beiden sich mächtig in die Wolle kriegen. Als Gert sich entschließt, seinen Geschmackssinn auf einer Reise durch Frankreich neu zu justieren und seinen alten Freunden Betty und Lupo in der Normandie einen Besuch abzustatten, wo diese ihre Faszination für Molekularküche ausleben, beschließt er, Maximilian mitzunehmen. Die Fahrt wird zu einer Reise in die Vergangenheit der 80er-Jahre und nimmt eine dramatische Wendung, aus der Vater und Sohn gemeinsam ein Stück erwachsener hervorgehen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 471
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Werner Köhler
Cookys Reise
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Werner Köhler
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Werner Köhler
Werner Köhler, geboren 1956, ist Verleger und Geschäftsführer des internationalen Literaturfestivals lit.COLOGNE. Als Autor trat er erst später in Erscheinung. Neben zahlreichen Romanen schrieb er auch Kochbücher der etwas spezielleren Art, darunter das inzwischen zum Kultbuch avancierte »SATT«. Werner Köhler lebt in Köln.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Das Gourmet-Restaurant des Erzählers Gert Krüger, genannt Cooky, läuft ebenso gut wie seine übrigen gastronomischen Unternehmungen. Doch plötzlich der Schock: Der hochdekorierte Sternekoch verliert vorübergehend seinen Geschmackssinn. Und als wäre das allein nicht schlimm genug, zieht auch noch sein pubertierender Sohn Maximilian bei ihm ein, um eine Ausbildung zum Koch zu machen. Der Junge ist bei der Mutter aufgewachsen und Gert völlig fremd. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis die beiden sich mächtig in die Wolle kriegen. Als Gert sich entschließt, seinen Geschmackssinn auf einer Reise durch Frankreich neu zu justieren und seinen alten Freunden Betty und Lupo in der Normandie einen Besuch abzustatten, wo diese ihre Faszination für die gerade aufkommende Molekularküche ausleben, lässt er sich überzeugen, Maximilian mitzunehmen. Die Fahrt wird zu einer Reise in die Vergangenheit der 80er-Jahre und nimmt eine dramatische Wendung, aus der Vater und Sohn gemeinsam ein Stück erwachsener hervorgehen.
»Cookys Reise« ist ein lebenspralles Roadmovie und ein mitreißender Roman über die Leidenschaft fürs Kochen.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2013, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Werner Köhler
ISBN978-3-462-30740-5
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Der Riss
Vorbereitung
Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? …
1984
Abreise
1984
Unterwegs
1985–1990
1990
1985
1990
Am Ziel
In Zeiten der Not war auf unsere Truppe Verlass …
Playlist
Anmerkungen des Autors
Hinweise
Quellennachweis
»There are things in my life that I can’t control«Phoenix
Der Riss
2000
»Für mich eindeutig zu viel Safran.« Enrique Tirado, der Chefkoch des Cookys, tauchte seinen Saucenlöffel zum wiederholten Mal in die noch nicht abgeseihte Brühe, ließ das Gros der Flüssigkeit zurück in den Stiltopf tropfen und probierte erneut. Er schüttelte den rasierten Schädel. »Ich bleibe dabei. Sind Sie anderer Meinung, Chef?«
»Und sonst?«, fragte ich ausweichend.
Wieder probierte der Koch. »Sonst einwandfrei.«
»Das reicht aber nicht, sie muss perfekt sein. Wie lange arbeitet ihr jetzt an der Bouillabaisse?«
»Drei Wochen.«
»Länger!«
»Seit drei Wochen intensiv. Es ist nicht einfach, einen Klassiker zu dekonstruieren, ohne die Essenz des Gerichts zu verändern und damit die Kunden zu verstören. Es soll ungewöhnlich werden, richtig ungewöhnlich und doch vertraut schmecken. Und besser. Besser als das sogenannte Original.«
»Dann schlage ich vor, ihr gebt euch noch eine Woche, und dann entscheiden wir, ob es die Qualität hat, auf die Karte zu kommen oder nicht. Einverstanden?«
Enrique Tirado sah mich von unten herauf an. Das Zucken seiner Lider verriet Verunsicherung. Wir kannten uns seit vielen Jahren. Er erwartete von mir präzise Analysen und klare Ansagen. Keine Allgemeinplätze wie Sie muss perfekt sein oder Gebt euch noch eine Woche.
»Sí, Chef«, sagte er leise und schüttelte den Kopf.
»Okay, machen wir eine Pause. Danach soll Sophia mir das neue Dessert vorstellen.«
Wie sehr mich die Übungssession mitgenommen hatte, bemerkte ich erst, als Enrique bereits vor der Tür an seiner Zigarette zog. Das T-Shirt unter meiner Kochjacke war durchgeschwitzt. Ich spreizte die Finger, meine Hand zitterte. Aber wie hätte ich zugeben können, nichts mehr zu schmecken? Als Chef dreier bedeutender Restaurants und einer Imbisskette? Mein durch und durch beunruhigender Zustand wurde allein dadurch etwas abgemildert, dass ich nicht mehr selbst das Zepter in der Küche schwang. Enrique war ein Meisterkoch. Ausgebildet bei einigen der interessantesten neuen Chefs in Spanien. Außerdem hatte er zwei Jahre in einem Drei-Sterne-Restaurant im Schwarzwald überstanden.
Wenn Enrique Tirado eine Dominanz von Safran herausschmeckte, dann war auf dieses Urteil hundertprozentig Verlass. Er besaß, was man den absoluten Geschmack nannte. Ein Super-Schmecker, wie es unter Geschmacksforschern hieß, im Gegensatz zum Normal-Schmecker. Oder dem Nicht-Schmecker. Dem Andalusier fielen selbst winzige Geschmacksverschiebungen auf. Schon Nuancen zu sehr in Richtung süß, sauer, salzig, bitter, umami ließen ihn gnadenlose Urteile über ein Gericht fällen. Was ihm noch fehlte, war der unbedingte Wille, etwas Besonderes zu schaffen. Daran arbeiteten wir gemeinsam, seit er die Küche im Cookys übernommen hatte.
Am Vorabend hatte ich Enrique in der Küche vertreten. Was eine schöne Unterbrechung meiner Routinen als Chef hätte werden können, geriet zur Katastrophe. Während des Service ging ich jedes einzelne Mitglied der Brigade an, weil mir alle Gerichte, die die Küche verlassen sollten, geschmacklos erschienen. Ich ließ nachwürzen und in mehr als einem Fall sogar neu kochen. Mit dem Ergebnis, dass die Teller zurückkamen.
Und nun der erneute Schock: Der verwendete Safran wollte sich meinen Papillen einfach nicht offenbaren. Warum in aller Welt schmeckte ich das Gewürz nicht? Ich nutzte die Pause, um den Probierlöffel erneut in den Topf zu tauchen, schob die Probe im Mund hin und her, brachte den flüssigen Bestandteilen des Gerichts die gleiche Konzentration entgegen wie den festeren und musste mir eingestehen, nicht nur den Safran, sondern auch die übrigen Zutaten nicht wie gewohnt bestimmen zu können. Ein Gefühl der Niederlage bemächtigte sich meiner. Ich vertraute meiner Zunge normalerweise mehr als meinem besten Freund, eigentlich war sie mein bester Freund.
In der Nacht schreckte ich auf, lief schlaftrunken ins Badezimmer und streckte vor dem Spiegel die Zunge heraus. Im Traum hatte statt des gesunden rosafarbenen Organs ein Stück fauliges Holz in meinem Mund gelegen. Und tatsächlich fühlte es sich auch so an: dick und rau und borkig.
War dieser weiße Belag der Normalzustand einer Zunge oder bereits Teil einer einsetzenden Verwesung? In der Mitte der weißen Fläche wuchsen kleine grellrote Pickel wie Bergspitzen aus einer geschlossenen Wolkendecke. Die zumindest, da war ich mir sicher, gehörten nicht auf ein gesundes Organ. Ich putzte mir die Zähne, ich spülte kräftig mit Mundwasser und schlich mich deprimiert zurück ins Bett.
Von Stund an war meine Aufmerksamkeit zu einhundert Prozent auf das Innere meiner Mundhöhle gerichtet. Am Ende einer weiteren Woche war ich mir sicher, den Geschmack unwiederbringlich verloren zu haben.
Im Tagesrhythmus suchte ich daraufhin einen Internisten, einen Zahnarzt und zwei Homöopathen auf. Den zweiten Naturheilkundler nur auf dringende Empfehlung meiner Freundin Dana. Am Tag vier des Untersuchungsmarathons erhielt ich gegen Mittag einen Anruf des Internisten, der einen Abstrich der Zunge vorgenommen und im Labor hatte untersuchen lassen. Er bat mich, noch mal vorbeizukommen.
»Kein Grund zur Besorgnis«, schickte er voraus, als ich ihm gegenübersaß. In seiner Stimme lag vernehmbarer Stolz.
»Wahrscheinlich enthielt das vom Kollegen verordnete Antibiotikum einen Bestandteil, den Sie nicht vertragen haben. Das ist gar nicht so selten. Eigentlich verschreibt man dieses spezifische Medikament auch nur noch im äußersten Notfall. Jedenfalls hat sich auf Ihrer Zunge ein Pilz gebildet. Kein Wunder also, dass Sie nichts mehr schmecken. Da müssen wir ran, das kann chronisch werden.«
Der erstbehandelnde HNO-Arzt war ein unsympathischer Typ gewesen. Ich hatte ihn wegen einer Sinusitis aufgesucht, und er hatte mir in der Tat, neben dem eigentlichen Medikament, vorsorglich, wie er sagte, auch noch ein Breitbandantibiotikum verschrieben. Der Geschmacksverlust fiel in die Zeit danach. Bis zu diesem Augenblick hatte ich die beiden Dinge allerdings nicht miteinander in Verbindung gebracht.
»Ein Pilz in meinem Mund?« Ich war ehrlich erschrocken.
Der Internist lachte aufmunternd. »Vom Pilzbefall der Darmflora nach der Gabe von Antibiotikum wurde hin und wieder berichtet, ein Zungenpilz ist jedoch etwas Seltenes, mein Lieber, aber genau darum handelt es sich.«
»Und was machen wir jetzt?«
»Ich zeige Ihnen einmal, wie die Zunge arbeitet. Es ist immer gut, wenn der Patient die Zusammenhänge versteht. Sehen Sie hier.« Er war offensichtlich vorbereitet, der medizinische Atlas mit all den unschönen Bildern lag, aufgeschlagen beim Kapitel Zunge, auf dem Schreibtisch des Arztes.
»Das hier ist Ihre Zunge. Zuständig für Ihren Geschmack sind die Rezeptorzellen. Die befinden sich beim Menschen in den Geschmacksknospen, die sich wiederum in den Geschmackspapillen verteilen.«
Während der gute Doktor weiter über die Mundhöhle, Geschmacksknospen und Papillen dozierte, sah ich aus dem Fenster. Meine angeborene Skepsis gegenüber Quacksalbern bekam reichlich Nahrung. Ich beschloss, nichts mehr hören zu wollen. Ich wollte so schnell wie möglich wieder mein Tagesgeschäft aufnehmen.
»Wir haben es gleich«, hörte ich ihn sagen. »Wichtig ist eigentlich nur, dass diese Papillen Tausende von Geschmacksknospen beherbergen. Was Sie aber noch wissen sollten …«
»Doktor …«, unterbrach ich ihn unwirsch.
»Noch einen winzigen Moment. Was Sie also noch wissen sollten, ist, dass Sie nur etwa zwanzig Prozent Ihres Geschmacks auch tatsächlich über die Zunge erfahren. Wussten Sie das?«
»Wussten Sie, dass Jesus an Ostern auferstanden ist? Ich bin Koch. Geschmack ist meine Religion. Doktor, auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, was tun wir nun mit diesem Pilz?«
»Das fragen Sie mich?« Der Arzt schüttete sich fast aus vor Lachen. »Sie sind doch der Koch.«
Na prima, der erste Weißkittel war ein Kurpfuscher und der hier ein verhinderter Komödiant. Armes Deutschland!
»Ich verordne Ihnen eine Suspension. Sie spülen den Mund damit für zwei bis drei Minuten, und dann schlucken Sie das Zeug einfach runter. Die Zunge ist länger als der Teil, den man sieht, wenn man vor dem Spiegel steht.« Wieder deutete er auf das Schaubild. »Einfach runterschlucken. Haben Sie damit ein Problem?«
Das Schlucken wurde keineswegs zum Problem, wohl aber die weiterhin andauernde Geschmacklosigkeit. Seit Beginn der Einnahme verschlechterte sich meine Laune von Tag zu Tag. Zwei Wochen später schlich ich wie ein geprügelter Hund zur ersten Nachuntersuchung. Weitere zwei Wochen Einnahme der Suspension lautete deren nüchternes Ergebnis. Erst danach folgte der erlösende Befund: Zunge und Mundraum pilzfrei.
Am selben Abend zog ich mir eine Flasche besten Rotweins auf, zelebrierte das Dekantieren wie einen heiligen Akt, spülte das bauchige Burgunderglas mit klarem Wasser und trocknete es mit einem frischen Geschirrspültuch.
Der erste Schluck. Mit geschlossenen Augen ließ ich den reifen Wein über die Zunge laufen, zog etwas Luft, schmatzte und schluckte endlich. Beim Einsaugen der Luft war mir, als entdeckte ich ungeahnte Finessen.
Drei Schlucke später fühlte sich meine Zunge an wie eine offene Wunde, über die man Essig geschüttet hatte. Am liebsten hätte ich mir das brennende Stück Fleisch aus dem Mund geschnitten.
»Because maybe You’re gonna be the one that saves me«Oasis
Vorbereitung
2000
Ich schaute aus dem Fenster. Draußen verabschiedete sich ein herrlicher Sommertag mit einem beeindruckenden Farbenspiel. Rot, gelb, violett. Streulicht färbte die Dämmerung. Tage schienen zu Wochen anzuwachsen, seit mein Leben einem neuen Rhythmus unterlag, Minuten dehnten sich zu Stunden. Ich stellte die Tasse in die Spüle und fügte den Kreidestrichen auf der Schiefertafel einen weiteren hinzu. Das folkloristische Accessoire, von dem mir die ersten elf Tage meines neuen Lebens entgegensprangen, diente normalerweise dazu, Einkaufslisten oder Botschaften an die Hausgemeinschaft zu erstellen.
»Urlaub«, antwortete ich betont schmallippig, wenn ich zu den Strichen befragt wurde. »Eine Auszeit. Den Akku aufladen. Kraft tanken.«
Ein Geräusch in meinem Rücken riss mich aus meiner Melancholie. Maximilian. Fünfzehn, in fünf Monaten sechzehn Jahre alt. Einen Meter fünfundachtzig groß, wuscheliges braunes Haar, spitze Nase, schön geformte Augenpartie und eine für meinen Geschmack viel zu große Brille. Der Junge öffnete den Kühlschrank, setzte sich die Milchflasche an die Lippen und trank in langen Zügen.
»Nimm bitte ein Glas, Maximilian. Vielleicht wollen andere auch noch von der Milch trinken.« Ich hasste Milch. Schon von Kindheit an. Würde sie allenfalls kurz vor dem Verdursten anrühren. »Hast du Hunger? Ich kann uns was kochen.« Ich sah durch das Loft hinüber zur Bahnhofsuhr über dem Aufzug. »Es ist schon neun. Dana wird sich verspäten.«
Der Junge schüttelte den Kopf. »Keinen Hunger.«
»Na schön, dann mache ich uns nur einen Salat. Ist das okay? Setz dich zu mir, es dauert nicht lange. Wie war es heute in der Küche?«
»Nichts Besonderes.« Er sah nicht mich an, sondern vor sich auf den Boden.
»Was heißt das?«
»Alles wie immer. Gemüse putzen, den Köchen ihren Müll hinterherräumen. So’n beknacktes Zeug eben.« Immer noch sah er mich beim Reden nicht an. Stand einfach nur da. Kopf gesenkt, die Arme kraftlos neben dem Körper baumelnd wie Gummischläuche.
»Tja, mein Sohn, hättest du die Schule nicht abgebrochen … Lassen wir das. Sei froh, dass du nur bis nachmittags arbeitest und nicht auch noch abends ranmusst.«
»Ich bin fünfzehn.«
»Drohst du mir mit der Gewerkschaft?«
Eine erste Reaktion, er lächelte, immerhin. Nicht übel.
»Gute Idee«, sagte er und zog die Brille ab, um die Gläser mit dem Saum seines T-Shirts zu putzen. »Die Arbeit ist ultrakrass. Kannst du ruhig mal zugeben.«
»Du weißt gar nicht, wie gut du es hast, hier im Cookys arbeiten zu können. Frag mal deine Kollegen in der Berufsschule, wie es in einer Großküche zugeht. Trotz Gemüseputzens und anderer von dir als nieder eingestufter Arbeiten stehst du auf der Sonnenseite des Berufs, mein Freund. Und vor allem: du hast eine Perspektive.«
Wie immer, wenn er keine Lust mehr auf ein Gespräch hatte – und das konnte, wie ich inzwischen gelernt hatte, aus dem Nichts kommen –, verzog sich mein Sohn ohne ein weiteres Wort. So langsam gewöhnte ich mich an sein Verhalten.
In seinen ungeschnürten Chucks und den tief sitzenden Hosen schlurfte er hinüber zum Wohnbereich. Die Milchflasche nahm er mit. Er hockte sich auf die Kante des Ledersofas, stülpte sich die riesigen Muscheln meines alten Kopfhörers über die Ohren und versenkte sich in seine Lektüre. Auf dem Cover des letzten Buches war die Zeichnung eines Jungen mit Nickelbrille vor einem kollabierenden Schachbrett gewesen. Dieses zeigte denselben Jungen und einen bunten Drachen im Hintergrund. Maximilian las beim Warten an der Bushaltestelle, beim Musikhören, ja sogar während er am Telefon mit seiner Mutter sprach. Ich vermutete, dass er es aus purer Langeweile tat, auf diese Weise der Welt zu entkommen suchte. Thematisieren wollte ich es nicht. Während unserer gemeinsamen Zeit sollte der Junge in den Genuss kommen, abseits seiner Pflichten tun zu können, wonach ihm der Sinn stand. Lesen, Computer spielen, Musik hören, abhängen. Ich wollte ihm unbedingt mehr Freiheiten lassen als seine Mutter, die einfach alles zu kontrollieren versuchte. Da beide mit einem unglaublichen Dickkopf gesegnet waren, lag darin meiner Meinung nach die Ursache dafür, dass sie augenblicklich nicht miteinander klarkamen. Neben dem Umstand, dass er die Schule geschmissen hatte und nun bei mir, besser gesagt bei Enrique, in die Lehre ging. Und deshalb auch seit sieben Wochen bei mir wohnte.
Leicht war das nicht. Eine Ausnahmesituation für uns beide. Schließlich hatten wir uns, bevor der Junge bei mir einzog, nie länger als einen Tag am Stück gesehen. Im Gegensatz zu anderen getrennt lebenden Paaren gab es bei Natalie und mir keine fest eingeplanten Vater-Sohn-Wochenenden oder gemeinsame Ferien. Während seiner ersten Lebensjahre hatte ich den Jungen so gut wie nie zu Gesicht bekommen. Später waren meine diesbezüglichen Bemühungen ebenfalls kaum von Erfolg gekrönt gewesen. Und irgendwann hatte ich sie eingestellt. Kein Wunder also, dass ich absolut keinen Plan davon hatte, was man mit Teenagern in seinem Alter anfangen sollte. In den Momenten, in denen ich mich an meine eigene Pubertät erinnerte, hätte ich ihn ohnehin am liebsten gleich wieder weggeschickt.
Natürlich war ich auch ein bisschen stolz, dass der Junge sich entschlossen hatte, bei mir zu wohnen. Etwas zu sehr vielleicht, denn ich hatte vergessen, nach dem Warum zu fragen. Auch warum er ausgerechnet Koch werden wollte, war mir bislang verborgen geblieben. Laut Enrique tat er in der Küche genau, was man ihm sagte, ließ darüber hinaus aber jedes Engagement vermissen, außer, dass er alle Köche mit seinem ständigen Hinterfragen nervte. Etwas von einem erfahrenen Koch einfach anzunehmen, schien ihm gar nicht in den Sinn zu kommen. Immerhin erledigte er die ihm auferlegten Arbeiten korrekt und, wie allgemein bestätigt wurde, sogar mit einigem Geschick.
Was ich sonst noch an meinem Sohn festgestellt hatte: Er mochte keine Rockmusik. Erst recht keinen Pop (positiv) oder Jazz (eher nicht positiv), sondern hörte etwas, das man Gangster-Rap nannte und das ich grausam fand. Was aber viel schwerer wog: Maximilian hasste Sport im Allgemeinen und Fußball im Besonderen. Bestünden die Regeln noch, die meine alte Crew und ich zu Anfang unserer Zusammenarbeit aufgestellt hatten, hätte er gar nicht im Cookys kochen dürfen.
Es hätte mir gefallen, wenn mein Sohn etwas mehr nach seinem Vater gekommen wäre.
Seit sieben Wochen lebten wir nun schon nebeneinanderher. Gemeinsamkeiten? Bislang Fehlanzeige. Bis auf einen gemeinsamen Kinobesuch hatten wir nichts zusammen unternommen. Maximilian hatte den Film ausgesucht. Irgendwas über ein Mathegenie. Zwanzig Minuten nach Beginn der Vorstellung schlief ich tief und fest.
Dass sich Maximilian jetzt allerdings über eine Tüte Chips hermachte, wo er doch angeblich kein Hunger hatte, ärgerte mich. In meiner Welt war kein Platz für Junkfood. Eigentlich waren Salzgebäck, minderwertige Schokoladen oder Tiefkühlkost alles, wogegen ich kämpfte.
Trotzdem hielt ich an meinem Vorhaben fest und begann Salat zu putzen. Etwas Rucola, einige Blätter Eichblattsalat, Endivien, etwas Batavia-Salat. Im Kühlschrank waren noch marinierte Kartoffelscheiben. Zwei pralle, sonnengereifte Tomaten aus dem Cookys-eigenen Garten, wachsweich gekochte Eier, ein paar blanchierte Bohnen, gehäutete Paprika.
Das tiefrote Thunfischfilet briet ich auf dem Teppan Yaki scharf an, bevor ich es in dünne Scheiben aufschnitt und diese auf dem Salat anrichtete. Ich trug die beiden Teller zum Tisch, legte Besteck an, Stoffservietten, etwas aufgebackenes Brot, Fassbutter, zwei Wassergläser, die auch für die Milch zu gebrauchen wären, von der Maximilian am Tag bis zu drei Litern trank.
Ich ging hinüber zur Couch. Außer Schlaf- und Badezimmern gab es in meinem Loft keine abgetrennten Räume, alles ging ineinander über. Ein letzter Streifen Tageslicht fiel auf die alten Dielen. Maximilian reagierte nicht, las einfach weiter, wohl, weil er wusste, was ihm bevorstand. Ich zog ihm die Kopfhörer mit einem Ruck von den Ohren. »Das Essen ist fertig. Komm an den Tisch. Esst ihr zu Hause denn nie zusammen?«
Maximilian zuckte mit den Schultern. »Manchmal.«
»Geht’s etwas genauer?«
»Meistens nicht. Mama isst im Restaurant. Manchmal bringt sie was mit, das können wir uns dann am nächsten Tag aufwärmen. Herreira ist es egal.« Er nannte den Geliebten seiner Mutter beim Nachnamen. »Und ich mach mir eben was, wenn ich Hunger habe.«
»Maximilian, du bringst mich zur Verzweiflung.«
»Wieso? Ich nehme das Essen mit in mein Zimmer. Auf einem Tablett.«
»Du isst auf deinem Zimmer? Alleine? Das musste ich früher, wenn ich etwas ausgefressen hatte. Auf dem Zimmer essen war eine Strafe, wie Taschengeld-Entzug.« Maximilian zuckte mit den Schultern. »Du aber machst das freiwillig … Okay. Lassen wir das. Ist mir auch egal, wie es bei euch abläuft. Hier gibt es Regeln, klar? Im Restaurant sowieso, aber hier oben auch. Außerdem sollten wir häufiger miteinander reden, was aber nicht geht, wenn du dich unter deinen Kopfhörern verschanzt.« Er sah mich irgendwie fragend an. »Wir müssen miteinander reden, wenn wir uns nicht irgendwann die Köpfe einschlagen wollen. Menschen tun so was. Schließlich möchte ich wissen, wer du bist.«
»Ich bin dein Sohn«, antwortete Maximilian, die Augen niedergeschlagen. »Sagt Mama.«
Das saß. Ich schlich zurück zum Küchentisch. Er folgte.
»Du wartest ja auch nicht auf Dana«, sagte er in meinem Rücken. Ich blieb stumm. »Von euch tut jeder, was er will, aber ich soll einen auf Familie machen. Was ist so schlimm daran, wenn jeder für sich isst? Wer bei uns zu Hause Hunger hat, macht sich was. Sonntags gehen wir aus. Aber ich muss nicht mit, wenn ich nicht will. Zu Hause läuft alles bombe.« Er machte eine Pause, und ich verkniff mir den Hinweis darauf, dass es wohl eher nicht so astrein lief, was seine Anwesenheit in Aachen verriet.
»Mir ist egal, was ich esse«, fuhr er fort. »Natalie redet zwar auch ständig über die Qualität von Lebensmitteln, über biologischen Anbau und so, aber mich interessiert das nun mal nicht.«
Seine Mutter nennt er beim Vornamen, dachte ich, tolle Sitten schienen dort oben in Berlin zu herrschen. Zwar hatte auch ich Maximilian gebeten, mich Gert zu nennen, aber doch nur, weil wir uns kaum kannten. Er hielt sich im Übrigen nicht daran. Irgendwie nannte er gar keinen Namen, wenn er mich ansprach – was ohnehin eher selten vorkam. Mit seiner Mutter hingegen hatte er von Geburt an unter einem Dach gelebt.
Und was Dana, meine langjährige Freundin, anging, so verbot sich jeder Vergleich mit der Situation zwischen Maximilian und mir. Ihr unregelmäßiges Berufsleben als Stewardess machte sie zu einer nahezu idealen Lebensgefährtin für mich. Obwohl wir zusammen in meiner Wohnung lebten, war unser Aufeinandertreffen auch nach zehn gemeinsamen Jahren noch immer von Zufälligkeiten geprägt. Dauernde Verschiebungen in unseren jeweiligen Terminkalendern torpedierten ein normales Zusammenleben. Die Hälfte der Zeit war ohnehin keiner von uns zu Hause. Dafür hatten wir es in den Momenten, die uns blieben, unheimlich schön miteinander. Dana stellte kaum Besitzansprüche, machte mir selten Vorwürfe. Einen gemeinsamen Lebensplan gab es nicht.
Während ich selbst hungrig aß, beobachtete ich, wie Maximilian in den Salatblättern herumstocherte, als erwartete er, dabei auf Regenwürmer zu stoßen. Schließlich spießte er ein winziges Stück Paprika auf die Gabel. Den sündhaft teuren Thunfisch schob er an den Tellerrand.
»Gib mir den Thunfisch, wenn du ihn nicht magst. Diese Sushi-Qualität ist wirklich selten. Ich an deiner Stelle würde ihn probieren. Schmeckt großartig.«
»Hmh«, sagte er nur und stocherte weiter im Salat herum.
»Maximilian, was genau ist an diesem Essen falsch?«
»Ungeil!«
»Bedeutet übersetzt?«
»Ich mag keinen Salat.«
Den Kopfhörer trug er jetzt lässig auf einem Ohr, sodass ich die Klaviertöne aus der frei hängenden zweiten Muschel hören konnte, ohne die Melodie oder das Stück zu erkennen. Neben Rap hörte er ausgerechnet noch klassische Musik. Es waren diese Momente unseres Zusammenlebens, in denen ich an meiner biologischen Vaterschaft zweifelte.
»Das hättest du mir vor einer halben Stunde sagen können. Willst du den Kopfhörer nicht für einen Moment absetzen?«
»Ich hab gesagt: Ich habe keinen Hunger. Du hörst mir bloß nicht zu.«
»Dann sag mir doch bitte, womit ich dir eine Freude machen kann? Ich kann was aus dem Restaurant kommen lassen, wenn dir mein Essen nicht schmeckt.« Ich konnte mir das Lachen nicht verkneifen. »Die Jungs braten dir sogar eine Extrawurst, wenn du sie nett darum bittest. Etwas, das nicht vom Chef inspiriert ist. Allerdings muss ich dich warnen: unten wird, wie du ja weißt, alles frisch zubereitet, kein Junk, nichts aus der Truhe.«
Maximilian wirkte tierisch gelangweilt.
»Hab keinen Hunger. Vielleicht gehe ich später noch zur Grillstation.«
Dort hatte er in den zurückliegenden Wochen fast jeden Tag gegessen. Immerhin zog er tatsächlich den Kopfhörer ab, ließ die Musik aber weiterlaufen. Die Muscheln lagen auf dem Tisch und schepperten vor sich hin.
»Wieso kommst du eigentlich nicht mehr runter ins Restaurant? Ich dachte, du bist hier der Chef?«
»Du weißt, was mit mir ist. Diese Zungengeschichte hat mich ausgeknockt.«
»Der Pilz ist doch weg.«
»Sagt der Arzt.«
»Ihr Erwachsenen seid beknackt.«
»Also bitte …«
»Entweder ist man krank oder gesund. Der Doc wird’s schon wissen.«
»Ja, der Pilz ist weg. Trotzdem schmecke ich noch nicht wieder so wie vor der Erkrankung.«
»Und was sagt der Arzt dazu?«
»Kann dauern.«
Ich hatte keine Lust mehr, über diesen verdammten Champignon in meinem Mund zu sprechen. Die ganze Geschichte hatte mich aus der Bahn geworfen, irgendwie war seither mein Selbstvertrauen angekratzt.
»Wird schon wieder«, fuhr ich fort. »Ich nehme mir ’ne Auszeit. Aber es ist ja keineswegs so, dass ich hier oben Däumchen drehe. Ich telefoniere mit Geschäftspartnern und organisiere meine Läden. Und ich weiß zu jeder Zeit, was unten im Lokal vor sich geht. Im Cookys und in den Grillstationen oder bei deiner Mutter in Berlin. Nur an den Gerichten zu arbeiten traue ich mir im Augenblick nicht zu. Wahrscheinlich reine Kopfsache.« Ich winkte ab. »Was soll’s, immerhin koche ich für dich, auch wenn du es vorziehst, Chips in dich reinzustopfen. Und ich würde sehr gerne mehr mit dir unternehmen. Ich könnte dir zum Beispiel das Restaurant von Grund auf erklären. Du brauchst nur ein Wort zu sagen. Wenn ich wüsste, was dich tatsächlich interessiert …«
»Physik.«
»Was ist damit?«
»Mich interessiert Physik. Und Chemie. Sogar Mathe.«
»Klassische Musik nicht zu vergessen.«
»Quatsch, klassische Musik ist langweilig.«
»Wie bitte?« Hatte ich da was falsch verstanden?
»Nur klassische Klavierkonzerte.«
»Also doch Klassik«, sagte ich enttäuscht.
»Ist doch völlig egal.«
»Und Flöte, von diesem Telemann.«
»Oh Gott, das war, als ich ein Baby war.«
»Entschuldige, natürlich.«
Man könnte meinen, er hätte sich genau das ausgesucht, was seinen Vater am allerwenigsten interessierte.
»Die einzige Erinnerung, die ich an Physik habe, ist, wie sich mein Klassenkamerad Willi Keupp direkt vor mir auf unsere Physiklehrerin einen runtergeholt hat.«
Maximilian schlug sich mit der flachen Hand vor die Stirn. Oh Gott, dachte ich im selben Augenblick, hatte ich tatsächlich vorgehabt, einem Fünfzehnjährigen diese olle Kamelle aus meiner Schulzeit zu erzählen? Wenn ja, würde ich ihm dann eines Tages auch von meinem ersten Sex erzählen oder darauf bestehen, seinen ersten Joint mit ihm gemeinsam zu rauchen? Machten Väter so was, um sich bei ihren Söhnen einzuschleimen oder um ihr Älterwerden zu verdrängen?
»Tut mir leid, blöde Geschichte«, versuchte ich abzuwiegeln. Maximilian hatte sich den Kopfhörer wieder aufgesetzt und blickte starr gegen die Wand. »Was ist denn los? Tut mir leid, echt.« Als er selbst dann nicht reagierte, hörte ich mich tatsächlich sagen: »Komm schon, du wirst bald sechzehn.«
»Du bist echt peinlich«, sagte der Junge und trabte, bevor ich etwas entgegnen konnte, in Richtung Schlafzimmer davon.
Ich räumte den Tisch ab und verstaute das schmutzige Geschirr in der Spülmaschine. Jazz drang aus den Boxen in den Ecken des Raumes. Ich pegelte die Lautstärke etwas herunter. Die hypnotische Musik des norwegischen Pianisten Ketil BjØrnstad übte eine beruhigende Wirkung auf mich aus. Ich hörte seine Scheiben oft, wenn ich spätnachts nach Hause kam. Überhaupt hörte ich inzwischen häufiger Jazz. Zur Klangausstattung des Cookys gehörte er schon seit den Gründungstagen, persönlich hatte ich mich ihm erst sehr viel später zugewandt.
Ich lehnte mich an den Herd und starrte hinüber zum Tisch, wo eben noch Maximilian gesessen hatte. Es war eindeutig, dass ich ihm gegenüber noch nicht den richtigen Ton gefunden hatte. Von meiner Idee, ihm Freiheiten zu lassen, war ich ebenfalls noch Lichtjahre entfernt. Ich war einfach zu sehr mit meiner eigenen Situation beschäftigt.
Dazu kam, dass ich keine Ahnung hatte, wie man sich als Vater benahm. Mein eigener war zu früh gestorben und zudem als Vorbild ungeeignet. Was erwartete man von sich selbst in dieser Rolle, und was wurde von einem erwartet? Sollte ich versuchen, Maximilian ein guter Freund zu sein oder doch besser den strengen Erwachsenen geben?
Na klar, als Natalie mich um Hilfe bat, hatte ich mich gut gefühlt, sehr gut sogar. Instinktiv glaubte ich wohl auch, dass ein Junge besser bei seinem Vater als bei seiner Mutter aufgehoben wäre. Nur dass dieser Macho-Traum schneller ausgeträumt war, als er begonnen hatte.
Sieben Wochen waren seit der Ankunft des Jungen vergangen, und ich wusste mir keinen anderen Rat, als ihm peinliche Pubertätsgeschichten zu erzählen. Wenn die gemeinsame Zeit mit meinem Kind nicht für uns beide zu einem Trauma werden sollte, mussten wir einen anderen Umgang miteinander finden. Aber, verdammt noch mal, hätte er nicht vor einem Jahr kommen können, als ich mich noch in ruhigem Fahrwasser befand? Verkackte Vorsehung!
Ich nahm einen Schluck kalt gepresstes Sonnenblumenöl und bewegte das Öl so lange in meiner Mundhöhle, bis es seine Viskosität eingebüßt hatte und sich nur mehr wie simples Wasser anfühlte. Erst danach spuckte ich die jetzt toxische Flüssigkeit in ein Papiertaschentuch und wusch mir den Mund mit warmem Wasser aus. Ein Ritual, das ich anwandte, seit Dana das alte Hausmittel gegen Mundfäule von einer Freundin empfohlen worden war. Ich fand, es half besser als die bislang verordnete Chemie, und hatte beschlossen, die Behandlung noch eine Weile fortzuführen.
Mein Handy summte und kündigte eine SMS von Dana an: »Gerade gelandet. Freue mich auf dich. Nicht einschlafen! Bis gleich. Love D.«
Ich legte mich aufs Sofa und ließ meinen Blick durch die Fabrikhalle schweifen, die nun schon seit über zwanzig Jahren mein Heim war.
Beim Einzug hatte ich all mein Hab und Gut einfach nur irgendwo abgestellt. Meine Räder, die Stereoanlage, den Basketballkorb. Das Einzige, was wirklich fachmännisch aufgebaut worden war, war eine Profiküche, die ich nicht zwingend gebraucht hätte, deren Anblick mich allerdings stets aufs Neue beruhigte. In dieser Fabriketage hatten wir gefeiert, fast jede Nacht. Das Cookys war ein Teil von mir, ein wichtiger Teil.
Es fiel mir nicht allzu schwer, mich nicht um den Aufbau der Pizzakette oder die bestehenden Grillstationen zu kümmern, auch nicht, den Ableger in München oder das Légumes in Berlin selbstständig wirtschaften zu lassen. Bei der Keimzelle meines kleinen Imperiums verhielt sich das entschieden anders.
Vor zwanzig Jahren hatte es hier draußen, neben dem nahe gelegenen Schlachthof nichts gegeben, außer gefährlich dunkle Ecken und Industriebrachen mit kontaminiertem Erdreich. Inzwischen war das Gelände vollständig erschlossen, die Wege zwischen den Gebäuden geteert, eine Ampelanlage regelte den an- und abfließenden Verkehr zur größten Diskothek der Stadt.
Ein paar Künstlerateliers hatten sich als Erste hinzugesellt. Nach und nach eine Probebühne, Lagerräume für Theaterrequisiten und eine Tanzkompanie. Es folgten die übrigen Kreativen: Programmierer, Grafiker, freie Filmschaffende, später dann eine Cateringfirma und ein Psychologe. Erst als es sich bis in den letzten Teil der Stadt herumgesprochen hatte, dass um das Cookys herum eine Enklave kleiner unabhängiger Betriebe entstanden war, bezogen auch die Arrivierten Quartier: eine nationale Anwaltskanzlei, ein Versicherungsbüro, Steuerberater. Mitte der Achtziger hatte ich hier mit der Grillstation mein erstes Franchisemodell ausprobiert.
Die Eröffnung des Cookys hatte nicht nur den Beginn einer anderen Art des Kochens eingeläutet, mit der Inbetriebnahme hatte auch die Zeit begonnen, Fahrt aufzunehmen. Sie verstrich in nie da gewesener Geschwindigkeit. Zumindest war das mein Eindruck. Beim ersten Innehalten hatte ich mich verliebt und doch keine Zeit, diese Liebe zu leben. Beim zweiten Innehalten wurde ein Kind geboren, und wir, die Eltern, hatten uns wieder getrennt. Immer schneller verrann das kostbare Gut.
Und während all dieser schönen, verrückten, schweren Jahre blieb ich stets über dem Cookys wohnen. Die Wohnung sah noch aus wie am ersten Tag. Die Fläche war noch immer zu groß, selbst wenn es weitere Söhne oder Töchter gegeben hätte. Das Unfertige war geblieben. Auf Fremde wirkte die Einrichtung, als stünde ein Auszug kurz bevor. Die Arbeit forderte mich ganz und gar, und, was noch viel wichtiger war, sie machte mir noch immer große Freude. War ich zu Hause, fand man mich im Cookys. Nicht mehr in der offenen Küche, dem Wahrzeichen des Restaurants, ich kochte schon lange nicht mehr selbst. In meinem Büro, auf einer eigens errichteten Empore mit Blick in den Speiseraum, verbrachte ich meine Zeit. Manchmal trank ich ein Glas Wein an der Theke, wo die Gäste ihren Aperitif zu sich nahmen. Ein andermal probierte ich die Kreationen meines Küchenchefs, lobte dessen Einfallsreichtum und fügte den Gerichten hier und da noch einen Touch Cookys hinzu. Wenn ich Lieferanten traf, Architekten, Ingenieure, Küchenbauer, Menschen mit einer Idee, so lud ich sie ins Cookys ein. Dann konnte ich dasitzen, den Service beobachten, in der Weinkarte blättern, die Frische der Waren begutachten und gleichzeitig Geschäfte machen.
»Schatz, das macht doch nichts.« Dana wollte mich in den Arm nehmen. Ich erwehrte mich ihrer Zuwendung und löschte das Licht, um Blickkontakt zu vermeiden. »Vielleicht solltest du dir tatsächlich helfen lassen. Nicht wegen dem gerade. Du machst insgesamt keinen guten Eindruck auf mich.«
In der Dunkelheit klang ihre Stimme eine Oktave tiefer, sanft und verführerisch zugleich. Ich antwortete nicht, wartete stattdessen mit klopfendem Herzen, bis ich nach gefühlten Stunden ihren gleichmäßigen Atem hörte. Erst dann schlich ich mich aus dem Zimmer, zog den Bademantel über und hockte mich auf die Couch. Ich versuchte, Ordnung in meine Gedanken zu bringen. Dana hatte recht, es ging nicht um das akute Versagen gerade eben, es ging darum, dass im Augenblick einfach nichts richtig funktionierte. Zwar kam mein Geschmack langsam zurück, aber immer häufiger befielen mich düstere Momente, in denen ich einfach nur dahockte und negativen Stimmungen erlag. Dabei war ich dafür eigentlich gar nicht der Typ, wenn mir auch ein schluderiger Moll-Akkord allemal näher war als noch der schönste Dur-Wohlklang. Dass diese Krise unter den Augen meines Sohnes stattfand, machte die Dinge nicht eben leichter. Ich schämte mich und hasste mich im nächsten Augenblick genau dafür.
Ich stieß die Luft aus, als stellte Ausatmen ein grundsätzliches Problem dar, ging ins Bad und pinkelte. Minutenlang betrachtete ich mein Spiegelbild. Alt war ich geworden, meinen Augen fehlte der Glanz. Ich öffnete den Bademantel. Ein Bauchansatz war trotz des Sports, den ich mir regelmäßig verordnete, nicht zu übersehen, und über das kümmerliche Ding zwischen meinen Beinen hätte ich in diesem Augenblick heulen mögen. Ich sah auf die Uhr. Kurz nach zwei in der Früh. Ich zog Hausschuhe an, schleuderte sie sogleich wieder von den Füßen, lief hinüber zum Aufzug.
Fahrstuhl zum Schafott erklang, sobald sich die Kabine in Bewegung setzte. So war es seit Anbeginn aller Cookys-Zeiten. Selten zuvor hatte Miles’ Horn so tief-traurig, so deprimiert geklungen. Der Witz war schal geworden, gleich morgen würde ich Atif bitten, die Musik zu ändern.
Wie oft schon hatte ich allein in diesem Raum gestanden? Zu den großen Fenstern hinübergeschaut und mich still meines Daseins gefreut? Jenseits der Panoramascheiben das schlafende Aachen. Und wie hatte ich diese Momente geliebt. Frühmorgens, wenn noch keiner im offenen Rund der Küche arbeitete. Ganz allein machte ich meine Mise en place, schärfte die Messer, heizte den Molteni-Herd auf, brühte mir einen Kaffee aus der Ferrari-roten Maschine hinter dem Tresen. Setzte eine der kleineren Gusspfannen auf den Herd, ließ ein Stück Butter schmelzen, bis leichter Nussgeruch den Raum durchzog, gab dann ein zerschlagenes Ei in die braune Butter und frühstückte das fertige Omelett zusammen mit einer Scheibe Toast.
Noch schöner war dieser Blick über die Stadt bei Nacht. Wenn alle Gäste gegangen waren, alle Arbeit getan war. Es hatte keinen Abend gegeben, nicht einen einzigen, an dem ich mich nicht am Aufzug noch einmal umgedreht und diesen Blick genossen hätte, der zugleich ein Blick auf mein gutes Leben war.
Ich ging einige Schritte in den Raum hinein. Direkt vor dem Rondell der Köche stand immer noch der lange Holztisch aus den frühen Jahren des Cookys. Hier hatte ich meine Freunde bekocht, jeden Abend. Hier servierte ich die typischen Gerichte meiner Jugend. Die Lasagne. Mit einem simplen Nudelgericht hatte alles begonnen. Dann die Aufläufe und gefülltes Gemüse, die großen Braten, Klöße in jedweder Form und das von allen geliebte Wiener Schnitzel. Den Wein gab es aus großen Karaffen. Die Besetzung am Tisch änderte sich jeden Abend, nicht alle kamen zum Essen. Einige wollten reden, andere einen Absacker trinken oder einfach nur Hallo sagen.
Ich starrte den Tisch an. Ein Symbol meiner kräftigen Jahre. Wie lange war das her? Lichtjahre. Als das Leben noch wehtat, nicht aber Knochen und Gelenke. In einer weit zurückliegenden, unschuldigen Zeit.
Heute, im Cookys unter Enriques Führung, wurde dieser Tisch Abend für Abend teuer verkauft. Damals hieß er Cookys Table und war der nicht zu buchende Stammtisch. Heute nannten wir ihn einfach Küchentisch. Der Mythos war verflogen. Mindestens sechs Personen, maximal zehn konnten bekocht werden. Sie speisten, was die Crew eigens für diesen Tisch zusammenstellte, und saßen dabei den Köchen praktisch auf dem Schoß. Bedient wurden sie vom Küchenchef persönlich, und Atif, der Letzte aus der alten Crew und Chef de Service, beriet mit ihnen die Weinfolge, degustierte vielleicht sogar ein paar Flaschen parallel, unterschiedliche Jahrgänge, verschiedene Produkte der gleichen Lage. Die Gäste waren verrückt nach diesem Logenplatz, Buchungen wurden nur alle sechs Monate für das kommende halbe Jahr angenommen, und der Tag, an dem das passierte, galt uns Cookyanern als D-Day. Der Tisch, der einst für meine Freunde bestimmt gewesen war, an dem Tom als Stammgast allabendlich Platz genommen hatte, an dem niemals jemand hatte bezahlen dürfen, war heute das beste Geschäft des Cookys.
Meine Faust traf auf das blank gescheuerte Holz. Nicht einmal ein paar lächerliche Tränen wollten mir gelingen.
Ich ging zur Bar am Ende des Raums, die von Veränderungen weitgehend verschont geblieben war. Heute wie damals wurden hier die Gäste empfangen, tranken ihren Champagner, bekamen erste Amuse-Gueules – die wir inzwischen, politisch korrekt, Amuse-Bouches nannten – und gaben ihre Bestellung auf, bevor sie zum Tisch begleitet wurden. Hinter der Bar gläserne Kühlschränke, das Handlager der Weinkellner. Dort, wo einst mein kleines Büro mit dem wackligen Schreibtisch, dem gebrauchten Safe und der abgewetzten Besetzungscouch gewesen war, befand sich nun ein begehbarer, wohltemperierter Weinschrank für die besseren Gewächse. Die tatsächlichen Preziosen aber lagerten wie eh und je zwei Stockwerke unter der Erde, im immer gleichen Klima des alten Gewölbekellers.
Ich schenkte mir ein Glas Wein ein und sah nach, was Atif als Letztes gespielt hatte. Nach wie vor war der Libanese unser MoM, unser Master of Music. Und immer noch konnte er fuchsteufelswild werden, wenn man seine Wahl kritisierte. Guter, alter Atif. Ich liebte ihn wirklich. Stark und unbeugsam wie eine antike Heldenfigur. Ein wenig aus der Zeit gefallen, mit großem Herzen hinter bärbeißiger Fassade. Ich erwartete The Chronic von Dr. Dre oder die Fugees, die er gerne zum Ausklang eines Abends spielte, je nachdem wie der Service gelaufen war. Er schiss auf die Kritiker, die Wyclef Jean und Lauryn Hill ihren Hang zu Coverversionen vorwarfen. Ertönten jedoch stattdessen die Beastie Boys, konnte man getrost auf einen alkoholreichen Fortgang der Nacht wetten. Atif erlebte man dann aufgedreht, voller Leben, was aller Erfahrung nach auf eine neue Liebschaft hinwies. Nach dem Service traf er sich mit seiner Braut und durchtanzte den Rest der Nacht in seiner an einen trotzigen Bären erinnernden, unnachahmlichen Art. Am Tag nach einer solchen Nacht tat man gut daran, vorsichtig mit Atif umzugehen. Er hatte seine Launen nicht immer unter Kontrolle.
Als hätte er geahnt, was seinen alten Weggefährten in dieser Nacht umtrieb, erfüllte leises Gitarrenspiel den Raum, nachdem ich die Play-Taste gedrückt hatte. Gefolgt von einer Stimme, brüchig wie ausgetrocknetes Holz: Johnny Cash in seinen letzten Lebensjahren. Endlich ein paar Tränen.
Ich dachte zurück an jene Nacht vor achtzehn Jahren. Die Nacht nach Toms Beerdigung. An den kleinen Tom. Meinen Freund aus Jugendtagen, mit dem Betty und ich unzählige Nächte durchraucht, durchtrunken, durchfeiert hatten. Immer am Rande des gerade noch Beherrschbaren. Am Ende war er seiner Sucht nach Leben erlegen. Sein Tod hatte eine Zäsur in meinem Leben bedeutet, in unser aller Leben. So wie der Pilzbefall meiner Zunge im Begriff stand, mich in eine neue Zeitrechnung zu überführen. Eines Tages würde ich zurückblicken und zu meinen Kindern sagen: Damals, als ich plötzlich nichts mehr schmeckte … Zu meinen Kindern? Ich war fünfundvierzig Jahre alt. Ich schüttelte den Kopf. Oben schlief Maximilian, mein Junge, den ich kaum kannte und der eigentlich bei seiner Mutter lebte, die ich am Ende jenes Abends, an dem Tom beerdigt wurde, zum ersten Mal geküsst hatte.
Natalie! Ich hatte es vermasselt, war nicht aufmerksam genug gewesen, zu selbstverliebt und unreif, um an der Seite einer starken Frau bestehen zu können. Zu viele Wetten damals, zu viele Kocharien, zu viel Jungs-Geplänkel mit den Guerilla Kochthosen.
Während ich an meinem Weinglas nippte, versuchte ich mich auf etwas zu konzentrieren, das außerhalb meines inneren Aufruhrs lag. Ich hatte eindeutig zu viel und zu schnell getrunken. Ich lauschte der Musik. Billie Holiday.
Southern trees bear a strange fruit,
blood on the leaves and blood at the root,
black bodies swinging in the Southern breeze,
strange fruit hanging from the poplar trees.
Bei Strange Fruit, dieser unfassbar traurigen Anklage gegen die Lynchmorde in den Südstaaten der USA, begann ich erneut zu weinen. Wahrscheinlich nicht einmal wegen der grausamen Wahrheiten des Songs, sondern wegen der tiefen Melancholie, die sich aus der Musik erhob. Trotzdem würde ich für den Rest der Nacht bei Billie bleiben.
»Was soll ich denn deiner Meinung nach tun?« Ich reagierte gereizt auf Dana, die die Ereignisse der vergangenen Nacht nicht auf sich beruhen lassen wollte. Und dabei sprach sie keinesfalls vom Naheliegenden. »Meine Köche brauchen mich.«
»Keines deiner Restaurants wird zugrunde gehen, wenn du deine Präsenz zukünftig etwas herunterfährst. Du hast sehr gutes Personal, sagst du das nicht immer? Enrique, Cruyff in München, Natalie in Berlin. Sie werden auch ohne deinen feinen Gaumen und dein Näschen zurechtkommen. Immerhin stehst du doch schon lange nicht mehr selbst jeden Tag hinter dem Herd. Und alles andere, dein Gespür für Entwicklungen in der Gastronomie, deine Fantasien, Träume, deine übrigen Talente, ist doch nicht betroffen. Du kannst doch arbeiten!«
Sofort schossen mir die Tränen in die Augen. Seit ich damit in der Nacht angefangen hatte, brauchte es wenig, um deren Fluss erneut in Gang zu bringen. Ungewohnt war das. Ein Zeichen, dass mir die Dinge entglitten.
»Ja, vielleicht ist gerade das das Problem, dass ich schon lange nicht mehr aktiv koche. Zumindest nicht da, wo es wehtut, wo es um etwas geht. Es gibt so vieles, was ich schon lange nicht mehr mache.«
»Hab ich irgendetwas verpasst?«
»War nur so dahingesagt. Aber es ist doch so: Es gibt Tage, da fühle ich mich, als steckte ich in einer Zwangsjacke. Ich komme aus den negativen Gedanken einfach nicht mehr raus.«
»Vielleicht solltest du dir etwas Zeit nehmen. Zeit für dich ganz persönlich. Überleg dir, was du mit den nächsten zwanzig Jahren deines Lebens anfangen willst. Vielleicht kommst du zu dem Ergebnis, dass es gut und richtig ist, weiterzumachen wie bisher. Es ist nichts falsch an deinem Leben. Vielleicht findest du aber auch heraus, dass es noch mehr gibt, was man tun könnte. Ganz andere Dinge vielleicht.«
»Als Kochen?«, fragte ich ungläubig.
»Vielleicht sogar das. Steht dein Plan mit der Reise noch?«, fragte sie.
Ich nickte. »Klar. Und es wird mir von Tag zu Tag wichtiger. Ich muss tatsächlich mal raus, sonst werd ich am Ende noch depressiv oder gleich ganz verrückt.«
»Hör auf Krüger. Deine Wehleidigkeit ist echt nicht zum Aushalten. Jetzt reiß dich mal ein wenig zusammen. Weißt du denn schon, wohin du reisen willst?«
»Hab ich dir doch schon gesagt, zu Armel in die Bretagne. Und vorher vielleicht noch zu Betty.«
»In die Bretagne. Ist doch prima. Reine Luft, koscheres Essen, was auch immer.«
»Koscher ist jüdisch.«
»Was du nicht sagst.«
»Koscher ist jüdisch. Armel ist meines Wissens nicht jüdisch und jüdisches Essen nicht, wonach ich suche. Ich möchte meinen Geschmack ganz neu aufbauen, verstehst du?« Ich richtete mich auf, merkte, wie mich allein schon der Gedanke an diese Reise aufheiterte. »Ich habe die Öl-Ziehkur durchgehalten, Reizstoffe reduziert, alles dafür getan, dass meine Zunge gereinigt wird. Jetzt, wo sie fast wieder okay ist, möchte ich sie neu … neu … formatieren.« Ich stockte. »Ich erlaube mir, noch einmal alles neu zu schmecken. Wie ein kleines Kind, das seine erste Möhre bekommt, die erste Kartoffel, den ersten Schluck Milch. Alles neu, alles aufregend. Vielleicht verschiebt sich dadurch sogar mein Wissen um den Geschmack. Das ist irre aufregend, findest du nicht?«
»Geht so. Für mich steht die Geselligkeit über dem Essen, das weißt du ja. Bei dir ist es umgekehrt.«
»Das kannst du nicht sagen. Wer hatte denn jahrelang einen Tisch für Freunde?«
»Vergangenheitsform, Gert.«
Meine Euphorie fiel in sich zusammen. »Der Junge frisst übrigens nur Scheiß. Chips statt Salat.«
»Rasanter Themenwechsel, Herr Krüger. Aber okay. Wie fändest du es, wenn du Maxi einfach essen lässt, worauf er Lust hat.«
»Der Kerl macht mich verrückt.«
Sie fasste meinen Arm. »Ist kein guter Moment für eine Vater-Sohn-Zeit, oder? Wenn der Vater sich gerade nur mit sich selbst und seiner Vergangenheit beschäftigt, hat er wenig Zeit für die Zukunft seines Sohnes.«
Ich sah Dana ratlos an. »Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer, was ich mit ihm anfangen soll.«
»Dann beschäftige dich endlich mehr mit ihm. Wie kann man ein Kind in die Welt setzen und keinerlei Interesse an ihm entwickeln? Bist du niemals auf die Idee gekommen, dass dem Jungen der Vater fehlen könnte?«
»Es stimmt doch nicht, dass ich keinerlei Interesse an ihm habe oder gehabt hätte. Das ist einfach nicht wahr. Und das weißt du auch.«
»Mir geht’s nicht um Schuld, sondern darum, dich zu verstehen. Du bist mein Partner, und da gibt es dieses schwarze Loch in deinem Leben. Jedes Mal, wenn ich versuche, etwas Licht da reinzubringen, verweigerst du dich. Und was mich am meisten erstaunt, ihr arbeitet doch zusammen, du und Natalie. Ihr telefoniert mindestens einmal wöchentlich …«
»Dana, hör auf. Ich habe mich vor langer Zeit entschieden, lieber gar kein Vater als ein schlechter zu sein. Ich arbeite sechzehn Stunden am Tag und lebe siebenhundert Kilometer von dem Jungen entfernt. Ich schufte an den Wochenenden und hatte in all den Jahren nicht ein einziges Mal richtig Ferien. Natalie übrigens auch nicht. Wir sind Köche, wir haben ein anderes Leben.«
»Das mag sein, aber erinnere dich bitte, wie wir um gemeinsame Stunden kämpfen müssen.«
»Ich will mich nicht streiten.«
»Wir streiten doch nicht. Kannst du dich nicht erinnern, wie es ist, wenn ich richtig fuchsteufelswild werde?«
»Lieber nicht.« Ich nahm ihren Kopf zwischen die Hände und gab ihr einen Kuss.
»Hast du mal daran gedacht, dass man nicht nur eine Zunge neu justieren kann, sondern auch eine Beziehung?«, fragte sie nach einer kurzen Pause.
»Findest du unsere Beziehung so schlimm?«
»Ich spreche von Maximilian. Eure Beziehung ist es wert, dass daran gearbeitet wird. Er ist nämlich ein toller Junge.« »Wie der Vater.«
Sie küsste mich.
»Gert, ich glaube, ich habe eine gute Idee.«
Am nächsten Morgen stand ich auf der Leiter und schraubte neue Birnen in die schwarzen Industrieleuchten, als Dana hereinkam, das Haar zerzaust. Maximilian saß über einen Teller Cornflakes gebeugt und las dabei in einem von Danas Hochglanzmagazinen.
»Guten Morgen«, sagte Dana.
Ich kletterte von der Leiter und nahm sie in den Arm. Ich liebte den Geruch nach Schlaf an ihr und die Wärme ihres Körpers am Morgen.
»Wer macht denn hier so einen Krach?«, murmelte sie.
»Ich wechsle die Birnen aus.«
»Die waren doch noch in Ordnung.«
»Aber die Lichtausbeute war schlecht.«
»Ist mir gar nicht aufgefallen.«
»Die Dinger sind drin, seit ich hier eingezogen bin.« Dana verzog den Mund. Sie fand, dass ich zu Übertreibungen neigte. »Manche ganz bestimmt«, insistierte ich schnell. »Man sollte die Birnen alle zwei Jahre durchwechseln.«
»Sagt wer?«
»Das weiß man doch.«
»Und du, Einstein, bist du der gleichen Meinung?« Sie wuschelte Maximilian durchs Haar, der nichts dagegen zu haben schien, so wie er sie dabei anstrahlte. Die beiden hatten sich von Beginn an glänzend verstanden.
»Weiß nicht.«
»Maximilian weiß nie irgendwas«, rief ich und stieg wieder auf die Leiter. »Scheint etwas Grundsätzliches zu sein.«
»Hör nicht auf ihn, Maxi.«
»Eigentlich müsstest du es wissen. Hast du nicht gesagt, du magst Physik und Chemie? Und irgend so was ist das doch hier wohl.« Ich hielt ihm eine Birne entgegen.
»Das hängt von vielen Faktoren ab.« Maximilian sprach zu seinem Teller. »Normalerweise halten die Lampen 1000 bis 2000 Stunden. Zu hohe Betriebsspannung verkürzt die Lebenszeit, und umgekehrt kann man durch eine niedrigere Spannung die Brenndauer um ein paar Prozent verlängern. Aber auch Erschütterungen oder zu hohe Umgebungstemperatur verringern die Ausbeute und auch, wenn man das Licht zu häufig aus- oder einschaltet.«
»Hoppla, du bist ja plötzlich richtig gesprächig. Ich mache dir Frühstück, Dana. Was darf es sein?«
»Bei Halogenstrahlern ist es anders, und Leuchtstoffröhren verlieren tatsächlich ihre Kraft mit der Zeit. Vielleicht hast du das verwechselt.«
»Und, Männer, was bringt euch euer Tag?«, fragte Dana und streckte dabei zwei Finger in die Höhe.
»Spiegel oder Rühr?«, fragte ich. Zwei Finger schlossen ein gekochtes Ei aus.
»Spiegeleier, kein Speck, Sunny Side up.«
»Kommen sofort. Hash browns?«
Meine Standardfrage, wenn Dana Lust auf ein Amerikanisches Frühstück verspürte. Auf dem Rückweg vom Napa Valley, wo ich an einer internationalen Weinverkostung teilgenommen hatte, hatten wir einen Tag gemeinsam in Los Angeles verbracht, bevor wir zurückflogen. Ich als Passagier der ersten Klasse, Dana als Purserette des Fluges. In einem Coffeeshop, zwei Blocks vom Hotel entfernt, hatten wir am Morgen vor dem Abflug zusammen gefrühstückt. Als wir eintraten, hockte dort bereits die gesamte Flugcrew im Küchendunst vor dampfenden Kartoffeln und glibberigen Eiern. Flugbegleiter sind Herdentiere, die in der Ferne noch näher zusammenrücken. Dana konnte stundenlang Geschichten von den Schrullen ihrer Arbeitskollegen erzählen, wobei der Löwenanteil darauf abzielte, wer es gerade mit wem trieb. Mir hatte es genügt, einmal die Nase über den Teller zu halten, um am Ende mit einer Tasse schlechten Kaffees vorliebzunehmen.
Bei mir wurden Eier auf andere Art und Weise gebraten, als es jenseits des großen Teichs Brauch war. Schon die Qualität des Produkts hatte nichts mit dem blassen Eigelb aus einer Legebatterie gemein. Außerdem benutzte ich kein Kochsalz, sondern reine Salze, derzeit am liebsten ein Produkt aus der Kalahari-Wüste. Bratkartoffeln am Morgen würde ich mich allerdings bei jedweder Qualität verweigern. Zu den Bioeiern aßen wir in der Regel selbst gebackenes Brot aus der Restaurantküche oder, wie an diesem Morgen, vom Chef höchstpersönlich hergestellte Brioche. Bestrichen mit normannischer Butter, nicht mit Low-Fat-Butterersatz, den die Amerikaner über ihren labberigen Toast strichen.
»Kaffee, ein großes Glas. Milchschaum, zwei Löffel Zucker, bitte.«
»Du bist spät zurückgekommen«, sagte Maximilian in Danas Richtung.
»Drei Stunden delay, ätzend. Und dann auch noch in diesem dämlichen Aden.«
Ich stellte das Glas neben ihren Teller, servierte die Eier und beobachtete Dana, wie sie mit jedem Bissen wacher wurde.
»Wie ist es da?«, wollte der Junge wissen.
»In Aden? Oh Gott! Warst du schon mal in einem muslimischen Land?« Maximilian schüttelte den Kopf. »Dann lass es auch besser bleiben. Fürchterlich, diese Machos. Außerdem ist der Flughafen der dreckigste weit und breit. Lagos vielleicht noch …«
»Das Klo der Welt«, warf ich ein.
»Richtig, Lagos ist das Klo der Welt. Flugbegleiter-Geschwätz, Maxi, hör nicht drauf, berufliche Deformation. Wir haben unsere eigene Sicht auf die Welt.«
Das Telefon klingelte. Gerry war dran, einer aus Enriques Mannschaft. Ich hatte ihn ausgewählt, um mit ihm zusammen an der Qualität der Pommes frites für die Grillstation zu arbeiten. Das neue Frittieröl war endlich eingetroffen, und ich versprach, nachher noch in der Küche vorbeizuschauen, um mir selbst ein Urteil zu bilden. Meine neu erwachenden Geschmacksnerven mit Fettstäbchen zu quälen war zwar sicher nicht ideal, aber wer sollte es sonst machen. Enrique hasste die Grillstation. Diesbezüglich war er ein Snob. Bei dem anstehenden Test ging es außerdem weniger um den Geschmack als vielmehr um die Konsistenz der Kartoffelstäbchen. »Ich möchte Pommes, die innen fluffig wie cremiges Püree sind und eine Haut wie aus dünnem Glas haben. Sie sollen richtig krachen, wenn man zubeißt.« Nur weil ich seit über zwanzig Jahren die besten Pommes frites der Stadt machte, wollte ich nicht ausruhen. Nichts war so gut, dass man es nicht noch verbessern konnte.
»Maximilian, du isst doch jeden Tag an der Grillstation.« Ich sah zu meinem Sohn hinüber. »Wie findest du die Pommes?«
»Weiß nicht«, sagte der Junge und blickte Dana Hilfe suchend an. Die zuckte nur mit den Schultern.
»Jetzt komm. Du haust dir das Zeug kiloweise rein und hast keine Meinung? Los, trau dich.«
»Gut«, sagte er zaghaft und dehnte den Vokal dabei abstrus in die Länge.
»Einfach so: gut. Nichts zu beanstanden? Sehr gut oder nur gut?«
»Gert, lass den Jungen in Ruhe. Sehr gut oder nur gut, was soll denn das? Wer war da eben am Telefon?«
»Gerry.«
»Der süße Typ mit den roten Haaren?«
»Er ist Engländer.«
»Du sagst das, als könnten Engländer nicht süß sein. Also ich erinnere mich da an diesen Burschen in Dublin, wie hieß er noch gleich?«
»Schon gut, Chérie, es war der süße englische Gerry.«
»Und, was hat er gewollt?«
»Das neue Öl ist da.«
»Nein!« Dana klatschte in die Hände und strahlte über das ganze Gesicht. »Ist es zu fassen? Maxi, das neue Öl ist da. Und da sitzt du hier noch so rum?«
Ich merkte, wie ich sauer wurde.
»Gerry testet das neue Öl«, sagte ich trotzig. »Vielleicht werden die Pommes damit besser. Erdnussöl, ich bin skeptisch, aber er schwört, es bringt die Konsistenz, die ich gerne hätte. Ich gehe später mal kurz runter und sehe mir das Ergebnis an.«
»Warum nimmst du Maximilian nicht mit. Der Junge hat den absoluten Frittengeschmack, und du hast doch eh Angst, in irgendetwas reinzubeißen.«
»Danke auch fürs Mutmachen. Aber warum nicht?« So würde der Junge wenigstens sehen, dass ich mich sehr wohl noch im Restaurant blicken ließ, und nicht nur das … »Was ist Maximilian, hättest du Lust auf ein kleines Testessen? Findet allerdings während deiner Pause statt.«
Zu meiner Verwunderung stimmte er sofort zu und wartete obendrein noch mit einem schmalen Lächeln auf.
Bevor ich den Raum verlassen konnte, zupfte Dana mich am Ärmel.
»Hast du mal darüber nachgedacht, was ich letzte Nacht gesagt habe?« Ich nickte. »Und?«
»Du bist nicht nur wahnsinnig attraktiv, sondern auch irrsinnig klug.«
»Jetzt benimm dich wenigstens einmal erwachsen.«
»Aber gern.«
»Also, was nun?«
»Gute Idee, aber sie liegt mir auf der Leber.«
Der Mittagstisch war durch, die Vorbereitungen für das Abendgeschäft erledigt und die Köche in die Pause verschwunden. Um fünf würden sie zurück sein, dann ging es bis nach Mitternacht. Kein Beruf für Leute mit anderweitigen Bedürfnissen oder Verpflichtungen.
»Wie geht’s dir heute, Cooky?« Atif saß über der Abrechnung und winkte von der Bar herüber.
»Ganz passabel, danke. Ihr kennt Maximilian? Nats Junge.«
Atif, Gerry und eine junge Frau aus dem Service sahen mich ausdruckslos an. Verwunderung in den Blicken. Ich überspielte die peinliche Pause nach meinem missratenen Witz und kam direkt zur Sache.
»Und, Gerry, wie sieht es aus? Innen saftig und außen ganz knusprig?«
»Ist nicht so schlecht, Chef.« Der Cockney-Akzent verriet den Südlondoner. »Wollen Sie probieren?«
»Atif, was hältst du von den Pommes?«
Der Libanese erhob sich von seinem Hocker und streichelte sich über den mächtigen Bauch. Dabei ließ er ein kräftiges, dunkles Lachen ertönen. »Fritten, Cooky, sind für mich tabu!«
»Eine könntest du probieren. Für mich.«
»Für dich tue ich fast alles, aber bitte keine Fettstäbchen mehr. Nicht mehr für den Rest meines Lebens.« Eine Anspielung auf seine ersten Jahre in Deutschland, die er als Bierkutscher verbracht hatte und in denen Fast Food so sehr zu ihm gehört hatte wie heute die Haute Cuisine und die großen Weine der Welt.
Ich lachte. »Lass sehen, Gerry.«
Der Koch warf eine Ladung wohlgeformter Kartoffelstäbchen in das Sieb und senkte es in das heiße Fett.
»Wie viel Grad?«, fragte ich.
»Wie immer, zweihundert. Der erste Durchgang mit einhundertfünfzig, Herr Krüger.«
Kurze Zeit nach Toms Tod hatte ich meinen Namen geändert. Cooky, der Name, der mich über Jahre begleitet hatte, erschien mir nicht länger tragbar. Nach den dramatischen Ereignissen war es Zeit gewesen, erwachsen zu werden. Die alte Crew allerdings blieb, ebenso wie langjährige Freunde, von dieser Maßnahme unberührt. Es wäre mir lächerlich vorgekommen, meine Ansagen in der Küche plötzlich mit dem allgemein üblichen »Oui, chef« bestätigen zu lassen.
Ich machte einige Schritte durch den Küchenbereich. Über zehn Jahre hatten wir hier in der gleichen Besetzung gekocht. Cruyff auf dem Fleischposten, Sweety bei den Desserts. Natalie hatte ihre Gemüse gegen alle Anfeindungen verteidigt, und Lupo war eine Gefahr für jeden Fisch und jede Frau gleichermaßen gewesen. Was für eine Crew! Ich seufzte. Alles ging einmal zu Ende. Und diese banale Weisheit galt ganz besonders für die Besetzung in Küchen der Top-Gastronomie.
Ich sah zu Gerry hinüber. Er hielt eine fertige Fritte wie einen Taktstock in die Luft. Ich schloss die Augen und dirigierte all meine Konzentration auf den Punkt meiner Zunge, der als Erster mit der Kartoffel in Berührung kommen würde. Beim Reinbeißen entstand kein Geräusch. Enttäuschend! Das Innere der Kartoffel war weich, aber nicht fluffig. Dafür überzog ein Ölfilm meine Zunge. Ein schlechtes Zeichen. Ich öffnete die Augen wieder, spuckte die zerbissene Kartoffel in die Hand und ließ den Matsch in den Abfalleimer gleiten. Dann wischte ich mir den Mund ab und trank ein Glas Wasser. Alle Augen waren auf mich gerichtet.
»Seht mich nicht so an, Freunde. Probiert selbst, wenn ihr mir misstraut. Die Fritten sind schlechter als die vom Grill. Was ist los, Gerry? Das schmeckt selbst ein Geschmacksgestörter. Probier doch selbst mal. Atif? Maximilian? Könnt ihr bitte auch mal was sagen?«