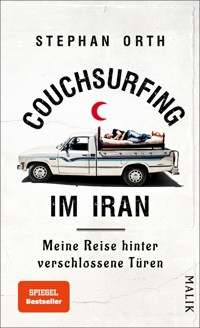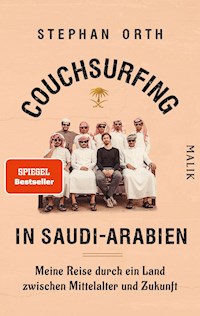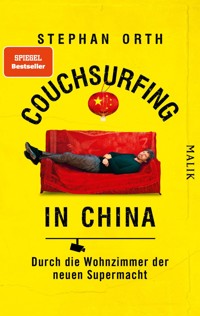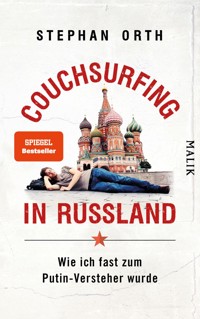
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Das erste Russland-Buch ohne Bären und Balalaikas! Was ist Propaganda, was ist echt? Über keinen Teil der Erde ist die Informationslage verwirrender als über Russland. Da hilft nur: hinfahren und sich sein eigenes Bild machen. Zehn Wochen lang sucht Bestsellerautor Stephan Orth zwischen Moskau und Wladiwostok nach kleinen und großen Wahrheiten. Und entdeckt auf seiner Reise von Couch zu Couch ein Land, in dem sich hinter einer schroffen Fassade unendliche Herzlichkeit verbirgt. Ein wilder Streifzug durch ein Land, das auf der Suche nach sich selbst ist. »Stephan Orth versteht es hervorragend, Land und Leute für den Leser lebendig werden zu lassen.« Westdeutsche Allgemeine Zeitung Abseits des Mainstreams: ein Journalist mit einem Faible für »Länder mit einem schlechten Ruf« Der Journalist und SPIEGEL-Bestsellerautor Stephan Orth bereist am liebsten Gegenden, in die sich andere Touristen nicht so schnell verlaufen: Länder abseits des Mainstreams oder gefährliche Zonen.. In der gleichen Reihe sind »Couchsurfing in Saudi-Arabien«, »Couchsurfing im Iran« und »Couchsurfing im Iran« erschienen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.malik.de
Mit 59 farbigen Fotos, 39 Schwarz-Weiß-Abbildungen und einer Karte
ISBN 978-3-492-96581-1
März 2017
© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2017
Fotos im Bildteil: Stephan Orth; mit Ausnahme der Fotos mit Copyright Gulliver Theis
Innenteilfotos: Stephan Orth; mit Ausnahme der Fotos von Gulliver Theis im Kapitel Grosny (erstes und drittes Bild), sowie die ersten beiden Bilder im Kapitel Machatschkala.
Karte: Birgit Kohlhaas, kohlhaas-buchgestaltung.de, nach einer Vorlage von Marlise Kunkel
Litho: Lorenz & Zeller, Inning am Ammersee
Covergestaltung: Birgit Kohlhaas, kohlhaasbuchgestaltung.de
Covermotiv: Gulliver Theis
Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
»Überraschend.«
Edward Snowden (auf die Frage, wie er seinen Eindruck von Russland in einem Wort zusammenfassen würde)
ANGEKOMMEN
Hinter der Absperrung geht es 500 Meter in die Tiefe, wir stehen am Rand eines riesigen Kraters. »Willkommen am Arschloch der Welt!«, ruft die Leiterin der Dezernate Kultur und Jugend der Stadtverwaltung. Sie hält ihr Handy hoch, um ein paar Selfies unserer kleinen Gruppe zu knipsen. Lächeln. Klick. Victory-Zeichen. Klick. Arme hochreißen, »Ein bisschen näher zusammen!«. Klick. »Und jetzt alle richtig bescheuert gucken!« Klickklickklick. Wie Teenager am Schloss Neuschwanstein oder am Roten Platz.
Die Luft riecht nach Schwefel und verbranntem Holz, die Abendsonne hängt tief am Himmel und taucht den staubigen Dunst ringsum in rötliches Licht. Sonnenuntergangsromantik auf Apokalyptisch. Am Geländer der Aussichtsplattform hängen Liebesschlösser mit den Namen von Hochzeitspaaren. Julija und Sascha. Schenja und Sweta. Wjatscheslaw und Marija. Der Bund fürs Leben, besiegelt am Eingang zur Hölle, ein Treueschwur an der absurdesten Touristenattraktion des Planeten.
Ich kenne die Menschen nicht, mit denen ich Gruppenfotos mache. Gerade haben sie mich an einem winzigen Flughafen abgeholt, an dem mehr Hubschrauber als Flugzeuge parken und mehr ausrangierte Flugzeuge als solche, die noch starten und landen können.
Sie kamen zu dritt: die Kulturbeauftragte, die Referentin für industrielle Angelegenheiten und der Student. Unterhalten haben wir uns bislang nicht, dafür war die Musik zu laut. Im Lada Priora mit der Heckscheibenaufschrift »Street Hunters« vibrierten die Sitzpolster. Der Fahrstil des Studenten und seine Angewohnheit, bei Tempo 75 beide Hände vom Lenker zu nehmen, um sie im Takt in der Luft herumwirbeln zu lassen, kennzeichneten ihn als jemanden, der schon mit zwanzig nicht mehr viel vom Leben erwartet.
Wo zum Teufel bin ich?
Antwort von Wikipedia: Mirny, Republik Jakutien, Ferner Osten Russlands, 37 188 Einwohner laut Zensus von 2010. Bürgermeister Sergej Alexandrow, Postleitzahlen 678 170 bis 678 175 sowie 678 179.
Antwort von Google Maps: zwischen Tschernyschewskij, Almasny, Tas-Jurjach, Tschamtscha, Lensk, Suntar, Scheja Malykaj, Njurba, Werchnewiljujsk, Nakanno, Oljokminsk und Morkoka. Die Bezeichnung »Nachbarorte« wäre allerdings irreführend, sie befinden sich in einem Radius von 400 Kilometern um Mirny verteilt.
Der Reiseführer antwortet: nichts. Dem »Lonely Planet« ist Mirny ein bisschen zu lonely.
Und meine Antwort? Genau da, wo ich hinwollte. Selfies vor Neuschwanstein kann jeder, zum Taj Mahal muss niemand mehr hinfahren, weil es schon sieben Milliarden Fotos davon gibt. Ich habe genug Schönheit auf Reisen gesehen, um nun bereit für das andere Extrem zu sein. Nicht die Hässlichkeit einer Kakerlake auf dem Küchenboden oder eines kaputten Autoreifens im Straßengraben. Peanuts. Ich meine Anti-Ästhetik von einem Ausmaß, dass einem die Sinne schwinden. Reisen als Horrorfilm oder Thriller, David Fincher statt Rosamunde Pilcher, Hässlichkeit mit Wow-Effekt, Hässlichkeit mit Geschichte. Nur die Normalnull ist langweilig, interessant wird es an den Extrempunkten der Ästhetikskala. Alles eine Frage der Wahrnehmung, nach welchen Kriterien man ein Reiseziel auswählt.
Das »Arschloch der Welt«, so lautet der lokale Spitzname, ist eine Meisterleistung der Ingenieurskunst. Jahrzehntelange Arbeit, ausgefuchste Statik. Die zweitgrößte Anlage ihrer Art, weltweit. Und einen versteckten Schatz gibt es auch. So weit, so Weltkulturerbe-Kandidat. Gleichzeitig ist die offene Mine von Mirny nun wirklich keine Augenweide, allein das Wort »Weide« würde ja implizieren, dass hier irgendetwas wächst. Jahrzehntelang wurden Diamanten ausgebuddelt, ein paar Gramm Edelstein pro Tonne Boden. Glitzernde Reichtümer, verborgen irgendwo im Morast.
Schrägwände aus grauem Erdreich führen nach unten, ein paar rostige Rohre sind noch von den Förderanlagen übrig. Am gegenüberliegenden Kraterrand, 1200 Meter entfernt, wirken die achtstöckigen Wohnblocks von Mirny wie eine Legolandschaft.
Im Jahr 2004 legte Russlands Edelstein-Gigant Alrosa die »Mir«-Mine – der Name bedeutet »Frieden« – aus einem simplen Grund still: weil der Abgrund bald Gebäude der Stadt verschlungen hätte, wenn die Bagger ihn noch weiter ausgebaut hätten. Nun arbeiten die Diamantenschürfer im Untertagebau weiter.
»Kommen viele Touristen her?«, frage ich die Kulturbeauftragte.
»Haha, nein, eigentlich nur die Einwohner«, antwortet sie. »Deshalb haben wir dich zu dritt abgeholt, das ist schon etwas Besonderes.« Aber gerade sei ein Filmemacher aus Italien da, der nächstes Jahr einen Spielfilm drehen will. »Ich gehe morgen zum Casting, kannst ja mitkommen. Aber jetzt machen wir erst mal eine Stadttour!«
In ihren besten Jahren galt »Mir« als die ertragreichste Diamantenmine der Welt. 342,5 Karat wog der größte Diamant, der hier ausgegraben wurde. Er ist zitronengelb, so groß wie eine Cocktailtomate und mehrere Millionen Euro wert. Ein Sensationsfund verdient einen sensationellen Namen, also nannte man ihn »26. Kongress der Kommunistischen Partei der Sowjetunion«. Auch der »60. Jahrestag des Komsomol« (200,7 Karat) wurde hier freigesprengt. Nicht jedoch »70 Jahre Sieg im Großen Patriotischen Krieg« (76,07 Karat), der stammt aus der Jubilejnaja-Mine weiter nördlich.
»Bist du angeschnallt?«, fragt der Student, dann rasen wir in Schlangenlinien über Schotterpisten Richtung Stadt. Vorbei an einem Hügel mit der Aufschrift »Mir 1957 – 2004«, auf dem riesige ausrangierte Bagger stehen. Der Lada hüpft über Schlaglöcher, die Reifen quietschen, und die Arme des Studenten tanzen. Die beiden Damen von der Stadtverwaltung singen lauthals einen Song von Elbrus Dschanmirsojew mit: Ich bin ein brodjaga, ein Landstreicher ohne Geld, und ich heirate trotzdem die schönste Frau. Nach einigen Wochen unterwegs bin ich es gewohnt, herzlich begrüßt zu werden, aber ein solches Empfangskomitee habe ich noch nicht erlebt. Wegen der Musikbegleitung fällt die erste Stadtführung wenig detailliert aus und besteht darin, dass die beiden Frauen von der Rückbank Ortsbezeichnungen nach vorne brüllen. »Hauptstraße, Uliza Lenina! Stadtzentrum! Schule! Bibliothek! Kirche! Feuerwache! Kriegsdenkmal! Stalinbüste!«
Schmucklose Beton-Hochhäuser, viele ziemlich neu, und zweistöckige lang gezogene Holzbauten aus früheren Jahren säumen die Straßen. Kein Eingang ist ebenerdig, denn alle Häuser sind auf Stelzen gebaut, wegen des Permafrostbodens. Ohne diese Podeste würde durch die Heizungswärme im ostsibirischen Winter der Boden schmelzen, die Gebäude würden absinken. »Du solltest im Januar wiederkommen, da wird es minus vierzig, manchmal minus fünfzig Grad!«, ruft die Referentin für industrielle Angelegenheiten.
Bei Stalin steigen wir kurz aus. Der bärtige Diktator aus dunkelgrauem Stein blickt stolz in Richtung Stadtzentrum, er trägt eine oben zugeknöpfte Uniform mit Sowjetstern am Revers. Auf Stalins Befehl wurde in den Fünfzigerjahren in der Republik Jakutien massiv nach Diamanten gesucht, weil Sanktionen des Westens Russland in eine Wirtschaftskrise katapultiert hatten. Nur deshalb entdeckte man hier die Mine, nur deshalb errichtete man eine Stadt.
Laut Sockel wurde die überlebensgroße Büste 2005 aufgestellt, zum sechzigsten Jahrestag des Kriegsendes. Ich bringe meine Überraschung zum Ausdruck, hier ein Denkmal des Schreckensherrschers vorzufinden. »Im ganzen Land gibt es nur zwei oder drei Stalinstatuen, eine andere steht in Murmansk«, sagt die Kulturbeauftragte. Es habe zunächst Proteste gegeben. »Dann wurde abgestimmt, und viele Kriegsveteranen waren dafür. Bei uns geht es noch etwas kommunistischer zu als anderswo. Komm, wir zeigen dir dein Zimmer.«
Kurz darauf biegt der Lada mit Discosound in die Straße »40 Jahre Oktober« ein. Das wäre auch ein schöner Name für einen Diamanten, gemeint ist nicht der Monat, sondern die Revolution. Wir halten vor einem Holzhaus mit blauen Wänden, natürlich auf Stelzen. Die Kulturbeauftragte führt mich in den ersten Stock und schließt die schief in den Angeln hängende Tür mit der Nummer elf auf. »Normalerweise ist das eine Unterkunft für Lehrer, die in Mirny arbeiten«, sagt sie und gibt mir den Schlüssel. Mein Zimmer ist auf mindestens 35 Grad geheizt und enthält eine Schlafcouch, einen Kleiderständer und einen Flachbildfernseher. Hier darf ich kostenlos für die nächsten drei Tage wohnen.
Wahrheit Nummer 18:Ich fühle mich willkommen. Willkommen am Arschloch der Welt.
МОСКВA
MOSKAU
Einwohner: 11,5 MillionenFöderationskreis: Zentralrussland
Bürokratie
Sechs Wochen vorher.
Wer auf Couchsurfing.com das Profil von Genrich aus Moskau aufruft, sollte sich für die folgende Stunde nichts vornehmen. Zumindest, wenn es nach Genrich aus Moskau geht.
Er schreibt: »Wer mich um einen Schlafplatz bittet, bestätigt damit, die Prinzipien des Zusammenlebens, die ich in meinem Profil aufgelistet habe, gelesen und verstanden zu haben, und verspricht, sich an sie zu halten.«
Oben links steht das Schwarz-Weiß-Foto eines Mannes, der auf der polierten Motorhaube eines Geländewagens sitzt. Er hat kaum Haare auf dem Kopf, dafür einen Vollbart, der den späten Dostojewskij neidisch gemacht hätte, und mustert den Betrachter mit ernsten Augen und tiefen Skepsisfalten auf der Stirn. Man könnte sich das Bild gut an der »Mitarbeiter des Monats«-Fotowand eines Inkasso-Unternehmens vorstellen.
Darunter erwarten den Leser 27 Bildschirmseiten mit Text. Ich erfahre, dass Genrich 31 Jahre alt ist und sich für A-capella-Gesang, Linguistik, Kochrezepte, orthodoxen Glauben, Motorräder, Poesie und »Auf-dem-Tisch-Tanzen« interessiert. In der Kategorie »Lieblingsfilme« listet er unter anderem »Easy Rider«, alles von Emir Kusturica und die »Deutsche Wochenschau« auf. Er spricht fließend Englisch, Französisch, Russisch, Deutsch, Polnisch und Ukrainisch und lernt gerade Altgriechisch, Arabisch, Georgisch und Latein.
Herzstück der Profilseite ist ein kompliziertes Regelwerk, wie sich ein Gast zu verhalten hat, verteilt auf mehrere Google-Dokumente mit Titeln wie »WICHTIGE NACHRICHT VON MIR FÜR DICH«, »Früher habe ich viel Zeit verschwendet« und »Wenn ich Gäste habe, lebe ich mit ihnen«. Falls Google-Dokumente an dem Ort, an dem sich der Leser gerade befindet, nicht zugänglich sind, gibt es dasselbe Schriftstück noch einmal über einen Link des russischen Yandex-Servers, verbunden mit dem Hinweis: »Und ja, das ist von Festlandchina aus zugänglich.«
Bei der Lektüre erfahre ich unter anderem:
– dass bei Genrich keine zehn Zwerge hausen, die hinter jedem Besucher herwischen und den Boden staubsaugen,
– dass seine Wohnung kein Backpacker-Hostel ist
– und dass er sich dem Prinzip des »rationalen Egoismus« verbunden fühlt, weshalb er nur Leute einlädt, die er interessant findet.
Eine halbe Din-A4-Seite widmet er einem Satz, den er niemals in einer E-Mail lesen möchte, er lautet: »Ich bin offen, unkompliziert, mag Reisen und freue mich, neue Leute kennenzulernen.« Klingt doch ganz vernünftig? Nicht für Genrich. Eine solche Selbstbeschreibung findet er auf einem Online-Reiseportal trivial und nichtssagend. Und da man diesen Satz vermutlich aus einem anderen Profil kopiert habe, sei das heutzutage doch nur »eine Art zu sagen: ›Ich bin ein fauler Idiot.‹«
Apropos: Ein weiterer Klick führt zur »Checkliste für Couch-Anfragen« für »extrem Vielbeschäftigte und extrem Faule«. Das weckt Hoffnungen, den Bewerbungsprozess beschleunigen zu können. Ist aber eine Falle. Auf dem Bildschirm erscheint ein Formular, in dem neun Häkchen gesetzt werden müssen, die zusammengenommen eine Art Eid ergeben: »Ich werde keine Copy/Paste-Anfrage senden«, »Meine Entscheidung, diese Person zu kontaktieren, hat einen tiefer gehenden Grund, den ich in meiner E-Mail erwähnen werde und von dem ich denke, dass er dem Gastgeber gefallen wird«, »Ich habe den hier verlinkten Artikel zu Prinzipien des Zusammenlebens gelesen, werde mich daran halten und werde im Fall einer Kontaktaufnahme alle Punkte erwähnen, in denen mein Verständnis von Gastfreundlichkeit abweicht«.
Der dazugehörige Link führt – wie gesagt, es ist eine Falle – zu einem 79 Bildschirmseiten umfassenden Dokument auf der Seite WikiHow.com mit Gedanken und Illustrationen zu Themen wie Pünktlichkeit, Körperhygiene, Gastgeschenke, Verweildauer und Klobenutzung.
Klickt man nun, zurück im Ankreuzformular, auf »Kann losgehen!«, ohne alle neun Häkchen gesetzt zu haben, erscheint an jedem fehlenden Feld der Hinweis »Ich würde mit Nachdruck vorschlagen, dass du diesen Punkt nicht überspringst« nebst einem schwarzen Ausrufezeichen in gelbem Kreis. Ein harter Brocken, dieser Genrich. Aber mich reizen harte Brocken, also schreibe ich ihm: »Priwjet, liebes Backpacker-Hostel ›Genrich‹! Ich bin offen, unkompliziert, mag Reisen und freue mich, neue Leute kennenzulernen. Hast du eine Couch für mich?«
Ebenfalls ein harter Brocken: Russland. Im Spätsommer 2016 fühlt sich eine Reise dorthin an wie ein Besuch im Feindesland. Als lebten wir wieder in Zeiten, in denen das Sprichwort kursierte: »Besuche die Sowjetunion, bevor sie dich besucht.« Im Flieger von Hamburg nach Riga lese ich ein paar Artikel, die ich auf dem Handy gespeichert habe.
Es geht um einen möglichen Krieg. Der Ton ist so scharf wie nie seit dem Zerfall der UdSSR vor 25 Jahren. Ob Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Gernot Erler, der Russlandbeauftragte der Bundesregierung, oder Sergej Karaganow, der Ehrenvorsitzende des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, sie alle sprechen in Interviews von einem drohenden Eskalieren der aktuellen Situation bis hin zum militärischen Konflikt. Bei der Zwischenlandung im NATO-Außenposten Lettland gucke ich aus dem Fenster, ob schon die ersten Militärjets in Position gebracht werden, kann aber vorerst Entwarnung geben.
Auf dem Weiterflug nach Moskau sitzt neben mir eine blonde Russin, die ihrer Mutter Handyvideos von einem Spiel der Fußball-Europameisterschaft zeigt. Der Wettbewerb läuft noch. Russland fiel dabei vor allem durch seine Hooligans auf, die sich athletischer und treffsicherer präsentierten als die altersschwachen Sbornaja-Kicker auf dem Rasen, die als Gruppenletzter ausschieden. Offensichtlich war das Team beim staatlichen Dopingprogramm übersehen worden, das ein weiteres Reizthema dieser Tage ist.
Ich überlege, was die letzte erfreuliche Neuigkeit aus Russland war, an die ich mich erinnere. Irgendwie will mir nur eine Aufführung von »Peter und der Wolf« einfallen, die ich als Siebenjähriger besucht habe. Am Schluss stellte sich nämlich heraus, dass die vom bösen Wolf gefressene Ente in seinem Bauch weiterlebt, weil er sie verschluckt hat, ohne zu kauen.
In den deutschen Medien überwiegen kritische Russland-Geschichten, und immer mal wieder wird dabei über das Ziel hinausgeschossen, wie etwa die Kritik des ARD-Programmbeirats an »tendenziösen« Berichten über die Ukrainekrise zeigte. Haben nicht in Wahrheit, wenn man es einmal objektiv betrachtet, die USA in den letzten zwanzig Jahren außenpolitisch mehr Blödsinn angestellt als Russland, vom Irak-Krieg bis Abu Ghuraib? Warum verhängt niemand Sanktionen gegen die USA? Natürlich ist die Frage zynisch, weil man Krisen nicht gegeneinander aufrechnen sollte, aber ganz unberechtigt ist sie nicht.
Wer mal was Positives über das größte Land der Erde erfahren will, kann auf den Propagandadienst »Sputnik« zurückgreifen. Sputnik hieß im Oktober 1957 der erste Satellit, der die Erde umkreiste, ein technologischer Meilenstein, der aller Welt zeigte, wie großartig Russland ist. Heute macht man es sich einfacher und schickt Nachrichten um die Erde, um dasselbe zu erreichen.
Noch wirkungsstärker ist dabei der Fernsehsender »RT«, der früher »Russia Today« hieß, bis man zu dem Schluss kam, ohne expliziten Hinweis auf die Herkunft besser spindoktern zu können. Mit den Claims »Telling the Untold« und »Find out what the mainstream media is keeping silent about« aasen »Sputnik« und »RT« im Zeitalter der »Lügenpresse«-Verdrossenheit unter denjenigen, die das Gefühl haben, auf herkömmlichen Wegen nicht wahrheitsgetreu informiert zu werden. Aus der Sichtweise eines Außerirdischen wäre es wahnsinnig komisch zu beobachten, dass viele Bürger einheimische Medien als deutsche Staatspropaganda beschimpfen, um dann einen Teil ihrer Informationen aus russischer Staatspropaganda zu beziehen (teilweise, ohne es zu ahnen).
ABC
A
ALKOHOL •АЛКОГОЛЬ
Volksdroge Nummer eins und Hauptgrund dafür, dass russische Männer im Schnitt nur 64,7 Jahre alt werden, während Frauen statistisch gesehen fast zwölf Jahre länger leben. In keinem Land der Erde ist der Abstand zwischen den Geschlechtern so groß. Trotzdem bessert sich die Lage, seit landesweit der Verkauf von Alkohol zwischen 23 und acht Uhr verboten wurde. In Nowosibirsk allerdings kamen clevere Unternehmer auf Ideen, das Gesetz zu umgehen: Die einen »vermieten« Hochprozentiges (wer die ungeöffnete Flasche bis zehn Uhr morgens am Folgetag zurückgibt, erhält das gesamte Geld zurück), andere verkaufen spektakulär überteuerte Schlüsselanhänger, zu denen es als Gratisgeschenk eine Flasche Wodka gibt.
Unter deutschen Russlandinteressierten gibt es drei Gruppen. Diejenigen, die nichts mehr glauben, was »Westmedien« schreiben, weil dort sowieso alles schlechtgemacht wird. Diejenigen, die sich auskennen. Und diejenigen, die nicht mehr wissen, was sie zum Thema Russland noch glauben sollen und was nicht. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bilden sie die große Mehrheit.
Über kein Land der Erde ist die Informationslage derzeit verwirrender. Für mich heißt das: Es gibt kein Reiseziel, dessen Besuch gerade jetzt dringlicher erscheint. Zumindest für denjenigen, der das Unterwegssein nicht als Suche nach Spaß, sondern als Suche nach Erkenntnis versteht. Ich weiß, dass es mit der objektiven Wahrheit so eine Sache ist. Wer sich als ihr Hüter und Besitzer ausgibt, ist fast automatisch Populist. Gerade in einem Land, in dem eine Zeitung namens »Prawda«, russisch für »Wahrheit«, jahrzehntelang als Propagandawerkzeug diente. Ich will trotzdem versuchen, wenigstens ein paar Gewissheiten auszumachen unter den 100 000 Informationen, die einem als Wahrheit verkauft werden.
Als Vorbereitung nahm ich einige Stunden Russisch-Unterricht und schrieb etwa fünfzig E-Mails, in denen ich um einen Schlafplatz bat.
Meine zehnwöchige Reise ist ein Experiment mit offenem Ausgang: Ich will zu normalen Menschen, die normale Dinge tun, und mit ihnen den Alltag verbringen – und mich nicht auf Politiker, Aktivisten und Intellektuelle konzentrieren, wie das sonst journalistische Praxis ist.
Jede neue Begegnung soll ein Puzzleteil sein. Ein lückenloses Porträt ohne fehlende Teilchen wird am Ende nicht herauskommen, doch ich hoffe, dass zumindest ein Bild entsteht. Ich werde auch dorthin gehen, wo es wenige andere Touristen hinverschlägt, um die ganze Vielfalt dieses Landes kennenzulernen, von West nach Ost. Ich will wissen, was die jungen Menschen beschäftigt, welche Träume sie haben. Und ich will zum Putin-Versteher werden. Nicht in der gängigen Bedeutung, die mit »Putin-Verehrer« besser beschrieben wäre, sondern als jemand, der das Phänomen Putin und seine Wirkung auf die Menschen versteht. Weil »verstehen« nichts Böses ist.
Die Idee für diese Reise kam mir vormittags am 3. März 2014. Das war der Moment, als Angela Merkels Aussage bekannt wurde, Putin lebe »in einer anderen Welt«. Ich bin schon ein bisschen herumgekommen, aber Ausflüge in fremde Galaxien waren bisher noch nicht dabei. Könnte also interessant werden.
Wie tickt Russland, was wollen die Russen, wo steuert dieses rätselhafte Land hin? Selbst hinfahren war schon immer besser als Nachrichten lesen, ein Dummkopf, der reist, ist besser als ein Weiser, der zu Hause bleibt. Also habe ich meinen Job bei »Spiegel Online« gekündigt und Flugtickets gebucht. Vielleicht finde ich auf meiner Suche nach dem Normalen ja etwas, was anderen auf der Suche nach der Sensation bislang entgangen ist.
KEIN FEIND DES ALKOHOLS
Das mit dem Couchsurfing, das funktioniert so: Auf der gleichnamigen Webseite gibt man nach der Registrierung einen Ort ein, den man bereisen möchte. Dann werden Mitglieder aufgelistet, die dort eine Ecke auf dem Teppich, eine Wohnzimmercouch, eine Luftmatratze oder, wenn man ganz viel Glück hat, ein eigenes Zimmer mit King-Size-Bett, Meerblick und eigenem Strand anbieten (das habe ich in Australien erlebt). In Profilen stellen sich die Gastgeber und Gäste vor. Je sympathischer die Selbstdarstellung im Internet, desto größer die Chance, aufgenommen zu werden. Weiblich zu sein und hübsch soll Gerüchten zufolge auch helfen. Im Unterschied zu Airbnb ist Couchsurfing einerseits kostenlos, andererseits versuchen hier Menschen, sich selbst im besten Licht zu präsentieren und nicht nur ihre Schlafzimmer und Küchen.
Als ich einen Nachmittag lang Onlineprofile aus Moskau studiere (es gibt allein in der russischen Hauptstadt mehr als 100 000 davon), muss ich an die Verkupplungsshow »Herzblatt« denken. Am Schluss war dort immer die Stimme einer Moderatorin namens Susi Müller zu hören, deren einziger Job darin bestand, die Attribute und Antworten der Show-Teilnehmer zusammenzufassen. »Wer soll dein Herzblatt sein?«, gesprochen mit einem Timbre, das derartig wohlklingend war, dass 98 Prozent der männlichen Zuschauer eher die unsichtbare Susi Müller heiß fanden als eine der Kandidatinnen.
Aber ich schweife ab. Was ich sagen wollte: Man könnte auch Couchsurfing-Profile wunderbar auf diese Art zusammenfassen.
Wer soll dein Gastgeber sein?
Ist es Anastasija, 24, die fließend Lingala spricht, in »seltenen Fällen und zu besonderen Ereignissen kein Feind des Alkohols« ist, nicht lange still sitzen kann und trotzdem Yoga mag, in Goa ein paar Mantras lernte und auf einem ihrer Fotos im bodenlangen knallroten Kleid nebst Raubkatze auf dem Beistelltisch posiert?
Oder ist es Nastja, 25, die esoterische Literatur und Cartoons liebt und von sich sagt, sie sei »Liebe. Liebe ist unsere Welt. Die Welt ist Einheit«, und statt eines Fotos von sich selbst einen winzigen Dackel neben einer Teetasse mit Comic-Enten-Motiv zeigt.
Oder Alexander, 27, viele Muskeln, keine Haare, der sich als »Wissenschaftler, Schreiber und Alkoholiker« bezeichnet, auf seinem Foto mit einer Trompete in einer Art Labor posiert und als Interessen »Literatur, Wissenschaft, Alkohol und Sex« angibt?
Oder Olja, 24, die Manowar und Britney Spears mag, für ein Modemagazin arbeitet, eine »sehr niedliche Katze namens Adolf« hat und als gemeinsame Beschäftigung vorschlägt, man könne »Ballett angucken und Wodka trinken«? (Auf einem Foto hat sie eine weiße Gesichtsmaske aufgetragen und deutet mit den Lippen einen Kuss an.)
Oder Wadim, 29, der gerne mit »intelligenten Menschen über Themen aller Art spricht«, sich mit Kampfsport auskennt und Gästen beibringen kann, wie man ein russisches Badehaus besucht? (Das Foto dazu: ein ernster Typ neben einer Alienfigur aus Metallteilen.)
Oder Natalja, 38, die im schwarzen Bikini auf einem Quad sitzt, im Moment nicht arbeitet, lieber Männer als Frauen zu sich einlädt, »fröhlich, aktiv, positiv und abenteuerlustig« ist und gerne Borschtsch kocht?
Oder Alina, 28, die zu Hause »einen kleinen Zoo hat«, bestehend aus Katze, Hund, Ratte, einer australischen Schildkröte und einem Vogel, die sich aber alle gut vertragen, und als Motto angibt: »Mach einfach, bereuen kannst du später.« (Auf einem Foto posiert sie mit zwei Kamelen. Hoffentlich sind die nicht auch noch in der Wohnung.)
Oder ist es Genrich, 31, der sechs Sprachen beherrscht und potenzielle Besucher mit mehr als hundert Seiten Knigge-Informationen schikaniert?
Seine Antwort kommt übrigens exakt drei Minuten, nachdem ich ihn angeschrieben habe: »Du hast einen feinen Humor, so viel kann mit Sicherheit gesagt werden. Ich wäre in der Tat froh und würde mich geehrt fühlen, dir zu den angegebenen Daten eine Unterkunft anzubieten.«
Des Weiteren enthält seine E-Mail zwei Bildschirmseiten mit präzisen Anreiseinformationen, der Bitte um eine genaue Angabe der »ETA« (estimated time of arrival) und insgesamt vierzehn Links, die zu Karten und Metrofahrplänen führen. »Ich beantworte gerne relevante Fragen«, schreibt er außerdem, »falls diese aufkommen, nachdem du alle verfügbaren Quellen überprüft hast.«
Schon kapiert, keine weiteren Fragen.
Wahrheit Nummer 1: Hinter einer schroffen Fassade verbirgt sich manchmal überraschende Freundlichkeit.
Ein paar Tage später lande ich auf dem Flughafen Moskau-Scheremetjewo. Sein Alleinstellungsmerkmal ist ein Blumenautomat mit Sträußen für tausend, 1500 und 2000 Rubel. Je teurer, desto mehr niedliche Plüschmäuse stecken zwischen den Blüten. Die Idee, mit einem solchen Geschenk Genrich freundlich zu stimmen, verwerfe ich schnell. Stattdessen habe ich für ihn und die folgenden Gastgeber ein paar große Packungen Lübecker Marzipan eingepackt.
Nervös warte ich aufs Gepäck, ich will ja die ETA einhalten. Dann nehme ich, wie in der Wegbeschreibung verlangt, den knallroten modernen Flughafenexpress in die Stadt. Ich übe Kyrillisch, indem ich auf dem Weg zum Bahnhof Belorusskaja jedes Hinweisschild lese. Bileti. Kassa. Aeroekspress. Minimarket. Produkti. Avtoservis. Ekspress Servis. Gazprom. Rosneft. Makdonalds. Elektronika. Gastronom. Teatr. Metro.
Die Moskauer U-Bahn erschlägt Besucher entweder mit ihren lebensgefährlichen Schwingtüren am Eingang oder mit der Pracht ihrer Bahnsteige. Stalins Architekten schufen damals Opulenz für alle. Wer zu Hause wie ein Hund lebte, sollte wenigstens auf dem Weg zur Arbeit zweimal täglich durch unterirdische Paläste flanieren. Heute sind sie das meistbesuchte Kommunismus-Museum der Welt mit mehr als sieben Millionen zahlenden Gästen pro Tag.
Belorusskaja ist sehr dekorativ mit Stuckdecken, Kronleuchtern und einer überlebensgroßen Partisanenskulptur. Sakral anmutende Deckengemälde zeigen Frauen bei der Ernte, Männer mit Gewehren und Kinder, die ihre Lehrer mit Blumensträußen beschenken (ohne Stofftiere). Die echten Russen im Waggon dagegen sind zum Großteil in ihre Handys versunken, das freie WLAN funktioniert noch siebzig Meter unter der Erde. Gedämpfte Unterhaltungen, Blicke ins Leere. Erstes Stimmungsbild: Beim Lachyoga bin ich hier nicht gelandet.
Nur drei Stopps sind es mit der grünen Metrolinie zur Haltestelle Sokol, die ähnlich kathedralenhaft wirkt wie Belorusskaja. Zwar mit weniger Bildnissen, dafür mit Marmorwänden und polierten Fußböden aus rotem und grauem Granit. Schon seit einem Jahr stört kein Werbeplakat mehr die architektonischen Schätze der Moskauer Unterwelt. Allerdings nicht aus ästhetischen Gründen, sondern weil es Ärger gab mit der zuständigen Agentur, die es mit den vereinbarten Zahlungen an die Stadt nicht so genau nahm.
Oben an der Straße orientiere ich mich mit einer von Genrichs vierzehn Karten, folge für etwa 300 Meter der Leningrad-Straße und freue mich angesichts des Staus, nicht mit einem Taxi unterwegs zu sein. Unter einem Torbogen biege ich rechts in die Peschanaja-Straße ab, an einem deutschen Restaurant namens Schwarzwald noch einmal nach rechts. Nachdem ich im Innenhof die Bekanntschaft einiger höflicher Jungs mit Fußball gemacht habe, stehe ich vor einer lila Metalltür, die nach Farbe riecht. Klingeln auf Russisch: auf dem Interkom auf »K« wie kwartira drücken, dann die Apartmentnummer eingeben (die Tasten erinnern an Telefonzellen Ende der Achtzigerjahre), auf das Piepssignal warten (der Ton erinnert an Videospiele Ende der Achtzigerjahre), Tür ziehen statt drücken, noch eine zweite Metalltür passieren, geschafft.
Meine Uhr zeigt einen Wert von ETA plus zwei Minuten an, als mich ein ächzender Miniaufzug in den elften Stock bringt. Beim Anhalten federt er massiv nach, als sei er mit dem plötzlichen Stopp nicht einverstanden. Bis zur Diele meines Gastgebers muss ich noch zwei weitere Metalltüren passieren.
»Das ist Moskau. Ein Hochsicherheitstrakt«, sagt Genrich zur Begrüßung. Er trägt ein T-Shirt, auf dem »Ask me, I’m local«steht, eine Halskette mit goldenem Kreuz und eine dieser Brillen, deren Gläser sich bei starkem Licht dunkel verfärben. Sein Bart ist orangefarben, die tapotschki (Hausschlappen), die er mir anbietet, sind es auch. Wir unterhalten uns auf Englisch, für längere Gespräche reichen meine Russischkenntnisse nicht aus.
»Ich bin dein erster Gastgeber? Na dann: Willkommen in Russland!« Er dirigiert mich durch einen Flur, der fast zu eng ist für mich und meinen Reiserucksack, und bietet mir einen Holzstuhl in der Küche an. »Leider bin ich furchtbar untypisch für dieses Land. Ich trinke keinen Alkohol, habe kein Bärenfleisch im Eisfach und auch keine Balalaika im Haus. Das ist so falsch, tut mir leid.« Er holt ein paar Papiertüten mit Gebäck aus dem Schrank und breitet sie auf dem Tisch aus.
Die Wohnung, die er sich mit einer Mitbewohnerin teilt, ist etwa vierzig Quadratmeter groß und ein Paradebeispiel für effiziente Raumnutzung. Einbauschränke an jeder freien Wand, eine Waschmaschine, die unter das Waschbecken im Bad montiert wurde, und eine Couch in Genrichs Zimmer, die sich zum Schlafen ausziehen lässt. Als Gästebett dient eine knarzende blaue Luftmatratze. Wenn ich die auslege, muss mein Rucksack in die Küche, weil sonst kein Platz mehr auf dem Boden ist. Mein Lieblingsort ist der Balkon mit einer tollen Aussicht auf weiße Hochhäuser, ein Gebäude in Stalins Zuckerbäckerstil und die Zwiebeltürme einer orthodoxen Kirche.
»Jetzt zur wichtigsten Frage«, sagt Genrich. Er streicht über das Kreuz an seinem Hals und macht eine bedeutungsschwere Pause.
»Tee oder Kaffee?«
»Kaffee«, sage ich. Die Antwort scheint ihm zu gefallen, denn er schüttelt mir die Hand und sagt in offiziellem Ton: »Willkommen im Klub!«
ABC
B
BLUMEN •ЦВЕТЫ
Läden mit der Aufschrift »Zweti24« sind allgegenwärtig in russischen Städten. Sie bieten rund um die Uhr Blumensträuße an. Um drei Uhr nachts ist es in Sankt Petersburg einfacher, ein paar frische Rosen zu bekommen als einen Schokoriegel oder Zigaretten. Erklärt wird der 24-stündige Bedarf an Geschenkflora häufig damit, dass Männer, die betrunken nach Hause kommen, nur durch einen Strauß auf dem Küchentisch verhindern können, von ihrer Frau abgemurkst zu werden. Am extremsten ist die Nachfrage zum Weltfrauentag am 8. März – dann können Blumenhändler ihre Preise fast beliebig nach oben treiben.
Er geht zu einem seiner bis auf den letzten Millimeter vollgepackten Küchenschränke, in denen jedes Objekt seinen festen Platz zu haben scheint, und holt eine Packung Kaffeebohnen heraus. Die elektrische Mühle macht einen solchen Höllenlärm, dass ich die nächste Frage fast nicht verstehe.
»Stephan, was denkst du über Gewürze?«
»Über was?«
»Ge-wür-ze!«
»Finde ich gut.«
»Magst du es scharf? Ich meine nicht so scharf, dass es dir das Gehirn wegpustet, aber scharf?«
»Ja.«
Er platziert einen mittelöstlich anmutenden Kocher mit langem Henkel auf der Platte.
»Willst du ein paar Gewürze in deinen Kaffee?«
»Welche denn?«
»Kardamom, Pfefferschoten, Muskatnuss und Ingwer. Ich habe diese Mischung erfunden, sie heißt ›Kick am Morgen‹. Wenn du sie probiert hast, wirst du verstehen, warum.«
»Da kann ich nicht Nein sagen.«
»Doch. Du kannst immer Nein sagen, das ist meine Philosophie.«
»Meine Philosophie ist, auf Reisen möglichst oft Ja zu sagen.«
Er gießt Kaffee in zwei graue Becher von Ikea.
»Sei damit bloß vorsichtig in Russland. Das kann dich hier leicht zu weit führen.«
Zum Beweis pustet mir der erste Schluck »Kick am Morgen« das Gehirn weg. Genrich dagegen scheint gegen Pfefferschärfe immun zu sein, er trinkt in Windeseile aus. Dann zieht er sich eine Stoffjacke über. »Ich muss jetzt los, ein wichtiger Termin.« Er drückt mir einen Zweitschlüssel für die Wohnung in die Hand. »Fühl dich wie zu Hause!«, dann fällt die Tür scheppernd zu, und ich bin allein.
ZUHÖREN
Als ich meine Zunge wieder spüren kann und sich mein Puls wieder im zweistelligen Bereich befindet, verlasse ich die Wohnung und fahre in die Stadt. Sightseeing. Moskau ist die größte Baustelle Europas, an vielen Ecken entstehen gerade neue Parks, eine Menge Rubel fließen in ein Nobel-Hochhausviertel namens »Moscow City«. Gebaut werden außerdem Fußgängerzonen und Bürgersteige, was bislang mancherorts vernachlässigt wurde, weil Moskauer nicht als große Spaziergänger bekannt sind. (Was natürlich ein Huhn-Ei-Problem ist: Vielleicht sind Moskauer nicht als große Spaziergänger bekannt, weil es an attraktiven Wegen fehlt?) Der »grüne Sommer« wurde ausgerufen, grün sind auch die Plastikplanen, mit denen die Stadtverschönerungs-Baustellen abgesperrt wurden, und davon gibt es viele.
Ich fahre mit der Metro bis Kropotkinskaja, dann gehe ich ein Stück zu Fuß über die Insel Baltschug zum Südufer der Moskwa. »I follow the Moskva, down to Gorky Park, listening to the wind of change«, vor beinahe exakt 25 Jahren veröffentlichten die Scorpions ihre erfolgreichste Single. Mit change meinten sie einen Gesinnungswandel, ein Ende der Konflikte, ein Zusammenwachsen von Russland und »dem Westen«. 25 Jahre sind eine lange Zeit, die Träume von damals scheinen heute weit weg zu sein. Ich mache ein Experiment: Was hört man heute, wenn man an der Moskwa entlangläuft in Richtung Park?
Zunächst einmal: Verkehrslärm, Verkehrsrauschen, immer wieder Hupen.
Die ungeölten Ketten eines Rennrades; an der sauber betonierten Uferpromenade verläuft ein Radweg.
Das Geklacker von High Heels, dann das Schlurfen von Männer-Halbschuhen und das regelmäßige Gummisohlenpochen von Joggern.
Teenagergelächter.
Windrauschen, natürlich, viele Bäume säumen die Promenade.
Den laufenden Motor eines stehenden Taxis, der Fahrer ist nicht zu sehen.
Wasserkaskaden unter dem fast hundert Meter hohen Denkmal für Zar Peter den Großen, einem düsteren Koloss aus den Neunzigerjahren, in denen einiges schiefging in Russland. Zu sehen ist ein Schiff mit riesigem Mast und einer überdimensionalen Herrscherfigur darauf, die eine Schriftrolle in der Hand hält.
Das mehr als fünfzehn Millionen US-Dollar teure Kunstwerk aus Bronze und rostfreiem Stahl hat die zweifelhafte Ehre, immer wieder in Listen der »hässlichsten Denkmäler der Welt« aufgeführt zu werden. Wenn das der arme Peter wüsste, der ein großer Ästhet war und zugleich der europafreundlichste aller Zaren. Laut Umfragen würde die Mehrheit der Moskauer das Bildnis lieber heute als morgen einschmelzen. Oder in den Datscha-Garten von einem der Verantwortlichen verfrachten. Oder nach St. Petersburg verbannen (was jedoch in St. Petersburg auf größte Ablehnung stößt). Die Kaskaden am Fuße des Denkmals sollen andeuten, dass sich das Schiff im Wasser bewegt, was aber kein Mensch kapiert, weil sich der Rumpf viel höher auf einem Podest befindet.
Ich schließe die Augen und lausche weiter. Dem Lärm eines Baggers, dem Knattern des Ausflugsschiffes Moskwa-84, den Stimmen der Passanten. Ein Mädchen stimmt den Refrain des Titanic-Songs »My heart will go on« an, als wünschte sie Peters Bronzekahn den Untergang, ihre Freundin lacht. Von oben auf der Krimbrücke tönen Polizeisirenen, darunter kratzt der Besen eines Straßenfegers über den Asphalt.
Ein paar Meter weiter fiept die Lüftungsanlage vor dem Gebäude der Parkdirektion wie ein kaputter Haartrockner. In ihrem Inneren hat man viel zu tun zurzeit, denn ein Großteil des Gorki-Parks ist eingezäunt, wegen Renovierungsarbeiten. Quietschende Bagger verteilen Sand für ein Beach-Volleyball-Feld, zwei Rasenmäher jaulen am Golizynskij-Teich. Ein paar Beete weiter rupfen Männer mit Harken und Rechen große Grünzeugbüschel aus dem Boden, um Platz für neue Pflanzen zu schaffen. Ein Arbeiter zieht ein Holzstöckchen an einem Metallgeländer entlang, an jeder Stange entsteht ein anderer Ton.
Spatzen zwitschern, Tauben gurren, Hunde bellen und Kinder schluchzen. Doch es gibt auch Musik. Niederländische House-Beats tönen aus dem »Café Pelman«, amerikanischer Saxofonjazz aus der »Tschajnaja Wysota« und britischer Pop von Noel Gallagher aus dem Kopfhörer eines Passanten, der eine Jutetasche mit der Aufschrift »Open to the future« trägt. Wahnsinn, welche Vielfalt an Eindrücken man erhält, wenn man einfach mal nur zuhört. Doch es sind zu viele verschiedene Töne am Ufer der Moskwa, um heraushören zu können, welcher Wind des Wandels hier gerade weht.
»Haben Sie gut geschlafen?«, fragt Genrich am nächsten Morgen in perfektem Deutsch. In einem Topf köchelt Haferbrei, mit der Fingerfertigkeit eines Profikochs häckselt Genrich Bananen in exakt gleich breite Scheiben.
»Sie können mich duzen, mein Herr«, sage ich.
»Nein, ich mag es lieber, so höflich zu reden. Stimmt es, dass in Deutschland alle nackt baden?«
»Stimmt es, dass in Russland alle Wodka zum Frühstück trinken?«, frage ich zurück.
Genrich schaltet nun wieder auf Englisch um, er wird ernst. »Laut Statistik trinken die Russen jedes Jahr weniger. Speziell Wodka. Vor zwanzig Jahren war der Alkoholkonsum wirklich ein Problem. Aber es wird besser.« Dazu passt seine eigene Geschichte. »Ich habe früher gerne getrunken, ich mag den Geruch und den Geschmack. Ich liebe Strohrum, mit achtzig Prozent. Aber mein Körper hat inzwischen etwas gegen Alkohol. Als ich das letzte Mal mit Freunden gezecht habe, ging es mir danach zwei Tage lang schlecht, eine richtige Vergiftung, ich wäre fast gestorben. Seitdem benutze ich Alkohol nur noch zum Kochen.«
Auch sein extremstes Erlebnis aus der Zeit beim Militär – ein Jahr Infanterie, irgendwo im Norden, weit weg von Moskau – hat mit Alkohol zu tun: Während einer Silvesterparty joggte er bei zweistelligen Minusgraden im Pyjama zu einem Geschäft, um fünf Flaschen Wodka als Nachschub zu kaufen. Ein heldenhafter Einsatz, eine Viertelstunde Wegstrecke bei Nacht und Kälte, doch gedankt wurde es ihm nicht: »Am nächsten Tag hieß es nur: ›Scheiße, und dann hat irgendein Idiot noch mehr Wodka angeschleppt.‹«
Auf die Haferbreiportion, Marke »Gerkules« (die Russen haben es nicht so mit dem Buchstaben »h«), türmt Genrich Bananenscheiben, Schaumgebäck, Schokokekse, Schokostreusel, Butter, ein Stück Joghurteis und eine Limette. »Leider habe ich kein Minzblatt, das ist wirklich schade«, entschuldigt er sich, als er das beste Flockenfrühstück der Menschheitsgeschichte serviert.
In den folgenden Tagen erweist sich Genrich als perfekter Gastgeber und geistreicher Gesprächspartner, der die Gabe besitzt, in Sekunden umschalten zu können zwischen trivialen und hochgeistigen Themen. Im einen Moment referiert er über das linguistische Konstrukt der progressiven und regressiven Assimilation des Schwa-Lauts, zwei Minuten später geht es um das musikalische Werk des deutschen Heavy-Metal-Proleten Tom Angelripper. Und zwischendurch kommt immer wieder die eine oder andere Ermahnung oder Belehrung, die an den Ton seines Onlineprofils erinnert: »Sosehr ich es wertschätze, dass du Teller gespült hast, erlaube mir doch den Hinweis, dass sich der korrekte Platz zum Trocknen auf dem Abtropfgestell oberhalb des Waschbeckens befindet und nicht rechts daneben.« Er liebt komplizierte Satzkonstruktionen und altmodische Höflichkeit. Sein geschliffenes Englisch gibt einem manchmal das Gefühl, man habe sich in einen Roman von Charles Dickens verirrt statt in eine Moskauer Zweizimmerwohnung. Warum er alles so kompliziert macht in seinem Profil, sagt er mir schließlich auch noch: Er habe einfach zu viele Anfragen und wolle dafür sorgen, dass ihn nur Leute anschreiben, die Couchsurfing aus den »richtigen« Gründen nutzen und nicht zum Geldsparen.
Alltag ist normalerweise das Gegenteil von Urlaub. Für mich nicht, mein Urlaub findet im Alltag der anderen statt. Ich besuche mit Gastgebern ihre Stammkneipe, gucke mir Fotos ihrer letzten Reise an, erfahre etwas über ihren stressigen Tag im Büro oder die Trennung des besten Freundes. Innerhalb von zwei oder drei Tagen lerne ich ein Stück der Lebensgeschichte eines vorher Fremden kennen.
Und seinen Bücherschrank. Ich bin bekennender Billy-Regal-Voyeur, praktizierender Schrank-Analyst, heimlicher Buchrückenspion. Mir macht es große Freude, Spontan-Psychogramme von Menschen zu erstellen, die nur darauf basieren, welcher Lesestoff in ihrem Wohnzimmer steht. Das ist natürlich empörend unwissenschaftlich. Wer weiß, aus welchem Grund die einzelnen Bücher dort gelandet sind. Doch es macht eben auch fürchterlichen Spaß. Genrich hinterlässt in dieser Hinsicht einen sehr gebildeten Eindruck, bei ihm stapeln sich unter anderem Jane Austen, Dostojewskij, viele Reiseführer und schwere wissenschaftliche Wälzer über Linguistik, Biologie und das alte Griechenland.
Ende der Leseprobe