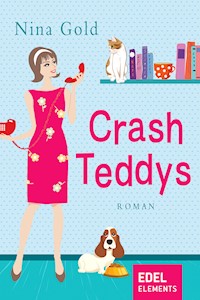
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stellas Leben gleicht dem Schleudergang einer gut funktionierenden Waschmaschine. Rasant stürzt die Dreiundzwanzigjährige von einer Lebensfrage in die nächste: War es richtig, das Studium hinzuschmeißen? Muss sie wirklich jeden Job annehmen, den ihr ihre Mutter vermittelt? Wie tickt wohl ihr Vater, von dem sie nur weiß, dass er in England lebt? Und was ist von einem Mitbewohner zu halten, der sich "Lämmlein" nennt? Mit ihrer verrückten Freundin Shahi macht Stella sich auf den Weg nach England. Und hier wird es erst richtig lustig...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 347
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Nina Gold
Crash Teddys
Roman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 1998 by Nina Gold
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-171-2
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Sitting at the dock of the bay
Im Haus der Ahnungslosen
Early one morning
Barbie goes shopping
Stargazer
Ravin’ the blues
Lets spend the night together
The lady, that raised me
My heart belongs to Da-Da-Daddy
These boots are made for walking
Strangers in the night
Sympathy for the devil
Every step I’ll make, every breath I’ll take, I’ll be watching you
Making me dizzy
Smashing Pumpkins
If you’re looking for trouble, look right in my face
Dead man walking
Crazy for you
Through with love
Killing him softly
Bonnie & Shahi
I didn’t kill the deputy
Stop making sense
Magic Bus
Killing Fields
Sweet dreams are made of this
Reality Bites
Summer was a long one always on the run moving through the moonlit nights resting in the sun you say that you were cheerful like a child in chasing play or a gambler guessing recklessly when someone else will pay.
Robin Laing, The Summer of ‘46 › Walking in time‹, Scottish Songs
Sitting at the dock of the bay
Da sitz ich tatsächlich. Stella Keroviak. Am Dock der San Francisco Bay, am äußersten Ende der Fisherman’s Wharf, direkt am Ozean. War ein ziemlich kurvenreicher Weg bis hierhin. Achterbahn mit dreifachem Looping und Todesspirale oder so ähnlich. Für meine knapp vierundzwanzig Jahre bin ich jedenfalls reichlich rumgekommen im letzten Jahr.
Hinter mir kräuseln sich über Ghiradelli’s Espressoaroma und Krapfenduft in den kalifornischen Himmel. Vor mir kämmt ein kräftiger Wind den tintenblauen Pazifik und setzt Schaumhäubchen darauf. Mir zerzaust er kräftig das Haar. Wie ein Putzmop werde ich bald aussehen, außerdem gibt er meine etwas zu großen Ohren zur Besichtigung frei. Bis vor wenigen Monaten hätte ich dem himmlischen Windkind das nicht gestattet.
Meine Ohren waren immer ein echtes Problem für mich, schon als ich noch gar nicht wußte, was echte Probleme sind. Die kamen erst später und überflügelten meine Ohren um Längen.
Vorbei, vorbei. Jetzt kenne ich ein paar real problems und sehe das Leben endlich so, wie es wirklich ist: als eine prallgefüllte Wundertüte, die nicht immer die gewünschte, aber immerhin Überraschungen für uns bereithält. Und alles für ein paar Mark fuffzig. Mit Geld hat Glück – also wirkliches, handfestes Glück – nämlich nur in bescheidenem Maße zu tun. Schon eher mit dem süßen, trostreichen Puffreis, der die Wundertüte verlockend prall und erstaunlich leicht zugleich macht.
Eine tranfette Möwe sticht herab und zieht provozierende Kreise über einer Kollegin, die auf einem Holzpflock steht und an einem Hering knabbert. Eine Kabbelei ist unausweichlich, ein kleiner Heringskrieg en miniature. Hübsch sowas, ich könnte stundenlang zuschauen.
Ein Fährdampfer stampft an mir vorbei, voll mit vom Wind geblähten Touristen in Nylonblousons und fliehenden Butchcappies, die sie kreischend auf ihre rotgegrillten Köpfe drücken. Schön blöd und träge, wie Touristen nun mal sind, lassen sie sich zu der stillgelegten, von Haien bewachten Knastinsel Alcatraz rüberschippern, die rechts von mir kalkig und kantig aus dem Wasser ragt. Auch so ein teuer bezahltes Vergnügen, auf das ich getrost verzichten kann. Dem Knast bin ich in den letzten Monaten ein paarmal haarscharf entronnen, und meine Phantasie reicht aus, um mir ein Leben hinter Gittern on the rock vorzustellen. Nicht eben lustig. Weshalb ich meine neue Freiheit, vor allem die Freiheit zur Faulheit, um so mehr genieße.
Yeah, I’m sitting on the dock of the bay, watching time slipping away, und dabei bemühe ich mich, meine Erinnerungen auf die Reihe zu kriegen. Erinnerungen, die, sauber zusammengenommen und verknüpft, einen Bilderteppich ergeben, dessen Muster stets von meinem ganz persönlichen Lebensfaden durchschossen ist. Jeder Mensch hat so ein Teppichmuster, und es macht einen höllischen Spaß, dieses Muster zu entwirren, fortzuspinnen oder zu verkomplizieren, statt einfach darüber hinwegzutrampeln, bis man an die Teppichkante stößt und den stolpernden Abgang via heaven’s gate macht. Kapiert, was ich meine? Nein?
Also: Aus lauter Furcht davor, Knoten und Filz im eigenen Lebensfaden zu entdecken, neigen viele Menschen dazu, ihn schönzufärben und zu begradigen. Was notgedrungen zu einer Form von sauberer, eintöniger Langeweile mit LBS-Bausparvertrag und Allianz-Lebensversicherung führt. Langeweile, die die Qualität eines teuren, sandfarbenen Veloursteppichs hat. Nein danke, Leben läuft anders. Leben ist etwas, bei dem man auch mal was riskieren und durch Scheiße stiefeln muß, um es voll und ganz zu spüren. »In der Gefahr wächst das Rettende auch«, um es mit Hölderlin zu sagen. (Lieblingszitat Nummer eins.)
Woher ich das weiß? Genau davon handelt meine Geschichte, von der ich schon mal soviel versprechen kann: Sie ist nicht zur Nachahmung empfohlen. Und sie beginnt am nebligtrüben Niederrhein, genauer gesagt, am äußersten südlichen Ende, knapp vorm Mittelrhein, in Köln, der Stadt mit dem zerklüfteten Dom, den seine Bewohner seit mehr als siebenhundert Jahren einfach nicht fertiggebaut bekommen. Was mir die Kölner ungemein sympathisch macht, denn nichts ist langweiliger als ein vollendetes Bau- oder Kunstwerk. Glaubt mir, davon verstehe ich was, denn bislang habe ich so gut wie nichts von dem vollendet, was ich begonnen habe. Und eben das ist mein ganz entschiedenes, eigenes Talent. Es eröffnet mit jedem Tag neue Möglichkeiten, in einer Welt, von der es heißt, sie stehe kurz vor dem globalen Wirtschaftskollaps, der ökologischen Endzeit oder der finalen Heimsuchung durch Außerirdische. Weshalb sich jetzt, kurz vor der Jahrtausendwende, Sektenmitglieder in Hundertschaften per Zyankali himmeln. Manchmal in blauen Nyltestuniformen und manchmal splitternackt wollen sie einem outerspace alien, der mit universaler Weisheit begabt sein soll, entgegentreten. Frei nach Raumschiff Enterprise flehen sie: »Beam us up, Scotty.« Warum Aliens gerade an derart unterbelichteten Exemplaren der Gattung Mensch ein wissenschaftliches oder gar erlöserisches Interesse haben sollen, ist mir freilich ein Rätsel.
Endzeitvisionen sind also ganz und gar nicht meine Baustelle. Ich lebe lieber unverschämt gern, schnell und vor allem heftig. »Ich will meinen eigenen Unfug« – das wußte schon Hugo Ball (Lieblingszitat Nummer zwei) –, schließlich hat doch wohl jeder Mensch das Recht, sich die Wirklichkeit so zusammenzudichten, wie es ihm paßt. Und das trotz oder gerade wegen: Bürgerkriegen, Hungersnöten, Flutwellen, Dioxin, Atommüll, Klimakatastrophen und Leuten, die so viel Haarspray benutzen, daß sie da oben ihr eigenes Ozonloch haben. Zynisch? Nun ja, ich bin eben ein Kind der Tschernobyl-Ära. Weshalb ich einfach weiß: Die Welt mag so schmutzig sein wie sie will, es gibt keinen Ort im Universum, an dem man einen so guten Cappuccino wie den von Ghiradelli serviert bekommt. Basta!
Und nun endlich zu meiner Geschichte, die, wie gesagt, in Köln beginnt, einen Zwischenstopp in Great Britain macht – »... that lovely stone set in a silver sea ...« (Shakespeare, yeah; Lieblingszitat Nummer drei) – und erst ganz zum Schluß wieder hier an der Fisherman’s Wharf andockt.
Im Haus der Ahnungslosen
In Köln-Mülheim steht ein kleines rotes Ziegelhaus, das sich halb verschämt an andere Ziegelhäuser lehnt, die allesamt rauh verputzt oder verklinkert sind und einen auf arielrein machen. Die Besitzer dieser vollverkleideten Reihenhäuser sind stolz darauf, »dat man da nur mal eben mit ‘em Schlauch drüberspritzen muß«. Nicht so unser Ziegelhaus, das sich stellenweise mit Moos und Schimmel schmückt. Es ist sandig rot und so alt, wie es eben alt ist, also fast achtzig Jahre. Die Stiegen sind steil und knarzig, die Räume verwinkelt, das Dach ein Buckel, auf dem nachts die Katzen patrouillieren und tagsüber Hagelschauer von Tauben niedergehen. Wir lebten dort zu viert, das heißt eigentlich zu fünft, denn ein Toter gehörte auch dazu. Das ist jetzt genau ein Jahr her, scheint mir aber Lichtjahre entfernt.
WG-Mitbewohner Nummer eins: Lämmlein, der viel zu spät, nämlich neun Jahre nach ‘68 geborene Revoluzzer, der am liebsten »alle, die nicht endlich mitziehen bei einer humanen Umgestaltung unserer Gesellschaft, an die Wand stellen würde«. Was er bevorzugt seinem Totenschädel Dignity, Mitbewohner Nummer zwei, erklärte. Der hörte nämlich weise grinsend zu und war sein treuster Begleiter. Lämmlein hatte Dignity während seiner kurzen, aber tiefschwarzen Gruftiephase aus einem Armengrab ohne Namen freigeschaufelt und mit Corega-Tabs von Kalkablagerungen befreit. Er ließ ihn in einem Turnschuhregal leben und kutschierte ihn in seinem hustenden Opel Kadett regelmäßig in der Gegend herum, damit Diggy die allgemeine Lage in Augenschein nehmen konnte.
Lämmlein heißt eigentlich Martin und ist gelernter Chemielaborant ohne Job. Damals schlug er sich als Zigarettenpromoter durch, was uns kartonweise Rauchwaren einbrachte. Ansonsten kiffte er sich gern die Hirse zu und experimentierte mit bedenklichen, selbstgemixten und leider sauguten Drogen. Wir liebten Lämmlein auch deshalb, weil er gern und gut spülte – mit Wurzelbürste und Kraftaufwand, also ganz anders als der übliche Y-Chromosomenträger, der Teller lediglich sanft badet oder sie nur andeutungsweise abstaubt und dafür auch noch kuhäugige Anbetung erwartet. Außerdem sorgte Lämmlein für erstaunlich saubere Toiletten.
Lämmleins flammende Reden gegen die allgemeinen und speziellen Arschlöcher dieser Welt ersetzten uns an so manchem Abend die üblichen schlaffördernden alkoholischen Erfrischungsgetränke. Einmal fiel ich vor lauter Erschöpfung sogar vom Stuhl, während er seine Pläne für vierhundertstöckige Hochhäuser erläuterte, »in denen man die Menschen zusammensperrt, damit sie sich mal wieder umeinander kümmern. Nix da, Eigenheim und Tür zu, die sollen mal wieder was miteinander zu tun kriegen. Arschlöcher ...«
Lämmleins eigentliche Wunde ist allerdings seine Mutter, eine konsequente, man könnte sagen professionelle Alkoholikerin, die sich nicht liebt, ihn nicht liebt und die Welt allgemein zum Kotzen findet. So eine Mutter kann dazu führen, daß jemand die ganze Welt zum Brennen bringen will und gleichzeitig Wert auf den Knick im Sofakissen legt. Typischer Fall von moderner Seelenspaltung, könnte man sagen. Wir Mädels wußten das, nur Martin-Lämmlein reagierte auf die Erwähnung seiner verkorksten Erzeugerin und seiner Macken stets mit frühkindlichstem Trotz, weshalb wir ihn einfach Lämmlein tauften und das Thema schleunigst fallenließen. Therapie für den Hausgebrauch war unsere Sache nicht ... oder, na ja, meine manchmal schon. Leider! Gelegentlich komme ich eben ins Grübeln, von wegen Papa, Mama, Freud und so.
Wie Frauen nun mal sind, ahnten wir natürlich damals schon, daß Lämmlein eines Tages an sich selbst verglühen würde. Vor allem Marusha, Mitbewohnerin Nummer drei. Mit knapp einundzwanzig Jahren meldete sich die Polin ohne exakt nachweisbares Elternhaus auf eine unserer Anzeigen (»Wohngemeinschaft sucht politisch korrekte Genossin – gezeichnet, Lämmlein«) in der Stadtzeitung. Soeben ihrer harten Punk- und Metalphase entwachsen, den Bauchnabel frei und ein grimmiges »Tach« auf den Lippen, erschien sie mit Sack und Pack auf unserer morschen Türschwelle – eine Großstadtindianerin, kampferprobt und zäh. Als Sammlerin für die Aktion Sorgenpunk – »Hasse ma ‘en paar Groschen« – hatte sie sich auf Kölns Straßen durchgeschlagen und den Winter in einem besetzten Haus in der Nähe der Weyerstraße verbracht – eine Punk-WG der härteren Gangart, die sie ohne bleibende Schäden und mit dem festen Vorsatz no more drugs überlebte. Im In-Treff Stadtgarten schmiß sie bald darauf die Frittenbude, indem sie ungeschälte Kartoffelstücke in die Friteuse haute, um sie ein paar vollblöden Szene-Touristen als American potatoe skins auf die Theke zu klatschen. Ihr »Mayo oder Ketchup?« bellte sie so entnervt, daß die Szenetouris ihren Einbruch in die Welt der wahren, stets schlechtgelaunten Szenehelden mit astronomischen Trinkgeldern wiedergutzumachen versuchten. Das führte allerdings dazu, daß Marushas Bauchnabel bald einem Abschlagsieb glich, so durchlöchert war er von Piercingringen, in die sie jede überschüssige Kohle sofort umtauschte.
Marushas weiches, herzförmiges Gesicht steht in merkwürdigem Gegensatz zu ihrem martialischen Outfit, das an archaische Stammesrituale erinnert. Ihrer eisblaugesträhnten, halblangen Haare wegen gleicht sie in meinen Augen »den schmerzensreichen, heilig-nüchternen Märtyrerinnen aus dem kalten Osten«, weshalb ich sie schon bald »Die Madonna aus der Eisdiele« nannte. Es sind diese Widersprüche in ihrem Wesen, die sie so reizvoll machen. Es ist möglich, sie dabei zu überraschen, wie sie einer selbstgezogenen Sonnenblume polnische Schlaflieder vorsingt, so rauh und kehlig, daß es einem das Herz zerreißt.
Und nun zu Shahi, Mitbewohnerin Nummer vier und, meistens jedenfalls, meine allerbeste Freundin. Obwohl, Kumpanin trifft es eher, denn ihr verdanke ich die Verstrickung in diverse, nicht ganz legale Aktivitäten.
Shahi ist eine verwöhnte, in Deutschland geborene Inderin mit klotzreichen Eltern von hohem Nervkaliber. Sie wünschten sich eine höhere Tochter mit Tussitugenden und besten Heiratschancen, durften statt dessen aber ein zickendes Girlie der Extraschärfe ihr eigen nennen, was sie zu gelegentlichen Panikanfällen und Wutausbrüchen veranlaßte, mit denen sie den Anrufbeantworter unserer WG füllten. Und eines kann ich euch sagen: Indische Wutausbrüche haben eine würzigere Klangart als deutsch-bleischwere Kummerergüsse. Hot and spicy. Achtet beim nächsten Besuch in einem indischen Restaurant einfach genau auf die nervenzerfetzend gemütliche Wirkung einer Endloskassette voll Sitargezupfe und Schrammelgesang, und ihr wißt, um welche Tonlage es sich handelt.
Shahi ist die multikultigste Menschenmischung, der ich bis dahin begegnet war. Dank karamelfarbener Haut und Mandelaugen sieht sie beneidenswerterweise aus wie die indische Tempeltänzerin aus einem Hollywoodschinken à la ›Der Tiger von Eschnapur‹. Dazu trägt sie meist einen Modemix aus bauchfreien Designerteilen, Plüschboas und Springerstiefeln, alles im Wert eines deutschen Mittelklassewagens. Als waschechtes Yuppiekind der Achtziger – ach ja, Shahi war die Älteste in unserer WG und der lebende Beweis dafür, daß man mit sechsundzwanzig immer noch ’ne Mattscheibe haben kann – liebt sie dekadente Einkaufsorgien, was sie allerdings nicht davon abhielt, den trashigen Neunzigern zu huldigen, indem sie ihr Zimmer mit den grellbunten Postern einer waschechten indischen Dschungelpartisanin schmückte.
Ganz die Tochter reicher Eltern trödelte Shahi einfach durch den Tag, vernachlässigte ihr Designstudium und lud mich häufig zum Shopping ein. Ab und zu sperrten ihre Eltern ihr allerdings die Plastikknete – aus pädagogischen Gründen, versteht sich –, was bei Shahi regelmäßig einen indisch-deutschen Wutausbruch à la »Scheiße, ich bin voll pleite und weiß nicht, wo ich Kohle für die Miete herkriegen soll« verursachte. »Willkommen im 21. Jahrhundert«, antwortete ich dann, »du bist mit deinen Problemen nicht allein, Prinzessin. Fünf Millionen Arbeitslosen geht es nicht anders. Zeit, das Leben mal ernst zu nehmen.« Doch alles, was ich darauf zu hören bekam, war: »Dito, du Nervtusse.« Und damit hatte sie nicht mal unrecht.
Ich war nämlich chronisch pleite, obwohl ich einen schlechtbezahlten Job nach dem anderen begann. Oder besser gesagt: Ich schmiß einen Job nach dem anderen, denn der richtige war einfach nicht dabei. Immerhin legte – und lege ich auch heute noch – Wert darauf, nicht meiner Mom zur Last zu fallen. Aus reinem Eigennutz übrigens, denn sie ging mir schon so genug auf den Zeiger, von wegen, was ich ihr alles so zu verdanken hätte, seit dem Tag, als ihre Fruchtblase und ich in ihr Leben geplatzt seien. Streiten ist unser Hobby, und im Erzeugen von Schuldgefühlen ist Mom unschlagbar. Ich halte es deshalb gern mit den Spice Girls, ›Get a job, get a life‹, was da heißen soll: Ohne eigene Arbeit und Knete kannst du dir Eigenständigkeit und Sinnsuche in die Haare schmieren, Baby, da wird nichts draus. Nur, wo liegt der Sinn der Arbeit oder besser: Welche Arbeit macht für mich Sinn? In jenem Sommer wußte ich das nicht. Und meine Mitbewohner auch nicht, weshalb wir unser Haus »Das Haus der Ahnungslosen« tauften.
Eine Sache war mir allerdings klar: Ich wollte etwas, das mit Häuserbau oder mit Schauspielerei zu tun hat. Was weiter kein Wunder ist, da ich der Sproß einer Bauunternehmerin und eines britischen Straßenkünstlers (Nachname unbekannt) bin. Letzterer nahm in den swinging seventies insofern am deutschen Straßenverkehr teil, als er mit seiner politisch-grotesken Szenencollage ›Hamlet fucks Hitler‹ durch die Gegend fuhr. Very british und total plemplem. Weshalb er nebenher jobben mußte, was er zeitweise auch auf einer Baustelle tat, wo er dann die Tochter des Bauunternehmers, also Mom, kennenlernte, mit ihr einen Sommer lang das Bett im Kornfeld aufschlug, um dann in das Nichts zu entschwinden, aus dem er gekommen war, und das, bevor meine Mutter ihm mitteilen konnte, daß ich, die Frucht ihrer Flowerpowerphase, in ihrem Bauch zu reifen begann.
Das einzige Lebenszeichen, das Mom danach jemals von ihm erhielt, war eine Postkarte. Fünf Jahre später und ohne Absender. Sie zeigte ein Aquarell eines wunderschönen englischen Herrenhauses aus dem 18. Jahrhundert inmitten einer Hügellandschaft. »Still want a palace, princess? Hope you got it. Robin«, stand da in schwungvoller Schrift.
Mom schenkte sie mir, weil ich die Briefmarke mit der Frau mit Krönchen darauf liebte. Als ich fünfzehn war und, wie sie meinte, reif genug, um zu verstehen, was für ein unverbesserlicher Spinner mein Vater gewesen sei, verriet sie mir, daß Robin mein Vater, der Straßenkünstler, ist. Von diesem Zeitpunkt an verehrte ich die Postkarte wie ein Heiligenbildchen und stellte mir vor, daß mein mysteriöser Dad der Besitzer des abgebildeten Kastens sein müsse, nicht weil ich scharf auf Geld war, sondern fest davon überzeugt, daß ich etwas Besonderes und völlig anders als Mom sei.
Geboren im Zeichen der Fische und aszendiert vom Zeichen der Löwin bin ich ein – mindestens – zweiseeliges Geschöpf, hin und her gerissen zwischen meiner gründelnden Wassernatur, sensibel und dem Künstlerischen zugeneigt, und meiner energiegeladenen, klauenbewehrten Sonnenseite, die, typisch löwisch, der Nachwelt gern etwas Palastartiges hinterlassen würde. »Seht her, das habe ich geschaffen.« Meine Mutter, Bauunternehmerin seit dem frühen Tod ihres Vaters, hatte nach eigenen Angaben stets beide Hände – »und das sind zu wenige« – voll zu tun, mich mit den Füßen auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Sanft ging sie dabei nicht gerade vor.
Auch während des vergangenen Sommers hörte sie nicht auf, immer wieder meinen »Rücksturz zur Erde« in Angriff zu nehmen: Ich hatte nach einem Studium der Philosophie ein weiteres der englischen Literatur geschmissen. Sie vermittelte mir Jobs, die so gar nicht mein Film waren. Wie etwa der Schnarchposten bei einer Bauzulieferungsfirma, der mich dazu verpflichtete, Wärmedämmplatten, Bettungsmodule oder Hydraulikbeton-Vibratoren in hoher, aber angemessener Stückzahl zu bestellen, zu listen und an Baustellen weiterzuexpedieren. Und bei allem Spaß muß man sich doch ehrlich fragen: Wie lange kann sich ein Mensch mit Türfuttern, Muffen oder Doppelnippeln beschäftigen, ohne dabei einen Dachschaden zu kriegen?
Womit ich nun endlich an einem ganz normalen Frühlingsmorgen angelangt bin, der typisch für meine damalige Seelenlage war.
Early one morning
Metall gegen Metall. Mit einem harten Schrappen entsichere ich die Kalaschnikow. Dann stürme ich los über den fleckigen Filzbelag. Vor der Teeküche mache ich kurz halt, grüße wie jeden Morgen freundlich Frau Finkenbügel, die den Kaffee aufgießt. Sie merkt nichts. Zwei Türen weiter, der Konferenzraum. Ich trete ein und lege an, mein Werkzeug zielsicher auf die Chefseite des Tisches gerichtet. Ohne mit der Wimper zu zucken eröffne ich das Sperrfeuer. Die Patronen peitschen schnurgerade durch die Luft, Leiber werden zerfetzt, Blutfontänen spritzen hoch, wobei ich sorgfältig darauf achte, daß meine Kollegen keinen Tropfen abbekommen. Nach einer Minute herrscht Totenstille. Auf der Angestelltenseite des Tisches beginnt einer mit zaghaftem Klatschen, Beifall brandet auf, der schließlich in tosenden Applaus übergeht. Ich verbeuge mich bescheiden. Im Hintergrund ist ein schrilles Klingeln zu hören.
Scheißwecker. Aus der Traum. Langsam, ganz langsam wurde mir klar, was das zu bedeuten hatte: aufstehen und wie jeden Morgen ins Büro dieser Baustoffirma, von der ich mir noch nicht mal den Namen merken konnte. Auch nach vier Wochen nicht. Keine Chance. Frau Finkenbügel war sicher schon dabei, den ersten Kaffee aufzugießen.
Mißmutig tappte ich ins Badezimmer und griff zur Zahnbürste. Mein Mund schmeckte nach Kneipe, die Zahnreihen nach Theke, an der sich noch einige verzweifelte Tequila-Typen rumdrückten. Ich putzte sie energisch zur Seite, verwirbelte sie mit mächtigem Gurgeln und spie sie in den Strudel, der im Abfluß kreiselte. Dabei hing ich noch eine Weile meinem Halbschlaftraum mit dem Maschinengewehr nach und versuchte, ihn in einen Tagtraum zu verwandeln.
Das mit der Kalaschnikow im Büro war natürlich vollständiger Unsinn. Man würde mich auf der Stelle verhaften. Applaus hin, Applaus her, das war der spontane Massenmord an ein paar Schlammaalen nicht wert. Ich betrachte die Zahnpastaspritzer auf dem Badezimmerspiegel. Verfügte Lämmlein vielleicht über ein nicht nachweisbares Gift, das ich den Chefs – lauter abnormale Lümmel mit Kasernenhofstimme – in ihre Kaffeebecher praktizieren könnte? Aber wie? Vielleicht direkt ins Kaffeepulver? Die Vorstandsriege wurde immerhin aus einer Extradose bedient. Premium-qualität.
Nein, nein, erklärte ich meinem entnervten Spiegelbild, auf diese Weise könnte der Tod einen Unbeteiligten treffen, einen Besucher oder eine diebische Sekretärin etwa. Und was Morde angeht, da habe ich eine strenge Moral. Unverdientermaßen soll selbst in meiner Phantasie niemand zu Tode kommen. Zur Strafe für die dumme Idee ließ ich das kalte Wasser lange laufen und spritzte es mir erst ins Gesicht, als es beträchtliche Minusgrade hatte.
Und dann war ich endlich klar, die Killerträume verflogen. Aus dem Spiegel musterte mich eine bemerkenswert hellwache, blonde junge Frau mit grünspanfarbenen Augen. Dynamisch, frisch, aber unverkennbar auf Krawall gebürstet. Ärgerlich zupfte ich mir ein paar widerspenstige Locken über die freiliegenden, ärgerlich erröteten Ohren.
Kein Zweifel, der Tag war da. Wieder einmal. Heute würde ich den Kollegen Chefs aber mal gehörig die Schuhe aufblasen. Ich hatte ihre herablassende Art, mit der sie Sekretärinnen und junge Praktikantinnen wie mich durch willkürliches Heranschleichen und müßige Kontrollfragen zu erschrecken versuchten, gründlich satt. »Frau Keroviak«, gellte es von fern in meinen Ohren, »was macht der Bogler-Auftrag?« Der Bogler-Auftrag lag selbstverständlich längst im Postausgang oder verschimmelte auf dem Schreibtisch einer langjährigen männlichen Fachkraft. Aber es war meine Rolle als weibliche Praktikantin, die willkürlichen Befehlslaunen meiner Chefs abzufangen, und zwar ohne sie zu retournieren.
Diese planvolle Entmündigung ging mir entschieden auf den Zeiger. Die Chefs verstanden das natürlich als notwendigen Schliff von Nachwuchskräften, als den Tritt ins Erwachsenenleben schlechthin sozusagen. Und Erwachsensein bedeutete für sie Frust und noch mal Frust, und daß ich so gar nichts Frustriertes an mir hatte, frustrierte sie doppelt.
Nicht, daß ich etwas dagegen hätte, erwachsen zu werden, nur scheint es mir in Zeiten wie diesen reichlich nutzlos. Wenn erwachsen sein frustriert sein bedeutet, dann muß ich doch feststellen, daß schon genug Frustrierte auf allen möglichen Jobsesseln der BRD pattexfest kleben, bei jeder Tarifrunde nach noch mehr Lohn für noch weniger Arbeit jaulen und dabei meine Zukunft als ihre Rentenbeschafferin rabenschwarz ausmalen. Würg. Halt, ich werde hier politisch, und Politik geht der Jugend ja heute angeblich am Arsch vorbei. Aber egal, das ist ein anderes Thema.
»JERONIMO«, rief ich nach Art eines Kamikazefliegers meinem Spiegelbild zu und stapfte entschlossen die knarzenden Stiegen herab, wobei sich mein Fuß in der Telefonschnur verfing, und ich nur um Haaresbreite einem völligen Absturz entging.
In der Küche verbrannte Lämmlein in einer Teflonpfanne ein paar äußerst appetitliche Karzinogene: Schinkenspeck mit Spiegelei. Auf der Geschirrablage qualmte sein üblicher Morgen-Joint, der mich auf der Stelle benebelte.
»Morgen, Stella. Siehst aus wie Bonnie von Clyde. Geladen.«
»Mmpf«, stieß ich hervor und betrachtete ihn mit dem seichten, leicht schiefen Blick einer unfreiwillig Wachen.
»Gibt’s ’n?« fragte Lämmlein.
»Muß meinen Job loswerden.«
Mit diesem Satz entflammte ich unseren WG-Revolutionär. Suchend blickte er sich in der Küche um. So als fehle ihm ein kleines Holzpodest, auf dem er in angemessener Form Stellung beziehen konnte. In Ermangelung eines solchen Gegenstandes räusperte er sich, warf sich in Lenin-Positur, geballte Faust voran, und weckte mich mit einem Vortrag über den »globalen Schweinekapitalismus« und die »Ausbeutung der ahnungslosen Massen« auf. Ich ließ ihn gewähren, da er zwischendurch Zeit fand, mir den Teller mit brutzelnden Schweinereien zu füllen. Wahrscheinlich um die werktätige Bevölkerung bei Kräften zu halten. Am Ende meines zweiten Spiegeleis angelangt, unterbrach ich ihn.
»Voll klar, Lämmlein, aber wie flieg ich elegant raus, ohne meine Mutter zu verärgern? Sie hängt an dem Job. Ich meine, die Firma ist einer ihrer wichtigsten Zulieferer, auch in Sachen Prozenten. Da kann ich nicht einfach die Platte putzen.«
Das war allerdings eine etwas zu gewagte Vorlage. Das Wort Mutter war für Lämmlein eine Art Reizwort.
»Du bist verstrickt in die negative Dialektik der Ausbeuter. Woher denn die Prozente? Überleg mal, wer diese Prozente letztlich erwirtschaftet. Und wem sie zu ...«
»Na, ich nehme doch an, ich erwirtschafte die Prozente«, unterbrach ich ihn. »Mit meiner Arbeitskraft!«
Lämmlein schwang seinen fettspritzenden Küchenfreund mit der Verve eines frühen Boris Becker. »Exakt. Du bist es, der den eigentlichen Mehrwert produziert, weshalb der sozialistische Gedanke der Genossenschaft und des volkseigenen Be... «
»Scheiße, kann man hier keinen Morgen länger als bis neun Uhr schlafen? Die Weltrevolution muß doch nicht von Frühaufstehern gemacht werden. War ’ne Scheißrevolution.« Shahi schlurfte in die Küche und ließ sich mit rebellischer Stirnfalte zwischen den Mandelaugen auf einen orangefarbenen Plastikhocker fallen, den ich aus der Uni-Mensa hatte mitgehen lassen – als Anerkennung für meine langjährigen Studien. Sie war von Kopf bis Fuß in einen maisgelben, goldbestickten Seidensari gewickelt. Spätes 18. Jahrhundert tippte ich, eine erlesene Köstlichkeit jedenfalls. Dazu trug sie neongrüne Sandalen mit einer Plateausohle bis fast unter die Decke.
Lämmlein wirbelte zu ihr herum, ein erbostes Zucken um die Mundwinkel. Shahi gähnte – etwa so gelangweilt wie ein indischer Königstiger in stiller Betrachtung einer Heuschrecke. Und dann schien sich in Lämmlein eine Verwandlung zu vollziehen, die sich in einem seltsamen Schnurren äußerte. Nein, natürlich schnurrte er nicht, aber ich hatte schon oft beobachtet, daß eine kleine Geste des Mißmuts von Seiten Shahis ihn völlig vom neorevolutionären Weg abbringen konnte. Zwischen den beiden herrschte eine seltsame Chemie, die jedoch nie zu einer finalen Reaktion zu führen schien.
»Wülste Speck und ’n Spiegelei?« muffte Lämmlein unsere Prinzessin, wie er sie heimlich nannte, an.
»Bäh. Du weißt doch, daß ich keine toten Tiere esse.« Dabei sah sie aus wie eine beutewitternde Bestie.
»Müsli?«
»Bin ich ein Körnerfresser? Mach mir einfach einen netten, kleinen Pfannkuchen.« Shahi setzte eine geschickte kleine Pause, um dann ihrerseits ein zärtliches »Ich liebe deine Pfannkuchen« zu schnurren. Das saß. Lämmlein vergaß mit einem Schlag die versklavten, werktätigen Massen und stürzte sich in die Arbeit. Dignity, sein Totenschädel, saß auf der Spüle und grinste sich eins.
»Meine Eltern sind von ihrem Besuch in Indien zurück«, seufzte Shahi. »Voll ätzend. Bin ganz Curry.«
»Wieso?« fragte ich, dankbar für die Ablenkung von meiner Rolle als werktätiger Sklave.
»Weil die wieder irgendeine Nichtentochter meiner Schwiegertante kennengelernt haben, die fünf Examen in Tempelbau und Elefantenkunde bestanden und nebenher von ihren Eltern mit einem billiardenschweren indischen Softwareingenieur verkuppelt worden ist. Arrangierte Ehe, voll traditionell. Bin ich froh, daß ich nicht mit war.«
»Logo. Und was ist das Problem?«
»Na, was wohl. Jetzt wollen meine Eltern mich nach dem Vorbild dieser Traditions-Trulla klonen, damit ich in den gleichen Diskettenschacht ihrer Weltordnung passe. Und außerdem hat meine Mutter heute früh schon zum drittenmal angerufen und mit ihrem baldigen Ableben gedroht, falls ich nicht Medizin oder Informatik studiere und einen entsprechenden Schwiegersohn anschleppe. Muß mal wieder meine Ghandi-Phase raushängen lassen, nix essen und große Reden für den Weltfrieden schwingen, damit sie mich für voll hoffnungslos halten und froh sind, daß ich nicht mit ’nem Handtuch um die Hüften durch die Schildergasse tingel.«
Ja, ja, unsere Shahi. Lämmlein schnaubte und servierte Pfannkuchen. Ich nutzte die Unterbrechung und schaute auf die Uhr. Himmel, es war tatsächlich bereits neun Uhr, sogar zehn Minuten nach. Ich würde todsicher zu spät kommen.
Entkräftet sank ich in meinem Stuhl zusammen. Shahi angelte nach der Teekanne und goß sich einen Becher voll. Die Mandelaugen über dem Becherrand und umkräuselt von heißen Teenebeln sah sie aus wie eine Hohepriesterin mit seherischen Gaben.
»Stella, was ist? Im Traum Krokodile geküßt?«
»So ähnlich, ich muß meinen Job loswerden. Mal wieder.«
Shahi grinste hypnotisch wie die Schlange Ka im Dschungelbuch. »Und jetzt brauchst du von der lieben, weisen alten Shahi einen entsprechenden Schlachtplan.«
Lieb? Weise? Alt? Shahi wirkte mit ihren sechsundzwanzig Jahren ungefähr so alt wie Blümchen, so weise wie Bart Simpson und so lieb wie die Brüder von Oasis. Ich rückte ein wenig zur Seite. Shahis Ratschläge waren naturgemäß mit Vorsicht zu genießen. Was sie nicht davon abhielt, sie zu erteilen.
»Mach was falsch. Richtig falsch, grandios falsch. Es muß ein großer, stilvoller Abgang werden. Mit Musik und Leuchtreklame. Verstehst du?« sagte sie genießerisch und nippte am Tee. Lämmlein seufzte und tupfte Dignity etwas Pfannkuchenteig vom Schädel.
»Falsch?« fragte ich nachdenklich. »Nee. Bringt nix. Dummheit ist kein Kündigungsgrund«, zitierte ich meine leidgeprüfte Mutter, die auf diversen Baustellen ein paar Experten beschäftigte, die sich meisterhaft dumm stellen konnten. Was sich dann ungefähr so anhörte:
»Wie, die Tür jehört da nit hin, Chefin?«
»Schauen Sie doch mal in die Bauskizze, verflucht noch mal.« Kopfkratzen beim Türexperten.
»Aber die ist doch jenau da, wo se sein soll, Chefin.« Schwarzer Daumennagel tippt vorwurfsvoll auf die Skizze.
»Aber doch nur, wenn Sie die Skizze falsch herum halten, Sie Riesenhornochse.«
»Falsch ’eröm? Ach! Na, dat muß einem doch jesacht werden, Chefin. Also ährlich. Han ich dat Zeichnen jeliert oder dä Architekt?«
Soviel zum ausgefuchsten Dummstellen. Kölner haben darin ein TÜV-Siegel verdient.
Shahi ließ nicht locker. »Hast schon recht, mit dem Kündigungsgrund, aber das gilt nur für Leute, die jahrelang dabei sind und im Falle einer ungerechtfertigten Kündigung eine gehörige Abfindung kassieren könnten. Du bist bloß eine blöde Praktikantin und das auch erst seit vier Wochen. Mach was falsch, und du bist morgen wieder frei.«
Blöde Praktikantin. Ich krauste die Stirn, um über Dummheiten nachzudenken, was furchtbar schwer ist, wenn man es sich vornimmt. Lämmlein servierte Pfannkuchen, Shahi dankte hoheitsvoll mit knappem Kopfnicken. Dann wandte sie sich mir wieder zu.
»Na komm schon, Stella Segelohr, so schwer kann das doch nicht sein. Schon gar nicht für dich. Denk doch an die Sache mit der Siebdruckerei. Das war voll Brett. Entscheidende Fehler und Unfälle sind doch dein Spezialgebiet.«
Shahi grinste in den Becher, und ich hätte ihr am liebsten eine geknallt. In diesem Punkt und bezüglich meiner Ohren war ich damals ziemlich leicht verwundbar. Und das aus gutem Grund.
Die Sache mit der Siebdruckerei lag nämlich so: Ich hatte einen Auftrag für 10 000 Feuerzeuge voll versiebt, indem ich den hingekrakelten Auftrag und die Skizze für den Werbeaufdruck nicht ganz eindeutig entziffern konnte. Statt 10 000mal »Firma Ose & Brauch – Keramik vom Feinsten« auf die Plastikhüllen zu drucken, schnitt ich eine Schablone mit dem Schriftzug »Famose Bruchkeramik – voll Staub« und verwendete sie großzügig für 100 000 Feuerzeuge.
Zugegeben, mir war die Bedeutung dieses Schriftzugs von Anfang an schleierhaft, aber das ging mir in dieser Druckerei oft so. Oder wissen Sie auf Anhieb, was der Werbespruch »Rute gut – alles gut« uns sagen will? Das kommt dabei raus, wenn der Chef eines Zwei-Mann-Unternehmens die Werbung mal eben selbst in die Hand nimmt. Kennt man schließlich, von so genialen Sprachvergewaltigungen wie: »Wenn’s schmutzig tropft und unfein gluckert, rufen Sie nur Klempner Ruckert – seit 100 Jahren Profi in verstopften Rohren.«
Schwamm drüber. Die 100 000 Bruchfeuerzeuge kosteten mich damals meinen Job. Kleiner Betriebsunfall eben.
Nur, so was kann man sich nicht absichtlich ausdenken. Ich jedenfalls nicht, außer ich stehe unter Drogen, und das sagte ich Shahi ausdrücklich.
Marusha unterbrach unseren morgendlichen Zwist mit mehreren hundert Dezibel und einem Stammestanz in die Küche. Es gehört zu ihren Ritualen, sich morgens wach zu tanzen mit wild zuckendem Bauchnabel, denn was ein echter Beat ist, der schlägt erst mal auf den Magen, durchhackt einen bis in die Fersen und elektrifiziert die Haarspitzen.
»Was is los, Stella?« brüllte sie vorwurfsvoll, so als sei ich die Quelle des Lärms. »Keine Arbeit heute morgen?«
Seltsamerweise war es Marusha, die auf Pünktlichkeit bei der Arbeit am meisten Wert legte, und ein Blick auf die Uhr – 9 Uhr 25 – gab mir den Rest. Shahi killte den Dschungelsound mit einem Schlag auf die Stoptaste des Ghettoblasters, raste zum Telefon und orderte ein Taxi.
»Bist du voll gaga?« brüllte ich. »Das kann ich mir doch nicht leisten.«
»Aber ich«, blaffte sie zurück und nestelte in ihrem goldenen Gucci-Rucksack nach Flocken. Energisch patschte sie mir einen Hunni in die Hand und schob mich, ganz die indische Mutter markierend, vor die Haustür. Mit Nachdruck knallte sie sie zu und rief mir noch durchs Holz hinterher: »Und wehe, du kommst heute abend nach Hause und hast immer noch diesen Scheißjob an der Backe, klar?«
Die Möglichkeit zu einer würdevollen Antwort wurde mir durch Trommelgedröhn abgeschnitten, meine WG feierte eine Frühstückssause, und ich graugesichtiger Wurm hatte die ehrenvolle Aufgabe, erneut meine Karriere in den Sand zu setzen.
Zwei Tage später war ich den Job dann tatsächlich los. Und das, wie ich noch immer meine, ohne mein Zutun. Das heißt, getan hatte ich schon was. Im besten Glauben. Die Firma Selbiger Bau aus Neuwied hatte per Fax bei mir persönlich und ausdrücklich und sofort fünfhundert Partien Kantenbruchschrauben bestellt, was einer Stückzahl von einer Viertelmillion entspricht. Solche Partien machen einem mächtig Arbeit, zumal Firma Selbiger auch noch vermessingte Exemplare haben wollte. Den ganzen Tag hing ich an drei verschiedenen Telefonen, um die Schrauben lockerzumachen. Auf diese Weise erarbeitete ich mir bei sämtlichen nieder- und mittelrheinischen Schraubenlieferanten eine Menge Verehrer und Freunde. Ein Auftrag wie dieser ist nicht von Pappe.
Aber von Blech. Am nächsten Morgen tänzelte ich beschwingt aus dem Aufzug im vierten Stock meiner Firma – jawoll meiner, denn nach so viel erfolgreicher Arbeit fühlte ich deutlich so was wie corporate identity, zu Deutsch: Firmenzugehörigkeit. In der Teeküche begrüßte ich sogar tatsächlich Frau Finkenbügel, nur daß sie, anders als in meinem Traum, keinen Kaffee aufsetzte, sie spülte bereits Tassen.
»Morgen, Frau Keroviak.«
»Einen wunderschönen, exorbitanten Morgen, Frau Finkenbügel.« So viele Vokabeln machten Frau Finkenbügel maulfaul. Ohne Prädikat, persönliches Fürwort und bar aller Höflichkeit bellte sie mir zu: »Krisenkonferenz beim Chef, schon seit zehn Minuten. Jetzt aber dalli.«
Himmel, ich war schon wieder zu spät. Im Stechschritt, wenn auch ohne Kalaschnikow, raste ich auf die Tür vom Cockpit zu. Ich nannte den Konferenzraum so, weil mich der abgerundete, riesige weißeTisch ein wenig an die Brücke von Raumschiff Enterprise erinnerte. Die Chefs thronten in futuristischen, meterhohen Lehnstühlen in einer Ausbuchtung des Kommandotisches, auf der anderen Seite pflegten die Angestellten ohne Rückenlehnen klarzukommen.
»Schön, daß Sie auch schon da sind, Frau Keroviak«, unterbrach sich der Oberindianer Clausen gereizt in seinem Chefvortrag, als ich die Tür aufriß und das Türblatt dummerweise krachend gegen die Wand schlug. Ein Fauxpas, den ich wohl den ganzen Tag werde ausbaden müssen, dachte ich noch, während die Kollegen bereits erleichtert grinsten. Sie wußten, daß ausnahmsweise mal jemand anderes dran war: ich. Ich und eine Viertelmillion unverlangt gelieferter Kantenbruchschrauben im Foyer der Firma Selbiger Miederwaren und Feinstrick AG, Neuwied.
»Was zum Teufel, Frau Keroviak, haben Sie sich dabei gedacht? Sind Sie des Wahnsinns? Wollen Sie uns ruinieren? Ist das Ihre Art von halbdebilem Humor? Und alles nur per Fax und mit voller Rücknahmegarantie unsererseits«, brüllte Clausen mich an. »Sie haben mit niemandem in der Firma überhaupt gesprochen. So einen Fehler traue ich nicht mal einem Orang-Utan zu. So ein Fehler kann einem nicht unterlaufen, es sei denn mit Absicht!« Er brüllte noch weiter: von sofortiger Entlassung, Schadensersatzklagen, Folter, Einzelhaft ...
Während ich mich anschreien ließ, dachte ich nur ein einziges verdammtes Wort: SHAHI! Die dumme, indische Kokosnuß. Völlig klar, das Fax mit dem falschen Firmennamen konnte nur von ihr stammen. Die Idee, auf ein einzelnes Fax hin und ohne persönliche Nachfrage einen Großauftrag generalstabsmäßig durchzuziehen, war jedoch original von mir, weshalb Clausen mit dem Abschlußbrüller »Ihre Papiere können Sie sich beim Pförtner abholen« hundertprozentig recht hatte.
Ich schlich mich, vorbei am Haifischgrinsen von Ex-Kollege Sprockhövel, Ex-Kollegin Harfenschuh und Ex-Kollegin Finkenbügel zur Tür. Ihr Tag war gerettet, denn nun hatten sie acht Stunden – inklusive Mittagspause – damit zu tun, ein nachbereitendes Gespräch in Sachen »diese krummhirnige Keroviak« zu führen. Wenigstens das gab mir während der Rückfahrt mit der Straßenbahn das erhebende Gefühl, etwas Sinnvolles geleistet zu haben. Und um dieses Gefühl der sozialen und gesellschaftlichen Nützlichkeit noch zu steigern, bot ich meinen Sitzplatz eine Haltestelle weiter einer älteren Dame an. Nur, um zu erfahren, daß Dankbarkeit nicht jedermanns Sache ist, schon gar nicht die Sache von Komposties auf Buerlecithintrip.
»Wat soll dat denn?« herrschte sie mich an und warf die blaugefärbte Watte auf ihrem Schädel kess und kriegerisch nach hinten. »Seh isch vielleicht aus wie ein aal Oma?«
Murmelnd schob ich mich an ihr vorbei und sprang durch die aufzischenden Türen auf den Bürgersteig und in die Freiheit: jung, ledig, arbeitslos und auf der Suche nach dem weiteren Sinn meines Lebens. Die Straßenbahn sang über die Schienen und legte sich seufzend in die Kurve.
Barbie goes shopping
»Na, endlich«, empfing mich mit so ungeduldiger Stimme die Schlange Shahi noch vor der Haustür, daß es mir glatt die Sprache verschlug. »Ich dachte schon, der Saftladen würde dich nie mehr rausschmeißen. Von wegen deutsche Präzision und Pünktlichkeit. Komm schon, laß uns was unternehmen, ich langweile mich zu ...«
»Shahi«, schnitt ich ihr Weg und Wort ab und schüttelte ihr armreifenklimperndes Handgelenk aus meiner Ellbogenbeuge. »Dich haben sie als Kind wohl mit Nutella eingecremt. Kannst du mir mal sagen, wie ich das meiner Mutter erklären soll?«
Shahi hakte sich wieder fest, so fest wie eine Zecke. »Brauchst du nicht, hab ich schon gemacht. Mit anderer Leute Eltern komme ich prima zurecht.«
Sie zog mich durch den staubigen Vorgarten, vorbei an Lämmleins efeubewachsener Reifen- und Lenkradinstallation »Death of a car«. Ich zog in die Gegenrichtung, bis wir wankend und schwankend in das Gummikunstwerk fielen. Efeuumrankt und leicht vulkanisiert arbeitete ich mich aus einem Reifen hervor. »Du hast, bitte schön, was gemacht?«
Shahi prustete und pustete eine Haarsträhne zur Seite. »Ich habe deiner Mutter erklärt, daß du dich in einer akuten Nervenkrise befindest.«
»Nervenkrise? Wieso das denn? Ich bin doch völlig ruhig, du blöde indische Giftschlange, du subkontinentale Winseltüte, du ... du ...«
»Da siehst du’s, was ich immer sage, du hast kreative Talente, derart poetische Schimpfwörter, einmalig. Und genau das habe ich deiner Mutter endlich mal beigebogen.«
Ich stemmte meine Ellbogen auf die Reifenwände und richtete mich verblüfft auf. »Was, zum Teufel, hast du?« stammelte ich.
»Na, ich habe ihr expliziert, daß die Künstlerseele in dir den profanen Dingen des Alltags trotzt, daß sie endlich Oberhand gewinnen will über die Banalitäten eines nichtssagenden Jobs, der dich eindeutig unterfordert. Nicht umsonst hat deine Mutter dich Stella getauft. Der Stern. Ein künftiger Stern am Himmel der Künste, der unmöglich zwischen Wärmedämmplatten verglühen sollte.«
Ich ließ mich erschöpft in den Reifen zurücksinken. »Und das meiner Mutter! Schöne Scheiße, wie soll ich das wieder geradebiegen? Das schaff ich im Leben nicht.«
Shahi grinste genüßlich. »Wieso geradebiegen? Deine Mutter ist eine ausnehmend vernünftige, nüchtern kalkulierende Frau, die mir am Ende vollständig beigepflichtet hat.«
»Das denkst du dir aus«, empörte ich mich, bereit, die emotionale Unvernunft meiner Mutter mit Zähnen und Klauen zu verteidigen. Ich war mit einem Ruck auf den Beinen.
»Für so was reicht nicht einmal meine Phantasie«, gab Shahi gelassen zurück und streckte mir ihre Hand entgegen. »Mal im Ernst, Fräulein, deine Mutter war äußerst angenehm überrascht von meinem Einfühlungsvermögen und der Tatsache, daß ich sie im Ingenieurbüro meines Vaters ins Gespräch bringen kann. Betonbaumäßig und so weiter. Was sagst du nun?«
Shahi klopfte Staub und welkes Efeu von ihrem Paul-Smith-Shirt. »Biste baff, was?« fragte sie eindringlich und triumphschwanger.
»Meine Mutter ist so was von korrupt«, stieß ich hervor und schüttelte entrüstet den Kopf. »Ihr einziges Kind für ein paar Eimer Beton zu verraten. Ekelerregend. Typisch.«
»Pragmatisch, würde ich sagen. Die überzähligen Kantenbruchschrauben kann sie übrigens direkt übernehmen. Der Auftrag ist frisch von Vaterns Schreibtisch und war ziemlich dringend, woher sonst sollte ich wissen, daß es so was überhaupt gibt. Kantenbruchschrauben, typisch deutscher Wortelefant. Nix für eine poetische Seele wie dich. Ich hoffe, du hast dafür einen fairen Preis ausgehandelt? Bei so was kennt mein Management leider keinen Spaß. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung über das Geschäftsgebaren südländischer und subkontinentaler Menschen, können Inder äußerst geschäftstüchtig sein. Vor allem meine Mutter.«
Ich hörte nicht mehr hin. Ich konnte nicht mehr hinhören, denn wie es manchmal in existentiellen Krisensituationen so ist, übermannte mich ein monströses Kichern. Das Kichern wich einem Gackern, das Gackern einem Gröhlen, und dann mußte ich so verdammt dringend eine sanitäre Anlage aufsuchen, daß Shahis singendes Gelächter an meinem verschwindenden Rücken einfach abperlte.
»Wohin fahren wir?« fragte ich eine halbe Stunde später, während ich es mir zwischen Marlboro-Stangen und West-Ice-Zigaretten-Kartons auf dem Rücksitz von Lämmleins Kadett bequem machte.
Shahi ruhte entspannt im Fahrersitz, als warte sie auf eine willige Friseurin, die ihr eine Kopfmassage anbieten würde. Zur allgemein nötigen Entspannung hatten wir unsere Lungen mit einer Prise schwarzen Afghans kontaminiert.
»Shoppen, was sonst«, erklärte sie, ohne den Blick vom Seitenfenster wegzulenken, denn links von uns fesselte ein Zoogeschäft ihren Blick. Der Verkehr vor uns schien sie hingegen zu langweilen, was Lämmlein dazu zwang, höllisch konzentriert die Straße zu beobachten und bei gegebenem Anlaß korrigierend ans Lenkrad zu greifen. Er hatte sich spontan gegen eine Promotiontour für seine Lungentorpedos und für eine Begleitung Shahis entschieden, was mich einmal mehr davon überzeugte, daß der Weltrevolution das leibliche Begehren empfindlich im Weg stehen kann. Oder umgekehrt.
»Ich glaube, ich will diesen Leguan«, rief Shahi lässig und stieg voll in die Eisen. Solche Überraschungen waren bei ihr an der Tagesordnung. Mal wollte sie unbedingt das ausgestopfte Huhn eines Geflügelhändlers, mal die Plastikpetersilie einer Metzgereiauslage. Sie liebte es, Dinge nach Hause zu tragen, deren einziger Sinn darin bestand, sie wegzuwerfen und ihre Eltern ärmer zu machen. Konsum ist für Shahi eine Kunstform.
Der Kadett verschluckte sich und kam röchelnd zum Stehen. Mitten auf der Fahrbahn. Shahi öffnete die Fahrertür und huschte zum Zooladen hinüber, während Lämmlein sich fluchend auf den Fahrersitz hievte, das Armaturenbrett seines Kadetts streichelte und betend den Anlasser betätigte. Hinter uns stimmten sich diverse BMWs, Ford Kas und Mazda Cabrios auf ein mehrstimmiges Hupkonzert ein, begleitet von menschlichen Stimmeinlagen, die reichlich fortissimo vorgetragen wurden.
»Ihr Asis, äh.« »Macht voran.« »Wat soll dat dann?« »Hievt eure Schrottschüssel von der Fahrbahn, aber dalli.« Lämmlein gelang es, seinen Kadett in Gang zu bringen und lenkte ihn sanft und Entschuldigungen murmelnd auf die Seite.
»Dieses verfluchte, dekadente, verwöhnte Weibsstück«, fluchte er, als er eine akzeptable Parkposition erreicht hatte. »Leguan! So ein snobistischer Scheiß. Und so was ist angeblich Vegetarierin aus reiner Tierliebe. Daß ich nicht lache.«





























