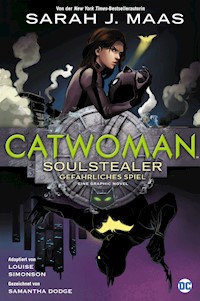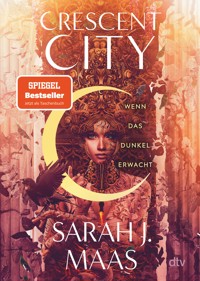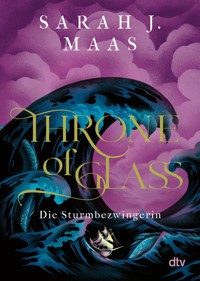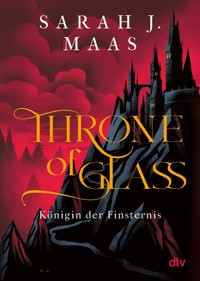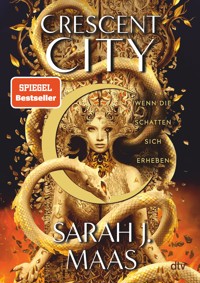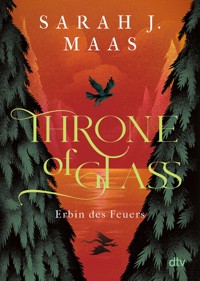17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Crescent City-Reihe
- Sprache: Deutsch
Zurück in Crescent City Liebe, Lügen – und gefährliche Geheimnisse: Nachdem Bryce den Tod ihrer besten Freundin gerächt und Crescent City gerettet hat, schließt sie mit den göttlichen Asteri einen Pakt: Wenn sie und Hunt sich unauffällig verhalten, werden sie für ihre Verbrechen nicht bestraft. Doch mit ihrer neu erwachten Magie zieht Bryce die Aufmerksamkeit der Rebellen auf sich, die sie auf ihre Seite ziehen wollen. Aber Bryce will weder in eine Rebellion verwickelt werden noch den Befehlen der Asteri weiterhin folgen. Gemeinsam mit Hunt schmiedet sie einen eigenen Plan. Der aber ist hochgefährlich … Alle Bücher der ›Crescent City‹-Reihe: Band 1: Wenn das Dunkel erwacht Band 2: Wenn ein Stern erstrahlt Band 3: Wenn die Schatten sich erheben Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar. Kennen Sie bereits die weiteren Serien von Sarah J. Maas bei dtv? »Das Reich der sieben Höfe« »Throne of Glass«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1312
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Liebe, Lügen – und gefährliche Geheimnisse
Nachdem Bryce den Tod ihrer besten Freundin gerächt und Crescent City gerettet hat, schließt sie mit den göttlichen Asteri einen Pakt: Wenn sie und Hunt sich unauffällig verhalten, werden sie für ihre Verbrechen nicht bestraft. Aber als Sterngeborene Fae zieht Bryce die unerwünschte Aufmerksamkeit ihres Vaters auf sich, der sie für seine Ränkespiele missbrauchen will. Und auch die Rebellen, die die Asteri um jeden Preis stürzen wollen, versuchen Bryce für ihre Sache zu gewinnen. Sie behaupten, Danika sei eine von ihnen gewesen! Bryce kann weder schweigen, während Unschuldige unterdrückt werden, noch Danikas Rolle in der Rebellion ignorieren. Trotz aller Warnungen lässt sie sich in die Pläne der Rebellen hineinziehen …
Die spannende Fortsetzung der atmosphärischen Bestsellerreihe
Von Sarah J. Maas sind bei dtv außerdem lieferbar:
Crescent City 1 – Wenn das Dunkel erwacht
Crescent City 3 - Wenn die Schatten sich erheben
Throne of Glass 1 – Die Erwählte
Throne of Glass 2 – Kriegerin im Schatten
Throne of Glass 3 – Erbin des Feuers
Throne of Glass 4 – Königin der Finsternis
Throne of Glass 5 – Die Sturmbezwingerin
Throne of Glass 6 – Der verwundete Krieger
Throne of Glass 7 – Herrscherin über Asche und Zorn
Throne of Glass 8 – Celaenas Geschichte
Das große Throne of Glass-Fanbuch
Das Reich der sieben Höfe 1 – Dornen und Rosen
Das Reich der sieben Höfe 2 – Flammen und Finsternis
Das Reich der sieben Höfe 3 – Sterne und Schwerter
Das Reich der sieben Höfe 4 – Frost und Mondlicht
Das Reich der sieben Höfe 5 – Silbernes Feuer
Das große Reich der sieben Höfe-Fanbuch
Catwoman – Diebin von Gotham City
Sarah J. Maas
Crescent City
Wenn ein Stern erstrahlt
Band 2
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch vonFranca Fritz und Heinrich Koop
Für Robin Rue,
furchtlose Agentin und wahre Freundin
DIE VIER HÄUSER VON MIDGARD
Gemäß Erlass des Reichssenats der Ewigen Stadt
im Jahr 33 W. E.
HAUS DER ERDE UND AHNEN
Gestaltwandler, Menschen, Hexen, herkömmliche Tiere und viele andere, die Cthonas Ruf folgen, sowie einige, die von Luna auserwählt sind
HAUS DES HIMMELS UND ATEMS
Malakhim (Engel), Fae, Elementarwesen, Kobolde[1] und alle, die von Solas gesegnet sind, sowie einige, die von Luna bevorzugt werden
HAUS DER VIELEN WASSER
Flussgeister, Meerwesen, Wasserbestien, Nymphen, Kelpies, Nixen und andere, über die Ogenas wacht
HAUS DER FLAMMEN UND SCHATTEN
Daemonaki, Schnitter, Geisterwesen, Vampire, Draki, Drachen, Totenbeschwörer und viele bösartige und namenlose Wesen, die nicht einmal Urd selbst sehen kann
PROLOG
Sofie hatte jetzt schon zwei Wochen im Todeslager von Kavalla überlebt.
Zwei Wochen, in denen die Wachen – ausnahmslos Schreckenswölfe – sie noch immer nicht aufgespürt hatten. Alles war nach Plan verlaufen. Der Gestank der langen Tage, die sie im Viehwagen eingepfercht gewesen war, hatte den verräterischen Geruch in ihrem Blut überdeckt. Und er hatte sie auch eingehüllt, als die Wölfe sie und die anderen an den Ziegelsteingebäuden des Lagers entlangführten – quer durch diese neue Hölle, die nur ein Vorgeschmack auf die wahren Pläne der Asteri war, falls der Krieg noch lange andauerte.
Nach zwei Wochen hier im Lager war ihr der Gestank so tief in die Poren gedrungen, dass er sogar die feine Nase der Wölfe täuschte. Heute Morgen hatte sie in der Frühstücksschlange nur ein paar Meter von einem Wachmann entfernt gestanden, aber der hatte nicht mal in ihre Richtung geschnuppert.
Ein kleiner Sieg, aber einer, der in diesen Tagen sehr willkommen war.
Die Hälfte der Stützpunkte der Ophion-Rebellen war gefallen. Schon bald würden weitere folgen. Aber für Sofie gab es jetzt nur zwei Orte: das Lager und den Hafen von Servast, ihr Ziel an diesem Abend. Allein – und sogar zu Fuß – hätte sie den Hafen mit Leichtigkeit erreichen können. Einer der wenigen Vorteile, wenn man zwischen der Identität als Mensch und der als Wanin wechseln konnte … und wenn man noch dazu einer der wenigen Menschen war, die den Sprung in die Unsterblichkeit absolviert hatten.
Dieser Sprung machte sie genau genommen zur Wanin, was ihr eine hohe Lebenserwartung und alle anderen Vorteile schenkte, die ihre menschliche Familie nicht hatte und nie haben würde. Hätten ihre Eltern sie nicht dazu ermutigt, hätte auch sie den Sprung wohl nie absolviert. Aber die Selbstheilungskräfte, die man dadurch gewann, verliehen eine zusätzliche Rüstung in einer Welt, die darauf ausgelegt war, ihre Art zu töten. Also hatte sie es getan, heimlich, in einem hochgradig illegalen Sprungzentrum irgendwo in einem Hinterhof, mit einem lüsternen Satyr als Anker und ihrem Erstlicht als Preis für das Ritual. In den darauffolgenden Jahren hatte sie gelernt, ihre Menschlichkeit wie einen Umhang zu tragen, nach außen wie nach innen. Sie mochte alle Merkmale einer Wanin haben, aber sie würde nie eine sein. Nicht in ihrem Herzen, nicht in ihrer Seele.
Aber heute Abend … heute Abend hatte Sofie nichts dagegen, das Monster in ihr ein wenig freizulassen. Ein Vorhaben, das jedoch alles andere als einfach werden würde – dafür sorgte das Dutzend kleiner Gestalten, das hinter ihr am Stacheldrahtzaun im Schlamm hockte.
Fünf Jungen und sechs Mädchen, begleitet von Sofies dreizehn Jahre altem Bruder, der sie bewachte wie ein Hirte seine Herde. Emile hatte sie alle aus ihren Kojen geholt, unterstützt von einem sanften menschlichen Sonnenpriester, der jetzt in einem zehn Meter entfernten Schuppen Wache hielt.
Die Kinder hatten graue Haut und waren abgemagert, ihre Augen zu groß und ohne Hoffnung. Sofie musste ihre Geschichte gar nicht erst hören. Es war vermutlich die gleiche wie ihre eigene: aufständische, menschliche Eltern, die entweder geschnappt oder verraten worden waren. Bei ihr war Letzteres der Fall.
Nur reines Glück hatte Sofie vor den Klauen der Schreckenswölfe bewahrt – bis jetzt zumindest. Damals, vor drei Jahren, hatte sie bis spätabends mit Freunden in der Universitätsbibliothek gelernt. Als sie gegen Mitternacht nach Hause kam und die eingeschlagenen Fenster, die zersplitterte Tür und die Sprühfarbe an der Wand ihres einfachen Vorstadthauses sah – REBELLENSCHWEINE –, war sie sofort losgerannt. Sie konnte Urd nur dafür danken, dass der Schreckenswolf, der an der Eingangstür postiert gewesen war, sie nicht bemerkt hatte.
Später hatte sie herausgefunden, dass ihre Eltern tot waren. Von der Hindin oder ihren Verhörspezialisten zu Tode gefoltert. Sofie hatte Monate gebraucht, um sich in den Reihen der Ophion-Rebellen hochzuarbeiten und an den Bericht zu gelangen. Darin hatte auch gestanden, dass man ihre Großeltern nach Erreichen des Bracchus-Lagers im Norden mit anderen Älteren zusammengetrieben, sie erschossen und ihre Leichen anschließend in ein Massengrab geworfen hatte.
Und ihr Bruder … Sofie hatte bis vor Kurzem nichts über Emile in Erfahrung bringen können. Jahrelang hatte sie mit den Ophion-Rebellen zusammengearbeitet, um irgendetwas über ihn und ihre Familie herauszufinden. Sie wollte lieber nicht darüber nachdenken, was sie im Gegenzug dafür getan hatte. All die Leute, die sie ausspioniert und getötet hatte, um an die geheimen Informationen zu kommen, die die Widerstandsbewegung benötigte. Diese Dinge lasteten wie ein bleierner Mantel auf ihrer Seele.
Irgendwann hatte sie dann offenbar genug für Ophion getan, denn ihr wurde mitgeteilt, dass Emile allen Widrigkeiten zum Trotz noch lebte und in dieses Lager hier gebracht worden war. Endlich wusste sie, wo er sich befand. Die Führungsgruppe der Widerstandsbewegung hatte sie allerdings erst noch davon überzeugen müssen, sie hier einzuschleusen – ein weiteres Hindernis, das sie überwunden hatte.
Was ohne Pippas Unterstützung vermutlich nicht gelungen wäre. Die Führungsgruppe hörte auf Pippa, ihre treue und eifrige Soldatin und Anführerin der Eliteeinheit Lightfall. Vor allem jetzt, da die Reihen der Ophion-Rebellen so stark dezimiert worden waren. Die mehr oder weniger menschliche Sofie dagegen … Sie wusste, dass sie ein Aktivposten für Ophion war, man ihr aber wegen des Wanenbluts in ihren Adern nie ganz vertrauen würde. Also war sie gelegentlich auf Pippa angewiesen. Genau wie Pippa bei ihren Lightfall-Missionen auf Sofies Kräfte angewiesen war.
Pippas Hilfe hatte nichts mit Freundschaft zu tun. Sofie war sich ziemlich sicher, dass im Netzwerk der Ophion-Rebellen Freundschaften nicht existierten. Aber Pippa war eine Opportunistin – und sie wusste, was sie gewinnen würde, wenn diese Operation reibungslos verlief. Welche Türen sich in der Führungsebene für sie öffnen würden, wenn Sofie erfolgreich war.
Eine Woche nach Absegnung ihres Plans – über drei Jahre nach der Verschleppung ihrer Familie – hatte Sofie das Todeslager von Kavalla betreten.
Eine knappe Meile entfernt hatte sie gewartet, bis eine der Schreckenswolf-Patrouillen vorbeimarschierte, und war ihnen dann vor die Füße gestolpert. Die Wölfe hatten die gefälschten Rebellen-Dokumente in ihrem Mantel natürlich sofort gefunden. Aber sie hatten keine Ahnung, dass Sofie in ihrem Kopf auch Informationen bei sich trug, die durchaus der letzte Mosaikstein in diesem Krieg gegen die Asteri sein konnten.
Der Schlag, der ihn beenden konnte.
Ophion hatte zu spät herausgefunden, dass Sofie vor Betreten des Lagers endlich die Mission erfüllen konnte, auf die sie jahrelang hingearbeitet hatte. Bevor sie der Patrouille absichtlich über den Weg lief, hatte sie Pippa und Ophion wissen lassen, dass sie im Besitz der gewünschten Informationen war. Jetzt würden sie ihr Versprechen, Emile und sie aus dem Lager herauszuholen, nicht zurücknehmen. Auch wenn Sofie wusste, dass man ihr anschließend die Hölle heißmachen würde, weil sie die Informationen heimlich beschafft hatte und sie jetzt als Rückversicherung nutzte.
Aber darüber würde sie sich später Sorgen machen.
Die Patrouille hatte sie zwei Tage lang verhört und dann zu den anderen in den Viehwagen geworfen, fest davon überzeugt, dass sie bloß ein dummes Menschenmädchen war und die Dokumente von einem Liebhaber stammten, der sie nur benutzt hatte.
Sofie hätte nie gedacht, dass sich ihr Nebenfach Theater einmal als nützlich erweisen würde. Dass sie hören würde, wie ihr Lieblingsprofessor ihre Darbietung kritisierte, während ihr jemand die Fingernägel ausriss. Dass sie ein Geständnis mit all der Ernsthaftigkeit vortäuschen würde, die sie einst auf der Bühne bewiesen hatte.
Sie fragte sich, ob die Rebellenführer wussten, dass sie diese schauspielerischen Fähigkeiten auch bei ihnen angewandt hatte.
Aber auch das kümmerte sie nicht, zumindest nicht im Moment. Denn heute Abend ging es nur um den verzweifelten Plan, der jetzt in die Tat umgesetzt werden sollte. Wenn man sie nicht verraten oder die Führung nicht die Wahrheit herausgefunden hatte, dann wartete zwanzig Meilen entfernt ein Boot, das sie aus Pangera herausbringen würde. Sie blickte auf die Kinder um sich herum und betete, das Boot möge mehr Personen Platz bieten als den drei Passagieren, die sie angekündigt hatte.
Die ersten anderthalb Wochen in Kavalla hatte sie versucht, ihren Bruder zu finden – oder wenigstens einen Hinweis darauf, wo in dem ausgedehnten Lager er untergebracht war. Und dann, vor ein paar Tagen, hatte sie ihn endlich in der Essensschlange entdeckt. Rasch hatte sie so getan, als wäre sie gestolpert, um ihren Schock, ihre Freude und ihren Schmerz zu verbergen.
Er war groß geworden. So groß wie ihr Vater. Schlaksig und mager und weit entfernt von dem gesunden Dreizehnjährigen, der er hätte sein sollen. Aber sein Gesicht … es war das Gesicht, mit dem sie aufgewachsen war. Und es zeigte die ersten Anzeichen von Männlichkeit.
Am Abend hatte sie die Gelegenheit genutzt und sich in seine Koje geschlichen. Und trotz der drei Jahre und der zahlreichen Entbehrungen, die sie erduldet hatten, hatte auch er sie sofort erkannt. Sofie hätte ihn augenblicklich weggezaubert, hätte er sie nicht angefleht, die anderen mitzunehmen.
Jetzt hockten zwölf Kinder hinter ihr.
Schon bald würde Alarm geschlagen werden. Sie hatte gelernt, dass es hier verschiedene Sirenen gab, die entweder zum Wecken, zum Essen oder zu unangekündigten Inspektionen riefen.
Ein wehklagendes Vogelzwitschern drang durch den tief hängenden Nebel. Alles klar.
Mit einem stummen Dankesgebet an den Sonnenpriester und den Gott, dem er diente, hob Sofie ihre verstümmelte Hand zum Elektrozaun. Sie schaute weder auf ihre fehlenden Fingernägel noch auf die Striemen. Und sie achtete auch nicht darauf, wie gefühllos und steif ihre Hände waren, nicht einmal, als der Strom des Zauns sie knisternd durchfuhr.
Durch sie hindurch, in sie hinein. Er wurde zu ihr, gehörte ihr, und sie konnte ihn nutzen, wie es ihr gefiel. Ein Gedanke genügte, und die Elektrizität des Zauns richtete sich wieder nach außen. Ihre Fingerspitzen sprühten Funken – dort, wo sie das Metall berührten, das sich zuerst orange und dann rot verfärbte.
Sie zog ihre Handfläche nach unten, deren Haut jetzt so heiß war, dass sie Metall und Draht spaltete. Emile flüsterte den anderen etwas zu, damit sie nicht aufschrien, aber Sofie hörte einen der Jungen murmeln: »Hexe.«
Die typische Angst der Menschen vor allen Wesen mit Wanen-Fähigkeiten – vor den Frauen, die solch unglaubliche Kräfte besaßen. Doch Sofie schwieg, statt dem Jungen mitzuteilen, dass keineswegs die Kräfte einer Hexe durch ihre Adern strömten, sondern etwas viel Selteneres.
Ihre Hand berührte kalte Erde, als sie das letzte Stück des Zauns durchtrennte und die beiden Hälften auseinanderzog. Die Öffnung war gerade breit genug, dass auch sie hindurchpassen würde. Die Kinder drängten vorwärts, aber Sofie bedeutete ihnen, stehen zu bleiben, und sondierte das offene Feld dahinter. Die Straße, die das Lager vom Farn und den hoch aufragenden Kiefern trennte, war leer.
Aber die eigentliche Gefahr drohte von hinten. Sofie drehte sich zu den Wachtürmen um, die an den Ecken des Lagers aufragten. Dort waren Schreckenswölfe postiert, die ihre Scharfschützengewehre permanent auf die Straße gerichtet hielten. Sie holte tief Luft, und der Strom, den sie aus dem Zaun gesaugt hatte, zuckte erneut durch sie hindurch. Auf der anderen Seite des Lagers explodierten die Scheinwerfer in einem Funkenregen, zu dem die Wachen herumwirbelten. Rufe ertönten.
Sofie zog den Zaun weiter auseinander. Die Muskeln an ihren Armen spannten sich an, und das Metall bohrte sich in ihre Handflächen, als sie die Kinder anknurrte: Lauft, lauft, lauft …
Kleine Schatten, deren zerrissene, schmutzige Uniformen im Licht des fast vollen Mondes zu hell schimmerten, huschten durch den Zaun und über die Schotterstraße zum dichten Farn und der steilen Schlucht dahinter. Emile passierte den Zaun als Letzter. Sein großer, knochiger Körper war noch immer ein Schock für Sofie – so brutal wie jede Kraft, die sie ausüben konnte.
Doch sie erlaubte sich nicht, darüber nachzudenken. Sie hastete ihm nach, geschwächt durch den Mangel an Nahrung, die zermürbende Arbeit und das trostlose Elend dieses Orts. Schlamm und Steine schnitten in ihre nackten Füße, aber der Schmerz verschwand, als sie das Dutzend blasser Gesichter sah, die aus dem Farn schauten. »Schnell, beeilt euch«, flüsterte sie.
Der Transporter würde nicht ewig warten.
Eines der Mädchen schwankte, als sie alle auf den Hügel zusteuerten, aber Sofie packte ihre knochige Schulter und hielt sie aufrecht, während sie gemeinsam weitertaumelten. Farne streiften ihre Beine, und ihre Füße verfingen sich in Wurzeln. Schneller. Sie mussten schneller sein …
Eine Sirene heulte.
Diesen Ton hatte Sofie bis jetzt noch nicht gehört. Aber sie wusste, was das schrille Kreischen verkündete: Flucht.
Die Strahlen von Taschenlampen zuckten durch die Bäume, während Sofie und die Kinder eine Kuppe des Hügels erklommen und dann eine farnbewachsene Senke mehr hinunterfielen als hinunterliefen. Die Schreckenswölfe hatten also ihre humanoide Gestalt angenommen. Einerseits gut, weil ihre Augen in der Dunkelheit nicht so scharf waren. Andererseits schlecht, weil das bedeutete, dass sie Waffen trugen.
Sofies Atem ging stoßweise, aber sie konzentrierte sich und richtete ihre Kraft schneidend hinter sich. Die Taschenlampen erloschen. Nicht einmal Erstlicht konnte gegen ihre Kraft bestehen. Erneut ertönten Rufe und Schreie … von männlichen, bösartigen Stimmen.
Sofie setzte sich an die Spitze der Gruppe, während Emile sich zurückfallen ließ, um sicherzustellen, dass kein Kind verloren ging. Stolz erfüllte ihre Brust, wenn auch mit Angst vermischt. Sie wusste: Falls man sie schnappte, würden sie das Lager nicht mehr lebend zu sehen bekommen.
Mit brennenden Oberschenkeln sprintete Sofie den steilen Hang der Senke hinauf. Sie mochte gar nicht daran denken, was die Kinder durchmachten, deren knochige Knie sie kaum aufrecht zu halten schienen. Endlich erreichten sie die Spitze des Hügels, im selben Moment, als die Schreckenswölfe zu heulen begannen – ein unmenschlicher Laut, der aus humanoiden Kehlen drang und zur Jagd rief.
Sie trieb die Kinder an, schneller zu laufen. Nebel und Farn und Bäume und Steine … Als einer der Jungen zusammenbrach, trug Sofie ihn und konzentrierte sich auf die allzu zarten Hände, die sich in ihr Hemd krallten.
Beeilt euch, schneller …
Und dann erreichten sie die Straße, den Transporter. Agent Silverbow hatte gewartet.
Seinen richtigen Namen kannte sie nicht. Hatte ihn gar nicht wissen wollen, obwohl sie eine ziemlich genaue Vorstellung davon hatte, was – oder wer – er war. Für sie war er immer nur Silver gewesen. Und er hatte gewartet. Obwohl er gesagt hatte, dass er ihr nicht helfen würde. Dass Ophion ihn umbringen würde, wenn er seine aktuelle Mission aufgab. Dass Pippa ihn umbringen oder einem ihrer Lightfall-Soldaten den Befehl dazu erteilen würde.
Aber er war mitgekommen, hatte sich die ganzen zwei Wochen versteckt, bis Sofie vergangene Nacht einen kleinen Strahl Erstlicht ausgesandt hatte – das einzige Signal, das sie sich im Todeslager zu senden getraut hatte und das bedeutete, er solle in 24 Stunden am vereinbarten Ort sein.
Sie hatte ihm geraten, seine Kräfte nicht einzusetzen, auch wenn dann alles viel sicherer und einfacher gewesen wäre. Aber es hätte ihn für die Flucht zu sehr geschwächt. Und er musste in Bestform sein.
Im Mondlicht schimmerte Silvers Gesicht blass über der Reichsuniform, die er gestohlen hatte, die Haare zurückgekämmt wie ein herausgeputzter Offizier. Er verzog das Gesicht, als er zuerst Emile und dann die elf anderen Kinder sah – offenbar überlegte er, wie viele in den unauffälligen weißen Transporter passten.
»Alle«, sagte Sofie mit rauer Stimme, während sie auf das Fahrzeug zustürmte. »Alle, Silver.«
Er verstand. Er hatte sie immer verstanden.
Mit übernatürlicher Eleganz sprang er aus dem Wagen und öffnete die hinteren Türen. Eine Minute später, auf dem Vordersitz dicht an Silver gepresst, dessen Wärme durch ihre dünne Kleidung drang, konnte Sofie kaum schnell genug Luft holen, als er das Gaspedal auch schon bis zum Anschlag durchtrat. Sein Daumen strich über ihre Schulter, wieder und wieder, als wollte er sich vergewissern, dass sie wirklich da war, dass sie es geschafft hatte.
Keines der Kinder sagte etwas. Keines weinte.
Und während der Transporter durch die Nacht raste, fragte Sofie sich, ob die Kinder dazu überhaupt noch in der Lage waren.
Sie brauchten eine halbe Stunde bis zur Hafenstadt Servast.
Sofie lehnte sich an Silver, der dafür sorgte, dass die Kinder selbst während der hektischen Fahrt über die holprige, kurvenreiche Landstraße die Proviantbeutel fanden, die er im hinteren Teil des Transporters verstaut hatte. Die Verpflegung reichte zwar nur für drei, aber die Kinder wussten, wie man eine magere Ration streckte. Und Silver bestand darauf, dass Sofie ebenfalls etwas aß. Die zwei Wochen im Lager hatten sie an den Rand ihrer Kräfte gebracht. Sie konnte nicht verstehen, wie diese Kinder Monate, Jahre dort überlebt hatten. Ihr Bruder hatte drei Jahre durchgehalten.
Als sie um eine scharfe Kurve bogen, sagte Silver leise: »Die Hindin ist ganz in der Nähe. Ich habe heute Morgen erfahren, dass sie sich in Alcene aufhält.« Eine Kleinstadt, keine zwei Stunden entfernt – eins der wichtigen Depots entlang des sogenannten Rückgrats, des Nord-Süd-Eisenbahnnetzes, über das die Reichstruppen mit Munition und Proviant versorgt wurden. »Unsere Spione hatten schon herausgefunden, dass sie in diese Richtung unterwegs war.«
Sofies Magen krampfte sich zusammen, aber sie konzentrierte sich darauf, die Kleidung und die Schuhe überzustreifen, die Silver für sie mitgebracht hatte. »Dann wollen wir hoffen, dass wir es vor ihr zur Küste schaffen.«
Er schluckte.
»Pippa?«, fragte sie vorsichtig.
An seinem Kiefer zuckte ein Muskel. Er und Pippa wetteiferten inzwischen schon seit Jahren um eine Beförderung in die höheren Ränge der Führung. Eine verrückte Fanatikerin, so hatte Silver Pippa bei mehr als nur einer Gelegenheit genannt – meistens nachdem ihre Lightfall-Staffel einen brutalen Angriff durchgeführt hatte, bei dem es keine Überlebenden gab. Aber Sofie verstand Pippas gnadenlosen Eifer: Sie war während ihrer Kindheit und Jugend selbst als bloßer Mensch angesehen worden. Hatte am eigenen Leib erfahren, wie die Menschen behandelt wurden – wie die Wanen Pippa vermutlich ihr ganzes Leben lang behandelt hatten. Manche Dinge, manche Erfahrungen konnte Silver einfach nicht nachvollziehen.
»Nein, noch keine Info«, antwortete Silver. »Gnade ihr Cthona, wenn sie nicht wie versprochen am vereinbarten Ort auftaucht.« Missbilligung und Misstrauen sprachen aus jedem seiner Worte.
Sofie schwieg während der restlichen Fahrt. Sie würde ihm keine Details der geheimen Informationen verraten, trotz allem, was er für sie getan und was er ihr bedeutet hatte, trotz der stillen gemeinsamen Stunden, in denen ihre Körper und ihre Seelen miteinander verschmolzen waren. Sie würde niemandem etwas sagen – nicht, bevor die Führung ihr Versprechen einlöste.
Die Asteri hatten inzwischen wahrscheinlich begriffen, was sie entdeckt hatte, und zweifellos die Hindin auf sie angesetzt, um zu verhindern, dass sie es jemandem verriet. Aber die im Moment größere Gefahr bildeten die Schreckenswölfe, die sich mit jeder Meile näherten wie Hunde auf einer Fährte. Silvers häufige Blicke in den Rückspiegel verrieten ihr, dass er es ebenfalls wusste.
Sie beide konnten es vielleicht mit einer Handvoll Wolf-Gestaltwandlern aufnehmen – es wäre schließlich nicht das erste Mal. Aber nach einer Flucht aus Kavalla würde man sicher mehr als nur eine Handvoll an ihre Fersen heften. Wesentlich mehr, als sie abwehren und überleben konnten. Doch auf diese Möglichkeit war sie vorbereitet, sie hatte der Führung bereits vor Kavalla ihren Kommunikationskristall ausgehändigt. Die kostbare, einzige Verbindung zu ihrer wertvollsten Kontaktperson. Sie wusste, dass man den kleinen Quarzbrocken sicher aufbewahren würde. Genau wie Silver dafür sorgen würde, dass Emile in Sicherheit war. Er hatte ihr sein Wort gegeben.
Als sie aus dem Transporter stiegen, hüllte Nebel die engen Docks von Servast in Schleier und wälzte sich über die nachtschwarzen Fluten des Haldren-Ozeans. Er schlängelte sich um die alten Steinhäuser der Hafenstadt, wo das Erstlicht in den wenigen Straßenlampen der Kopfsteingassen flackerte. Kein einziges Licht leuchtete hinter den verschlossenen Fenstern, kein Auto und kein Fußgänger bewegte sich in den tiefen Schatten des Nebels. Es hatte den Anschein, als wären die Straßen von Servast vor ihrer Ankunft geräumt worden. Als hätten sich die Bewohner der Hafenstadt – meist arme Fischer, sowohl Menschen als auch Wanen, die dem Haus der vielen Wasser angehörten – versteckt. Weil irgendein Instinkt ihnen gesagt hatte, dass sie dem Nebel lieber nicht trotzen sollten. Nicht in dieser Nacht.
Nicht, wenn die Schreckenswölfe auf der Jagd waren.
Silver ging voran. Seine Haare schauten unter seiner Kappe hervor, seine Augen zuckten von links nach rechts, und seine Pistole steckte griffbereit im Holster an seiner Seite. Sofie hatte schon gesehen, wie effizient er seine Kraft zum Töten einsetzte, aber manchmal waren Waffen einfach schneller.
Emile blieb dicht bei ihr, während sie über das abgewetzte Kopfsteinpflaster der Straßen schlichen, durch die leeren Gassen. Sie spürte auf sie gerichtete Augen hinter den geschlossenen Fensterläden. Aber niemand öffnete eine Tür, um seine Hilfe anzubieten.
Sofie war es egal. Solange dieses Schiff an der vereinbarten Stelle wartete, konnte die Welt zur Hölle fahren.
Glücklicherweise dümpelte die Bodegraven drei Häuserblocks weiter am Ende eines langen Holzstegs im Wasser. Die silbernen Buchstaben leuchteten auf ihrem schwarzen Rumpf. In den Luken des kleinen Dampfers schimmerten ein paar Erstlichter, aber an Deck war alles ruhig. Emile keuchte leise auf, als handelte es sich um eine von Luna geschenkte Vision.
Sofie betete, dass die anderen Ophion-Schiffe jenseits des Hafens als Verstärkung warteten, so wie die Führung es versprochen hatte: als Gegenleistung für den wertvollen Trumpf, den sie aus dem Todeslager geholt hatte. Die Tatsache, dass es sich dabei um ihren Bruder handelte, hatte die Führungsgruppe nicht interessiert. Wichtig war nur das, wozu er laut Sofies Aussage in der Lage war.
Sofie sondierte die Straßen, die Docks, den Himmel.
Die Kraft in ihren Adern pochte im Takt ihres Herzens. Ein Gegenrhythmus, der Schlag einer Knochentrommel, eine Totenglocke. Eine Warnung.
Sie mussten sofort aufbrechen.
Sofie setzte sich in Bewegung, aber Silvers breite Hand packte sie an der Schulter.
»Sie sind hier«, sagte er in seinem nordischen Akzent. Mit seinen scharfen Sinnen konnte er die Wölfe besser aufspüren als sie.
Sofie musterte die steilen Dächer, die Pflastersteine und den Nebel. »Wie nah?«
Furcht erfüllte Silvers attraktives Gesicht. »Überall. Sie sind überall.«
Nur drei Blocks trennten sie von ihrer Rettung. Rufe hallten von den Steinen wider, einen Block entfernt. »Da drüben! Da!«
Ein Herzschlag, um eine Entscheidung zu treffen. Nur ein Herzschlag …
Emile blieb abrupt stehen, helle Angst in den dunklen Augen.
Keine Angst mehr. Keine Schmerzen.
»Lauf«, zischte sie in Silvers Richtung. Silver griff nach seiner Waffe, doch sie drückte seine Hand nach unten und herrschte ihn an: »Bring die Kinder aufs Schiff und fahrt los. Ich halte die Wölfe auf und treffe euch dort.«
Ein paar der Kinder rannten bereits zum Steg. Emile wartete. »Lauf!«, befahl sie Silver erneut. Er berührte ihre Wange – streichelte sie sanft – und sprintete dann den Kindern nach, brüllte dem Kapitän zu, die Maschinen zu starten. Keiner von ihnen würde überleben, wenn sie nicht sofort ablegten.
Sie wirbelte zu Emile herum. »Schnell! Zum Schiff!«
Seine Augen – die Augen ihrer Mutter – weiteten sich. »Aber wie willst du …?«
»Ich verspreche dir, dass ich euch finden werde, Emile. Denk an das, was ich dir gesagt habe. Und jetzt lauf!«
Als sie seinen schlaksigen, knochigen Körper umarmte, erlaubte sie sich, einen Hauch seines Dufts einzuatmen, des Dufts, der sich unter den beißenden Schichten von Schmutz und Unrat des Lagers verbarg. Dann taumelte Emile davon und stolperte fast über die eigenen Füße, als er die Kraft spürte, die sich in ihren Fingerspitzen bildete.
Aber ihr Bruder sagte leise: »Zahl es ihnen heim.«
Sie schloss die Augen und machte sich bereit. Sammelte ihre Kräfte. In den Gassen um sie herum erloschen die Lichter. Als sie die Augen in der plötzlichen Dunkelheit wieder öffnete, hatte Emile den Steg erreicht. Silver wartete an der Rampe und winkte unter der einzigen Straßenlampe, die noch brannte. Ihre Blicke trafen sich.
Sie nickte ihm einmal zu – in der Hoffnung, dieses Nicken möge alles ausdrücken, was in ihrem Herzen war – und lief dann auf das Heulen der Schreckenswölfe zu.
Sofie sprintete direkt in die goldenen Strahlen der Scheinwerfer von vier Jeeps, auf denen das Symbol der Asteri prangte: die Buchstaben SPQM, umgeben von sieben Sternen. Alle dicht besetzt mit Schreckenswölfen in Reichsuniformen, die Waffen gezogen.
Sofort entdeckte sie die Frau mit den goldblonden Haaren, die lässig auf einem der Beifahrersitze saß. Ein silberner Reif glänzte an ihrem Hals.
Die Hindin.
Flankiert von zwei Scharfschützen im offenen Wagen, deren Gewehre auf Sofie gerichtet waren. Sogar in der Dunkelheit schimmerten Lidia Cervos’ Haare. Ihr schönes Gesicht wirkte passiv und kalt. Die bernsteinfarbenen Augen der Hirsch-Gestaltwandlerin betrachteten Sofie mit einer selbstgefälligen Belustigung, aus der Triumph sprach.
Sofie sprintete um eine Häuserecke, bevor die ersten Schüsse wie Donnerhall ertönten. Hinter sich hörte sie die knurrenden Schreckenswölfe der Hindin, während sie auf das Zentrum von Servast zusteuerte, weg vom Hafen. Weg von dem Schiff und den Kindern. Von Emile.
Silver konnte seine Kräfte nicht einsetzen, um sie zu holen. Er hatte keine Ahnung, wo sie war.
Sofies Atem rasselte in ihren Lungen, während sie durch die leeren, düsteren Straßen stürmte. Das Horn des Schiffs dröhnte durch die neblige Nacht, als wollte es sie zur Eile antreiben.
Wie zur Antwort erhob sich ein unheimliches Heulen aus einem halben Dutzend Kehlen. Ein Heulen, das immer näher kam. Einige hatten offenbar ihre Wolfsgestalt angenommen. Klauen donnerten über das Pflaster, ganz in der Nähe.
Sofie biss die Zähne zusammen, bog in eine weitere Gasse ein und steuerte auf den einzigen Platz zu, an dem sie – allen sorgfältig studierten Landkarten und Straßenplänen nach – vielleicht eine Chance hatte. Wieder ertönte das Schiffshorn, ein letztes Signal vor dem Ablegen.
Wenn sie nur ein bisschen tiefer ins Stadtzentrum gelangen könnte, ein bisschen tiefer …
Hinter ihr schnappten Fangzähne laut zu.
Lauf weiter. Nicht nur weg von den Wanen, die sie verfolgten, sondern auch von den Scharfschützen, die nur auf eine freie Schusslinie warteten. Weg von der Hindin, die wissen musste, welche Informationen Sofie hatte. Sie sollte sich vermutlich geschmeichelt fühlen, dass die Hindin persönlich erschienen war, um das Ganze zu überwachen.
Vor ihr tauchte der kleine Marktplatz auf. Sofie rannte auf den Brunnen in der Mitte zu und richtete einen Strahl ihrer Kraft direkt auf Stein und Metall, bis das Wasser wie aus einem Geysir herausschoss und den ganzen Platz flutete. Wölfe preschten aus den umliegenden Straßen in das Wasser und veränderten ihre Gestalt, als sie auf sie zustürmten und sie umzingelten.
Doch Sofie verharrte in der Mitte des überfluteten Platzes.
Die Wölfe in Menschengestalt trugen Reichsuniformen, an deren Kragen winzige silberne Pfeile schimmerten. Ein Pfeil für jeden Rebellenspion, den sie zur Strecke gebracht hatten. Ihr drehte sich der Magen um. Nur eine Sorte von Schreckenswölfen besaß diese Silberpfeile: die Leibgarde der Hindin, die Elite der Gestaltwandler.
Ein kehliger Pfiff hallte durch den Hafen. Warnung und Abschiedsgruß zugleich.
In diesem Moment sprang Sofie auf den Brunnenrand und lächelte den Wölfen zu, die sich ihr näherten. Sie würden sie nicht töten. Nicht, wenn die Hindin darauf wartete, sie zu verhören. Zu dumm, dass sie nicht wussten, was Sofie wirklich war. Weder Mensch noch Hexe.
Sie gestattete den Kräften, die sie an den Docks gesammelt hatte, sich zu entfalten.
Knisternde Energie sprühte an ihren Fingerspitzen und zwischen den Strähnen ihrer kurzen braunen Haare. Dann begriff einer der Schreckenswölfe – er wusste wohl, woher er das, was er da sah, kannte: aus den Mythen, die die Wanen ihren Kindern zuflüsterten.
»Sie ist ein verdammter Donnervogel!«, brüllte der Wolf, genau in dem Moment, als Sofie ihre gesammelte Kraft entfesselte und auf das Wasser richtete, das den Platz überspülte. Auf die Schreckenswölfe, die bis zu den Knöcheln in den Fluten standen.
Sie hatten keine Chance.
Sofie wirbelte schon zu den Docks herum, als die letzte Elektrizität noch über die Steine schlängelte, und würdigte die verkohlten, halb untergetauchten Kadaver kaum eines Blickes. Die heißen Silberpfeile an ihren Kragen glühten in der Dunkelheit.
Ein weiterer Pfiff. Sie konnte es noch immer schaffen. Keuchend preschte Sofie über den gefluteten Platz.
Der Schreckenswolf hatte mit seinem Ausruf nur halb richtiggelegen. Sie war bloß zum Teil Donnervogel – ihre Urgroßmutter hatte sich vor langer Zeit mit einem Menschen gepaart, bevor man sie hinrichtete. Ihre Gabe, in diesen Tagen mehr Legende als Realität, hatte sich in Sofie erneut manifestiert.
Diese Gabe war der Grund, warum die Rebellen sie so dringend gebraucht und sie auf so gefährliche Missionen geschickt hatten. Warum Pippa sie inzwischen sehr zu schätzen wusste. Sofie roch wie ein Mensch und ging auch als solcher durch, aber in ihren Adern schlummerte eine Fähigkeit, mit der sie blitzschnell töten konnte. Die Asteri hatten schon vor langer Zeit Jagd auf die Donnervögel gemacht und die meisten ausgerottet. Sofie hatte nie erfahren, wie ihre Urgroßmutter so lange überleben konnte, aber ihre Nachkommen hatten ihren Stammbaum und ihre Gabe geheim gehalten. Genau wie Sofie.
Bis zu jenem Tag vor drei Jahren, als man ihre Familie verschleppt und getötet hatte. Als sie zum nächsten Ophion-Stützpunkt gelaufen war und den Rebellen gezeigt hatte, wozu sie fähig war. Als sie ihnen gesagt hatte, was sie im Gegenzug von ihnen verlangte.
Sie hasste sie. Fast so sehr, wie sie die Asteri und die Welt hasste, die sie aufgebaut hatten. Drei Jahre lang hatte Ophion ihr Emiles Aufenthaltsort verschwiegen, hatte versprochen, ihn zu finden und Sofie bei seiner Befreiung zu helfen, wenn sie nur noch eine Mission für sie übernahm. Pippa und Silver mochten an die Sache glauben, auch wenn sich ihre Kampfmethoden voneinander unterschieden. Aber Sofies Interesse hatte stets nur Emile gegolten. Eine freie Welt wäre wunderbar. Aber wozu nutzte das alles, wenn sie keine Familie hatte, mit der sie in dieser Welt leben konnte?
Ein ums andere Mal hatte sie für die Rebellen Elektrizität aus dem Stromnetz, aus Lichtern und Maschinen gezogen und getötet. Wieder und wieder. Bis ihre Seele zerstört war. Wie oft hatte sie darüber nachgedacht, ihren Bruder auf eigene Faust zu suchen … Aber sie war keine Spionin, hatte kein Netzwerk. Also war sie geblieben, hatte heimlich ihren eigenen Köder entwickelt und ihn Ophion vor die Nase gehalten. Hatte dafür gesorgt, dass sie genau wussten, wie wichtig die von ihr gesammelten Informationen waren, bevor sie sich nach Kavalla bringen ließ.
Schneller, immer schneller sprintete sie Richtung Steg. Wenn sie es nicht rechtzeitig schaffte, würde sie vielleicht ein kleines Boot finden, das sie zu dem Dampfer brachte. Aber vielleicht würde sie auch einfach schwimmen, bis sie nahe genug dran war, dass Silver sie entdecken und mithilfe seiner Kraft an Bord holen konnte.
Halb verfallene Häuser und holprige Straßen flogen an ihr vorbei, Nebelschwaden durchbrachen die Dunkelheit.
Das Stück des Holzstegs, das Sofie von dem ablegenden Dampfer trennte, war leer. Sie stürmte darauf zu und konnte Silver an Deck der Bodegraven schon erkennen, der ihre Ankunft wachsam verfolgte. Aber warum nutzte er seine Kraft nicht, um sie zu holen? Als sie noch näher kam, entdeckte sie die Hand, die auf seine blutende Schulter gedrückt war.
Cthona möge ihm gnädig sein. Silver wirkte nicht schwer verletzt, aber sie glaubte zu wissen, welche Art von Kugel ihn getroffen hatte. Eine Kugel mit einem Kern aus gorsischem Stein. Eine Kugel, die Magie unterdrückte.
Seine Kraft war nutzlos. Aber wenn ein Scharfschütze Silver auf dem Schiff getroffen hatte … Abrupt hielt Sofie inne.
Der Jeep stand im Schatten des Gebäudes gegenüber von den Docks. Noch immer thronte die Hindin darin wie eine Königin, neben sich einen Scharfschützen, der das Gewehr auf Sofie gerichtet hielt. Sie wusste nicht, wohin der zweite Schütze verschwunden war. Aber jetzt zählte nur dieser eine. Er und sein Gewehr – das vermutlich mit gorsischen Kugeln geladen war, die Sofie in Sekunden zu Fall bringen würden.
Die goldenen Augen der Hindin glühten wie Kohlen im Halbdunkel. Sofie schätzte die Entfernung bis zum Ende des Stegs ab. Das Seil, das Silver für sie heruntergeworfen hatte, wurde mit jedem Zentimeter, den die Bodegraven dem offenen Meer entgegentuckerte, unerreichbarer.
Herausfordernd neigte die Hindin den Kopf. Eine trügerisch ruhige Stimme drang zwischen ihren roten Lippen hervor: »Bist du schneller als eine Kugel, Donnervogel?«
Sofie ließ sich nicht auf ein Wortgeplänkel ein. So schnell, wie der Wind durch die Fjorde ihres Heimatlandes fegte, rannte sie über den Holzsteg. Sie wusste, dass der Scharfschütze sie im Visier hatte.
Das Ende des Stegs und der dunkle Hafen dahinter zeichneten sich ab.
Das Gewehr knallte.
Silvers Brüllen drang durch die Nacht, bevor Sofie auf die Holzplanken aufschlug. Splitter bohrten sich in ihr Gesicht, und sie spürte, wie einer durch den Aufprall in ihr Auge drang. Schmerz explodierte in ihrem rechten Oberschenkel und hinterließ eine Spur aus zerfetztem Muskelgewebe und zersplitterten Knochen, so heftig, dass sogar der Schrei in ihren Lungen erstickte.
Silvers Brüllen verstummte abrupt – und dann schrie er den Kapitän an: »Los, los, los, los!«
Sofie lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Steg und wusste, dass es schlimm war. Sie hob den Kopf und unterdrückte den Schmerzensschrei, während ihr Blut aus der Nase rann. Das dröhnende Brummen eines Omega-Boots vibrierte durch ihren Körper, noch bevor sie die sich nähernden Lichter unter der Wasseroberfläche entdeckte.
Vier Unterwasserkriegsschiffe des Reichs schossen wie Haie auf die Bodegraven zu.
Pippa Spetsos stand an Bord des Rebellenschiffs Orrae, um sich herum die dunklen Weiten des Haldren-Ozeans. An der Nordküste Pangeras funkelten die Erstlichter der weit entfernten Städte wie goldene Sterne. Aber ihre Aufmerksamkeit blieb auf das Schimmern von Servast gerichtet. Auf das kleine Licht, das auf sie zukam.
Die Bodegraven war pünktlich.
Pippa legte eine Hand auf die kalte, harte Rüstung, die ihre Brust bedeckte, direkt oberhalb der untergehenden Sonne – dem Abzeichen der Lightfall-Einheit. Sie würde erst dann erleichtert aufatmen, wenn sie Sofie sah. Erst dann, wenn sie die Trümpfe geborgen hatte, die Sofie mitbrachte: den Jungen und die geheimen Informationen.
Danach würde sie Sofie allerdings zeigen, was die Führung davon hielt, manipuliert zu werden.
Agent Silverbow, der arrogante Mistkerl, war der Frau gefolgt, die er liebte. Sie wusste, dass ihm das, was Sofie mitbrachte, wenig bedeutete. Der Idiot. Aber die Informationen, die Sofie angeblich jahrelang heimlich für Ophion gesammelt hatte … selbst Silverbow würde diese Informationen haben wollen.
Captain Richmond trat neben sie.
»Bericht«, befahl sie.
Er hatte auf die harte Tour gelernt, ihr nicht zu widersprechen. Hatte gelernt, welche Mitglieder der Führungsgruppe sie unterstützten und anderen in ihrem Namen die Hölle heißmachten. Den Blick auf den sich nähernden Dampfer gerichtet, meldete Richmond: »Wir haben Funkkontakt hergestellt. Deine Agentin ist nicht auf dem Schiff.«
Pippa erstarrte. »Und der Bruder?«
»Der Junge ist an Bord. Zusammen mit elf anderen Kindern aus Kavalla. Sofie Renast ist zurückgeblieben, um ihnen Zeit zu verschaffen. Es tut mir leid.«
Tut mir leid. Pippa wusste nicht mehr, wie oft sie diese beschissenen Worte schon gehört hatte.
Aber jetzt … Emile hatte es aufs Schiff geschafft. War er es wert, dass sie Sofie verloren?
Das war das Risiko, das sie eingegangen waren, als sie Sofie überhaupt erlaubten, sich in das Lager bringen zu lassen: der mögliche Verlust eines wertvollen Aktivpostens, um einen anderen zu gewinnen. Aber das war vor Sofies Aufbruch gewesen – bevor sie ihnen mitteilte, dass sie wichtige Informationen über ihre Feinde erhalten hatte. Wenn sie Sofie jetzt verloren, und mit ihr diese Informationen …
Wütend zischte sie Richmond an: »Ich will, dass …«
Doch ein menschlicher Matrose stürmte aus der verglasten Tür der Brücke. Seine Haut schimmerte im Mondlicht erschreckend blass. Er schaute zuerst Richmond und dann Pippa an, unsicher, wem er Bericht erstatten sollte. »Die Bodegraven wird von vier Omegas verfolgt, die rasch näher kommen. Agent Silverbow ist außer Gefecht gesetzt … von einer gorsischen Kugel in die Schulter getroffen.«
Pippa gefror das Blut in den Adern. Mit einer gorsischen Kugel im Körper würde Silverbow keine Hilfe sein. »Sie werden das Schiff eher versenken, als die Kinder gehen zu lassen.«
Noch war sie nicht so abgestumpft gegen die Schrecken dieser Welt, dass sich ihr bei dieser Vorstellung nicht der Magen umdrehte. Richmond fluchte leise.
»Die Kanoniere sollen sich bereit machen«, befahl Pippa. Auch wenn die Chancen schlecht standen, dass sie einen Angriff der Omegas überleben würden, konnten sie dennoch für eine Ablenkung sorgen. Richmond brummte zustimmend. Aber der Matrose, der von der Brücke an Deck gerannt war, keuchte auf und zeigte auf den Horizont.
In Servast erloschen alle Lichter. Die Welle der Dunkelheit schwappte ins Landesinnere.
»Was zum Teufel …«
»Nicht der Teufel«, murmelte Pippa, als sich der Blackout ausbreitete.
Sofie. Oder … Mit zusammengekniffenen Augen starrte sie zur Bodegraven.
Rasch rannte sie Richtung Brücke, um sich eine bessere Sicht zu verschaffen. Zusammen mit Richmond erreichte sie diese gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie die Bodegraven auf sie zuraste – während die Lichter der vier Omega-Boote hinter ihr unter Wasser flackerten und immer näher kamen.
Doch plötzlich tauchte ein mächtiges weißes Licht unter der Oberfläche auf und schlang seine langen Fangarme um eines der U-Boote. Und schon im nächsten Moment sprang das weiße Licht davon und flog zum nächsten Boot, in seinem Kielsog nur Dunkelheit, keine Unterwasserscheinwerfer. Das Omega-Boot verschwand von Pippas Radarschirm.
»Gütiger Himmel«, murmelte Richmond.
Etwas in der Art, wollte Pippa erwidern. Es war Sofies seltsame Gabe: nicht nur Elektrizität, sondern auch Erstlicht-Kraft. Sie beherrschte jede Form von Energie, saugte sie in sich auf. Vor Jahrhunderten hatten die Asteri ihre Art wegen dieser mächtigen, unbezwingbaren Gabe bis zur Ausrottung gejagt – so hatte es zumindest den Anschein gehabt.
Aber jetzt gab es zwei Personen mit dieser Gabe.
Sofie hatte behauptet, die Kräfte ihres Bruders würden ihre eigenen in den Schatten stellen. Kräfte, die Pippa nun in Aktion erlebte, als das Licht vom zweiten Boot sprang – ein weiterer Blackout – und dann zum dritten raste.
Sie konnte von Emile keine Spur entdecken, aber er musste sich an Deck der Bodegraven befinden.
»Was kann ein Omega-Boot ohne Torpedos ausschalten?«, murmelte einer der Matrosen. Das Licht war jetzt näher gekommen und schwenkte unter der Oberfläche auf das dritte Boot zu. Selbst aus der Entfernung konnte Pippa den Lichtstrahl erkennen, mit seinen langen, leuchtend weißen Ranken, die wie Schwingen aus ihm herausströmten.
»Ein Engel?«, flüsterte jemand.
Pippa schnaubte innerlich. Unter den wenigen Wanen in den Ophion-Reihen gab es keine Engel. Wenn es nach Pippa gegangen wäre, würde es überhaupt keine Wanen geben … bis auf solche wie diese. Wanenkräfte, aber mit der Seele und dem Körper eines Menschen. Emile war ein großer Trumpf für die Rebellion – die Führung würde hocherfreut sein.
Das dritte Omega-U-Boot erlosch und verschwand in der tintenschwarzen Tiefe. Bei diesem schrecklichen, herrlichen Anblick begann Pippas Blut zu singen. Nur noch ein Omega-Boot.
»Komm schon«, flüsterte Pippa. »Komm schon …« Zu viel hing von diesem Boot ab, vielleicht sogar der Ausgang des Kriegs.
»Das letzte Omega hat zwei Brimstone-Torpedos abgefeuert!«, schrie ein Matrose.
Aber das weiße Licht krachte schon in das letzte U-Boot, eine gewaltige Ladung Erstlicht, die dafür sorgte, dass es trudelnd in den tiefen Abgrund sank.
Und dann ein Sprung aus dem Wasser, eine Lichtpeitsche, die die Wellen türkis färbte. Eine ausgestreckte Hand.
Mit Ehrfurcht in der Stimme krächzte einer der Matrosen: »Die Brimstone-Torpedos sind vom Radar verschwunden. Einfach verschwunden.«
Nur die Lichter der Bodegraven waren noch da, wie blasse Sterne in einem Meer aus Dunkelheit.
»Kommandantin Spetsos?«, fragte Richmond.
Aber Pippa ignorierte ihn und hastete in den warmen Innenraum der Brücke, wo sie von einem Haken an der Tür ein Marinefernglas riss. Wenige Sekunden später war sie wieder draußen auf dem windgepeitschten Deck, das Fernglas auf die Bodegraven gerichtet.
Dort stand Emile, älter, aber definitiv das Kind von Sofies Fotos, nicht mehr als eine hagere Gestalt am Bug des Schiffs. Er starrte auf das nasse Grab, während sie darüberfuhren. Dann auf das Land dahinter. Langsam sank er auf die Knie.
Pippa lächelte in sich hinein und richtete das Fernglas auf die tiefe Dunkelheit von Pangera.
Sofie lag auf der Seite, hörte nur, wie die Wellen gegen den Steg schwappten und wie ihr Blut zwischen den Planken hindurch ins Wasser tropfte. Sie wartete auf den Tod.
Ihr Arm baumelte über das Ende des Stegs, während die Bodegraven zu den rettenden Lichtern auf dem Meer fuhr. Zu Pippa, die Schlachtschiffe geschickt hatte, um die Bodegraven in die Sicherheit zu bringen. Vermutlich, um sich zu vergewissern, dass Sofie an Bord war, zusammen mit Emile, aber … immerhin war sie gekommen. Ophion war tatsächlich gekommen.
Tränen rannen ihr über die Wangen, tropften auf die Holzplanken. Jede Faser ihres Körpers schmerzte.
Sie hatte gewusst, was passieren würde, wenn sie zu weit ging und zu viel Kraft beanspruchte, so wie heute Abend. Das Erstlicht brannte unendlich viel stärker als Elektrizität. Es verkohlte ihr Inneres, auch wenn sie sich danach sehnte, mehr von seiner starken Kraft zu spüren. Genau aus diesem Grund hatte sie es gemieden, so gut es ging. Und genau deshalb war Emile für die Führung, für Pippa und ihre Lightfall-Staffel so verlockend.
Aber jetzt hatte Sofie nichts mehr in sich. Nicht einen Funken Kraft. Und es würde niemand kommen, um sie zu retten.
Schritte polterten über den Steg, ließen ihren Körper erzittern. Sofie biss sich auf die Lippen, um den schneidenden Schmerz zu unterdrücken.
Glänzende schwarze Stiefel verharrten nur wenige Zentimeter vor ihrer Nase. Sofie richtete ihr unversehrtes Auge nach oben. Das blasse Gesicht der Hindin starrte auf sie herab.
»Böses Mädchen«, sagte sie mit dieser schönen Stimme. »Meine Schreckenswölfe einfach mit Stromschlägen zu töten.« Ihre bernsteinfarbenen Augen wanderten über Sofies Körper. »Welch bemerkenswerte Kraft du hast. Und welch bemerkenswerte Kraft auch dein Bruder hat, dass er meine Omega-Boote versenken kann. Es scheint, als wären alle Legenden über eure Art wahr.«
Sofie schwieg.
Die Spionjägerin lächelte matt. »Sag mir, an wen du die Informationen weitergeben hast. Dann werde ich sofort verschwinden und dich am Leben lassen. Damit du deinen geliebten kleinen Bruder wiedersehen kannst.«
»An niemanden«, stieß Sofie zwischen steifen Lippen hervor.
»Lass uns eine Bootstour machen, Sofie Renast«, erwiderte die Hindin nur.
Die Schreckenswölfe verfrachteten Sofie in ein unauffälliges Boot. Niemand sagte einen Ton, während sie aufs Meer hinausfuhren. Eine Stunde verging, und der Himmel hellte sich auf. Erst in dem Moment, als sie so weit von der Küste entfernt waren, dass sich diese nicht mehr als dunkler Schatten gegen den Nachthimmel abzeichnete, hob die Hindin eine Hand. Die Motoren wurden abgeschaltet, und das Boot schaukelte in den Wellen.
Erneut kamen diese glänzenden, kniehohen Stiefel auf Sofie zu. Man hatte ihr gorsische Fesseln angelegt, um ihre Kräfte zu unterdrücken. Ihr Bein war taub vor Schmerz.
Die Hindin befahl einem Wolf durch ein Kopfnicken, Sofie auf die Beine zu hieven. Sofie biss die Zähne zusammen, um nicht vor Schmerz aufzuschreien. Hinter ihr öffnete ein weiterer Wolf die Klappe am Heck und legte die kleine Plattform am hinteren Ende des Boots frei. Sofies Kehle schnürte sich zu.
»Da dein Bruder so vielen Reichssoldaten einen derartigen Tod beschert hat, dürfte dies eine angemessene Strafe für dich sein«, verkündete die Hindin und trat auf die Plattform. Das Wasser, das über ihre Stiefel spritzte, schien sie nicht zu kümmern. Sie zog einen kleinen weißen Stein aus der Tasche, hielt ihn Sofie vor die Nase und warf ihn dann ins Wasser. Verfolgte ihn mit ihren scharfen Wanen-Augen, während er tiefer und tiefer in die tintige Schwärze hinabsank.
»Bei dieser Tiefe wirst du vermutlich bereits ertrinken, bevor du den Meeresboden erreichst«, bemerkte die Hindin, und ihr goldenes Haar glitt über ihr gebieterisches Gesicht. Sie schob die Hände in die Taschen, als die Wölfe sich neben Sofie knieten und ihre Knöchel mit Ketten fesselten, die mit Bleiblöcken beschwert waren.
»Ich frage dich noch einmal«, sagte die Hindin und legte den Kopf auf die Seite, wobei der Silberreif um ihren Hals schimmerte. »Wem hast du von den Informationen erzählt, die du vor deiner Ankunft in Kavalla gesammelt hast?«
Sofie spürte den Schmerz ihrer fehlenden Fingernägel. Sah die Gesichter in diesem Lager. Die Menschen, die sie zurückgelassen hatte. Ihr war es um Emile gegangen – und doch hatten die Ophion-Rebellen in so vielen Punkten recht. Ein kleiner Teil von ihr hatte sich gefreut, für Ophion zu töten und für diese Leute zu kämpfen. Und sie würde auch jetzt für sie, für Emile kämpfen. »Das habe ich doch schon gesagt: niemandem«, stieß sie zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
»Also gut.« Die Hindin zeigte auf das Wasser. »Du weißt, wie das endet.«
Sofie zog eine ausdruckslose Miene, um den Schock über ihr Glück zu verbergen – ein letztes Geschenk von Solas. Offenbar war nicht einmal die Hindin so clever, wie sie selbst glaubte. Sie gewährte ihr einen schnellen, grausamen Tod. Das war nichts im Vergleich zu der endlosen Folter, die Sofie erwartet hatte.
»Stellt sie auf die Plattform.«
Ein Schreckenswolf in Gestalt eines stämmigen dunkelhaarigen Mannes widersprach hämisch: »Wir kriegen es aus ihr heraus.« Mordoc, der Erste Offizier der Hindin. Fast so gefürchtet wie seine Kommandantin. Vor allem wegen seiner besonderen Gaben.
Doch die Hindin würdigte ihn kaum eines Blickes. »Damit werde ich nicht meine Zeit verschwenden. Sie hat gesagt, dass sie es niemandem verraten hat, und ich bin geneigt, ihr zu glauben.« Ein verschlagenes Lächeln breitete sich auf ihrem Gesicht aus. »Also werden die Informationen mit ihr sterben.«
Mehr brauchte die Hindin nicht zu sagen. Die Wölfe zogen Sofie auf die Plattform. Sie unterdrückte einen Schrei, als ein heißer Schmerz durch ihren Oberschenkel zuckte. Eiskaltes Wasser spritzte auf, drang brennend und betäubend durch ihre Kleidung.
Sofie konnte nichts gegen ihr Zittern tun. Sie versuchte, sich an den Kuss der Luft, an den Duft der See, an das Grau des Himmels vor Tagesanbruch zu erinnern. Sie würde den Sonnenaufgang, der nur wenige Minuten fern war, nicht mehr erleben. Sie würde nie wieder die Sonne sehen.
Sie hatte die Schönheit und Schlichtheit des Lebens für selbstverständlich gehalten. Wie sehr wünschte sie sich, sie hätte es mehr ausgekostet. Jeden einzelnen Moment.
Die Hirsch-Gestaltwandlerin kam näher. »Irgendwelche letzten Worte?«
Emile hatte fliehen können. Das war das Einzige, was zählte. Er war jetzt in Sicherheit.
Sofie schenkte der Hindin ein schiefes Grinsen. »Fahr zur Hölle.«
Mordocs Krallenhände stießen sie von der Plattform.
Das eisige Wasser traf Sofie wie eine Bombe, und dann packte das Blei an ihren Füßen alles, was sie war und hätte sein können, und zog sie in die Tiefe.
Wie ein Gespenst im kalten Nebel des Haldren-Ozeans stand die Hindin da und schaute zu, wie Sofie Renast in Ogenas’ Armen versank.
TEIL IDIE KLUFT
1
Für einen Dienstagabend war der Saal des Crescent City Ballet ungewöhnlich gut gefüllt. Der Anblick der vielen Menschen, die sich im Foyer drängten, etwas tranken und sich unterhielten, erfüllte Bryce Quinlan mit einer Art stiller Freude und Stolz.
Es gab nur einen Grund, warum das Theater heute Abend so gut besucht war. Sie hätte schwören können, dass sie mit ihrem scharfen Fae-Gehör wahrnahm, wie zahlreiche Stimmen um sie herum den Namen Juniper Andromeda flüsterten. Der Star der heutigen Aufführung. Doch trotz der vielen Besucher herrschte im Saal eine Atmosphäre stiller Ehrfurcht und Ruhe. Als wäre er ein Tempel.
Bryce hatte das unheimliche Gefühl, von den antiken Götterstatuen zu beiden Seiten des langen Foyers beobachtet zu werden. Aber vielleicht lag es auch eher an dem gut gekleideten älteren Gestaltwandler-Paar dort drüben bei der Statue der nackten Erdgöttin Cthona, die hingerekelt auf die Umarmung ihres Geliebten Solas wartete. Die Gestaltwandler – dem Geruch nach eine Art Großkatzen, noch dazu reich, wie ihre Armbanduhren und der Schmuck vermuten ließen – starrten sie unverhohlen an.
Bryce schenkte ihnen ein gelangweiltes, schmallippiges Lächeln. Seit dem Angriff im vergangenen Frühjahr kam so etwas fast jeden Tag vor, in irgendeiner Form. Die ersten paar Male hatte es sich überwältigend und nervenaufreibend angefühlt – Leute waren auf sie zugekommen und hatten vor Dankbarkeit geweint. Aber mittlerweile glotzten sie nur noch.
Bryce machte denen, die mit ihr sprechen wollten, mit ihr sprechen mussten, keinen Vorwurf. Die Stadt war geheilt worden … durch sie … aber ihre Bewohner …
Unzählige waren bereits tot gewesen, als ihr Erstlicht durch ganz Lunathion strahlte. Hunt hatte Glück gehabt, denn in dem Moment, als er seinen letzten Atemzug tat, hatte das Erstlicht ihn gerettet. Fünftausend andere hatten nicht dieses Glück gehabt. Und auch deren Familien nicht.
So viele dunkle Boote waren über den Istros in den Nebel des Bone Quarter getrieben, dass sie wie eine Schar schwarzer Schwäne ausgesehen hatten. Hunt hatte Bryce in den Himmel hinaufgetragen, damit sie es sehen konnte. Die Klagerufe der vielen Trauernden entlang des Flusses waren bis in die tief hängenden Wolken gedrungen, durch die Hunt und sie segelten. Hunt hatte sie nur noch fester umschlungen und war dann mit ihr nach Hause geflogen.
»Machen Sie ruhig ein Foto«, rief Ember Quinlan jetzt den Gestaltwandlern zu. Sie stand neben einem Marmortorso der Meeresgöttin Ogenas, die mit vollen, spitzen Brüsten und erhobenen Armen aus den Wellen aufstieg. »Nur zehn Goldmark. Fünfzehn, wenn Sie auch drauf sein wollen.«
»Verdammt, Mom«, murmelte Bryce. Ember hatte die Hände in die Hüften gestemmt und sah in ihrem grauen Seidenkleid mit passendem Paschminaschal fantastisch aus. »Bitte lass das.«
Ember öffnete den Mund, als wollte sie dem eingeschüchterten Paar, das jetzt zum östlichen Aufgang hastete, noch ein paar weitere Worte mit auf den Weg geben. Doch ihr Mann unterbrach sie. »Bryce hat recht«, sagte Randall, der in seinem Marineanzug blendend wirkte.
Ember richtete ihre dunklen Augen empört auf Bryce’ Stiefvater – ihren einzigen Vater, was Bryce betraf –, aber Randall deutete beiläufig auf einen breiten Fries hinter ihnen. »Der da erinnert mich an Athalar.«
Bryce zog eine Augenbraue hoch, dankbar für den Themenwechsel, und drehte sich in die Richtung, in die er zeigte. Auf dem Fries war ein kräftiger Fae abgebildet, der über einen Amboss gebeugt stand, den erhobenen Hammer in einer Faust. Blitze fuhren vom Himmel herab in den Hammer und das Objekt, dem sein Schlag galt: ein Schwert. Auf der Plakette stand nur: Unbekannter Bildhauer. Palmira, ca. 125 W. E.
Bryce hob ihr Handy, machte ein Foto und rief die Nachrichten an Hunt Athalar, ein besserer Sonnenballspieler als ich auf. Was sie wirklich nicht abstreiten konnte. Letzte Woche waren sie an einem sonnigen Nachmittag zum Sonnenballplatz gegangen, und Hunt hatte sie beim Spielen wirklich alt aussehen lassen und auf dem Nachhauseweg dann seinen Namen in ihrem Telefon geändert.
Mit einem Wischen ihres Daumens schwirrte das Foto in den Äther, zusammen mit der Frage: Ein verschollener Verwandter von dir?
Sie ließ das Handy wieder in ihre Clutch gleiten und bemerkte, dass ihre Mutter sie beobachtete. »Was denn?«, murrte Bryce.
Aber Ember zeigte nur auf den Fries. »Wer ist hier abgebildet?«
Bryce las den Schriftzug in der unteren rechten Ecke. »Hier steht nur: Die Entstehung des Schwerts.«
Ihre Mutter schaute auf die halb verblasste Radierung. »In welcher Sprache?«
Bryce versuchte, entspannt zu bleiben. »In der Alten Sprache der Fae.«
»Ah.« Ember schürzte die Lippen, und Randall machte sich klugerweise durch die Menge davon, um eine hoch aufragende Statue der Luna zu betrachten, die ihren Bogen in den Himmel richtete, zu ihren Füßen zwei Jagdhunde und an ihrer Hüfte ein Hirsch. »Du sprichst diese Sprache noch immer fließend?«
»Ja«, antwortete Bryce und fügte dann hinzu: »Hat sich als praktisch erwiesen.«
»Das kann ich mir vorstellen.« Ember schob sich eine schwarze Haarsträhne hinters Ohr.
Bryce schlenderte zum nächsten Fries, der an fast unsichtbaren Drähten von der hohen Decke herabhing. »In diesem hier geht es um die Ersten Kriege.« Sie studierte das Relief, das in die drei Meter breite Marmorplatte gemeißelt war. »Es zeigt …« Angestrengt bemühte sie sich um einen möglichst neutralen Gesichtsausdruck.
»Was?« Ember trat näher an die Darstellung einer Armee geflügelter Dämonen heran, die vom Himmel auf eine terrestrische Armee in der Ebene herabstieß.
»… die Höllenarmeen, die während der Ersten Kriege aufgetaucht sind, um Midgard zu erobern«, fuhr Bryce in betont nüchternem Tonfall fort. Um das Aufblitzen von Krallen, Fangzähnen und ledernen Schwingen auszublenden – den Knall ihres Gewehrs, der durch ihre Knochen hallte, die Ströme von Blut in den Straßen, die unaufhörlichen Schreie …
»Man sollte meinen, dass sich dieses Werk heutzutage großer Beliebtheit erfreut«, bemerkte Randall, als er neben sie trat und den Fries betrachtete.
Bryce schwieg. Sie fühlte sich nicht besonders wohl bei dem Gedanken, mit ihren Eltern über die Ereignisse des vergangenen Frühjahrs zu sprechen. Schon gar nicht mitten in einem überfüllten Theaterfoyer.
Randall deutete mit dem Kinn auf die Inschrift. »Was steht da?«
Bryce wusste genau, dass ihre Mutter jedes Blinzeln registrierte, und überflog scheinbar unbeeindruckt den Text in der Alten Sprache der Fae.
Es lag nicht daran, dass sie ihnen verschweigen wollte, was sie durchgemacht hatte. Sie hatte mit ihren Eltern schon einige Male darüber geredet. Aber das Ganze hatte immer damit geendet, dass Ember weinte oder auf die Wanen schimpfte, die so viele Unschuldige ausgesperrt hatten. Und der Druck all der mütterlichen Emotionen, zusätzlich zu ihren eigenen …
Bryce hatte eingesehen, dass es einfacher war, gar nicht erst davon anzufangen, sondern lieber mit Hunt darüber zu sprechen oder ihre Gefühle zweimal wöchentlich im Tanzunterricht bei Madame Kyrah auszuschwitzen. Kleine Schritte als Vorbereitung auf eine richtige Gesprächstherapie, wie Juniper immer wieder vorschlug. Aber beides half wirklich ungemein.
Stumm übersetzte Bryce den Text in ihrem Kopf. »Das hier stammt aus einem größeren zusammenhängenden Werk, das sich vermutlich über die gesamte Fassade eines Hauses gezogen hat. Jede Platte erzählt einen anderen Teil der Geschichte. Auf dieser hier steht: Und so schauten die sieben Höllenfürsten voller Neid auf Midgard und ließen ihre unheiligen Horden auf unsere vereinten Armeen los.«
»Es hat sich in fünfzehntausend Jahren offenbar nichts geändert«, sagte Ember, und Schatten verdunkelten ihre Augen.
Bryce blieb stumm. Sie hatte ihrer Mutter nicht von Prinz Aidas erzählt – dass er ihr inzwischen schon zweimal geholfen und von den finsteren Plänen seiner Brüder wohl nichts geahnt hatte. Wenn Ember wüsste, dass sie mit dem fünften Höllenfürsten verkehrte, würde man den Begriff ausrasten vollkommen neu definieren müssen.
Aber dann fragte Ember: »Könntest du nicht hier einen Job bekommen?« Sie deutete mit einer sonnengebräunten Hand auf das prächtige Foyer des Crescent City Ballet, in dem stets wechselnde Kunstausstellungen stattfanden, und auf die anderen Geschosse. »Du hast doch die richtige Qualifikation. Es wäre perfekt.«
»Es gibt aber keine freien Stellen.« Was stimmte. Und sie wollte ihren Status als Prinzessin nicht ausnutzen, um an eine heranzukommen. In einer Institution wie der Kunstabteilung des City Crescent Ballet wollte sie lieber aufgrund ihrer eigenen Verdienste arbeiten.
Ihr Job im Fae-Archiv … Tja, den hatte sie eindeutig deshalb bekommen, weil sie eine Fae-Prinzessin war. Aber irgendwie war es nicht dasselbe. Weil sie auf die dortige Stelle nicht so scharf gewesen war wie auf eine Anstellung hier.
»Hast du es überhaupt versucht?«
»Mom«, sagte Bryce in schärferem Ton.
»Bryce.«
»Ladys«, sagte Randall. Eine neckende Bemerkung, um die angespannte Situation aufzulockern.
Bryce schenkte ihm ein dankbares Lächeln, aber ihre Mutter runzelte die Stirn. Seufzend schaute sie hinauf zu den Kristallleuchtern über der glitzernden Menge. »Also gut, Mom. Raus damit.«
»Womit?«, fragte Ember mit Unschuldsmiene.
»Mit deiner Meinung über meinen Job.« Bryce biss die Zähne zusammen. »Jahrelang hast du mich gehänselt, weil ich nur Assistentin war, aber jetzt, da ich was Besseres bin, ist es noch immer nicht gut genug?«
Das Foyer mit den vielen Leuten war definitiv nicht der richtige Ort für dieses Thema, aber sie hatte die Nase voll.
Ember schien das jedoch nicht zu kümmern. »Es geht nicht darum, dass dein Job nicht gut genug ist, sondern darum, wo du einen Job hast.«
»Das Fae-Archiv arbeitet unabhängig von ihm.«
»Ach, wirklich? Ich erinnere mich, dass er damit geprahlt hat, das Archiv sei so etwas wie seine persönliche Bibliothek.«
»Mom«, sagte Bryce genervt. »Die Galerie ist Geschichte. Ich brauche einen Job. Tut mir leid, wenn ich im Moment keinen geregelten Achtstundenjob finden kann. Oder die Kunstabteilung des City Crescent Ballet zurzeit niemanden neu anstellt.«
»Ich verstehe einfach nicht, warum du dich nicht irgendwie mit Jesiba einigen konntest. Sie hat doch noch immer dieses Lager und braucht dort bestimmt Hilfe.«
Bryce verzichtete darauf, die Augen zu verdrehen. Innerhalb eines Tages nach dem Angriff auf die Stadt hatte Jesiba die Galerie ausgeräumt – auch die kostbaren, noch verbliebenen Bände aus der Großen Bibliothek von Parthos. Die meisten anderen Artefakte aus ihrem Bestand waren jetzt in einem Lager untergebracht, viele in Kisten. Aber Bryce hatte keine Ahnung, wo die Zauberin die alten Parthos-Bücher versteckt hatte – eines der wenigen Überbleibsel aus der menschlichen Welt vor der Ankunft der Asteri. Bryce hatte es nicht gewagt, Jesiba danach zu fragen. Es war ein Wunder, dass die Asteri keinen Hinweis auf die Existenz der geschmuggelten Bücher bekommen hatten. »Wenn ich da ständig nach einem Job frage, sieht es irgendwann so aus, als würde ich betteln.«
»Und das kann man einer Prinzessin ja nicht zumuten.«
Bryce wusste nicht mehr, wie oft sie ihrer Mutter schon gesagt hatte, dass sie keine Prinzessin war. Sie wollte keine sein, und das Gleiche galt todsicher für den Herbstkönig. Seit seinem Besuch in der Galerie, kurz vor der Konfrontation mit Micah, hatte sie mit dem Arschloch nicht mehr gesprochen. Damals, als sie ihm gezeigt hatte, welche Kraft durch ihre Adern floss.
Sie musste sich zurückhalten, um nicht an sich herabzuschauen … in den tiefen Ausschnitt ihres hauchdünnen, hellblauen Kleids, wo zwischen ihren Brüsten das sternförmige Mal prangte. Hinten war das Kleid glücklicherweise hoch genug geschlossen, um das auf ihren Rücken tätowierte Horn zu verbergen. Wie eine alte Narbe hob sich die weiße Zeichnung deutlich von ihrer sommersprossigen, goldbraunen Haut ab. Seit dem Angriff auf die Stadt vor drei Monaten war sie kein bisschen verblasst. Sie wusste nicht, wie oft ihre Mutter seit ihrer Ankunft am Abend zuvor auf ihren Stern gestarrt hatte.
Eine Gruppe wunderschöner Frauen – Waldnymphen, dem Zedern- und Moosduft nach zu urteilen – schlenderte mit Champagnergläsern in der Hand vorbei, und Bryce senkte die Stimme. »Was erwartest du von mir? Dass ich wieder nach Nidaros ziehe und so tue, als wäre ich normal?«
»Was ist so schlecht daran, normal zu sein?« Das schöne Gesicht ihrer Mutter war von einem inneren Feuer erleuchtet, das niemals erlosch. »Ich glaube, Hunt würde es gefallen, dort zu leben.«
»Hunt arbeitet noch immer für die 33. Reichslegion, Mom«, erwiderte Bryce. »Er ist dort Erster Offizier, verdammt noch mal. Und wenn er noch so oft behauptet, dass er ja so gern in Nidaros leben würde, täusch dich nicht: Das ist alles andere als ernst gemeint.«
»So wirft man jemanden den Wölfen zum Fraß vor«, bemerkte Randall, der interessiert eine Informationstafel in der Nähe studierte.
Bevor Bryce antworten konnte, konterte Ember: »Glaub nicht, ich hätte nicht bemerkt, dass es zwischen euch beiden irgendwie nicht stimmt.«
Es war immer Verlass darauf, dass ihre Mutter innerhalb von fünf Minuten zwei Themen anschnitt, über die sie nicht reden wollte. »Wie meinst du das?«
»Ihr seid zusammen, aber nicht zusammen«, sagte Ember unverblümt. »Was hat es damit auf sich?«