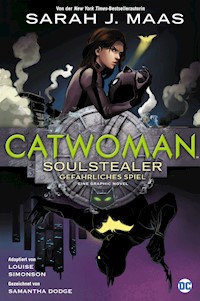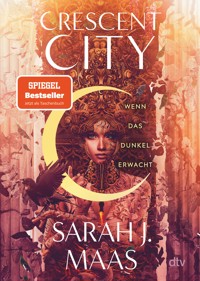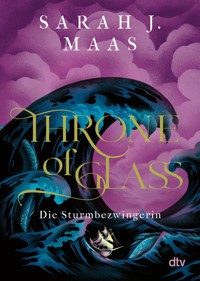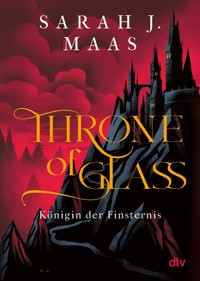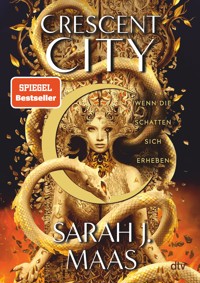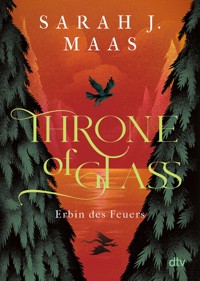11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Throne of Glass-Reihe
- Sprache: Deutsch
Das furiose Finale der erfolgreichen Fantasy-Saga Aelin alias Celaena wird von der Dunklen Königin gefangen gehalten. Eingesperrt in einem Käfig an einem geheimen Ort scheint eine Flucht unmöglich zu sein. Während Prinz Rowan die halbe Welt nach seiner verlorenen Liebe absucht, versuchen Aedion und Gestaltenwandlerin Lysandra, ihre Heimat – nun ohne die Macht und den Schutz ihrer Königin – mit allen Mitteln zu verteidigen. Alte Bündnisse werden gebrochen, neue geschmiedet und gestärkt. Alles läuft auf die letzte große Schlacht hinaus, die Aelin Feuerherz und ihre Gefährten für sich entscheiden müssen, um Erilea vor der Herrschaft der Dämonen zu bewahren. Kennen Sie bereits die weiteren Serien von Sarah J. Maas bei dtv? »Das Reich der sieben Höfe« »Crescent City«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1485
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über das Buch
Eine Sklavin, die jeder verachtete. Ein Champion, an den niemand glaubte. Eine Assssinin, die alle fürchteten.
Aelin alias Celaena hat für ihre Freunde und ihr Volk alles riskiert ‒ und zahlt dafür einen hohen Preis: Eingesperrt in einen eisernen Sarg muss sie Dunkelheit und Folter ertragen, gegen die ihr Feuer machtlos ist. Doch ihr Wille ist mächtiger als je zuvor. Ihr Wille, mit ihrem Gefährten vereint zu sein. Ihr Wille, als Königin nach Hause zurückzukehren. Ihr Wille, diesen letzten Krieg für Erilea zu gewinnen.
LANG ERSEHNT ‒ DAS EPISCHE FINALE!
Von Sarah J. Maas ist bei dtv lieferbar:
›Throne of Glass‹-Reihe
Prequel: Throne of Glass – Celaenas Geschichte
Band 1: Throne of Glass – Die Erwählte
Band 2: Throne of Glass – Kriegerin im Schatten
Band 3: Throne of Glass – Erbin des Feuers
Band 4: Throne of Glass – Königin der Finsternis
Band 5: Throne of Glass – Die Sturmbezwingerin
Band 6: Throne of Glass – Der verwundete Krieger
Band 7: Throne of Glass – Herrscherin über Asche und Zorn
Das große Throne of Glass-Fanbuch
›Das Reich der sieben Höfe‹-Reihe
Band 1: Das Reich der sieben Höfe – Dornen und Rosen
Band 2: Das Reich der sieben Höfe – Flammen und Finsternis
Band 3: Das Reich der sieben Höfe – Sterne und Schwerter
Band 4: Das Reich der sieben Höfe – Frost und Mondlicht
Band 5: Das Reich der sieben Höfe – Silbernes Feuer
Band 6: Das große Reich der sieben Höfe-Fanbuch
›Crescent City‹-Reihe
Band 1: Crescent City – Wenn das Dunkel erwacht
Band 2: Crescent City – Wenn ein Stern erstrahlt
Band 3: Crescent City – Wenn die Schatten sich erheben
Catwoman – Diebin von Gotham City
Sarah J. Maas
Throne of Glass
Herrscherin über Asche und Zorn
Band 7
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Michaela Link
Für meine Eltern –
die mich gelehrt haben zu glauben,
dass Mädchen die Welt retten können
Liebe Leserin, lieber Leser,
als ich mit dem Schreiben von ›Throne of Glass‹ anfing, war ich sechzehn Jahre alt und damit etwa im gleichen Alter wie meine Hauptfigur, Celaena Sardothien. Zu Beginn des Buches befindet Celaena sich an einem Tiefpunkt ihres Lebens (um es vorsichtig auszudrücken).
Tief in ihrem Inneren weiß sie, wozu sie fähig sein könnte und welche wundervolle Zukunft sie erwarten könnte. Sie hat Pläne (sie hat immer einen Plan, auch wenn sie ihn im Zweifelsfall gerade geheim hält). Aber es fällt ihr schwer, Hoffnung zu schöpfen.
Meine Hoffnung war es damals, ›Throne of Glass‹ eines Tages in Buchhandlungen zu sehen. Ich war bereit, so hart wie nur möglich dafür zu arbeiten, egal wie viele schlaflose Nächte oder Tränen es mich kosten würde. Aber selbst in meinen kühnsten Träumen hätte ich mir nicht vorstellen können, was seitdem alles geschehen ist. ›Throne of Glass‹ und den darauffolgenden Büchern habe ich es zu verdanken, dass ich die Welt bereisen und so viele großartige Menschen kennenlernen durfte. Ich habe dabei unglaublich viel über mich selbst als Autorin und als Mensch gelernt.
Es gab eine Zeit, da erschien es mir vollkommen unmöglich, meine Geschichten in die Welt hinauszutragen. Aber ihr, meine Leserinnen und Leser, habt es möglich gemacht. Ich hoffe, dass ihr alle, jede und jeder Einzelne von euch, die Gelegenheit bekommt, eure eigenen kühnsten Träume zu leben. Ich weiß, dass ihr es schaffen könnt. Ihr könnt die Sterne ins Wanken bringen, wenn ihr nur den Mut dazu habt.
Alles Liebe
Der Prinz
Er suchte nach ihr, seit man sie ihm geraubt hatte.
Seine Gefährtin.
Er erinnerte sich kaum an seinen eigenen Namen. Kannte ihn nur noch, weil seine drei Kameraden ihn benutzten, während sie auf stürmischen, dunklen Meeren nach ihr fahndeten, in uralten, schlummernden Wäldern und auf sturmgepeitschten Bergen, die schon jetzt unter Schnee begraben lagen.
Er machte lang genug Rast, um seinen Körper zu nähren und seinen Kameraden einige Stunden Schlaf zu gewähren. Ohne sie wäre er davongeflogen, hätte weite Strecken in der Luft zurückgelegt.
Doch er würde die Kraft ihrer Klingen und ihrer Magie brauchen, würde ihre Schläue und Weisheit benötigen, ehe dies zu Ende war.
Ehe er der Dunklen Königin gegenübertrat, die ihm sein Inneres zerrissen hatte, indem sie ihm seine Gefährtin stahl, lange bevor sie in einem eisernen Sarg eingesperrt worden war. Und wenn er dann mit ihr fertig war, würde er es mit den kaltblütigen Göttern selbst aufnehmen, die davon besessen waren zu vernichten, was von seiner Gefährtin vielleicht noch übrig war.
Also blieb er bei seinen Kameraden, obwohl Tage verstrichen. Dann Wochen.
Dann Monate.
Und immer noch suchte er. Immer noch jagte er hinter ihr her auf jeder noch so staubigen und vergessenen Straße.
Und manchmal sprach er über den Bund zwischen ihnen und sandte seine Seele auf dem Wind an den Ort – wo immer der war –, an dem sie gefangen gehalten wurde, eingeschlossen in einen Sarg.
Ich werde dich finden.
Die Prinzessin
Das Eisen erdrückte sie. Es hatte das Feuer in ihren Adern erstickt, so gründlich, als hätte jemand die Flammen mit Wasser gelöscht.
Selbst in dem eisernen Kasten konnte sie das Wasser draußen hören, selbst mit der eisernen Maske und den Ketten, die sie umschlangen wie Seidenbänder. Das Brüllen, das endlose Rauschen von Wasser über Stein. Es füllte die Pausen zwischen ihren Schreien.
Eine winzige Insel inmitten eines nebelverhangenen Flusses, kaum mehr als ein glatter Felsbrocken zwischen Stromschnellen und Wasserfällen. Dort hatte man sie untergebracht. Gelagert. In einem steinernen Tempel, der für irgendeinen vergessenen Gott erbaut worden war.
Man würde wahrscheinlich auch sie vergessen. Das war besser als die Alternative: dass man sich ihrer wegen ihres absoluten Versagens erinnerte. Falls jemand übrig blieb, der sich an sie erinnerte. Falls überhaupt irgendjemand übrig blieb.
Sie würde es nicht zulassen. Würde nicht versagen.
Sie würde ihnen nicht sagen, was sie wissen wollten.
Ganz gleich, wie oft ihre Schreie den tosenden Fluss übertönten. Ganz gleich, wie oft das Krachen ihrer brechenden Knochen das Brüllen der Stromschnellen durchschnitt.
Sie hatte versucht, die Tage zu zählen.
Doch sie wusste nicht, wie lange man sie schon in diesem eisernen Kasten einsperrte. Wie lange man sie gezwungen hatte zu schlafen, mithilfe des süßen Rauchs, den man während der Reise hierher in den Kasten hatte strömen lassen, um sie in Vergessen zu lullen. Auf der Reise zu dieser Insel, zu diesem Tempel des Schmerzes.
Sie wusste nicht, wie lange die Pausen zwischen Schreien und Erwachen dauerten. Zwischen dem Ende der Schmerzen und ihrem erneuten Beginn.
Tage, Monate, Jahre – sie flossen ineinander wie Blut, wie ihr eigenes Blut, das oft über den steinernen Boden in den Fluss rann.
Eine Prinzessin, die tausend Jahre leben sollte. Länger.
Es war ihr Geschenk. Und jetzt ihr Fluch.
Ein weiterer Fluch, so schwer wie der, der ihr lange vor ihrer Geburt auferlegt worden war. Sich selbst zu opfern, um ein altes Unrecht wiedergutzumachen. Um eine fremde Schuld den Göttern gegenüber zu begleichen, die ihre Welt entdeckt hatten und dann darin gefangen worden waren. Die seither über ihre Welt herrschten.
Sie spürte die warme Hand der Göttin nicht, die sie mit solch schrecklicher Macht gesegnet und verflucht hatte. Sie fragte sich, ob diese Göttin des Lichts und der Flamme sich überhaupt darum scherte, dass sie jetzt gefangen in diesem eisernen Kasten lag – oder ob die Unsterbliche ihr Interesse jetzt jemand anderem schenkte. Dem König, der sich vielleicht an ihrer statt anbieten und sein Leben geben würde, damit ihre Welt verschont würde.
Den Göttern war es gleich, wer die Schuld beglich. Daher wusste sie, dass sie nicht zu ihr kommen würden, sie nicht retten würden. Also machte sie sich nicht die Mühe, zu ihnen zu beten.
Sie erzählte sich selbst Geschichten, malte sich manchmal aus, dass der Fluss sie ihr vorsang. Dass die Dunkelheit, die in dem versiegelten Sarg herrschte, ihr ebenfalls eine Geschichte vorsang.
Es war einmal, in einem Land, das längst zu Asche verbrannt ist, eine junge Prinzessin, die ihr Königreich liebte …
Und dann driftete sie davon, tief hinein in die Dunkelheit, in das Meer aus Flammen. So tief, dass sie es manchmal nicht spürte, wenn die Peitsche knallte, wenn Knochen brachen.
Doch meistens spürte sie es.
In diesen endlosen Stunden richtete sie den Blick auf ihren Gefährten.
Nicht auf den Jäger der Königin, der Schmerz in die Länge ziehen konnte, so wie ein Musiker einem Instrument eine Melodie abschmeichelte. Sondern auf den riesigen, weißen Wolf, der mit unsichtbaren Ketten gebunden war. Gezwungen, dies mit anzusehen.
Es gab Tage, an denen sie es nicht ertrug, den Wolf anzusehen. An denen sie kurz davor war zu zerbrechen, zu kurz davor. Und nur die Geschichte bewahrte sie davor.
Es war einmal, in einem Land, das längst zu Asche verbrannt ist, eine junge Prinzessin, die ihr Königreich liebte …
Worte, die sie zu einem Prinzen gesagt hatte. Einst – vor langer Zeit.
Einem Prinzen von Eis und Wind. Einem Prinzen, der ihr gehört hatte und sie ihm. Lange bevor ihnen der Bund zwischen ihren Seelen offenbart worden war.
Ihm fiel nun die Aufgabe zu, das einst glorreiche Königreich zu beschützen.
Der Prinz, der nach Kiefern und Schnee roch, dem Duft jenes Königreichs, das sie mit ihrem Herz aus Wildfeuer geliebt hatte.
Auch wenn die Dunkle Königin diese Zuwendungen des Jägers anleitete, dachte die Prinzessin an ihn. Klammerte sich an die Erinnerung an ihn, als wäre sie ein Fels in einem tobenden Fluss.
Die Dunkle Königin mit dem Spinnenlächeln versuchte, das gegen sie zu verwenden. In den obsidianschwarzen Netzen mit Illusionen und Träumen, die sie wob, wenn die Prinzessin kurz davor war, aufzugeben, versuchte die Königin, die Erinnerung an ihn zu drehen, sie wie einen Schlüssel zu ihrem Geist zu nutzen.
Alles verschwamm. Die Lügen und Wahrheiten und Erinnerungen. Schlaf und die Schwärze in dem eisernen Sarg. Die Tage, die sie an den Steintisch in der Mitte des Raums gefesselt war oder von einem Haken an der Decke hing oder zwischen zwei in den Steinmauern verankerten Ketten gespannt war. Das alles verschwamm ineinander wie Tinte in Wasser.
Also erzählte sie sich die Geschichte. Die Dunkelheit und die Flamme tief in ihr wisperten sie ebenfalls und sie sang sie ihnen immer wieder vor. Eingeschlossen in diesem Sarg, versteckt auf einer Insel inmitten eines Flusses, erzählte sich die Prinzessin die Geschichte wieder und immer wieder und ließ zu, dass sie unendlichen Schmerz in ihrem Körper entfesselten.
Es war einmal, in einem Land, das längst zu Asche verbrannt ist, eine junge Prinzessin, die ihr Königreich liebte …
IArmeen und Verbündete
1
Die Schneefälle hatten früh eingesetzt.
Und auch die ersten Herbststürme waren für Terrasen ungewöhnlich früh herangefegt.
Aedion Ashryver war sich nicht sicher, ob das ein Segen war. Hielt es aber Moraths Legionen nur etwas länger von ihrer Türschwelle fern, würde er auf die Knie fallen, um den Göttern zu danken. Auch wenn diese Götter alles bedrohten, was er liebte. Falls man Wesen aus einer anderen Welt überhaupt als Götter ansehen konnte.
Aedion hatte ohnehin wichtigere Dinge zu überdenken.
Seit zwei Wochen war er mit seiner Bane wiedervereint, und seither hatten sie keine Spur von Erawans Streitkräften entdeckt, weder am Boden noch in der Luft. Der dichte Schneefall hatte kaum drei Tage nach seiner Rückkehr eingesetzt und den ohnehin schon langsamen Transport der Truppen von ihrer versammelten Armada zu dem ausgedehnten Lager der Bane auf der Ebene von Theralis behindert.
Die Schiffe waren die Florine hinaufgesegelt bis nach Orynth, und Banner in allen Farben hatten im frischen Wind geflattert, der von den Staghorns kam: Kobaltblau und Gold für Wendlyn, Schwarz und Dunkelrot für Ansel von Briarcliff, das schimmernde Silber des Königsgeschlechts von Whitethorn mit den vielen Cousins und Cousinen. Die Schweigenden Assassinen, die über die ganze Flotte verteilt waren, besaßen kein Banner, und es war auch keines vonnöten – sie erkannte man an ihren bleichen Gewändern und den wunderschönen, tödlichen Waffen.
Die Schiffe sollten sich schon bald wieder der Nachhut anschließen, die in der Mündung der Florine zurückgeblieben war, und dann die Küste von Ilium bis Suria überwachen, aber die Fußsoldaten – von denen die meisten zu den Streitkräften des Kronprinzen Galan Ashryver gehörten – würden an die Front ziehen. Eine Front, die jetzt metertief unter Schnee begraben lag. Und noch mehr Schnee würde kommen.
Verborgen über einem schmalen Bergpass in den Staghorns hinter Allsbrook stand Aedion und schaute finster zu dem schweren Himmel empor.
In seinen hellen Pelzen verschmolz er mit dem grauweißen Felsvorsprung. Eine Kapuze verbarg sein goldenes Haar und hielt ihn warm. Viele von Galans Soldaten hatten noch nie Schnee gesehen, dank des gemäßigten Klimas in Wendlyn. Die Edelleute von Whitethorn und ihre kleine Streitmacht waren kaum besser dran. Also trug Aedion seinem vertrauenswürdigsten Kommandanten, Kyllian, auf, dafür zu sorgen, dass sie es so warm hatten, wie es sich irgend einrichten ließ.
Sie waren weit fort von zu Hause und kämpften für eine Königin, die sie nicht kannten oder an die sie vielleicht nicht einmal glaubten. Die eisige Kälte würde die Moral schneller untergraben und Unzufriedenheit schüren, als der heulende Wind zwischen diesen Gipfeln hindurchpeitschte.
Eine Bewegung auf der anderen Seite des Passes erregte Aedions Aufmerksamkeit. Er nahm sie nur wahr, weil er wusste, wohin er blicken musste.
Sie war besser getarnt als er. Lysandra hatte jedoch auch den Vorteil, ein Fell zu tragen, das für diese Berge gemacht war.
Nicht dass er das ihr gegenüber hätte verlauten lassen. Oder auch nur in ihre Richtung geschaut hätte, als sie zu dieser Aufklärungsmission aufgebrochen waren.
Aelin, in deren Gestalt sie sich meist bewegte, hatte anscheinend etwas in Eldrys zu erledigen, und sie hatte Galan und ihren neuen Verbündeten einen Brief hinterlassen, um ihr Verschwinden zu erklären. Weshalb Lysandra sie bei dieser Angelegenheit begleiten konnte.
Seit fast zwei Monaten hielten sie diese List aufrecht, und bisher hatte niemand bemerkt, dass die Königin des Feuers keinen Funken Glut vorzuweisen hatte. Oder dass sie und die Gestaltwandlerin niemals zugleich am selben Ort erschienen. Und niemand, weder die Schweigenden Assassinen aus der Red Desert noch Galan Ashryver oder die Truppen, die Ansel von Briarcliff dem Hauptteil der Armee vorausgeschickt hatte, bemerkten die kleinen verräterischen Eigenarten, die gar nicht Aelins waren. Noch hatten sie etwas von dem Brandmal am Handgelenk der Königin gesehen, das Lysandra nicht beeinflussen konnte, ganz gleich, welche Haut sie trug.
Sie schaffte es jedoch, das Brandmal unter Handschuhen oder langen Ärmeln zu verbergen. Und wenn jemals ein Schimmer vernarbter Haut hervorlugte, konnte man das als Spuren der Fesseln entschuldigen, die von früher zurückgeblieben waren.
Sie hatte auch die unechten Narben hinzugefügt, genau dort, wo Aelin sie hatte. So wie das Lachen und das boshafte Grinsen. Den breitbeinigen Gang und das abgeklärte Gehabe.
Aedion konnte es kaum ertragen, sie anzusehen. Mit ihr zu reden. Er tat es nur, weil auch er die List aufrechterhalten musste. Vorgeben musste, dass er ihr getreuer Cousin war, ihr furchtloser Kommandant, der sie und Terrasen zum Sieg führen würde, so unwahrscheinlich der auch sein mochte.
Also spielte er seine Rolle. Eine von vielen, die er in seinem Leben übernommen hatte.
Doch sobald Lysandra ihr goldenes Haar gegen dunkle Locken eintauschte, Ashryver-Augen gegen smaragdgrüne, hörte er auf, ihre Existenz zur Kenntnis zu nehmen. An manchen Tagen spürte er den auf seine Brust tätowierten Terrasenknoten, in den die Namen seiner Königin und des noch jungen Hofes hineingewoben waren, wie ein Brandzeichen. Vor allem ihren Namen.
Er hatte Lysandra nur zu dieser Mission mitgenommen, um es leichter zu machen. Sicherer. Es standen noch mehr Leben als seins auf dem Spiel, und obwohl er diese Kundschaftermission auf eine Einheit innerhalb der Bane hätte abwälzen können, hatte er sie selbst übernommen, weil er die Beschäftigung brauchte.
Es hatte über einen Monat gedauert, mit ihren neuen Verbündeten von Eyllwe herzusegeln und Moraths Flotte um Rifthold herum auszuweichen. Dann noch zwei Wochen, um landeinwärts vorzurücken.
Sie hatten bisher wenig bis gar nicht gekämpft. Nur mit einigen herumstreifenden Banden adarlanischer Soldaten – unter denen keine Valg waren – hatten sie kurzen Prozess gemacht.
Aedion bezweifelte, dass Erawan bis zum Frühling warten würde. Bezweifelte, dass die Ruhe etwas mit dem Wetter zu tun hatte. Vor einigen Tagen hatte er das mit seinen Männern besprochen, und mit Darrow und den anderen Lords. Erawan würde wahrscheinlich bis zum tiefsten Winter warten, wenn es Terrasens Armee am schwersten hätte, in Bewegung zu bleiben, und Aedions Soldaten von Monaten im Schnee geschwächt und ihre Körper von der Kälte steif wären. Nicht einmal das Vermögen des Königs, das Aelin im Frühling für sie ergattert hatte, schuf da Abhilfe.
Ja, man konnte Nahrung, Decken und Kleidung kaufen, aber wenn die Versorgungswege unter Schnee begraben lagen, was nutzten sie dann? Alles Gold in Erilea konnte nicht verhindern, dass ihre Kräfte langsam und stetig schwanden, wenn sie Monate in einem Winterlager verbrachten und Terrasens unbarmherzigen Elementen ausgesetzt waren.
Darrow und die anderen Lords glaubten ihm nicht, dass Erawan im tiefsten Winter zuschlagen würde – glaubten auch Ren nicht, dem Lord von Allsbrook, der die gleiche Meinung vertrat. Erawan sei kein Narr, behaupteten sie. Trotz seiner Luftlegion aus Hexen konnten selbst Valg-Fußsoldaten den Schnee nicht durchqueren, wenn er drei Meter hoch lag. Sie glaubten, dass Erawan bis zum Frühling warten würde.
Doch Aedion ging keine Risiken ein. Genauso wenig wie Prinz Galan, der bei diesem Treffen geschwiegen hatte, der aber Aedion anschließend aufsuchte, um ihm seine Unterstützung zuzusichern. Sie mussten ihre Soldaten warm und gut genährt halten, mussten sie weiter trainieren lassen, damit sie bereit waren, loszumarschieren.
Diese Aufklärungsmission würde, wenn Rens Informationen sich als zutreffend erwiesen, ihrer Sache dienen.
In der Nähe ächzte eine Bogensehne kaum hörbar im Wind. Spitze und Schaft waren weiß angemalt und fast nicht zu erkennen, da der Pfeil mit tödlicher Präzision auf den Eingang vom Pass gerichtet war.
Aedion fing Ren Allsbrooks Blick auf. Der junge Lord stand zwischen den Felsen verborgen, sein Pfeil schussbereit. Eingehüllt in die gleichen grauweißen Pelze wie Aedion, einen hellen Schal vor dem Mund, war Ren kaum mehr als ein Paar dunkler Augen und die Andeutung einer Narbe, die quer durch sein Gesicht verlief.
Aedion bedeutete ihm zu warten. Dann übermittelte er der Gestaltwandlerin auf der anderen Seite des Passes den gleichen Befehl, fast ohne hinzuschauen.
Sollten ihre Feinde ruhig näher kommen.
Das Knirschen des Schnees mischte sich unter das Geräusch schwerer Atemzüge.
Schön pünktlich.
Aedion legte einen Pfeil an die Sehne seines eigenen Bogens und duckte sich auf dem Felsvorsprung tiefer.
Wie Rens Späherin berichtet hatte, als sie vor fünf Tagen in Aedions Kriegszelt gestürmt war, waren sie zu sechst.
Sie hatten sich keine Mühe gegeben, sich zu tarnen, um mit Schnee und Fels zu verschmelzen. Ihre dunklen Pelze, zottelig und seltsam, waren wie ein Leuchtsignal vor dem funkelnden Weiß der Staghorns. Doch ihr Gestank, herangetragen von einer Windböe, verriet Aedion genug.
Valg. Keine Spur eines Halsrings, kein Hinweis auf einen Ring, den ihre dicken Handschuhe verbargen. Anscheinend konnte selbst dämonenverseuchtes Ungeziefer frieren. Oder zumindest ihre sterblichen Wirte.
Die Feinde rückten weiter in den engen Pass vor. Ren hielt seinen Pfeil noch zurück.
Lasst einen am Leben, hatte Aedion befohlen, bevor sie ihre Posten eingenommen hatten.
Er hatte richtig geraten, dass sie sich diesen Pass aussuchen würden, eine halb vergessene Hintertür zu Terrasens Flachland. Gerade breit genug, dass zwei Pferde nebeneinander herlaufen konnten, war der Pass lange von erobernden Armeen und den Kaufleuten ignoriert worden, die danach trachteten, ihre Waren im Hinterland jenseits der Staghorns zu verkaufen.
Was dort draußen lebte, wer es wagte, sich jenseits einer anerkannten Grenze anzusiedeln, wusste Aedion nicht. Genauso wenig, wie er wusste, warum diese Soldaten sich so weit in die Berge wagten.
Er würde es bald herausfinden.
Der Dämonentrupp lief unter ihnen vorbei, und Aedion und Ren verlagerten ihr Gewicht, um sie im Schussfeld zu behalten.
Ein direkter Schuss in den Schädel. Er wählte sein Ziel.
Aedions Nicken war das einzige Signal, dann flog sein Pfeil.
~
Schwarzes Blut dampfte im Schnee, als der Kampf endete.
Es hatte nur wenige Minuten gedauert. Nur wenige Minuten, nachdem Rens und Aedions Pfeile ihre Ziele getroffen hatten und Lysandra von ihrem Ausguck gesprungen war, um drei weitere Valg zu zerfetzen. Und dem sechsten und einzigen überlebenden Mitglied der Truppe das Fleisch von den Waden zu reißen.
Der Dämon stöhnte, als Aedion auf ihn zuschritt, der Schnee unter den Füßen des Mannes jetzt pechschwarz, seine Beine zerfleddert. Wie die Fetzen eines Banners im Wind.
Lysandra saß neben seinem Kopf, ihr Maul schwarz verschmiert wie Ebenholz und ihre grünen Augen auf das bleiche Gesicht des Mannes gerichtet. Nadelspitze Krallen glänzten an ihren gewaltigen Pfoten.
Hinter ihnen untersuchte Ren die anderen auf Lebenszeichen. Sein Schwert hob und senkte sich, als er sie enthauptete, bevor sie in der eisigen Luft zu steif wurden, als dass man sie noch zerstückeln konnte.
»Verräterischer Abschaum«, wütete der Dämon und sah Aedion an, das schmale Gesicht hassverzerrt. Sein Gestank verstopfte Aedion die Nase, überzog seine Sinne wie ein Ölfilm.
Aedion zückte sein Messer – den langen, gemeinen Dolch, den Rowan Whitethorn ihm geschenkt hatte – und lächelte grimmig. »Dies kann schnell gehen, wenn du klug bist.«
Der Valg-Soldat spuckte auf Aedions schneeverkrustete Stiefel.
~
Allsbrook Castle stand seit über fünfhundert Jahren da, die Staghorns in seinem Rücken und den Oakwald Forest zu seinen Füßen. Aedion, der vor dem tosenden Feuer in einem der vielen übergroßen Kamine des Hauses auf und ab ging, spürte die überlieferte Geschichte der Festung auf den grauen Steinen lasten – die Jahre der Tapferkeit und des Dienstes, als diese Säle einst von Gesang erfüllt und voller Krieger waren. Doch auch die langen Jahre des Kummers, die folgten.
Ren hatte einen abgewetzten Sessel neben dem Feuer ergattert, die Unterarme auf die Oberschenkel gestützt, und starrte in die Flammen. Sie waren spät in der vergangenen Nacht eingetroffen, und selbst Aedion war von dem Marsch durch den verschneiten Oakwald Forest zu erschöpft, um sich überall herumführen zu lassen. Und nach dem, was sie an diesem Nachmittag getan hatten, bezweifelte er, dass er die Energie aufbringen würde, das jetzt nachzuholen.
Außerhalb des Feuerscheins lag der einst prächtige Saal still im Dunkeln, und über ihnen bewegten sich verblichene Wandteppiche und Wappen der Bannerherren der Familie Allsbrook in dem Luftzug, der durch die Reihe hoher Fenster an der einen Seite des Raums drang. Etliche Vögel nisteten in den Dachsparren, duckten sich gegen die tödliche Kälte zusammen, die jenseits der uralten Mauern der Festung herrschte.
Und zwischen ihnen saß ein grünäugiger Falke und lauschte auf jedes Wort.
»Wenn Erawan einen Weg nach Terrasen sucht«, bemerkte Ren schließlich, »wäre der über die Berge töricht.« Er betrachtete stirnrunzelnd die Reste ihrer Mahlzeit: ein herzhafter Hammeleintopf mit geschmortem Wurzelgemüse, heiß und würzig. »Das Land hier draußen ist gnadenlos. Er würde nur unzählige Soldaten verlieren.«
»Erawan tut nichts ohne Grund«, konterte Aedion. »Die einfachste Route nach Terrasen würde über die nördlichen Straßen durch das Ackerland führen. Jeder würde erwarten, dass er dort entlangmarschiert. Oder dass er seine Streitkräfte an der Küste zusammenzieht und von dort ausschickt.«
»Oder beides – über das Land und übers Meer.«
Aedion nickte. Erawan hatte in seinem Bestreben, jeglichen Widerstand auf diesem Kontinent im Keim zu ersticken, sein Netz weit gespannt. Das Reich Adarlan diente nicht mehr als Deckmantel: Von Eyllwe bis zu Adarlans nördlicher Grenze, von den Gestaden des Großen Meeres bis hin zu der hoch aufragenden Wand der Berge, die ihren Kontinent in zwei Hälften teilte, wuchs der Schatten des Valg-Königs mit jedem Tag. Aedion bezweifelte, dass Erawan Ruhe geben würde, bevor er ihnen allen schwarze Ringe um den Hals gelegt hatte.
Und wenn Erawan die beiden anderen Wyrdschlüssel an sich brachte, konnte er nach Belieben das Wyrdtor öffnen und Horden von Valg aus seinem eigenen Reich auf sie loslassen, vielleicht sogar Armeen aus anderen Welten versklaven und sie zur Eroberung einsetzen … Es würde unmöglich sein, ihn aufzuhalten. Weder in dieser Welt noch in irgendeiner anderen.
Alle Hoffnung, dieses schreckliche Schicksal zu verhindern, ruhte jetzt auf Dorian Havilliard und Manon Blackbeak. Aedion hatte nicht einmal ein Wispern darüber gehört, wo sie in diesen Monaten hingegangen waren, was ihnen widerfahren war. Was, wie er annahm, ein gutes Zeichen war. Ihr Überleben blieb geheim.
Aedion sagte: »Es scheint unklug von Erawan, einen Spähtrupp zu riskieren, nur um irgendwelche kleinen Bergpässe zu finden.« Er kratzte sich die mit Bartstoppeln bedeckte Wange. Sie waren gestern vor dem Morgengrauen aufgebrochen, und er hatte lieber geschlafen, als sich zu rasieren. »In strategischer Hinsicht ergibt es keinen Sinn. Die Hexen können fliegen, also hat es kaum Nutzen, Späher auszusenden, um das Terrain zu erkunden. Aber wenn diese Informationen für die Bodentruppen bestimmt wären … es würde Monate dauern, Streitkräfte durch diese engen Pässe zu bringen, ganz zu schweigen von dem Risiko, das das Wetter darstellt.«
»Der Späher hat einfach nur gelacht«, erinnerte sich Ren kopfschüttelnd, und sein schulterlanges, schwarzes Haar wippte. »Was übersehen wir hier? Was entgeht uns?« Im Feuerschein war die Narbe in seinem Gesicht noch deutlicher zu sehen. Eine Erinnerung an die Gräuel, die Ren erlitten hatte, und an die, die seine Familie nicht überlebt hatte.
»Sie könnten die Absicht verfolgen, uns im Ungewissen zu lassen. Damit wir unsere Streitkräfte neu positionieren.« Aedion stützte sich mit einer Hand am Kaminsims ab und die Wärme des Steins drang durch die Kälte seiner Haut.
Ren hatte die Bane in den Monaten von Aedions Abwesenheit bereit gemacht und eng mit Kyllian zusammengearbeitet, um sie so weit südlich von Orynth zu positionieren, wie Darrows Leine, an der sie hingen, es zuließ. Was, wie sich herausstellte, kaum weiter war als bis zu den Ausläufern am südlichsten Rand der Ebene von Theralis.
Ren hatte die Befehlsgewalt inzwischen Aedion überlassen, obwohl das Wiedersehen des Lords von Allsbrook mit Aelin frostig war. So kalt wie der Schnee, der außerhalb dieser Festung über das Land peitschte, um genau zu sein.
Lysandra hatte die Rolle gut gespielt und Aelins Schuldgefühle und Ungeduld großartig gemeistert. Und seither klug jede Situation gemieden, in der sie vielleicht über die Vergangenheit geredet hätten. Nicht dass Ren das Verlangen gezeigt hätte, in Erinnerungen an die Jahre vor Terrasens Fall zu schwelgen. Oder in denen an die Ereignisse des vergangenen Winters.
Aedion konnte nur hoffen, dass Erawan ebenfalls nicht erfuhr, dass die Feuerbringerin nicht länger in ihrer Mitte war. Was Terrasens Truppen sagen oder tun würden, wenn sie begriffen, dass Aelins Flamme sie in der Schlacht nicht beschützte, darüber wollte er gar nicht erst nachdenken.
»Es könnte auch ein echtes Manöver sein, das wir einfach durch Glück aufgedeckt haben«, überlegte Ren laut. »Also, riskieren wir es, Truppen auf die Pässe zu verlegen? Es sind bereits einige in den Staghorns hinter Orynth postiert, ebenso wie auf den nördlichen Ebenen dahinter.«
Ein kluger Zug von Ren – Darrow davon zu überzeugen, einen Teil der Bane hinter Orynth zu stationieren, sollte Erawan nach Norden segeln und von dort angreifen. Er traute dem Bastard alles zu.
»Ich will nicht, dass sich die Bane zu sehr verstreut und ausdünnt«, entgegnete Aedion, der das Feuer betrachtete. So anders, diese Flamme – so anders als Aelins Feuer. Als wäre die Flamme vor ihm ein Geist im Vergleich zu dem lebendigen Ding, das die Magie seiner Königin war. »Und wir können weiterhin keine Truppen erübrigen, weil wir zu wenige haben.«
Trotz Aelins verzweifeltem, kühnem Taktieren reichte die Anzahl der Verbündeten nicht einmal ansatzweise an die Macht Moraths heran. Und alles Gold, das sie angehäuft hatte, nützte nichts, um ihnen mehr zu erkaufen – es waren zu wenige übrig, die man überhaupt dazu hätte verleiten können, sich ihrer Sache anzuschließen.
»Aelin schien nicht allzu besorgt, als sie sich nach Eldrys davonstahl«, murmelte Ren.
Für einen Moment stand Aedion wieder auf einer Nehrung mit blutgetränktem Sand.
Ein eiserner Kasten. Maeve hatte sie ausgepeitscht und sie in einen regelrechten Sarg gesperrt. Und war davongesegelt, nur Mala wusste, wohin – in Gesellschaft eines unsterblichen Sadisten.
»Aelin«, begann Aedion und gab sich Mühe, es beiläufig klingen zu lassen, obwohl er an der Lüge zu ersticken drohte, »hat ihre eigenen Pläne, von denen sie uns erst erzählen wird, wenn die Zeit gekommen ist.«
Ren schwieg. Und obwohl die Königin, von der Ren glaubte, sie sei zurückgekehrt, eine Illusion war, fügte Aedion hinzu: »Alles, was sie tut, tut sie für Terrasen.«
Er hatte solch schreckliche Dinge zu ihr gesagt, an jenem Tag, an dem sie die Ilken besiegten. Wo sind unsere Verbündeten?, hatte er wissen wollen. Er versuchte noch immer, sich das zu verzeihen. Das alles. Er hatte nur diese eine Chance, es wiedergutzumachen, das zu tun, worum sie gebeten hatte, und ihr Königreich zu retten.
Ren blickte auf die beiden Schwerter, die er achtlos auf dem uralten Tisch abgelegt hatte. »Trotzdem ist sie gegangen.« Nicht erst vor Kurzem nach Eldrys, sondern damals vor zehn Jahren.
»Wir alle haben im vergangenen Jahrzehnt Fehler begangen.« Die Götter wussten, dass Aedion für vieles Buße tun musste.
Ren schreckte zusammen, als hätten ihn frühere Entscheidungen gezwickt.
»Ich habe ihr nie davon erzählt«, bemerkte Aedion leise, damit der Falke auf dem Dachsparren es nicht hörte. »Von der Opiumhöhle in Rifthold.«
Von der Tatsache, dass Ren die Besitzerin gekannt und die Vergnügungsstätte dieser Frau viele Male besucht hatte vor der Nacht, in der Aedion und Chaol den halb bewusstlosen Ren dort hingeschleppt hatten, um ihn vor den Männern des Königs zu verstecken.
»Du kannst ein richtiger Dreckskerl sein, weißt du das?« Rens Stimme wurde heiser.
»Ich würde das niemals gegen dich verwenden.« Aedion hielt dem zornigen, finsteren Blick des jungen Lords stand und ließ Ren seine Überlegenheit spüren. »Was ich sagen wollte, bevor du aus der Haut gefahren bist«, fügte er hinzu, als Ren den Mund wieder öffnete, »war, dass Aelin dir einen Platz an diesem Hof angeboten hat, ohne diesen Teil deiner Vergangenheit zu kennen.« Ein Muskel zuckte an Rens Kiefer. »Aber selbst wenn sie sie gekannt hätte, Ren, hätte sie dir dieses Angebot trotzdem gemacht.«
Ren musterte den Steinboden. »Es gibt keinen Hof.«
»Darrow kann das herausposaunen, so viel er will, aber ich erlaube mir, anderer Meinung zu sein.« Aedion ließ sich in den Sessel gegenüber von Ren sinken. Unterstützte Ren Aelin nun wirklich, jetzt da Elide Lochan zurückgekehrt war, und Sol und Ravi von Suria ihnen wahrscheinlich halfen, verschaffte das seiner Königin drei Stimmen zu ihren Gunsten. Gegenüber den vier Stimmen, die gegen sie waren.
Es gab nur wenig Hoffnung, dass Lysandras Stimme als Lady von Caraverre anerkannt werden würde.
Die Gestaltwandlerin hatte nicht darum gebeten, das Land sehen zu dürfen, das ihr Zuhause sein würde, falls sie diesen Krieg überlebten. Sie hatte sich auf dem Marsch hierher in einen Falken verwandelt und war davongeflogen. Bei ihrer Rückkehr hatte sie nichts gesagt, obwohl ihre grünen Augen geglänzt hatten.
Nein, Caraverre würde nicht als Territorium anerkannt werden, nicht bis Aelin ihren Thron bestieg.
Bis Lysandra an ihrer statt zur Königin gekrönt wurde, falls die echte Aelin nicht zurückkehrte. Sie würde zurückkehren. Das musste sie.
Am anderen Ende des Saals wurde eine Tür geöffnet und schnelle, leichte Schritte erklangen. Er fuhr kurz hoch, bevor ein freudiges »Aedion!« durch den Saal tönte.
Evangeline strahlte, von Kopf bis Fuß in grüne, wollene Kleider mit weißem Pelzbesatz gekleidet, ihr rotgoldenes Haar zu zwei Zöpfen geflochten. Wie die Bergmädchen von Terrasen.
Ihre Narben dehnten sich, als sie grinste, und Aedion breitete die Arme aus, damit sie sich hineinwerfen konnte. »Man hat mir gesagt, du seist gestern Nacht eingetroffen, aber du bist vor dem ersten Licht wieder aufgebrochen, und ich habe mir Sorgen gemacht, dass ich dich erneut verpassen würde …«
Aedion drückte ihr einen Kuss auf den Kopf. »Du siehst aus, als wärst du seit unserer letzten Begegnung ganze drei Handbreit gewachsen.«
Evangelines topasfarbene Augen leuchteten, als sie zwischen ihm und Ren hin- und herschaute. »Wo ist …«
Ein Blitz zuckte auf, und da war sie.
Leuchtend. Lysandra schien zu leuchten, als sie sich einen Umhang um ihren nackten Körper schlang. Das Kleidungsstück war zu genau diesem Zweck auf einem nahen Sessel abgelegt worden. Evangeline stürzte sich in die Arme der Gestaltwandlerin und schluchzte beinahe vor Freude. Ihre Schultern bebten, und Lysandra lächelte breit und streichelte dem Mädchen den Kopf. »Geht es dir gut?«
Dem Rest der Welt wäre die Gestaltwandlerin gelassen und heiter erschienen. Aber Aedion kannte sie – kannte ihre Stimmungen, die verräterischen Hinweise. Wusste, dass das leichte Zittern in ihrer Stimme ein Beweis für den tosenden Sturm unter der schönen Oberfläche war.
»Oh ja«, sagte Evangeline und trat einen Schritt zurück, um Ren anzustrahlen. »Er und Lord Murtaugh haben mich kurz darauf hierhergebracht. Fleetfoot ist übrigens bei ihm. Bei Murtaugh, meine ich. Sie mag ihn lieber als mich, weil er ihr den ganzen Tag lang heimlich Leckerbissen zusteckt. Sie ist jetzt fetter als eine träge Hauskatze.«
Lysandra lachte, und Aedion lächelte. Für das Mädchen wurde gut gesorgt.
Als hätte sie das selbst gerade begriffen, murmelte sie Ren ein Dankeschön zu, ihre Stimme ein leises Schnurren.
Rens Wangen färbten sich rot, als er sich erhob. »Ich dachte, sie wäre hier besser aufgehoben als im Kriegslager. Zumindest hat sie es hier bequemer.«
»Oh, das hier ist ein ganz wunderbarer Ort, Lysandra«, zwitscherte Evangeline und nahm Lysandras Hand in ihre beiden. »Murtaugh hat mich eines Nachmittags sogar nach Caraverre mitgenommen – bevor es zu schneien begonnen hat, meine ich. Du musst es dir ansehen. Die Hügel und Flüsse und die hübschen Bäume, bis direkt zu den Bergen. Ich dachte, ich hätte einen Geisterleoparden gesehen, der sich auf den Felsen versteckte, aber Murtaugh sagte, es sei nur Einbildung gewesen. Aber ich schwöre, da war einer – größer als deiner! Und das Haus! Es ist das schönste Haus, das ich je gesehen habe, mit einem ummauerten Garten hinten, von dem Murtaugh sagt, er werde im Sommer voller Gemüse und Rosen sein.«
Für einen Moment konnte Aedion den Ausdruck auf Lysandras Gesicht nicht ertragen, während Evangeline ihre großen Pläne für das Gut herausplapperte. Die schmerzhafte Sehnsucht nach einem Leben, das ihr wahrscheinlich entrissen würde, bevor sie überhaupt die Chance hatte, sie zu ergreifen.
Aedion wandte sich an Ren. Der Blick des Lords ruhte wie gebannt auf Lysandra. Wie immer, wenn sie ihre menschliche Gestalt annahm.
Aedion kämpfte gegen den Drang, die Zähne zusammenzubeißen, und sagte: »Du erkennst Caraverre also an.«
Evangeline fuhr mit ihrem fröhlichen Geplapper fort, aber Lysandras Blick wanderte zu ihnen.
»Darrow ist nicht Lord von Allsbrook«, war alles, was Ren entgegnete.
In der Tat. Und wer würde sich nicht eine so hübsche Nachbarin wünschen?
Solange sie nicht gerade in Orynth in der Haut und mit der Krone einer anderen lebte und Aedion benutzte, um eine gefälschte königliche Blutlinie zu zeugen. Kaum mehr als ein Zuchthengst wäre er.
Lysandra nickte abermals zum Zeichen ihres Dankes und Rens Röte vertiefte sich. Als hätten sie nicht den ganzen Tag damit verbracht, durch Schnee zu stapfen und Valg niederzumetzeln. Als würde ihnen nicht noch der Gestank des Bluts anhaften.
Tatsächlich schnupperte Evangeline gerade an dem Umhang, in den Lysandra sich gehüllt hatte, und runzelte die Stirn. »Du riechst schrecklich. Ihr alle.«
»Manieren«, tadelte Lysandra, lachte jedoch.
Evangeline stemmte die Hände in die Hüften, eine Geste, die Aedion so oft bei Aelin gesehen hatte, dass der Anblick ihn schmerzte. »Du hast mich gebeten, dir Bescheid zu sagen, solltest du jemals riechen. Vor allem dein Atem.«
Lysandra lächelte und Aedions Mundwinkel zuckten. »Das habe ich wohl getan, ja.«
Evangeline zerrte an Lysandras Hand. »Du kannst mit in meinem Zimmer schlafen. Da drin gibt es eine Badestube.« Lysandra folgte ihr einen Schritt weit durch den Saal.
»Ein schönes Zimmer für einen Gast«, murmelte Aedion Ren zu und zog die Brauen hoch. Es musste eins der schönsten Zimmer hier sein, wenn es eine eigene Badestube hatte.
Ren zog den Kopf ein. »Es hat Rose gehört.«
Seiner ältesten Schwester. Die zusammen mit Rallen, dem mittleren der Allsbrook-Geschwister, an der magischen Akademie abgeschlachtet worden war. Nahe der Grenze zu Adarlan hatte die Schule direkt in der Einfallschneise der Truppen gelegen.
Selbst bevor die Magie gebannt worden war, hätten sie kaum Verteidigungsmöglichkeiten gegen zehntausend Soldaten gehabt. Aedion gestattete sich nicht oft, an das Gemetzel von Devellin zu denken – dieser sagenumwobenen Schule. Wie viele Kinder dort gelebt hatten. Dass keins von ihnen entkommen war.
Ren hatte seinen beiden älteren Schwestern nahegestanden, aber der munteren Rose ganz besonders.
»Sie hätte sie gemocht«, erklärte Ren und deutete mit dem Kinn auf Evangeline. Vernarbt war sie, begriff Aedion, genau wie Ren es war. Den Schnitt auf seinem Gesicht hatte er sich zugezogen, als er den Schlachtbänken entkommen war. Das Leben seiner Eltern war der Preis für die Ablenkung gewesen, die ihm und Murtaugh die Flucht ermöglicht hatte. Evangelines Narben stammten von einer anderen Art der Flucht, als sie mit knapper Not dem höllischen Leben entgangen war, das ihre Herrin erduldet hatte.
Aedion gestattete sich auch nicht oft, daran zu denken.
Evangeline zog Lysandra immer noch hinter sich her, ohne etwas von dem Gespräch mitzubekommen. »Warum hast du mich bei deiner Ankunft nicht geweckt?«
Aedion hörte nicht, was Lysandra antwortete, während sie sich aus dem Saal führen ließ. Auch nicht, als die Gestaltwandlerin ihm in die Augen sah.
Sie hatte während der vergangenen zwei Monate versucht, mit ihm zu sprechen. Viele Male. Dutzende von Malen. Er hatte sie ignoriert. Und als sie endlich Terrasens Ufer erreichten, hatte sie aufgegeben.
Sie hatte ihn belogen. Hatte ihn so gründlich getäuscht, dass jeder Moment zwischen ihnen, jedes Gespräch … er wusste nicht, was davon echt gewesen war. Wollte es nicht wissen. Wollte nicht wissen, ob sie irgendetwas von alledem ernst gemeint hatte, als er sich ihr so töricht offenbart hatte.
Er hatte geglaubt, dies sei sein letzter Vorstoß. Dass er in der Lage sein würde, es langsam mit ihr anzugehen, ihr alles zu zeigen, was Terrasen zu bieten hatte. Ihr auch alles zu zeigen, was er zu bieten hatte.
Verlogenes Miststück hatte er sie genannt. Hatte ihr die Worte entgegengeschrien.
Er hatte genug Einsicht gehabt, um sich dafür zu schämen. Aber der Zorn blieb.
In Lysandras Blick trat ein fragender Ausdruck, als wollte sie sagen: Können wir nicht in diesem seltenen glücklichen Moment als Freunde miteinander reden?
Aedion wandte sich wieder dem Feuer zu und verdrängte ihre tiefgrünen Augen, ihr exquisites Gesicht.
Ren konnte sie haben. Selbst wenn er bei diesem Gedanken am liebsten etwas zerschmettern wollte.
Lysandra und Evangeline verließen den Saal und das Mädchen plapperte munter weiter.
Lysandras Enttäuschung ruhte schwer wie eine unsichtbare Hand auf ihm.
Ren räusperte sich. »Willst du mir erzählen, was zwischen euch beiden los ist?«
Aedion warf ihm einen bohrenden Blick zu, bei dem geringere Männer das Weite gesucht hätten. »Besorg eine Landkarte. Ich will noch mal die Pässe durchgehen.«
Man musste es Ren zugutehalten, dass er sich sofort auf die Suche nach einer Karte machte.
Aedion schaute ins Feuer, das ohne den magischen Funken seiner Königin so bleich war.
Wie lange würde es dauern, bis man statt des heulenden Windes draußen vor der Festung das Bellen von Erawans Bestien hörte?
~
Aedion bekam seine Antwort am nächsten Tag bei Sonnenaufgang.
Lysandra und Evangeline, die an einem Ende des langen Tischs im Hauptsaal saßen, gönnten sich ein stilles Frühstück, und am anderen Ende beherrschte Aedion das Zittern seiner Finger beim Öffnen des Briefs, den ein Bote ihm kurz zuvor übergeben hatte. Ren und Murtaugh, die bei ihm saßen, hielten sich zurück und verlangten keine Auskünfte, während er las. Einmal las. Zweimal.
Endlich legte Aedion den Brief auf den Tisch. Holte tief Luft und schaute stirnrunzelnd zu dem wässrig grauen Licht, das durch die Fenster fiel.
Vom anderen Tischende her lastete Lysandras Blick auf ihm. Doch sie blieb, wo sie war.
»Der Brief ist von Kyllian«, berichtete Aedion heiser. »Moraths Truppen haben die Küste erreicht – bei Eldrys.«
Ren fluchte. Murtaugh schwieg. Aedion blieb sitzen, da seine Beine ihn wahrscheinlich gar nicht getragen hätten. »Er hat die Stadt zerstört. Hat sie in Schutt und Asche gelegt, ohne den Einsatz einer einzigen Truppe.«
Warum der Dunkle König so lange gewartet hatte, konnte Aedion nur mutmaßen.
»Die Hexentürme?«, fragte Ren. Aedion hatte ihm alles erzählt, was Manon Blackbeak auf ihrem Weg durch die Stone Marshes offenbart hatte.
»Das steht da nicht.« Er bezweifelte, dass Erawan die Türme eingesetzt hatte, da sie so massiv waren, dass sie nur über Land transportiert werden konnten, und Aedions Späher hätten es mit Sicherheit bemerkt, wenn ein über dreißig Meter hoher Turm durch ihr Gebiet geschleppt worden wäre. »Aber die Explosionen haben die Stadt dem Erdboden gleichgemacht.«
»Aelin?« Murtaughs Stimme war kaum ein Flüstern.
»Es geht ihr gut«, log Aedion. »Sie machte sich am Tag zuvor auf den Rückweg zum Lager in Orynth.« Natürlich erwähnte Kyllians Brief mit keinem Wort ihren Verbleib, aber sein oberster Kommandant hatte spekuliert, dass die Königin davongekommen sein musste, da es weder eine Leiche gab noch feiernde Feinde.
Murtaugh sank auf seinem Stuhl zusammen, und Fleetfoot bettete ihren goldenen Kopf auf seinen Oberschenkel. »Mala sei Dank für diese Gnade.«
»Dank ihr nicht zu früh.« Aedion stopfte den Brief in die Tasche des dicken Mantels, den er gegen den Luftzug in der Halle trug. Dank ihr überhaupt nicht, hätte er beinahe hinzugefügt. »Auf dem Weg nach Eldrys hat Morath zehn von Wendlyns Kriegsschiffen in der Nähe von Ilium zerstört und den Rest in die Flucht geschlagen, zurück die Florine hinauf, zusammen mit unseren eigenen Schiffen.«
Murtaugh rieb sich das Kinn. »Warum sind sie ihnen nicht nachgejagt – ihnen den Fluss hinaufgefolgt?«
»Wer weiß?« Aedion würde später darüber nachdenken. »Erawan hatte ein Auge auf Eldrys geworfen, und nun hat er die Stadt eingenommen. Er scheint einige seiner Truppen von dort ausschicken zu wollen. Wenn man sie nicht daran hindert, werden sie binnen einer Woche Orynth erreichen.«
»Wir müssen ins Lager zurückkehren«, sagte Ren düster. »Schauen, ob wir unsere Flotte wieder die Florine hinunterbekommen können, um mit Rolfe vom Meer aus anzugreifen. Während wir gleichzeitig an Land zuschlagen.«
Aedion war nicht danach zumute, ihnen ins Gedächtnis zu rufen, dass sie von Rolfe nichts gehört hatten – abgesehen von vagen Nachrichten über seine Jagd nach den versprengten Mykinern und ihrer legendären Flotte. Die Chancen, dass Rolfe auftauchte, um ihnen die Haut zu retten, waren so gering wie die Hoffnung, dass der sagenumwobene Wolfsstamm am anderen Ende der Anascaul Mountains aus dem Hinterland herbeireiten würde. Oder dass die Fae von irgendwoher zurückkehren würden, um sich nun Aedions Streitkräften anzuschließen. Die Fae, die vor einem Jahrzehnt aus Terrasen geflohen waren.
Die Gelassenheit, die Aedion schon durch viele Schlachten und Gemetzel geleitet hatte, breitete sich in ihm aus, so robust wie der Pelzumhang, den er trug. Schnelligkeit würde jetzt ihr Verbündeter sein. Schnelligkeit und geistige Klarheit.
Die Kampflinien müssen gehalten werden, hatte Rowan befohlen, bevor sie getrennte Wege gegangen waren. Verschaff uns so viel Zeit, wie du nur kannst.
Er würde dieses Versprechen halten.
Evangeline verstummte, als Aedion sich an die Gestaltwandlerin hinten am Tisch wandte. »Wie viele Personen kannst du in deiner Wyvern-Gestalt tragen?«
2
Elide Lochan hatte einst gehofft, weit, weit wegzuziehen, an einen Ort, an dem noch niemand von Adarlan oder Terrasen auch nur gehört hatte, so weit weg, dass Vernon keine Chance hatte, sie zu finden.
Sie hatte nicht damit gerechnet, dass das tatsächlich passieren würde.
Als sie in der staubigen, uralten Gasse der gleichermaßen staubigen, uralten Stadt in einem Königreich südlich von Doranelle stand, staunte Elide über das mittägliche Glockengeläut, das durch die klare Luft tönte, staunte über die Sonne, die die bleichen Steine der Gebäude erhitzte, den trockenen Wind, der durch die schmalen Straßen dazwischen fegte. Sie hatte den Namen dieser Stadt inzwischen dreimal gehört, konnte ihn aber immer noch nicht aussprechen.
Es spielte wahrscheinlich keine Rolle. Sie würden nicht lange bleiben. Genauso wenig, wie sie in den anderen Städten blieben, die sie durchquerten, oder in den Wäldern und Bergen oder Niederungen. Ein Königreich nach dem anderen, das gnadenlose Tempo von einem Prinzen vorgegeben, der kaum sprach, geschweige denn ans Essen dachte.
Elide verzog das Gesicht beim Anblick der wettergegerbten Hexenledermontur, die sie noch immer trug, ihres ausgefransten, grauen Umhangs und der abgetragenen Stiefel, dann betrachtete sie ihre beiden Gefährten, die neben ihr in der Gasse standen. Sie alle hatten schon bessere Tage gesehen.
»Gleich«, murmelte Gavriel, der zur Mündung der Gasse blickte. Eine hoch aufragende, dunkle Gestalt verschmolz dort mit den Schatten unter dem halb zerfallenen Bogengang, von dem aus Lorcan die belebte Straße im Blick behielt.
Elide schaute nicht allzu lange zu ihm hinüber. Sie ertrug es während dieser endlosen Wochen kaum. Ertrug ihn kaum, oder den schrecklichen Schmerz in ihrer Brust.
Stirnrunzelnd sah Elide Gavriel an. »Wir hätten eine Pause machen sollen, um zu Mittag zu essen.«
Er deutete mit dem Kinn auf den abgenutzten Beutel, der an der Mauer lag. »In meinem Bündel ist noch ein Apfel.«
Elide sah zu dem Gebäude hoch, vor dem sie standen, seufzte und griff nach dem Bündel, um zwischen den Ersatzkleidern, Seilen, Waffen und verschiedenen Vorräten zu wühlen, bis sie einen großen, rotgrünen Apfel fand. Den letzten von denen, die sie in einem Obstgarten in einem benachbarten Königreich gepflückt hatten. Elide hielt ihn dem Fae-Lord wortlos hin.
Gavriel hob eine goldene Braue.
Elide erwiderte die Geste. »Ich höre deinen Magen knurren.«
Gavriel schnaubte amüsiert, nahm den Apfel mit einem leichten Nicken entgegen und rieb ihn am Ärmel seiner blassen Jacke sauber. »Das tut er in der Tat.«
Elide hätte schwören können, dass die dunkle Gestalt hinten in der Gasse sich versteifte. Sie beachtete den Mann nicht.
Gavriel biss in den Apfel und seine Eckzähne blitzten auf. Aedion Ashryvers Vater – die Ähnlichkeit war verblüffend, obwohl sie sich nur auf das Aussehen beschränkte. In den wenigen Tagen, die sie mit Aedion verbracht hatte, erwies er sich als das komplette Gegenteil dieses sanften, nachdenklichen Mannes.
Asterin und Vesta hatten sie an Bord des Schiffs zurückgelassen, mit dem sie hierhergesegelt waren, und seither hatte sie sich gesorgt, dass ihre Entscheidung, mit drei unsterblichen Fae zu reisen, vielleicht ein Fehler war. Dass sie von ihnen mit Füßen getreten werden würde.
Doch Gavriel war von Anfang an freundlich, hatte dafür gesorgt, dass Elide genug aß und in eisigen Nächten genug Decken bekam. Er hatte ihr beigebracht, die Pferde zu reiten, für die sie kostbares Geld ausgegeben hatten, weil Elide keine Chance gehabt hätte, zu Fuß mit ihnen Schritt zu halten, Knöchel hin oder her. Und wenn sie ihre Pferde über raues Terrain führen mussten, stärkte Gavriel ihr Bein sogar mit seiner Magie, seine Macht wie eine warme Sommerbrise auf ihrer Haut.
Lorcan würde sie nicht erlauben, so etwas für sie zu tun.
Sie würde den Anblick nie vergessen, wie er hinter Maeve hergekrochen war, als die Königin den Blutschwur gekappt hatte. Wie er hinter Maeve hergekrochen war wie ein verstoßener Liebhaber, wie ein geschundener Hund, der sich verzweifelt nach seiner Herrin sehnte. Aelin war brutal misshandelt worden, weil Lorcan Maeve ihren Aufenthaltsort verraten hatte, und dennoch hatte er versucht, Maeve zu folgen. Über den Sand, der noch feucht von Aelins Blut war.
Gavriel aß die Hälfte des Apfels und bot Elide den Rest an. »Du solltest ebenfalls etwas essen.« Sie betrachtete stirnrunzelnd die dunklen Schatten unter Gavriels Augen. Unter ihren Augen zeichneten sich zweifellos die gleichen Ringe ab. Wenigstens hatte ihr Zyklus im vergangenen Monat eingesetzt, trotz der beschwerlichen Reise, die sämtliche Nahrungsreserven in ihrem Körper verbrannt hatte.
Das war ihr besonders peinlich. Den drei Kriegern, die das Blut riechen konnten, zu erklären, dass sie Vorräte brauchte. Häufigere Pausen.
Sie hatte die Krämpfe nicht erwähnt, die sie im Rücken und im Unterleib verspürte und die ihre Oberschenkel durchzuckten. Sie war weitergeritten, den Kopf gesenkt. Sie wusste, dass sie angehalten hätten. Selbst Rowan hätte angehalten, damit sie sich ausruhen konnte. Aber wann immer sie eine Pause machten, sah Elide die eiserne Kiste vor sich. Sah die von Blut glänzende Peitsche durch die Luft sausen. Hörte Aelins Schreie.
Sie war gegangen, damit Elide nicht verschleppt wurde. Hatte nicht gezögert, sich an Elides Stelle zu ergeben.
Dieser Gedanke genügte, damit Elide auf ihrer Stute sitzen blieb. Jene paar Tage waren ihr immerhin dadurch erleichtert worden, dass Gavriel und Rowan ihr saubere Streifen Leinenstoffs gegeben hatten, zweifellos von ihren eigenen Hemden. Wann sie diese zerschnitten hatten, wusste sie nicht.
Elide biss in den Apfel und genoss die frische, knackige Süße. Rowan hatte als Bezahlung für das Obst einige Kupfermünzen aus seinem rasch schrumpfenden Vorrat auf einen Baumstumpf gelegt.
Schon bald würden sie ihre Mahlzeiten stehlen müssen. Oder ihre Pferde verkaufen.
Dumpfe Schläge erklangen hinter den fest verschlossenen Fenstern ein Stockwerk über ihnen, dazu die gedämpften Rufe eines Mannes.
»Glaubst du, wir haben diesmal mehr Glück?«, fragte Elide leise.
Gavriel betrachtete die blau gestrichenen Fensterläden, ein kunstvoll geschnitztes Gitterwerk. »Ich kann es nur hoffen.«
Das Glück war ihnen dieser Tage wirklich nicht hold. Überhaupt hatten sie seit jenem verfluchten Strand in Eyllwe wenig davon gehabt, als Rowan den Sog an dem Bund verspürte, der zwischen ihm und Aelin bestand – ihrem Bund als Seelengefährten –, und seinem Ruf über den Ozean gefolgt war. Doch als sie nach mehreren schrecklichen Wochen auf sturmwilden Gewässern dieses Ufer erreichten, war nichts mehr da, dem sie hätten folgen können.
Keine Spur von Maeves verbliebener Armada. Keine Nachricht vom Schiff der Königin, der Nachtigall, in einem der Häfen. Keine Neuigkeit über ihre Rückkehr zu ihrem Sitz in Doranelle.
Gerüchte waren alles, was sie hatten, und denen jagten sie über tief verschneite Berge hinterher, durch dichte Wälder und dürre Ebenen.
Bis zum vorherigen Königreich, der vorherigen Stadt, wo die Straßen voller Menschen waren, die zu Ehren der Götter Samhain feierten, den Tag, an dem der Schleier zwischen den Welten am dünnsten war.
Sie hatten keine Ahnung, dass diese Götter nichts anderes waren als Wesen aus einer anderen Welt. Dass die Hilfe, die die Götter versprachen, die Hilfe, die Elide von der kleinen Stimme in ihrem Ohr empfangen hatte, einem einzigen Ziel diente: nach Hause zurückzukehren. Schachfiguren – mehr waren Elide und Aelin und die anderen nicht für sie.
Dies wurde dadurch bestätigt, dass Elide seit jenem schrecklichen Tag in Eyllwe Anneiths Stimme nicht mehr gehört hatte. Nur Stupser während der langen Tage, eine Erinnerung an ihre Anwesenheit. Die Erinnerung, dass man sie beobachtete.
Die Erinnerung, dass die junge Königin immer noch den ultimativen Preis an diese Götter zahlen musste, sollten sie Erfolg bei ihrer Suche nach Aelin haben. Wenn Dorian Havilliard und Manon Blackbeak den dritten und letzten Wyrdschlüssel aufspüren konnten. Wenn der junge König sich nicht an Aelins Stelle opferte.
Also erduldete Elide diese gelegentlichen Stupser und weigerte sich, darüber nachzugrübeln, welche Kreatur sich so für sie interessierte. Für sie alle. Elide schob diese Gedanken beiseite, während sie die Straßen durchkämmten und die Ohren nach einem Gerücht zu Maeves Aufenthaltsort spitzten. Die Sonne war untergegangen, und Rowans Knurren wurde lauter mit jeder verstreichenden Stunde, in der sie nichts erfuhren. So wie sie auch in allen anderen Städten nichts erfahren hatten.
Elide hatte sie dazu gedrängt, weiter durch die Straßen zu schlendern, unbemerkt und unbeachtet. Sie hatte Rowan jedes Mal, wenn er die Zähne aufblitzen ließ, ins Gedächtnis gerufen, dass es in jedem Königreich, jedem Land Späher gab. Und wenn es sich herumsprach, dass eine Gruppe Fae-Krieger auf der Suche nach Maeve die Städte terrorisierte, würde das der Fae-Königin in kürzester Zeit zu Ohren kommen.
Die Nacht hatte sich herabgesenkt und in den goldenen Hügeln jenseits der Stadtmauern waren Lagerfeuer entzündet worden.
Rowan hatte schließlich aufgehört, bei deren Anblick zu knurren. Als hätten sie an seiner Erinnerung gerührt, an seinem Schmerz.
Dann kamen sie an einer Gruppe Fae-Soldaten vorbei, die etwas trinken wollten, und Rowan war verstummt. Hatte die Krieger auf diese kalte, berechnende Art gemustert, die Elide verriet, dass er irgendeinen Plan ausheckte.
Sie hatten sich in eine Gasse zurückgezogen und der Fae-Prinz hatte ihnen sein Vorhaben mit schroffen, erbarmungslosen Worten dargelegt.
Eine Woche später waren sie nun hier. Das Gebrüll in dem Gebäude über ihnen wurde lauter.
Elide verzog das Gesicht, als das Splittern von Holz das Läuten der Stadtglocken übertönte. »Sollten wir helfen?«
Gavriel fuhr sich mit einer tätowierten Hand durch das goldene Haar. Die Namen der Krieger, die unter sein Kommando gefallen waren, hatte er ihr erklärt, als sie letzte Woche endlich danach zu fragen gewagt hatte. »Er ist fast fertig.«
Selbst Lorcan blickte jetzt finster vor Ungeduld auf das Fenster über Elide und Gavriel.
Als das Mittagsläuten der Glocken verstummte, flogen die Fensterläden auf.
Besser gesagt, sie wurden zerschmettert, als zwei männliche Fae durch das Fenster krachten.
Einer von ihnen, braunhaarig und blutverschmiert, kreischte im Fallen.
Prinz Rowan Whitethorn blieb stumm und hielt den Mann mit gebleckten Zähnen fest.
Elide trat beiseite, als sie in den Haufen Kisten in der Gasse krachten und Splitter und Trümmer durch die Luft flogen.
Sie wusste, dass ein Windstoß verhinderte, dass der Sturz für den breitschultrigen Mann tödlich endete. Den Mann, den Rowan am Kragen seines blauen Waffenrocks aus den Trümmern zerrte.
Tot würde er ihnen nichts nutzen.
Gavriel zog ein Messer und blieb an Elides Seite, während Rowan den Fremden gegen die Mauer schmetterte. Die Miene des Prinzen zeigte keine Freundlichkeit. Keinerlei Wärme.
Er war ein kaltblütiges Raubtier. Wild entschlossen, die Königin zu finden, der sein Herz gehörte.
»Bitte«, stotterte der Mann. In ihrer Sprache.
Rowan hatte ihn also gefunden. An Samhain hatte Rowan begriffen, dass sie Maeve nicht aufspüren konnten. Die Kommandanten, die Maeve dienten und die über etliche Königreiche als Leihgaben an sterbliche Herrscher verteilt worden waren – die konnten sie jedoch aufspüren.
Und der Mann, den Rowan mit blutender Lippe anknurrte, war ein Kommandant. Ein Krieger, den breiten Schultern und den muskulösen Oberschenkeln nach zu urteilen. Rowan überragte ihn trotzdem um Haupteslänge. Gavriel und Lorcan ebenfalls. Als wären die drei selbst unter den Fae eine ganz andere Rasse.
»Es wird folgendermaßen laufen«, erklärte Rowan dem jammernden Kommandanten mit gefährlich leiser Stimme. Ein brutales Lächeln verzog den Mund des Prinzen, wodurch das Blut von seiner aufgeplatzten Lippe rann. »Zuerst breche ich dir die Beine, vielleicht auch dein Rückgrat, damit du nicht kriechen kannst.« Er deutete mit einem blutverschmierten Finger in die Gasse. Auf Lorcan. »Du weißt, wer das ist, nicht wahr?«
Lorcan trat unter dem Bogen hervor. Der Kommandant zitterte.
»Die Beine und das Rückgrat … dein Körper würde irgendwann heilen«, sprach Rowan weiter, während Lorcan immer näher heranschlich. »Aber was Lorcan Salvaterre mit dir machen wird …« Ein leises, freudloses Lachen. »Davon wirst du dich nicht erholen, Freund.«
Der Kommandant warf Elide und Gavriel verzweifelte Blicke zu.
Als so etwas zum ersten Mal passiert war – vor zwei Tagen –, hatte Elide nicht hinschauen können. Jener Kommandant hatte keine bedeutsamen Informationen besessen, und angesichts der unaussprechlichen Art von Bordell, in dem sie ihn gefunden hatten, bedauerte Elide es nicht wirklich, als Rowan seine Leiche an einem Ende der Gasse liegen ließ. Seinen Kopf am anderen.
Aber heute … Schau hin. Sieh zu, zischte ihr eine Stimme leise ins Ohr. Hör zu.
Trotz der Hitze und der Sonne schauderte Elide. Biss die Zähne zusammen und unterdrückte jedes Wort, das aus ihr herauswollte. Findet jemand anderen. Findet einen Weg, eure eigenen Kräfte zu benutzen, um das Schloss zu schmieden. Findet einen Weg, euer Schicksal anzunehmen und zu akzeptieren, dass ihr in dieser Welt gefangen seid, damit wir keine Schuld begleichen müssen, die von Anfang an nie die unsere war.
Doch wenn Anneith jetzt sprach, während sie Elide die letzten Monate immer nur angestupst hatte … Elide schluckte ihre Wut herunter. Wie man es von allen Sterblichen erwartete. Für Aelin konnte sie sich fügen. So wie Aelin sich zu guter Letzt fügen würde.
In Gavriels Gesicht zeigte sich keine Gnade, nur eine grimmige Nüchternheit, als er den zitternden Kommandanten in Rowans eisernem Griff ansah. »Sag ihm, was er wissen will. Du machst es dir sonst nur schwerer.«
Lorcan war fast bei ihnen, ein dunkler Wind wirbelte um seine langen Finger.
Von dem Mann, den sie kennengelernt hatte, war in seinem harten Gesicht jetzt nichts zu sehen. Von dem Mann, der er vor jenem Tag am Strand gewesen war. Nein, dies war die Maske, die sie das erste Mal im Oakwald Forest gesehen hatte. Gefühllos. Arrogant. Grausam.
Der Kommandant gewahrte die Macht, die sich um Lorcans Hand sammelte, schaffte es aber, Rowan mit blutigen Zähnen höhnisch anzugrinsen. »Sie wird euch alle töten.« Er hatte bereits ein blaues Auge und das Lid war zugeschwollen. Luft brauste Elide in den Ohren, als Rowan einen Windschild um sie alle herum schloss. Alle Geräusche darin versiegelte.
»Maeve wird jeden Einzelnen von euch Verrätern töten.«
»Sie kann es versuchen«, lautete Rowans Antwort.
Sieh hin, flüsterte Anneith abermals.
Als der Kommandant zu schreien begann, schaute Elide nicht weg.
Und als Rowan und Lorcan taten, wozu sie ausgebildet worden waren, konnte sie nicht entscheiden, ob Anneiths Befehl ihr hatte helfen sollen oder ob er sie daran erinnern sollte, was genau die Götter tun konnten, falls sie ihnen nicht gehorchten.
3
Die Staghorns brannten und der Oakwald Forest mit ihnen.
Die mächtigen, uralten Bäume waren kaum mehr als verkohlte Gerippe und Asche regnete dicht wie Schnee herab. Funken flogen im Wind, in höhnischer Anspielung darauf, wie sie einst wie Glühwürmchen hinter ihr auf und ab gehüpft waren, wenn sie beim Beltanefest durch die Feuer gelaufen war.
So viele Flammen, schwelende Hitze – die Luft selbst versengte ihr die Lungen.
Du hast das getan du hast das getan du hast das getan.
Das Krachen der sterbenden Bäume brachte die Worte stöhnend und weinend hervor. Die Welt badete in Feuer. Feuer, nicht Dunkelheit.
Eine Bewegung zwischen den Bäumen erregte ihre Aufmerksamkeit.
Der Herr des Nordens war rasend, galoppierte kopflos vor Qual auf sie zu. Als Rauch von seinem weißen Fell aufstieg, als Feuer sein mächtiges Geweih verzehrte – nicht die unsterbliche Flamme, die zwischen den Geweihenden schwebte wie die auf ihrem eigenen Emblem, die unsterbliche Flamme der heiligen Hirsche von Terrasen und davor von Mala Feuerbringerin. Sondern echte, bösartige Flammen.
Der Herr des Nordens donnerte vorbei, brennend, brennend, brennend. Sie streckte eine Hand nach ihm aus, unsichtbar und vergeblich, und der stolze Hirsch stürmte brüllend weiter.
Solch entsetzliches, unerbittliches Brüllen. Als würde das Herz der Welt in Fetzen gerissen.
Sie konnte nichts tun, als der Hirsch sich in eine Flammenwand warf, die sich wie ein Netz zwischen zwei brennenden Eichen spannte.
Er kam nicht wieder heraus.
~
Der weiße Wolf beobachtete sie wieder einmal.
Aelin Ashryver Whitethorn Galathynius strich mit einem gepanzerten Finger über den Rand des steinernen Tisches, auf dem sie lag.
Das war alles, was sie an Bewegung zustande bringen konnte.
Cairn hatte sie diesmal hiergelassen. Hatte sich nicht die Mühe gemacht, sie in den eisernen Kasten zu stecken, der an der angrenzenden Wand stand.
Eine seltene Atempause. Nicht in Dunkelheit zu erwachen, sondern in flackerndem Feuerschein.
Die Feuer in den Schalen erstarben langsam und ließen die feuchte Kälte ein, die sich an Aelins Haut drängte. An alles, was nicht von dem Eisen bedeckt war.
Sie hatte bereits, so leise sie konnte, an den Ketten gezogen. Aber sie gaben nicht nach. Man hatte noch mehr Eisen hinzugefügt. Ihr hinzugefügt. Beginnend mit den metallenen Panzerhandschuhen.
Sie erinnerte sich nicht daran, wann das geschehen war. Wo es geschehen war. Da hatte es nur den Kasten gegeben.
Den erdrückenden Eisensarg.
Sie hatte ihn auf Schwächen untersucht, immer wieder. Bevor man sie diesem süß riechenden Rauch ausgesetzt hatte, um ihr das Bewusstsein zu rauben. Sie wusste nicht, wie lange sie danach geschlafen hatte.
Als sie erwachte, war der Rauch fort.
Sie hatte den Kasten also wieder geprüft. Soweit die Eisenketten es zuließen. Sie hatte mit den Füßen dagegengedrückt, mit den Ellbogen, die Hände gegen das unerbittliche Metall gestemmt. Sie hatte nicht genug Platz, um sich umzudrehen. Den Schmerz der Ketten zu lindern, die sich in ihr Fleisch bohrten. An denen sie sich aufschürfte.
Die Wunden der Peitschenhiebe, die tief in ihren Rücken geschnitten hatten, waren verschwunden. Die Hiebe, von denen ihr die Haut bis auf die Knochen aufgeplatzt war. Oder war auch das ein Traum gewesen?
Sie war in Erinnerungen abgetaucht, in Jahre des Trainings in einer Assassinenfestung. In Lektionen, bei denen man sie in Ketten zurückgelassen hatte, in ihren eigenen Exkrementen, bis sie herausfand, wie sie sich befreien konnte.
Aber man hatte dieses Training berücksichtigt, als man sie hier fesselte. Nichts, was sie in der beklemmenden Dunkelheit auch probierte, funktionierte.
Das Metall des Handschuhs kratzte über den dunklen Stein, kaum hörbar über dem Zischen der Feuerschalen, dem Tosen des Flusses hinter ihnen. Wo immer sie waren.
Sie und der Wolf.
Fenrys.
Keine Ketten fesselten ihn. Es waren keine notwendig.
Maeve hatte ihm befohlen zu bleiben, nicht einzugreifen, und genau das würde er tun.
Minutenlang starrten sie einander an.