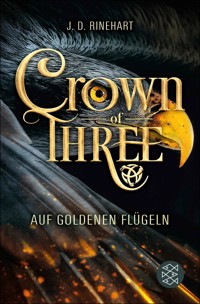
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Crown of Three
- Sprache: Deutsch
So gewaltig und episch wie »Game of Thrones«: Der erste Band der opulenten Fantasy-Trilogie um Macht und Schicksal, Liebe und Verrat, Sieg und Niederlage. Sie wurden in einer schicksalhaften Nacht geboren und dazu auserkoren, ein ganzes Land zu retten: Die Drillinge Gulph, Tarlan und Elodie müssen ihren eigenen Vater, den grausamen König Brutan, töten, um das Königreich Toronia zu befreien. Das Königreich Toronia ist in Aufruhr. Schon lange herrscht der grausame König Brutan über das Land. Doch nun gibt es endlich neue Hoffnung: Eine Prophezeiung sagt voraus, dass ihn seine Kinder stürzen werden. Doch die Drillinge wurden gleich nach ihrer Geburt getrennt und in weit entfernte Teile des Reiches gebracht. Trotz aller Gefahren müssen sie zueinanderfinden, denn nur gemeinsam können sie den Kampf um den Thron gewinnen – und Toronia den Frieden zurückbringen. »Wie ›Game of Thrones‹ an einem milden Tag.« Publisher's Weekly »Ein spannender und gnadenloser Auftakt einer Fantasy-Trilogie, der den Leser enorm mitreißt.« Magische Momente Blog »Ein düsterer, packender Trilogie-Auftakt, der vor Einfallsreichtum nur so strotzt.« Schmitz Juniors KiLiFü-Almanach der Kinderliteratur »Dieser aufregende, mystische und kreative Jugendroman zieht seine Leser sofort in den Bann. […] Spannend, kurzweilig, zauberhaft – ab nach Toronia!« Bücher, Spiele und Co Alle Bände der Crown-of-Three-Trilogie: Crown of Three – Auf goldenen Flügeln (Band 1) Crown of Three – Das Lied der Schlange (Band 2) Crown of Three – Die letzte Schlacht (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 416
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
J. D. Rinehart
Crown of Three – Auf goldenen Flügeln (Bd. 1)
Über dieses Buch
So gewaltig und episch wie »Game of Thrones«: Der erste Band der opulenten Fantasy-Trilogie um Macht und Schicksal, Liebe und Verrat, Sieg und Niederlage.
Sie wurden in einer schicksalhaften Nacht geboren und dazu auserkoren, ein ganzes Land zu retten: Die Drillinge Gulph, Tarlan und Elodie müssen ihren eigenen Vater, den grausamen König Brutan, töten, um das Königreich Toronia zu befreien.
Das Königreich Toronia ist in Aufruhr. Schon lange herrscht der grausame König Brutan über das Land. Doch nun gibt es endlich neue Hoffnung: Eine Prophezeiung sagt voraus, dass ihn seine Kinder stürzen werden.
Doch die Drillinge wurden gleich nach ihrer Geburt getrennt und in weit entfernte Teile des Reiches gebracht. Trotz aller Gefahren müssen sie zueinanderfinden, denn nur gemeinsam können sie den Kampf um den Thron gewinnen – und Toronia den Frieden zurückbringen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
J. D. Rinehart lebt in Nottinghamshire, England. Wenn er nicht gerade schreibt, besichtigt er Burgen, schaut Filme oder streift mit seiner Dänischen Dogge Sir Galahad durch die Natur.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Crown of Three. The Cursed King« bei Simon & Schuster, New York, USA
Copyright © 2015 by J. D. Rinehart
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015
Für die überarbeitete, deutschsprachige Neuausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5189-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Dank und Widmung
Motto
Prolog
Erstes Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Nachwort
Mit besonderem Dank an Graham Edwards
Für Y.K.
Toronia, das Reich der drei
Ächzt’ lang in dunkler Nacht.
Wo schwache Menschen nimmer frei,
Verführt von großer Macht.
Viel Blut und Treu’ verlorengeht
In der verwünschten Zeit.
Doch zieht der Dreistern auf, ersteht
Das Königreich erneut.
Erstarkt im neuen Himmelslicht
Drei Erben zieh’n ins Land.
Die Macht des Unrechtskönigs bricht,
Er fällt durch ihre Hand.
Drei Kronen tragen sie fortan
An Herz und Klugheit gleich.
Und eine neue Zeit bricht an
In Frieden für das Reich.
Gryndor, erster Zauberer von Toronia
Prolog
Melchior stand im Burghof von Schloss Berg und wandte das runzlige Gesicht zum Himmel. Über ihm funkelte das Sternenmeer, aber das Licht der Sterne war alt und längst erkaltet. Melchiors Augen jedoch waren noch viel älter.
Kahl und leer war er gewesen, dieser Himmel, vor langer Zeit. Erde und Meer waren voller Dunkelheit und seltsamer Magie. Alles war anders gewesen vor langer Zeit, bevor die Sterne aufgeflackert waren.
Melchior schloss seine uralten Augen und versuchte, ein Bild aus dieser längst vergangenen Zeit heraufzubeschwören. Aber seine Erinnerung versagte. Das Vergangene war verloren.
Auch ein Zauberer kann sich nicht an alles erinnern, dachte er.
Als er die Augen wieder aufschlug, hatte sich der Himmel verwandelt.
Dort oben funkelten nun, eingerahmt von den steinernen Zinnen der Burg, drei neue Sterne. Der erste schimmerte blassgrün, der zweite rot, der dritte golden, und jeder für sich überstrahlte alles andere am Himmel. Sie bildeten ein winziges Dreieck, das wie ein unfassbares Juwel in der Schwärze prangte.
»Die Prophezeiung«, flüsterte Melchior.
Er reckte seinen gebeugten Rücken auf, und die Last der Jahre fiel von ihm ab. Seine knotigen Finger schlossen sich um den Stab. Er wandte sich um und eilte auf die Turmtreppe zu. Sein abgewetzter gelber Umhang bauschte sich dabei auf wie Flügel. Er jagte an den Küchen vorbei. Ein Küchenjunge wollte gerade Spülwasser ausschütten, wie versteinert blieb er im Türstock stehen, der vom Feuerschein orange gerahmt war. Die Kupferschale fiel scheppernd zu Boden.
Melchior nahm zwei Stufen auf einmal. Die Steintreppe führte an der Außenmauer des Bergfrieds hoch. Seine nackten Füße tappten leise auf den schmalen Steintritten.
Drei Stockwerke weiter oben betrat er den Turm und ging durch unzählige dunkle Gänge tief ins Innere des Bergfrieds. Schloss Berg war in diesen Zeiten so gut wie verlassen, da König Brutans Armee bei Ritherlee gegen die Rebellen ins Feld zog. Melchior murmelte etwas, woraufhin kaltes Feuer aus der Spitze seines Stabs sprühte und ihm den Weg erleuchtete.
Der Zauberer zog vor einem niedrigen Bogen den Kopf ein und eilte weiter in einen großen, runden Raum, von dem aus eine Wendeltreppe nach oben führte. Auf einem wackligen Tisch unter dieser Treppe brannten drei Talglichter. Zufall oder ein weiteres Zeichen?
Melchior glaubte nicht an Zufälle.
»He! Wer ist da?« Ein dickbäuchiger Wächter hievte sich von der Bank hoch, auf der er gedöst hatte. »Ihr dürft Kalia nicht sprechen. Ich habe meine Befehle.«
Ohne seinen Schritt zu verlangsamen, ließ Melchior den Stab in der Hand herumwirbeln. Das Feuer an der Stabspitze wurde zu einem Lichtkreis, und das Licht sprang über den Kopf des Wächters, wo es sich rasch zu einer schimmernden Kugel zusammenzog. Als es die Stirn des Mannes berührte, rollten seine Augen in den Schädel hinein, und er sank zu Boden.
Melchior blickte durchs Fenster. Die drei Sterne waren deutlich zu sehen. Der Wächter hatte sie offenbar noch nicht bemerkt gehabt, aber früher oder später musste sie jemand entdecken und würde Alarm schlagen.
Nie war Melchior die Zeit kostbarer vorgekommen, obwohl er schon älter war, als er an Jahren zählen konnte.
Er jagte die zweihundertzehn Stufen zu Kalias Gemächern hinauf. Die Stufen zählte er, ohne darüber nachzudenken. Magie bestand für ihn aus Zahlen. Ermesse die Welt und du wirst ihr Meister sein. In diesem Wissen lebte er – und lehrte es sogar –, aber er war sich wohl bewusst, dass es außer seinen Zaubersprüchen noch andere Wege gab, Macht auszuüben.
Magie bestand aus sehr viel mehr als nur aus Zahlen.
Die Treppe endete an einer massiven Eichentür. Melchior stieß sie krachend auf und trat in einen weiten Raum mit hochgewölbter Decke. Die Wände waren mit Teppichen verkleidet und im offenen Kamin flackerte ein Feuer. Er eilte weiter durch einen Gang, in dem ein polierter Tisch und ein einzelner Stuhl standen, und trat in eine Kammer. Auf einem Bett mit seidenem Baldachin saß eine Frau. Ihr Gesicht war gerötet, das lange, rotgoldene Haar hing ihr in schweißnassen Strähnen herunter.
»Sie haben alle drei die Augen ihres Vaters«, sagte sie.
Melchior blieb stehen. Er ging neben dem Bett auf die Knie und legte seinen Stab auf die Bettdecke. Das Licht an seiner Spitze erlosch. Obwohl der Zauberer gerade quer durchs Schloss gejagt war, atmete er völlig ruhig.
»Drei«, sagte er.
»Ja«, antwortete Kalia.
Vor ihr lagen drei Bündel auf dem Bett. Man hätte sie leicht für Wäschehaufen halten können. Aber Melchior wusste es besser.
Er beugte sich vor, schlug die Decken zurück und betrachtete den Inhalt der Bündel, einen nach dem anderen. In jedem lag ein Neugeborenes. Alle drei waren rosig und hatten einen rotgoldenen Flaum auf dem Kopf. Und jedes hatte Augen so schwarz wie der Nachthimmel.
»Die Prophezeiung.« Melchior deutete zum Fenster, wo die drei Sterne eben in Sicht kamen.
»All die Zeit, als ich sie getragen habe, sagte ich mir immer wieder, dass es nicht sein kann«, sagte Kalia. »Selbst jetzt kann ich es kaum glauben.«
»Mit Glauben hat das nichts zu tun«, antwortete Melchior milde. »Dies ist das Schicksal. Seit tausend Jahren kennt Toronia nichts als Krieg. Hier …«, er breitete die Hände über den Babys aus, »… hier liegt nun endlich die Hoffnung auf Frieden.«
»Aber sie fortzuschicken, Melchior … es ist so entsetzlich.«
»Das Schicksal nimmt keine Rücksicht, Kalia.« Er deutete mit dem Finger zum Fenster. Schon wanderten die Sterne zur Mitte des Himmels hinauf. »Drei Sterne für drei Kinder, genau wie es in der Prophezeiung geheißen hat. Kalia, auch der König wird die Sterne sehen. Nun kann ich deine Kinder nicht mehr geheim halten.«
Sie blickte verzweifelt auf die Neugeborenen. »Ich habe sie doch gerade erst in diese Welt gebracht. Wie kann ich sie da schon hergeben?«
»Wenn du sie mir nicht anvertraust, werden deine Kinder sterben.«
Seine Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Aber Melchior hasste sich dafür, so grausam zu sein.
Wenn wir nicht rasch handeln, ist alles verloren.
»Er wird es nicht wagen«, sagte sie.
»Doch, das wird er. Du müsstest doch am allerbesten wissen, wie die Prophezeiung lautet. Dem König werden Drillinge geboren. Sie werden ihren Vater töten und an seiner Stelle herrschen. Erst wenn sie auf dem Thron sitzen, wird Toronia Frieden haben.« Er deutete auf die drei Babys. »Was, glaubst du, wird König Brutan tun, wenn er sie sieht? Glaubst du wirklich, sie werden den nächsten Morgen erleben?«
Kalia packte die Hand des Zauberers. »Dann nimm mich auch mit!«
»Kalia, ich …«
Draußen auf der Treppe hallten schwere Schritte. Schwerter schlugen an die steinernen Mauern, und eine Stimme bellte laut und unmissverständlich herauf. »König Brutan ist da!«
Melchior fluchte innerlich. Sie hatten zu lange gewartet! Es gab keinen anderen Weg aus den Gemächern. Jetzt saßen sie in der Falle.
Der alte Zauberer griff seinen Stab und ließ die Fingerkuppen über die abgegriffenen, vor Urzeiten eingekerbten Runen gleiten. Dann tanzten seine Finger auf dem Stab wie auf einem Musikinstrument, ohne dass jedoch ein Laut ertönte. Er zählte den Takt des stummen Liedes, das er schuf, und hoffte, dass er es rechtzeitig vollenden würde.
Vier Soldaten – sie trugen die bronzene Rüstung der Königlichen Legion – kamen in die Schlafkammer marschiert. Und kaum waren sie eingetreten, drängte sich ein Fünfter zwischen ihnen hindurch. Er war größer und breiter als die anderen und trug nur ein leichtes Nachtgewand. Sein schwarzes Haar und der Bart waren zerzaust; dennoch war König Brutan eine imposante Erscheinung, der keiner seiner Männer nahekommen wollte.
Kalia stockte der Atem. Sie zog das schweißnasse Nachthemd eng um den Hals und rief: »Brutan! Ich kann das erklären …«
»Erklären?«, donnerte die Stimme des Königs. »Kannst du das erklären?« Er zeigte zum Fenster hinaus, wo die drei Sterne hoch am Himmel standen. Kalia sagte nichts.
Brutan trat einen Schritt ans Bett heran. Auf seiner Stirn glänzte der Schweiß, die schwarzen Augen hatte er weit aufgerissen. »Du hast gelogen. Hast gesagt, es wäre nur ein Kind. Aber die Prophezeiung stimmt.«
Er beugte sich über die drei Bündel. Kalia warf sich in seine Arme, aber er stieß sie weg. Sie fiel schluchzend aufs Bett zurück. Brutan packte die Decke, in die das erste Kind eingeschlagen war, und riss sie auf.
Er starrte auf den Inhalt, dann grunzte er.
Er schlug das zweite Bündel auf und grunzte wieder.
Dann zog er langsam das dritte, winzige Flanellbündel auseinander und musterte lange das Neugeborene.
Abermals grunzte der König.
Melchior trat vor. Seine Finger schlossen sich sorgsam um den Stab.
»Wie Ihr seht, Herr«, sagte er, »waren die Kinder nicht für diese Welt bestimmt.«
Alle drei Neugeborenen lagen nun aufgedeckt auf dem Bett, Arme und Beine von sich gestreckt. Ihre Haut war jetzt runzlig und blau angelaufen, die Augen geschlossen. Kein Atem regte sich in ihrer Brust.
»Tot?«, sagte Brutan.
Kalia riss den Kopf hoch und schrie auf.
»Totgeburten«, meinte Melchior mit einer Verbeugung. »Deshalb wurde ich hergerufen – in der Hoffnung, dass meine Magie noch etwas ausrichten könne. Leider war es zu spät.«
»Und die Prophezeiung?«, fragte Brutan.
»Hat nicht zugetroffen.«
Langes Schweigen folgte, gebrochen nur durch Kalias Schluchzen, die sich über ihre toten Kinder warf. Da fing Brutan an zu lachen.
»Nicht zugetroffen!«, rief er aus. »Könnte es einen schöneren Moment geben als diesen, Zauberer? Sagt es mir.«
»Nein«, entgegnete Melchior. »Dies ist wahrhaftig ein erhebender Moment.«
Brutan packte Kalia am Schopf und riss ihren Kopf zurück. Er presste seine Lippen auf ihren Mund und küsste sie. Als sie versuchte, sich loszureißen, zog er an ihrem Haar, bis sie aufschrie. Dann stieß er sie zur Seite.
»Solltest du mich noch einmal anlügen«, zischte er, »wirst du als Hexe brennen, verlass dich darauf.« Er deutete auf die Babys. »Bring sie so weit fort von mir wie irgend möglich. Das ist ein Befehl. Verstanden, Zauberer?«
»Vollkommen, Herr«, antwortete Melchior.
Der König und seine Söldner hatten kaum die Kammer verlassen, als Melchior die Finger vom Stab löste. Es war, als würde ausgeatmete Luft durch den Raum wehen, obwohl sich nichts regte.
Sofort wurde die Haut der Neugeborenen wieder rosig. Die Falten glätteten sich. Bei einem nach dem anderen begann sich wieder die Brust zu heben und senken. Sie schlugen die Augen auf, dann öffneten sie die Münder.
»Pssst…«, sagte Melchior und breitete die Hände über ihnen aus. »Weint nicht, ihr Kleinen. Ihr braucht nicht zu weinen.«
Eines nach dem anderen verstummte wieder. Drei Paar schwarze Augen blickten den Zauberer an, weit geöffnet, doch ohne Furcht. Kalia hob die Kinder auf und drückte sie an ihre Brust. Tränen liefen über ihre Wangen.
»Vergib mir«, sagte Melchior. »Es war die einzige Möglichkeit.«
»Besser hätten wir es nicht erhoffen dürfen«, sagte Kalia, die vor Schluchzen nur stoßweise atmen konnte. »Er glaubt jetzt nicht mehr an die Prophezeiung. Nun werden sie in Sicherheit sein, nicht wahr? Nur …«
»Ja?«
Sie blickte unendlich traurig auf die Kleinen. Die Kinder sahen zu ihr auf. »Du hast recht – ich darf nicht mitkommen. Brutan würde sofort Verdacht schöpfen. Er würde mir folgen und …«
»Was wirst du tun?«
Ihr Blick wurde hart. Melchior spürte ihre Stärke und hoffte, dass auch ein wenig davon auf ihre Kinder übergegangen war. Sie würden es brauchen.
»Das liegt nun nicht mehr in meiner Hand. Es ist nun an dir, Melchior. Nimm sie. Bringe sie an einen Ort, an dem Brutan sie niemals finden wird.«
Sie hob das erste Kind hoch, einen Jungen, und küsste ihn auf die Stirn. »Du bist Tarlan«, flüsterte sie. Mit zitternden Händen reichte sie ihn Melchior.
Das zweite Kind war ein Mädchen. Kalia küsste ihre Wange. »Elodie, meine Tochter.«
Das dritte Kind, einen Jungen, küsste sie auf die Nasenspitze und sagte: »Dein Name ist Agulphus.«
Bald waren die drei Neugeborenen sicher in Melchiors weitem Umhang verstaut, und Kalia rannen aufs Neue die Tränen übers Gesicht.
»Diese Namen trage ich euch an, meine Liebsten«, sagte sie. »Sie sind alles, was ich euch geben kann. Kein Kind verdient ein solches Schicksal. Seid stark, alle drei, und bleibt euch treu. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder…«
Sie wandte sich ab – unfähig weiterzusprechen.
»Meine Herrin?«, sagte Melchior.
»Geh, Melchior. Bevor ich es mir anders überlege.«
So geschah es.
Die große südliche Mauer von Schloss Berg zeichnete sich hoch und dunkel gegen den fahlen Morgenhimmel ab. Melchior schlüpfte im Schatten des Torhauses durch jene Ausfallpforte, die von allen Zugängen zum Schloss am wenigsten benutzt wurde, und hielt auf drei Reiter zu.
Alle drei starrten zum schlanken Turm an der Südwestecke des Schlosses hinauf. Dort oben hing noch eine feine, gelbe Rauchfahne – der Rest des Signals, mit dem Melchior die Reiter herbeigerufen hatte. Es war nicht einfach gewesen, unbemerkt das Zeichen zu geben; quälend lange hatte er auf die Morgendämmerung und die Ankunft der Männer warten müssen.
Das Schicksal ist hart.
Gleichzeitig rissen die drei Männer die Augen vom Signal los und wandten sich Melchior zu.
»Wir sind bereit«, sagte der Erste. Er war kräftig gebaut, breiter noch als König Brutan, und hatte eine zerfurchte Stirn. Seine Augen waren trotz der mürrischen Miene gütig.
Wortlos griff Melchior in seinen Umhang, zog ein kleines weißes Bündel hervor und übergab es dem Mann.
»Ich werde den Jungen mit nach Yalasti nehmen«, sagte der Reiter. »Die Kälte wird ihn stark machen.«
»Wohl wahr, Hauptmann Leom«, sagte Melchior. Das zweite Bündel reichte er dem hochgewachsenen Mann auf einem glänzenden, grauen Streitross. »Und Ihr, Lord Vicerin?«
»Sie wird als Mitglied meiner eigenen Familie aufwachsen«, antwortete Vicerin. »Es wird ihr an nichts fehlen.«
Das dritte Kind gab Melchior dem letzten Reiter, einem grauhaarigen Ritter mit ramponierter Rüstung. Auch sein Pferd war alt und voller Narben.
»Werdet Ihr ihn gut behüten, Sir Brax?«
»Ich weiß eine Schenke«, erwiderte der alte Ritter. »Sie liegt tief verborgen in den Wäldern Isuriens. Niemand wird den Jungen dort finden.«
Die drei wendeten ihre Pferde und stoben in die Morgendämmerung davon. Am äußeren Ende des Burgplatzes wurde der Pfad zur Straße, die hinaus zur großen Brücke von Idilliam und weiter ins Königreich hineinführte.
Melchior sah sie immer kleiner werden, bis sie zu einem einzigen wandernden Punkt schmolzen. Am Ende der Brücke schlug jeder einen anderen Weg ein, und der Punkt zerteilte sich wieder. Der Staub, den die Hufe aufgewirbelt hatten, wurde dichter. Als er sich gelegt hatte, waren die Punkte verschwunden.
Nun machten sich Müdigkeit und Erschöpfung bemerkbar. Melchior fühlte sich wieder alt und leer.
Habe ich das Richtige getan?
Er hoffte es. Drillinge waren ungewöhnlich in Toronia. Wenn sie zusammenblieben, würde Brutan sie früher oder später finden, und alles wäre vergebens gewesen. Sie mussten weit voneinander entfernt aufwachsen, das war ihre einzige Chance. Wenn sie überlebten, würde das Schicksal sie vielleicht wieder vereinen.
Und dann konnten sie endlich gemeinsam die Krone übernehmen.
Melchior trottete den Fußweg zum Schloss zurück. Kurz vor dem Tor blickte er noch einmal zum Himmel hinauf. Die meisten Sterne waren verblasst. Nur drei leuchteten noch.
»Ihr seid Toronias einzige Hoffnung«, flüsterte er und ging durch das Tor.
Erstes Buch
Fünfzehn Jahre später
Kapitel 1
Gulph starrte auf die Menge. Ein Meer von Gesichtern umringte ihn, manche erwartungsvoll, andere gelangweilt. Es mussten Hunderte Zuschauer sein – vielleicht sogar tausend –, und alle erlesen gekleidet, wie er es noch nie gesehen hatte. Sie füllten die Ränge der Großen Halle von Toronia. In eitlen Tagträumen hatte er sich oft vorgestellt, vor einem solchen Publikum zu spielen – allerdings nicht als Gefangener des Königs.
Er schöpfte Atem, und die Düfte der saftigen Bratenstücke, die die Diener auf Tabletts vorbeitrugen, ließen seinen leeren Magen knurren. Er lauschte auf das dumpfe Gemurmel der Menge. Die Gäste des Königs unterhielten sich, rückten sich auf ihren Stühlen zurecht und fächelten sich Luft zu. In den Lichtstrahlen, die durch die golden schimmernden Dachfenster hereinfielen, sah er den Staub tanzen. Gab es so etwas? Glas, das aus Gold gemacht war? Gulph wusste es nicht.
»Fangt endlich an!«, rief jemand aus den hinteren Reihen.
Als ob wir eine Wahl hätten, dachte Gulph.
Er verbeugte sich tief, so tief, dass seine Nase die linke Schuhspitze berührte. Und er wartete, bis die Welle der Belustigung die ganze Menge erfasst hatte. Dann richtete er sich wieder auf, wartete und bog sich nach hinten. Diesmal stockte den Zuschauern der Atem. Gulph krümmte seinen Rücken so weit, dass er die Fesseln mit den Händen packen konnte, streckte den Kopf durch die Beine vor und grinste, so breit er nur konnte.
Derartig verrenkt durchquerte Gulph die Arena. Dabei kam er an Pip vorbei, die von einem Fuß auf den anderen hüpfte und dabei mit Äpfeln und Birnen jonglierte. Sie zwinkerte ihm deutlich sichtbar zu, aber die Traurigkeit in ihren braunen Augen war nicht zu übersehen. Die anderen Tangletree-Mitglieder sahen zu und klatschten in die Hände. Sidebottom John, der den Narren spielte, setzt noch eins drauf, indem er einen Handstand machte und die Schellen an seinen Fußgelenken klingeln ließ.
Die Menge stimmte in den Applaus mit ein. Als Gulph wieder in der Mitte ankam, waren viele aufgesprungen. Er stellte die Hände auf den Boden und schwang die Beine über den Kopf. So landete er auf den Füßen und verbeugte sich wieder, diesmal in Richtung der Königsloge.
König Brutan und Königin Magritt waren in ihren Purpurmänteln nicht zu übersehen. Der König strich sich ausdruckslos über den Bart. Und die Königin nickte kurz, aber anstelle eines Lächelns glaubte Gulph, eine finstere Miene zu erkennen.
Da schob sich eine Wolke vor die Sonne, und das goldene Licht erlosch. Mit einem Mal sah Gulph die Große Halle, wie sie wirklich war: ein ehemals prächtiger Saal, der mit den Jahren arg heruntergekommen war. Von den mächtigen Säulen blätterte der Putz, die Uniformen der Bediensteten waren zerschlissen und nur notdürftig geflickt.
Schloss Berg mochte noch immer das Herz des Königreichs sein. Aber es war krank, dieses Herz.
In der Königsloge entdeckte Gulph noch ein anderes Gesicht, das er am liebsten niemals gesehen hätte: der aufgeblasene General Elrick glich einem Wiesel, wie er selbstgefällig neben dem Königspaar saß und immer wieder auf die beiden einredete, ohne ihr Missfallen zu bemerken.
Elrick war es gewesen, der die Tangletree-Truppe hier nach Idilliam gebracht hatte. Kriegsmüde, wie er war, hatte er bei einer Aufführung vor Brutans Soldaten in den nahen Wäldern von Isur Gefallen an Gulph und seiner Gruppe fahrender Gaukler gefunden. Reichtümer und wohlgefüllte Bäuche hatte er ihnen versprochen, dazu ein warmes Quartier in der Obhut des Königs.
Aber alles war anders gekommen. General Elrick hatte die Artisten dem König als Kriegsbeute vorgeführt, und ihre neue Behausung war eine eiskalte Gefängniszelle, die sie sich zu zwölft teilen mussten. Schon zuvor hatten sie ein hartes Leben geführt, unter Hecken geschlafen, immer in Sorge, wo sie die nächste Mahlzeit herbekommen sollten oder ob ihnen im Schlaf irgendein Rohling die Kehle aufschlitzen würde. Aber wenigstens waren sie frei gewesen, fand Gulph.
Als Zugabe machte er noch ein paar Rückwärtssalti. Die Menge tobte. Nach jedem Sprung machte er eine Verbeugung, wobei er wieder seine Gelenkigkeit zur Geltung brachte und noch einmal einen verstohlenen Blick auf Königin Magritt warf.
Ihre Miene wurde mit jedem Mal noch grimmiger.
Schau doch, wie du willst. Ich bin das ohnehin gewohnt.
Dass Gulph sich so verrenken konnte, hielten die meisten für eine Missbildung, ebenso wie seine hervorstehenden Augen und seinen krummen Rücken. Aber Königin Magritts Blick war anders.
Sie starrte ihn so eindringlich an, dass er bei seinem letzten Salto ins Stolpern kam und mit verknoteten Beinen hart auf dem Rücken aufschlug, dass der Staub nur so aufwirbelte. Die Zuschauer bogen sich vor Lachen.
Königin Magritt sprang auf. Sie hatte die Fäuste geballt. Auf ihren blassen Wangen leuchteten rote Flecken. Der König hob die Hand und wollte sie wieder auf den Sitz ziehen, aber sie wand sich los.
»Aus meinen Augen mit ihm!«, kreischte sie und zeigte auf Gulph. Die Menge verstummte. Gulph starrte sie entgeistert an, während ihre Worte durch den Saal hallten:
»Dieses … dieses missgebildete Ungeheuer wird nichts als Unglück über das Reich bringen.«
»Aber … Euer Majestät …!«, rief General Elrick und erhob sich. Der König stieß ihn wieder zurück, wandte sich um und musterte seine Königin, wobei er eine Braue hochzog.
»Die Himmelsgruft!«, rief Königin Magritt. Aus dem Publikum kamen Rufe des Erstaunens. Sie winkte einen Söldnertrupp nach vorn. »Bringt ihn fort. Jetzt gleich. Ich will ihn keinen Moment mehr sehen.«
Die Soldaten marschierten heran, und Gulph blickte in die entsetzten Gesichter seiner Freunde.
»Das lassen wir nicht zu!«, rief Sidebottom John.
»Die Tangletree-Truppe bleibt zusammen«, sagte Willum, der Dudelsackspieler mit den hellen Augen. Er kam auf Gulph zugerannt. Nach kurzem Zögern folgten die anderen.
Die Jongleurin Pip war am allernächsten. Sie packe Gulphs Hand und zog ihn vom Boden hoch.
»Was ist das für eine Himmelsgruft?«, fragte Gulph verwirrt.
»Ich weiß auch nicht.« Pip schloss ihn fest in die Arme. »Ich werde das nicht zulassen, Gulph!«
Die Söldner erreichten Gulph vor seinen Freunden. Sie packten Pip und stießen sie zur Seite. Als sie Gulph umringten, trommelte ihnen Pip mit den Fäusten auf den Rücken. Die Übrigen der Gauklertruppe blieben unschlüssig stehen.
»Lass sie«, rief Gulph aus Sorge um Pip. »Du kannst mir nicht helfen!«
»Doch, das kann ich!«, erwiderte Pip.
Sie jagte quer durch die Arena bis vor die Königsloge und fiel vor dem König auf die Knie.
»Bitte, Hoheit, ich flehe Euch an«, rief sie. »Habt Gnade mit meinem Freund. Er möchte Euch doch nur unterhalten. Er hat doch nichts Böses getan.«
Lächelnd beugte sich der König vor. »Solche Treue für eine derart abstoßende Kreatur!« Sein Grinsen verfinsterte sich. »Weißt du, was mit kleinen Mädchen passiert, die sich königlichen Befehlen widersetzen?«
Gulph spähte an den Köpfen der Soldaten vorbei und musste mitansehen, wie einer Pip mit dem stumpfen Ende seiner Lanze quer über die Brust schlug. Sie stürzte rücklings in den Sand.
»Lasst sie in Frieden!«, brüllte Gulph und versuchte, sich zwischen den Söldnern hindurchzudrängen. »Mir ist egal, wo ihr mich hinbringt. Aber lasst meine Freunde in Frieden!«
Er wurde an Armen und Schultern gepackt und wehrte sich vergeblich, während Königin Magritt einen großen, grauhaarigen Mann in der Bronzerüstung der Königlichen Legion heranwinkte.
»Hauptmann Ossilius«, sagte sie. »Kommt her.«
Die Menge verstummte, während sie dem Söldner etwas zumurmelte. Gulph hörte auf zu zappeln. Er hörte den Puls in seinen Ohren hämmern.
Als die Königin gesprochen hatte, nickte Hauptmann Ossilius und schritt zu Gulph herüber. Die Soldaten traten zurück, sodass Gulph allein dastand.
»Willst du dich mir widersetzen, Junge?«, fragte Hauptmann Ossilius.
Gulph starrte ihm in die Augen. Er sah müde aus und irgendwie traurig.
Gulph sah, dass Sidebottom John der Jongleurin Pip wieder auf die Füße half. Zwei Söldner standen bedrohlich neben ihnen.
»Nein, Herr«, antwortete Gulph. Er hatte keine Ahnung, warum dies alles geschah – oder was hier überhaupt passierte. Er wusste nur, dass er gehorchen musste, wenn er seine Freunde retten wollte.
»Sehr gut«, sagte Hauptmann Ossilius. Er packte Gulph am Arm und zerrte ihn aus der Großen Halle. Als sie an der Königsloge vorüberkamen, richtete König Brutan seinen Zorn auf General Elrick.
»Du Narr!«, bellte er den General an, der sich ängstlich duckte. »Wie kannst du es wagen, meine Königin so zu verärgern? Du hast uns den ganzen Tag verdorben!«
In Gulphs Kopf lärmten so viele Gedanken durcheinander, dass er nichts von dem Zorn des Königs mitbekam. Die Himmelsgruft, dachte er aufgewühlt. Was mag das wohl sein? Eigentlich klang der Name angenehm, aber seine Angst linderte das nicht.
Die Gassen vor dem Schloss waren voller Bauern, die Tische und Stände aufbauten. Hauptmann Ossilius bugsierte Gulph wortlos durch das Gewirr. Sein Griff war hart wie Eisen.
Diesmal werde ich mich nicht herauswinden können.
Eine Frau hinter einem Gemüsestand warf einen Kohlkopf nach Gulph. Er traf ihn am Kopf und glitt als faulige Masse schmieriger Blätter auf seine Schulter herunter. Der Gestank war entsetzlich und genauso fühlte sich Gulph. Er zerrte am Arm des Hauptmanns und wollte erklären, dass er kein Verbrecher war; dies alles musste ein Missverständnis sein.
Dann sah er, dass alles Gemüse an diesem Verkaufsstand verfault war – nicht nur der Kohl, den die Frau geworfen hatte. Und die Kleider, die es am nächsten Stand zu kaufen gab, waren so oft geflickt, dass sie beinahe von selbst zerfielen. So verzweifelt Gulph war, bemerkte er doch, dass Idilliam kein glücklicher Ort war.
Sie bogen um eine Ecke, ließen den Markt hinter sich und gelangten auf einen offenen Platz. Hauptmann Ossilius blieb stehen.
»Hier sind wir«, sagte er.
Gulph verstand nicht. Er hatte mit einer Art Gefängnis gerechnet, aber er sah nur einen Wald aus Baumstämmen. Sie ragten wie die Beine eines riesigen Untiers aus dem groben Pflaster.
»Was …?«, fragte er. Dann sah er nach oben.
Die Stämme waren Stützen, auf denen etwas ruhte, das einem riesigen Vogelnest glich – so groß, dass die gesamte Große Halle hineingepasst hätte, in der die Tangletree-Truppe eben aufgetreten war.
Was Gulph für Äste gehalten hatte, waren Eisenträger, die zu einem engen Netz aufgestellt waren. Dazwischen sah man gelegentlich eine orangefarbene Flamme züngeln. Ansonsten war das Innere des Nests völlig schwarz.
»Komm, Junge«, sagte Hauptmann Ossilius.
Eine schmale Treppe führte die Stützpfeiler hinauf. Die Stufen hingen an knarrenden Seilen und schwangen hin und her. Sie gelangten an eine rechteckige Eisentür. Daneben war eine Reihe verrosteter kleiner Eisenkäfige, gerade so groß, dass ein Mann hineinpasste.
Hauptmann Ossilius schob Gulph in einen Käfig und ließ das Schloss zuschnappen. Dann zog er einen Schlüssel aus der Tasche, öffnete die Tür und verschwand im eisernen Nest.
Gulph starrte durch die Gitterstäbe hinunter zum Boden, tief unter ihm. Im Käfig neben ihm entdeckte er einen Haufen Knochen.
War das nun sein Ende? Sollte er hier elend verdursten und verhungern? Und warum? Weil der Anblick seines verwachsenen Körpers die Königin beleidigt hatte?
Er kniff die Augen zu. Weinen würde er nicht.
Scheppernd ging die Eisentür auf. Jemand fingerte am Käfigschloss herum. Gulph schlug die Augen auf – Hauptmann Ossilius stand vor ihm. Gulph forschte im Gesicht des Mannes nach einem Zeichen der Hoffnung.
»Vergib mir«, sagte der Hauptmann und Gulph war erleichtert. Alles war nur ein Missverständnis gewesen! Aber Ossilius fuhr fort: »Ich musste dich einsperren, bis ich deine Einweisung geregelt hatte. Komm!«
Wieder schloss sich seine Hand fest um Gulphs Arm, und er wurde durch die Tür ins Dunkel gezerrt. Die Tür schlug zu, und aus der schwarzen Leere vor ihm tönte eine Reibeisenstimme:
»Ah, da bist du ja. Willkommen in der Himmelsgruft.«
Kapitel 2
Heiße Luft schlug ihm wie eine Welle ins Gesicht. Es stank nach Rauch und Schweiß. Von irgendwoher hörte Gulph Menschen rufen und schreien. Die Stimmen hallten von den Eisenträgern zurück, aus denen die Wände des Kerkers bestanden.
»Was ist das hier für ein Ort?«, fragte er.
»Sei still«, sagte Hauptmann Ossilius, der Gulph einen langen, gewundenen Gang entlangführte. Vor ihnen flackerte orangefarbenes Licht auf. Je näher sie ihm kamen, desto stärker wurde das Getöse.
»Das ist die Gruft«, antwortete die raue Stimme, die ihn begrüßt hatte.
Gulph sah sich um. Ein kleiner, dicker Mann eilte hinter ihnen her. Ein riesiger Schlüsselbund hing klingelnd vor seinem massigen Bauch, und von seinem kahlen Schädel tropfte der Schweiß.
»Was ist …?«, begann Gulph, aber da erreichten sie das Ende des Ganges und kamen in eine riesige Halle. Direkt vor ihnen war die Lichtquelle, die Gulph schon gesehen hatte: eine riesige Metallkugel mit zahllosen runden Löchern, aus denen Flammen schossen. Sie hing an Kabeln von der Decke und schwang langsam hin und her. Dabei spie sie einen Funkenregen auf den unebenen Boden herunter.
Die Wände! Sie bewegen sich!
Gulph kniff die Augen zusammen und begriff allmählich, was er da sah. Was er für Wände gehalten hatte, waren Käfige voller Menschen – ein Spinnennetz eng verflochtener Eisenstangen, hinter denen sich ein Gewirr menschlicher Leiber, Arme und Beine wand. Die Gefangenen der Himmelsgruft!
»Noch Fragen?«, knurrte der Dicke und blies Gulph seinen nach verrottetem Fleisch und Knoblauch stinkenden Atem ins Gesicht. »Sieht ziemlich voll aus, die Gruft, nicht wahr? Aber für einen kleinen Wurm wie dich finden wir schon noch ein Plätzchen.«
Er zog Gulph weg von Hauptmann Ossilius und schob ihn an der Feuerkugel vorbei auf eine Zelle zu, in der sich kreischende Häftlinge drängten wie Heringe in einem Fass. Als Gulph und der Dicke näher kamen, reckte ein dürrer Mann, der nur einen Fetzen um die Lenden trug, seinen abgemagerten Arm durch die Stäbe.
»Her mit der Missgeburt!«, rief er. »Wir werden gut auf ihn achtgeben!«
»Der ist ja noch magerer als du, Shankers!«, gackerte eine Frau mit Haaren, die wie ein Rattennest aussahen.
»Der sieht ja wie ein Frosch aus mit seinen Glubschaugen«, rief ein anderer.
»Froschschenkel zum Abendessen«, sagte der, den sie Shankers nannten. »Frosch-Schenkel, Frosch-Schenkel!«
Die anderen Gefangenen stimmten mit ein. Gulph stampfte mit den Füßen auf und versuchte, sich von seinem Bewacher loszureißen, aber der Dicke hielt ihn noch fester gepackt als Hauptmann Ossilius.
»Weg vom Gitter!«, brüllte er. »Räudige Rebellen, alle zusammen! Ihr wollt es mit der Krone aufnehmen? Was glaubt ihr, wer ihr seid? Ich könnte kotzen, wenn ich euch bloß ansehe!«
Er hob die Arme. In einer Hand klimperten nun die Schlüssel, von der anderen baumelte Gulph. Er wollte schreien. Schreien und weglaufen. Dann bemerkte er, dass zwischen den Gitterstäben relativ viel Platz war. Vielleicht konnte er sich ja hindurchzwängen.
Wenn ich so lange überlebe.
»Schluss jetzt!« Plötzlich war Hauptmann Ossilius wieder da und stellte sich breitbeinig vor den Käfig. Mit steinerner Miene starrte er auf den Dicken herunter. »Du hast den Befehl gehört, Blist. Also führe ihn gefälligst aus!«
Das rundliche Gesicht des Dicken bebte. »Ich dachte, das wäre ein Scherz …«
»Ich scherze nie. Und du nennst mich ›Herr‹, verstanden?«
»Aber … die Schwarze Zelle? Das kann nicht Euer Ernst sein, Herr.«
Ossilius beugte sich zu ihm. »Der Befehl kommt nicht von mir, Blist, sondern von der Königin persönlich. Soll ich ihr melden, dass du ihn nicht ausführen wolltest?«
»Nein, Herr«, erwiderte Blist. Seine Augen, die eben noch geleuchtet hatten, wurden eiskalt. »Der Königin bin ich ebenso treu ergeben wie einem Hauptmann der Legion.«
»Ausgezeichnet. Erfülle deine Pflicht, Wärter, dann will ich auch meine erfüllen.«
Hauptmann Ossilius machte auf dem Absatz kehrt und marschierte davon. Als er in den Gang einbog, blieb er stehen und blickte Gulph an. Er öffnete den Mund, als wolle er etwas sagen, besann sich aber anders und trat aus der Gruft hinaus ins gleißende Tageslicht.
»Könntet Ihr mich absetzen, bitte?«, sagte Gulph. »Mein Arm schmerzt.«
Blists andere Hand schloss sich fest um den Schlüsselbund, und Gulph befürchtete schon, er würde ihm mit der Faust ins Gesicht schlagen. Doch dann ließ der Wärter die Schultern hängen und setzte Gulph auf dem Boden ab.
»Und keinen Mucks mehr von dir, du Missgeburt«, knurrte er. Dann zerrte er ihn an der Feuerkugel vorbei in einen engen Gang, der in einer ebenfalls engen Spirale nach oben führte. Das Geschrei der Gefangenen verklang allmählich hinter ihnen, aber dafür nahm die Hitze zu. Als sie oben ankamen, triefte Gulph am ganzen Körper vor Schweiß.
Vor ihnen lag eine niedrige Tür. Wortlos wählte Blist einen langen schwarzen Schlüssel von seinem Bund, stieß ihn ins Schlüsselloch und drehte ihn um. Mit einem langgezogenen Quietschen öffnete sich die Tür. Der Wärter ließ Gulphs Arm los und beförderte ihn mit einem kräftigen Tritt in den Raum. Instinktiv rollte Gulph sich ab und kam gleich wieder auf die Füße.
Die Tür schlug hinter ihm zu. Der Schlüssel knarrte im Schloss und kurz hallten noch Blists Schritte, bis sie im allgemeinen Getöse des Gefängnisses untergingen.
Gulph drehte sich langsam um. Der Raum hatte einen unebenen Boden und seltsam schiefe Wände … aber es war ein Raum, keine Zelle. In einer Ecke stand ein mit Büchern und Schriftrollen bedeckter Schreibtisch mit einer flackernden Öllampe.
Hoch über ihm liefen die Eisenträger im spitzen Winkel zusammen; es fühlte sich an wie in einer merkwürdigen Dachkammer aus Metall. Fenster gab es keine. Nur durch einen dünnen Schlitz zwischen den Sparren fiel etwas Tageslicht herein. Vor dem Schreibtisch stand ein Stuhl mit kunstvoll bestickten Kissen, daneben ein Bett, auf dem sich Decken türmten. Auf dem Boden lag ein dicker Teppich.
Plötzlich sauste etwas aus dem Schatten neben dem Bett: eine Gestalt mit einem blassen Gesicht.
Ein Geist!
Gulph schlug die Hand vor den Mund und machte einen Satz nach hinten. Er blieb an der Teppichkante hängen und wäre beinahe gestolpert. Die Gestalt stand nun ganz im Licht – kein Geist, sondern ein hochgewachsener Junge in einer weiten Robe. Er war so blass, wie Gulph es noch nie gesehen hatte, und hatte große, blaue Augen. Er lächelte.
»Willkommen«, rief er freudig und breitete zitternd die Arme aus. »Sei willkommen!«
Gulph wich bis zur Tür zurück; weiter ging nicht. Der Junge war etwas älter als er und wirkte zwar kränklich, aber trotzdem selbstbewusst.
»Wer bist du?«, fragte Gulph.
»Ich bin Nynus. Und wie heißt du?«
»Gulph.«
Das Lächeln wurde zu einem begeisterten Grinsen. »Schön, dich kennenzulernen, Gulph. Du hast keine Ahnung, wie froh ich bin, wieder Gesellschaft zu haben. Ich bin in dieser Zelle eingesperrt, seit ich sechs bin, und …« Sein Gesicht war voller Trauer. »Zehn Jahre. Ist es tatsächlich schon so lang?«
»Zelle?«, sagte Gulph. »Das nennst du eine Zelle?«
»Du hast recht, es könnte schlimmer sein.« Er grinste wieder. Die Verzweiflung war so schnell verflogen, wie sie gekommen war. »Aber es ödet mich an, immer wieder dieselben alten Bücher zu lesen und hier im Kreis zu laufen.«
Gulph erwiderte mit etwas Unbehagen das Lächeln. »Na ja, verglichen mit dem Rest der Anlage, hast du’s hier ziemlich luxuriös.« Sein Blick wanderte über die feingearbeitete Robe, deren Säume mit Gold eingefasst waren. »Also, wie kann das sein? Bist du etwa reich oder so?«
»O ja.« Nynus nickte fröhlich.
»Ah. Na schön. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie mich hier einsperren. Königin Magritt hat das angeordnet, aber …«
»Nun, ich bin nur deswegen hier, weil mich König Brutan nicht mag. Ich habe niemandem etwas getan.«
»Besonders gerecht hört sich das nicht an.«
»Das ist es auch nicht. Aber ich kann es nicht ändern.«
Das Lächeln verschwand wieder, und mit ihm schien alle Kraft aus seinem Körper zu weichen. Noch nie hatte Gulph jemanden in so erbärmlichem Zustand gesehen.
»Das tut mir leid«, sagte er. »Es muss schrecklich sein, wenn man so viele Jahre von seiner Familie getrennt ist.«
Nynus zuckte mit den Schultern. »Ich weiß nicht einmal mehr, wie sie aussehen.« Er summte etwas, das wie ein Wiegenlied klang, und fuhr sich dabei mit der Hand übers Gesicht, streichelte sich die Wange.
Gulph wurde ganz mulmig zumute. Sollte er diesen merkwürdigen, blassen Jungen trösten und ihm erzählen, dass er sehr gut wusste, wie es war, ohne Familie aufzuwachsen? Schaudernd fragte er sich, ob er an diesem Ort genau wie Nynus werden würde.
Ein Tropfen fiel ihm auf die Wange. Gulph blickte zum Schlitz im Gebälk hinauf. Der Himmel war grau geworden. Wahrscheinlich hatte sich eine Wolke vor die Sonne geschoben. Immer mehr Tropfen fielen auf sein Gesicht, es hatte zu regnen begonnen.
Gulph schöpfte Hoffnung.
»Hast du jemals versucht zu fliehen?«, fragte er.
Bevor Nynus antworten konnte, war Gulph schon beim Schreibtisch und wischte mit einer Handbewegung die Bücher auf den Boden.
»He!«, protestierte Nynus. »Meine Bücher!«
»Es gibt genügend Bücher auf der Welt«, sagte Gulph. »Du wirst schon sehen.«
Er sprang auf den Schreibtisch, schob die Finger in das eiserne Flechtwerk und zog sich langsam empor. Es war schwierig – wie bei einem Baum, an dem man sich nur in der rauen Borke festkrallen konnte. Aber Gulph hatte die nötige Kraft und war geschmeidig, und bald hatte er die Hälfte geschafft. Die Wände wurden nun glatter. Er musste sich verrenken und die Arme so weit nach dem nächsten Halt strecken, wie es kein anderer gekonnt hätte. Bei jeder seiner Bewegungen hörte er, wie Nynus unten der Atem stockte, und ihm wurde ganz warm vor Stolz. Die anderen Gefangenen hatten ihn eine Missgeburt genannt – könnten sie ihn jetzt nur sehen!
Schließlich erreichte er die Dachschräge und hängte sich wie eine Spinne ein, presste sein Gesicht an den Schlitz zwischen den Trägern und spähte hinaus. Abwassergestank zog ihm in die Nase.
Unten lagen die Straßen von Idilliam mit ihrem Gedränge. Dahinter ragte am Stadtrand ein schroffer Felsen auf. Er wurde High Peak genannt, wie ihm Pip am Tag ihrer Ankunft erzählt hatte.
»Von dort oben kann man alle drei Regionen des Königreichs sehen«, hatte sie gesagt. »Ich wünschte, wir könnten hochsteigen!«
Die Erinnerung stach Gulph ins Herz. Würde er Pip jemals wiedersehen?
Am Fuß des High Peak lag die große Brücke von Idilliam. Das gewaltige steinerne Bauwerk überspannte die Schlucht zwischen der Hauptstadt von Toronia und den endlosen Wäldern von Isur. Es kam Gulph wie eine Ewigkeit vor, dass er sie mit dem Rest der Tangletree-Truppe auf dem Weg in die Stadt überquert hatte. Dabei war das nur fünf Tage her. Jetzt verhieß die Brücke Flucht und Freiheit, schien ihm aber unendlich fern. Wie sollte er sie nur jemals erreichen?
Eins nach dem anderen.
Gulph musterte die Außenseite des Daches. Gleich unterhalb der Lücke, durch die er spähte, liefen bei einem großen Fallrohr mehrere Dachrinnen zusammen. Von dort zog auch der Abwassergestank herauf. Das Rohr war oben offen und lief seitlich an der Himmelsgruft abwärts.
Bis zum Boden.
Es klapperte an der Zellentür. Mit pochendem Herzen hangelte sich Gulph wieder an der Wand hinunter und ließ sich das letzte Stück fallen. Er war kaum gelandet, als sich eine Klappe am Fuß der Tür öffnete und eine fette Hand zwei zerbeulte Blechschüsseln hereinschob. Eine enthielt ein dampfendes Schweinekotelett, zwei Kartoffeln und eine Portion Kohl, in der anderen befand sich eine graue, undefinierbare Masse.
»Und jetzt sollen wir uns wohl darum streiten!«, rutschte es Gulph heraus.
In Augenhöhe sprang eine zweite Klappe auf und Blist starrte herein. »Vergiss nicht, wer du bist, Missgeburt«, knurrte der Wärter. »Von Vorzugsbehandlung war bei dir nicht die Rede. Oder bist du etwa ein Prinz?«
»Natürlich bin ich kein Prinz!«, rief Gulph, aber die Klappen waren längst wieder zugeschlagen worden. »Was meint er nur damit? Was soll das damit zu tun …?«
Zu seiner Überraschung verbeugte sich sein Zellengenosse. »Prinz Nynus zu deinen Diensten. Ich könnte dich jetzt auffordern, mir die Hand zu küssen, aber ich glaube, das brauchen wir nicht mehr, oder?«
»Prinz … Du meinst, du bist der Sohn von …?« Gulph war so schockiert, dass er die Worte kaum herausbekam. »Aber warum bist du dann hier oben eingesperrt? Du sagst, der König habe das befohlen, aber ist er nicht …?«
»Mein Vater? Doch, das ist er. Und außerdem hat er völlig den Verstand verloren. Er verdächtigt jeden, ihm den Thron stehlen zu wollen.«
»Und warum?«
»Wer weiß? Vielleicht, weil er ihn selbst gestohlen hat«, meinte Nynus. »Ich war sechs, als er auf die Idee kam, ich könnte der Nächste sein, der es versucht. Also hat er mich einsperren lassen. Mutter – ich meine, die Königin – konnte es nicht verhindern, aber sie tut alles, um mir das Leben so angenehm wie möglich zu machen.«
Plötzlich wurden seine Augen ganz groß. »Deshalb bist du hier! Sie hat dich geschickt, damit du mir Gesellschaft leistest!«
Begeistert schlang er die Arme um Gulph und drückte ihn so fest, dass er ihn vom Boden hob. Gulph ließ es geschehen und versuchte zu verstehen, wie er als Schlangenmensch aus einem Wanderzirkus in eine Fehde der Königsfamilie hatte geraten können. Aber wie musste es erst für Nynus sein? Gulph konnte sich an seine eigenen Eltern zwar überhaupt nicht erinnern, aber auch Nynus wusste nur noch von dem Tag, als sie ihn wegsperrten.
Kein Wunder, dass er so geworden ist.
Nynus lächelte immer noch, als er Gulph wieder absetzte und die Schüsseln vom Boden aufhob.
»Wollen wir teilen?«, fragte er freudig.
Kapitel 3
Schwarzbl…«
Die Worte erstarben auf den blauen Lippen der Frosthexe. Ein Schauer lief ihr über den ganzen Körper. Das Hirschfell glitt zur Seite, und ein weißes, knochiges Handgelenk und eine spinnenartige Hand kamen zum Vorschein.
Tarlan zog die Felldecke wieder zurecht und strich der Hexe über die Stirn. Ihre Haut war kälter als das Eis am Höhleneingang. Er zog noch eine Decke von der Wand herunter und breitete sie über die reglose Gestalt.
»Nicht reden, Mirith«, sagte er. »Ruh dich aus.«
Er nahm einen Stock und stocherte damit im Feuer. Die Flammen leckten etwas höher, aber schon bald blieb nur noch ein schwaches Flackern. Bald würde er frisches Feuerholz holen müssen. Aber so konnte er Mirith nicht alleine lassen. Sie sah so klein aus, so schwach. Wie ein Baby.
Wie er sie so sah, wurde Tarlan leicht schwindlig, als wäre die Zeit stehengeblieben oder hätte sich umgekehrt. Hatte er so ausgesehen, als Mirith ihn vor fünfzehn Jahren als hilfloses Baby fand, verlassen in den eisigen Weiten von Yalasti? Sie hatte ihn aufgehoben, ihn mit sich genommen und für ihn gesorgt, als er aufwuchs.
Wie eine Mutter.
In der Glut am Rand des Feuers stand ein Tontopf mit dem Rest der Brühe, die Tarlan am vorigen Abend gekocht hatte. Er tauchte eine Schale in den Topf und hob sie dampfend heraus.
Er schob Mirith seinen anderen Arm unter die Schulter und setzte sie auf. Sie war so leicht, dass er erschrak. Zum ersten Mal dachte er daran, dass sie vielleicht sterben würde. Der Gedanke entsetzte ihn. Und der darauf folgende Gedanke war noch schlimmer.
Es war seine Aufgabe, für sie zu sorgen. Wenn sie starb, dann war das seine Schuld.
»Hier«, sagte er und hielt ihr die Schale an die Lippen. »Versuch zu trinken.«
Mirith schüttelte den Kopf. Sie nahm ihre Kräfte zusammen, hob zitternd eine Hand unter den Hirschfellen hervor und schob die Schale weg.
»Schwarz…«, sagte sie, bevor ein Hustenanfall sie unterbrach.
»Was? Schwarz was?«
»…blatt… Schwarzblatt.«
Tarlan verwünschte sich, weil er nicht schneller begriffen hatte. »Schwarzblatt? Soll ich das holen? Ist das eine Medizin? Wird sie dir helfen?«
Mirith nickte. Tarlan glaubte fast, dass er die Knochen in ihrem Hals dabei knirschen hörte.
Er stellte die Schale weg und bettete Mirith wieder aufs Lager. Dann sprang er auf, schnappte sich seinen Umhang und zog ihn über die Schultern. Wieder packte ihn der Schwindel. In diesen Umhang war er gewickelt gewesen, als Mirith ihn gefunden hatte. Inzwischen war er so groß geworden, dass er ihn tragen konnte, ohne dass der Saum auf den Boden hing. Er ergriff seinen Jagdspeer und marschierte aus der Höhle.
Kaum war er auf den Vorsprung hinausgetreten, drückte ihn der eisige Wind von Yalasti rückwärts gegen die Felswand. Tarlan lehnte sich dagegen. Sein ganzes Leben schon kannte er diesen Wind, und er war ihm mehr als gewachsen. Er zog den Umhang eng um sich. Der schwarze Samt hielt ihm Schnee und eisige Kälte vom Leib.
Tarlan legte die Hände an den Mund, reckte den Kopf hoch und schrie. Sein Gellen durchdrang den Sturm wie ein Messer. Als ihm der Atem ausging, holte er tief Luft und schrie noch einmal.
Bei seinem dritten Ruf erschienen die Thorrods.
Sie kamen aus einer niedrig hängenden Wolke gestürzt, als hätten sie auf sein Signal gewartet. Vielleicht hatten sie das sogar. Die goldenen Federn an den Spitzen ihrer Schwingen flatterten, als sie auf das Sims niederschwebten. Ihre riesigen gebogenen Schnäbel schimmerten im Morgenlicht. Sie glichen mächtigen Adlern, aber der verständige Ausdruck ihrer Augen hob sie deutlich von anderen Vögeln ab.
Auf Höhe des Felsbandes begannen die vier Tiere zu kreisen. Seethan, der den Schwarm anführte, wandte seinen grauen Kopf Tarlan zu. Thorrods waren etwa so groß wie Pferde – Seethan war mehr als doppelt so groß.
»Irgendetwas stimmt nicht«, sagte der riesige Vogel. Seine Stimme klang wie zersplitterndes Holz.
»Mirith ist krank«, rief Tarlan in der Sprache der Thorrods hinaus in den Wind. »Es geht ihr immer schlechter. Sie braucht Schwarzblatt. Wenn ich ihr keines bringe, dann« – die Worte blieben ihm im Hals stecken –, »dann wird sie sterben, fürchte ich.«
»Ostwald«, sagte Seethan und stieg über die anderen Vögel in die Höhe. Seine Flügel warfen gewaltige, huschende Schatten auf den Felsrand.
»Kitheen!«, rief Tarlan.
Ein Thorrod von der Größe eines Ponys landete auf dem Felsband. Tarlan streckte ihm die geöffnete Hand wie einen Flügel entgegen, und Kitheen berührte sie mit der Spitze seines tödlichen Schnabels – Zeichen gegenseitigen Vertrauens unter Thorrods.
»Wirst du hierbleiben?«, fragte Tarlan. »Und Wache halten?«
Kitheen sagte nichts, sondern hüpfte an Tarlan vorbei, stellte sich vor den Eingang der Höhle und plusterte das Federkleid – schwarz bis auf die goldenen Flügelspitzen – gegen den Wind auf.
Tarlan ballte die ausgestreckte Hand zur Faust. Sofort löste sich ein Thorrodweibchen aus der Formation und strich dicht unterhalb der Felskante vorbei. Tarlan sprang genau im richtigen Augenblick los und landete auf ihrem Rücken. Er hakte die Beine hinter ihren Schwingen ein und hielt sich im dichten Federkragen am Hals fest. Theeta war die Einzige der Thorrods, die vom Schnabel bis zum Schwanz in goldene Federn gekleidet war
»Du hast mich einst im Wald gefunden, Theeta«, sagte Tarlan. »Du hast Mirith zu mir gebracht. Du hast mich gerettet … und nun ist sie es, die wir retten müssen. Flieg, so schnell du kannst!«
Theeta zog mit ihm tief über das schneebedeckte Reich. Seethan und Nasheen mit dem weißen Brustgefieder flogen voran, damit Theeta sich in ihrem Windschatten halten konnte.
Je weiter sie sich von Miriths Einöde in den Bergen entfernten, desto mehr ließ der Wind nach, aber es blieb kalt.
Sie überflogen viele Dörfer, die Häuser aus blankem Eis gehauen. Von zahllosen Feuerstellen stieg Rauch auf. Die Menschen hier trotzten hartnäckig dem endlosen Winter von Yalasti.
Ein dunkler Fleck am Horizont wurde rasch größer. Wenig später flogen sie über den großen Ostwald. Theeta schoss über turmhohe Aschkiefern hinweg. Die Stämme dieser majestätischen Bäume waren im unteren Bereich kahl, aber oben breitete sich eine weite Krone aus glänzenden grünen Nadeln aus. Sie waren mit Harz überzogen, das die Leute als Brennstoff sammelten, um sich im Winter daran zu wärmen.
Tarlan spähte durch die Baumkronen, aber das Grün war zu dicht. »Wo finden wir das Schwarzblatt?«, fragte er.
»Unten«, erwiderte Theeta. »An den Stämmen.«
»Dort«, rief Nasheen und senkte den Schnabel. »Eine Lücke.«
Theeta tauchte zwischen die Wipfel hinab. Tarlan zog den Kopf ein und schloss die Augen, bis sie in den freien Raum unter dem Kronendach durchgestoßen waren.















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













