
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Crown of Three
- Sprache: Deutsch
So gewaltig und episch wie »Game of Thrones«: Der zweite Band der opulenten Fantasy-Trilogie um Macht und Schicksal, Liebe und Verrat, Sieg und Niederlage. Sie wurden in einer schicksalhaften Nacht geboren und dazu auserkoren, ein ganzes Land zu retten: Die Drillinge Gulph, Tarlan und Elodie töteten ihren eigenen Vater, den grausamen König Brutan, um das Königreich Toronia zu befreien. Doch obwohl die Geschwister mit magischen Fähigkeiten ausgestattet sind, ist ihr Kampf nicht nur brutal, sondern auch schwieriger, als sie es sich je hätten ausmalen können. Denn ihr bereits totgeglaubter Vater ist wieder auferstanden – und er schart nun eine Armee der Untoten um sich ... Wird es den Drillingen dennoch gelingen, ihre Heimat Toronia zu retten und von dem Grauen der Tyrannei Brutans zu befreien? »Wie ›Game of Thrones‹ an einem milden Tag.« Publisher's Weekly »Dieser aufregende, mystische und kreative Jugendroman zieht seine Leser sofort in den Bann. […] Spannend, kurzweilig, zauberhaft – ab nach Toronia!« Bücher, Spiele und Co Alle Bände der Crown-of-Three-Trilogie: Crown of Three – Auf goldenen Flügeln (Band 1) Crown of Three – Das Lied der Schlange (Band 2) Crown of Three – Die letzte Schlacht (Band 3)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 513
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
J. D. Rinehart
Crown of Three – Das Lied der Schlange (Bd. 2)
Über dieses Buch
So gewaltig und episch wie »Game of Thrones«: Der zweite Band der opulenten Fantasy-Trilogie um Macht und Schicksal, Liebe und Verrat, Sieg und Niederlage.
Sie wurden in einer schicksalhaften Nacht geboren und dazu auserkoren, ein ganzes Land zu retten: Die Drillinge Gulph, Tarlan und Elodie töteten ihren eigenen Vater, den grausamen König Brutan, um das Königreich Toronia zu befreien.
Doch obwohl die Geschwister mit magischen Fähigkeiten ausgestattet sind, ist ihr Kampf nicht nur brutal, sondern auch schwieriger, als sie es sich je hätten ausmalen können. Denn ihr bereits totgeglaubter Vater ist wieder auferstanden – und er schart nun eine Armee der Untoten um sich ...
Wird es den Drillingen dennoch gelingen, ihre Heimat Toronia zu retten und von dem Grauen der Tyrannei Brutans zu befreien?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
J. D. Rinehart lebt in Nottinghamshire, England. Wenn er nicht gerade schreibt, besichtigt er Burgen, schaut Filme oder streift mit seiner Dänischen Dogge Sir Galahad durch die Natur.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Crown of Three. The Lost Realm« bei Simon & Schuster, New York, USA
Copyright © 2016 by J. D. Rinehart
Für die deutschsprachige Erstausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Für die überarbeitete, deutschsprachige Neuausgabe:
© 2019 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-7336-5190-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Motto
Widmung
Prolog
Erstes Buch
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Zweites Buch
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Drittes Buch
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Nachwort
Mit besonderem Dank an Graham Edwards
Für M.K.
Prolog
Kalia schleppte sich übers Pflaster, so gut es die massiven Eisenstiefel an ihren Füßen zuließen. Ihre Hände steckten in schweren Panzerhandschuhen. Von diesen liefen Ketten zu den Händen der beiden Söldner, die sie den Korridor entlangführten.
Sie haben das getan, weil sie sich vor mir fürchten, sagte sie sich.
Eine Kette zog sich straff und riss schmerzhaft an ihrem Arm.
Aber ich fürchte mich nicht vor euch, dachte sie.
Und fast glaubte sie das auch.
Mitten in der Nacht waren die Söldner gekommen, um sie abzuholen – ganz in Schwarz gekleidet, auf leisen Sohlen. Lautlos. Noch bevor sie richtig wach war, hatten sie ihr die Metallhandschuhe und -stiefel übergestülpt.
»Was hat das zu bedeuten?«, hatte sie gefragt, als man sie aus dem Bett zerrte.
Wortlos hatten die Soldaten sie durch die Tür hinaus auf den Flur gestoßen.
»Wenn der König das erfährt …«, hatte sie gedroht, war aber verstummt, als man sie nur höhnisch angrinste.
Brutan wird in Kürze davon hören. Bis dahin werde ich sie nicht herausfordern.
Die Männer zerrten sie durch Schloss Berg, aber nicht auf den üblichen, öffentlichen Wegen, sondern durch verschlungene Geheimgänge und schmale, tief hinter massivem Mauerwerk verborgene Tunnel. Sie hielten ihre Arme fest gepackt und rissen bei jeder Biegung an ihren Schultern. Mit jedem weiteren Schritt ins Dunkel entfaltete sich Kalias Furcht wie die Blüte einer grausigen schwarzen Rose.
Bald waren die groben Pflastersteine Bodenplatten aus Feuerstein gewichen. Kalias eiserne Stiefel schlugen beim Aufsetzen Funken, deren Widerschein an den Wänden aufblitzte. Zwei schmerzvolle Biegungen weiter endete der Gang in einem breiten, von einem festen Eichentor versperrten Steinbogen. In die Balken war eine Krone mit drei Punkten eingebrannt.
Die Krone von Toronia.
Die Königskrone.
Er hat sie geschickt! Brutan hat seine Soldaten nach mir ausgesandt! Und jetzt wartet er hinter diesem Tor auf mich. Er erwartet seine Beute!
»Ich wäre auch so gekommen«, sagte sie. »Wenn ich gewusst hätte, dass der König mich sehen möchte, wäre ich freiwillig gekommen. Warum auch nicht?«
Sie warf das zerzauste rotgoldene Haar in den Nacken und hoffte, dass sie kühn geklungen hatte. Und doch verkrampfte sich ihr Magen in dunkler Vorahnung. Warum hatte Brutan sie aus dem Bett reißen und herbringen lassen? Und warum in Ketten?
Die Erkenntnis traf sie wie ein Fausthieb, und ihr Herzschlag geriet ins Stocken.
Er hat meine Kinder gefunden. Meine Drillinge. Und wenn er sie mir gezeigt hat, dann wird er sie töten!
Sie biss sich auf die Lippen, um nicht zu schreien.
»Es ist besser, wenn Ihr nicht sprecht«, knurrte der erste Söldner unter seiner schwarzen Kapuze. »Tut einfach, was man Euch sagt. Dann wird es leichter gehen.«
»Wenn der König befiehlt, gehorcht sogar die Geliebte des Königs«, entgegnete sie und verzog verächtlich den Mund.
Sie zuckte unwillkürlich zusammen. Überall im Reich wusste man von ihr; es war allgemein bekannt, dass in Schloss Berg der König wohnte, die Königin … und Kalia. Alle drei.
Drei war eine machtvolle Zahl. Und in Kalias Herzen hatte sie einen ganz besonderen Platz.
Meine drei! Oh, meine Kinder!
»Bitte, sagt mir –«, begann sie, aber es war zu spät. Ein Söldner stieß das Tor auf, und der zweite schob sie in die dahinterliegende Kammer.
Sie stolperte hinein. Außer dem dumpfen Scheppern ihrer Eisenstiefel auf den Steinplatten war nichts zu hören. Sie hielt den Kopf gesenkt, wollte nicht sehen, was sie erwartete.
Nach zwanzig Schritten hielten ihre Bewacher sie ruppig an. Eine kalte Hand packte sie am Kinn und riss ihren Kopf hoch. Sie nahm all ihre Kraft zusammen und starrte König Brutan direkt in die Augen.
Der König saß auf einem einfachen hölzernen Thron, der leicht erhöht auf einem Eichenpodest stand. Neben ihm, auf einem ähnlichen Stuhl, saß Königin Magritt. Trotz der späten Stunde waren beide in vollem königlichen Ornat von Toronia: roten Roben und Goldketten.
»Kalia«, sagte der König. »Schön, dass du gekommen bist.«
Seine Worte waren gütig, aber seine Stimme hallte wie Donnerschall. Seine normalerweise geröteten Wangen waren blass. Sein ganzes Gesicht wirkte verhärtet und grobschlächtig, und Kalia hatte mit einem Mal das Gefühl, dass oben aus den prächtigen Gewändern nicht der Kopf eines Mannes, sondern der eines Tieres herausragte.
»Ich wäre auch freiwillig gekommen«, sagte sie, »wenn du nur darum gebeten hättest.«
»Habe ich aber nicht«, grunzte Brutan. Wortklauberei war nie seine Sache gewesen, er war ein Mann der Tat. Im Umgang war er wie ein widerspenstiger Bär, was Kalia immer Unbehagen bereitet hatte. Neben diesem Rohling saß jedoch jemand, der Kalia noch mehr Schrecken einjagte.
»Willkommen, meine Liebe«, sagte Magritt, wobei die Bosheit in ihrer Stimme das freundliche Lächeln Lügen strafte – und genau hierin lag ihre Macht.
Bären waren im Grunde einfältige Kreaturen.
Magritt dagegen war eine Schlange.
Nun hörte Kalia Schritte hinter sich. Viele Schritte und dazu das Knarzen von Leder und das Klingen von Waffen. Die Soldaten schlossen offenbar die Reihen hinter ihr.
Sie wusste nur zu gut, dass es kein Entkommen gab, blickte aber dennoch nach beiden Seiten. Dies hier war der Untere Saal. Sie befanden sich direkt unter dem großen Thronsaal von Schloss Berg, und genau wie dieser war er lang und breit und wurde von dem Podest mit den beiden Thronsesseln beherrscht. Aber hier war es düster, nur ein paar Fackeln in schwarzen Wandleuchtern warfen flackerndes Licht an die Wände, und die niedrige Decke verstärkte die bedrückende Stimmung.
Kalia fragte sich, wie viele Verbrecher in diesem Gerichtssaal schon ihrem Schicksal gegenübergetreten waren. Wie viele hatten ihre Unschuld beteuert, hatten um ihr Leben gefleht?
Wie viele waren hingerichtet worden?
Ich werde stark sein.
Wieder herrschte Stille. Kalia sah sich um: Wie erwartet war eine ganze Kompanie von Brutans Legion angetreten – hundert Mann, kampfbereit in Bronzerüstung –, um dafür zu sorgen, dass sie hierblieb, bis der König mit ihr fertig war.
Und hier im Unteren Saal konnte das nur eines bedeuten.
»Verräterin!«, rief Brutan unvermittelt und sprang vom Thron auf. »Du hast mich angelogen! Die ganze Zeit hast du mich angelogen!«
»Wie das, mein Herr?«, entgegnete Kalia. Sie hoffte, mit der förmlichen Anrede seine Wut etwas zu besänftigen.
Vergebens.
»Zuerst hast du gesagt, du trägst nur ein Kind in dir. Aber dann waren es drei!« Ihm spritzte schaumiger Speichel auf den buschigen Bart. »Drei, wie von der Prophezeiung vorausgesagt. Der Prophezeiung!«
»Aber die Drillinge waren Eure Kinder, mein Herr. Euer eigen Blut.«
»Und mein Blut hätten sie vergossen!«
»Sie wurden tot geboren. Wie soll ein totes Kind einen König bedrohen?«
»Willst du die Worte der Prophezeiung leugnen? Unter diesen neuen Himmelslichtern werden drei Thronerben kommen. Sie werden ungeahnte Macht erlangen. Sie werden den verfluchten König töten. Und genau in jener Nacht sind drei Sterne am Himmel erschienen, Kalia. Wer weiß, welch andere dunkle Magie dabei noch am Werk war? Hältst du mich für töricht?«
Wohl nicht. Aber wenn je ein König verflucht war, dann du, Brutan!
Sie antwortete so ruhig wie möglich: »Fünf Jahre sind vergangen, seit die drei Sterne am Himmel aufgetaucht sind, mein Herr. Seither ist nichts Schlimmes geschehen. Die Prophezeiung hat sich nicht bewahrheitet. Es besteht keine Gefahr.«
»Doch, natürlich besteht Gefahr, meine Liebe«, erwiderte Magritt von ihrem Thron mit einer Stimme, so seidenweich, wie die ihres Ehegatten grob klang. Das aufreizende Lächeln spielte noch immer um ihre Lippen. »Die Gefahr bist du.«
Kalia schnaubte: »Gefahr? Ihr habt mich hier in Fesseln vorführen lassen! Welche Gefahr soll von mir ausgehen?«
»Du weißt sehr wohl, warum du in Eisen geschlagen wurdest«, entgegnete Magritt.
»Um dich an der Zauberei zu hindern, du verdammte Hexe!«, brüllte Brutan, trat vom Podest herunter und stützte die fleischigen Hände in die Hüften. Sein Gesicht war rot angelaufen, und seine Augen glänzten, ebenso wie der Schweiß auf seiner Stirn.
Das stimmte. Solange Kalias Hände und Füße im kalten, unnachgiebigen Metall eingeschlossen waren, konnte sie ihre besonderen Kräfte nicht entfalten. Aber selbst wenn sie frei gewesen wäre, hätte sie an diesem abscheulichen Ort und in Gegenwart so vieler Männer in Waffen kaum etwas ausrichten können. Ihre Magie war sanft und fein wie die Erde, auf der sie beruhte, und sie taugte nicht im Streit, nur für die Liebe.
Dass die beiden ihre Gaben fürchteten, gab Kalia jedoch neue Kraft.
»Ich habe der Magie vor Jahren abgeschworen – das wisst Ihr nur zu gut«, antwortete sie. Sie suchte Magritts Blick und hielt ihm stand. »Ich habe sie um meines Königs willen abgelegt.«
»Lügnerin!«, schrie Brutan. »Du hast die Wahrheit mit Zaubersprüchen verschleiert. Du behauptest, die Kinder wären tot? Ich behaupte etwas anderes: Als ich in jener Nacht in deine Schlafkammer kam, hast du meine Augen verhext, damit ich glaubte, sie wären es. Sogar Melchior, den treuen Zauberer, hast du getäuscht.«
Wenn du wüsstest, dachte Kalia. Melchior war es gewesen, der den König getäuscht hatte. Was würde Brutan wohl tun, wenn er entdeckte, dass der Zauberer in Wahrheit nicht ihm die Treue hielt, sondern der Prophezeiung, die seinen Untergang bedeutete?
Sie blickte sich noch einmal um, diesmal sah sie zurück zur Tür, durch die man sie gezerrt hatte. Sie wünschte sehnlichst, dass Melchior durch sie hereinkäme.
Aber Melchior kam nicht.
»Die Drillinge sind heute genauso tot, wie sie es schon an jenem Tag waren«, sagte sie und spürte die Bitterkeit dieser Worte. »Warum solltet Ihr etwas anderes behaupten?«
Brutan wischte sich mit dem Handrücken die Spucke aus dem Bart. Er machte – für einen Mann seiner Statur überraschend gewandt – auf dem Absatz kehrt und schnippte mit den Fingern einem der beiden Soldaten zu, die Kalia zum Unteren Saal geführt hatten.
»Bringt ihn her!«, donnerte er.
Kalia blieb das Herz stehen. Ihn herbringen? Wen?
Wie betäubt sah sie den Söldner im Schatten hinter den beiden Thronsesseln verschwinden. Voller Entsetzen erwartete sie, dass er mit einem fünfjährigen Kind im Arm zurückkehrte.
Wird es Tarlan sein? Oder Agulphus?
Der Soldat der Legion zerrte aber kein Kind herein, sondern einen heruntergekommenen Landstreicher. Kalia ließ erleichtert die Schultern sinken. Die Kleider des Mannes waren Lumpen, und sein fettiges Haar starrte vor Schmutz. Er rollte mit den Augen und murmelte unablässig. Als der Soldat ihn losließ, schwankte er und konnte sich kaum aufrecht halten.
Kalias Erleichterung wandelte sich rasch in Verwunderung darüber, wer dieser Mann sein mochte.
König Brutan betrachtete den Landstreicher mit unverhohlenem Abscheu, Magritt indessen erhob sich geschmeidig vom Thron. »Kalia«, sagte sie, »darf ich dir Sir Brax vorstellen? Er hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Wirklich interessant.«
Kalia wollte die Fäuste ballen, aber die schweren Handschuhe ließen das nicht zu. Sir Brax! Du warst Melchiors Verbündeter. Welches meiner Kinder hat er dir anvertraut?
Je länger sie den Landstreicher anstarrte, desto größer wurde ihr Entsetzen. Konnte man sich jemanden vorstellen, der weniger geeignet wäre, um für ein Kind zu sorgen? Sie biss die Zähne zusammen, um ihn nicht anzuschreien.
Was hast du meinem Baby angetan?
Der Söldner stieß Sir Brax mit dem Schwertheft an. Nach einer kurzen Pause – Kalia war davon überzeugt, dass er sich sofort übergeben würde – begann Sir Brax zu reden.
»Jeder von uns hat einen Balg bekommen«, lallte er, offensichtlich betrunken. »Meiner war ein Junge. Am Schloss, ja, von da sind wir dann fortgeritten, vom Schloss. Ich und der Balg.«
Kalia beugte sich vor, um sein Gebrabbel zu verstehen.
»Immer auf Schleichwegen«, stammelte Sir Brax. »Eine Schenke … in Isurien …« Ihm fiel das Kinn auf die Brust, und der Soldat versetzte ihm wieder einen Stoß. Mit glasigen Augen blickte er auf. »In Sicherheit, weit fort vom König … geheim … unter allen Umständen.« Und dann: »Sein Name … er hieß … er …«
Kalia gefror das Blut in den Adern.
»Weiter«, knurrte der Soldat und schüttelte den Mann.
Sir Brax kniff die Augen zusammen. »Er hieß … Allus, oder so? Aphullus?«
Agulphus!, dachte Kalia, Freude und Entsetzen durchströmten sie gleichzeitig. Das ist sein Name! Mein Gulph. Mein armer kleiner Gulph!
Als sich das Gestammel des Mannes verlor, keimte in Kalia ein Funken Hoffnung auf.
Wenn sie seinen Namen nicht wissen, dann können sie ihn auch nicht finden!
Brutan hatte sich abgewandt. Er stand mit geballten Fäusten da und zitterte am ganzen bärenartigen Körper. Magritt dagegen lächelte unentwegt.
»Der arme Sir Brax«, sagte sie. »Sein Verstand ist vom Alkohol zerfressen. Nun, Kalia, wem hast du deine anderen Kinder übergeben? Wirst du uns das vor dem Ende verraten?«
Vor dem Ende!
In Kalias Ohren hallten Magritts Worte wie ein angeknackstes Glockenspiel. Die beiden wollten sie also doch töten. Sie hatten sie nicht hier in den Unteren Saal bringen lassen, um sie zu befragen, und auch nicht, damit sie Sir Brax’ Geschichte zu hören bekam.
Sie haben bereits über mein Schicksal entschieden, dachte sie. Daran ist nichts mehr zu ändern, ganz egal, was ich sage.
Dies war schwer zu ertragen. Sie würde ihre Kinder niemals wiedersehen – sie wäre nicht dabei, wenn sie ihren Vater stürzten und die Krone übernahmen; würde nicht erleben, wie sich ihre Bestimmung erfüllte. Ihr stiegen heiße Tränen in die Augen, aber sie unterdrückte sie mit aller Macht.
Mich können sie töten, dachte Kalia, aber deshalb haben sie noch lange nicht gewonnen.
Sie streckte ihr Kreuz durch. Die Eisenhandschuhe waren beinahe unmenschlich schwer, aber sie hob sie in die Höhe und breitete die Arme aus.
»Sieh mich an, Brutan«, sagte sie leise.
Für einen Moment rührte er sich nicht. Dann, ganz langsam, wandte er sich um, das Gesicht zu einer bedrohlichen Grimasse verzerrt.
»Letzte Worte, Kalia?«, geiferte er. »Dann mach’s kurz – ich habe deinen Anblick so satt.«
»Ihr sagt mir, dass meine Kinder am Leben sind«, erklärte Kalia mit lauter Stimme und hoffte, dass sich ihre Worte aus diesem dunklen, entsetzlichen Ort hinaus in die Nacht erheben würden, so dass sie alle hören konnten, die unter dem Sternenzelt wandelten. »Und ich sage euch, dass es die Wahrheit ist. Meine Kinder haben damals gelebt, und sie leben noch immer, und ihr Leben hat nur einen einzigen Zweck: dir den Tod zu bringen!«
Brutan verzog den Mund. »Ich wusste, dass es so ist! Ich werde sie aufspüren. Und was dich betrifft – du wirst verstummen!«
»Das werde ich nicht! Was bist du doch für ein Ungeheuer, dass du dein eigen Fleisch und Blut als Kreaturen ansiehst, die man jagt und tötet? Nur ein Ungeheuer wie du lässt sein einziges anderes Kind ins Gefängnis sperren, aus Angst, es könnte dich verraten! Ein Junge von sechs Jahren!«
»Schweig, sage ich!«
»Und so wie Prinz Nynus vergessen in der Himmelsgruft sitzt, so ist auch dein eigenes Herz vergessen! Hatte dein geschätztes Toronia jemals einen König, der ihm mehr Leid und Grausamkeit bescherte?«
Sie schleppte sich mit den Eisenstiefeln zwei Schritte nach vorn. Obwohl ihre Arme zitterten, schien das ungeheure Gewicht mit einem Mal ihre Kräfte zu mehren. Ihre Magie mochte eingeschränkt sein, aber ihr blieb immer noch ihre Stimme.
»Sind meine Kinder am Leben? Ja, das sind sie! Werden sie erleben, dass sich die Prophezeiung erfüllt? Unbedingt! Sie werden dein Ende sein, Brutan. Ich weiß das! Und du weißt es auch! Ganz Toronia weiß es! Die Krone der Drei wird wieder ihren angestammten Platz finden. Und du? Du wirst aus dieser Welt verschwinden, als wärst du niemals hier gewesen. Keiner wird dich betrauern, Brutan. Und keiner wird sich an dich erinnern!«
»SCHWEIG!«
Brutan zog sein Schwert und ging auf Kalia zu, während sein Gebrüll wie eine Welle über ihr zusammenschlug. Sie hielt reglos stand und erwartete den Todesstoß. Als er sie erreichte, drückte er ihr die Klinge an die Kehle und fletschte die gelben Zähne.
»Du sollst sterben, Kalia!«
Sie wartete, für einen unerträglich langen Augenblick.
Schließlich senkte Brutan mit zitternden Händen das Schwert und ließ es wieder in die Scheide sinken.
»Du bist eine Hexe, und als Hexe wirst du sterben«, knurrte er. »Kein rascher Abgang durch die Klinge. Kalia, dein Ende wird langsam sein.« Wieder verzog er das aufgedunsene, schwitzende Gesicht. »Du wirst brennen.«
Königin Magritt, die noch immer hinter ihm auf ihrem Thron saß, nickte einmal, mit einem winzigen, zufriedenen Lächeln.
Die beiden Soldaten, die Kalia aus ihrer Schlafkammer gezerrt hatten, führten sie nun in einen kleinen Hof hinter dem Unteren Saal. Turmhoch ragten ringsum die Mauern von Schloss Berg in die Höhe. Kalia fühlte sich wie am Grunde eines rechteckigen, gemauerten Brunnenschachts.
In der Mitte ragte aus einem aus Holz und Stroh aufgeschichteten Haufen ein Pfahl in die Höhe.
Ich werde sterben. Der Gedanke weckte keine Angst in ihr, nur eine verzweifelte Sehnsucht.
Die Söldner hoben sie auf den Scheiterhaufen. Einer riss ihr die Arme nach hinten und legte sie um den Pfahl, der andere band ihr die Handgelenke zusammen. Das Gewicht der ganzen Welt schien die eisernen Handschuhe nach unten zu ziehen. Unter Kalias Eisenstiefeln splitterte das Holz. Der Rest der Kompanie marschierte im Hof auf und verteilte sich entlang der Mauern. Sie war in einen Ring aus Bronze eingeschlossen.
Wortlos entzündete Brutan das Feuer, indem er eine Fackel tief zwischen die Scheite stieß. Dabei funkelte er Kalia böse an. Sie antwortete, wie sie hoffte, mit einem trotzigen Blick.
Der König trat zurück, und alsbald schlugen die Flammen hoch in die Nacht. Kalia wartete auf den Schmerz, aber sie spürte nichts.
Warum tut es nicht weh?, dachte sie. Doch das spielte keine Rolle. Im Innern litt sie Höllenqualen.
Sie legte den Kopf in den Nacken und starrte über die Mauern zum Nachthimmel hinauf. Drei Sterne leuchteten dort: einer grün, einer rot, einer golden. Die Sterne der Prophezeiung.
Die Sterne meiner Kinder, dachte Kalia, während sich der Rauch über ihr schloss und sie ihren Blick verbarg. Was wird aus meinen dreien werden?
Sie würde es nie erfahren.
Plötzlich sah sie etwas, das sich bewegte: Dort war jemand auf einem Mauersims, hoch über ihr. Ein gelber Umhang, weißes Haar.
Melchior!
Der Zauberer blickte auf sie herab, das faltige Gesicht unendlich traurig. Er schwankte, die nackten Füße breit auf den Sims gestemmt, und für einen Augenblick fürchtete Kalia, er würde herabstürzen. Er stützte sich auf seinen Stab und packte ihn mit den knochigen Händen. Seine Finger strichen über die darin eingeschnitzten Runen, und auch seine Lippen bewegten sich. Kalia versuchte, von seinen Lippen zu lesen, konnte die Worte aber nicht erkennen.
Dann begriff sie, dass es keine Worte waren.
Es waren Zahlen.
Ja, Melchior! Wirke deine Magie! Nimm es fort. Nimm all dies fort!
Das Feuer brauste auf, der Rauch hüllte sie ein, hob sie in die Höhe und trug sie fort. Das Letzte, was sie hörte, war Brutans Stimme, der triumphierend brüllte.
Und dann, Dunkelheit.
Erstes Buch
Zwölf Jahre später
Kapitel 1
»Zum Ausfalltor!«, rief Hauptmann Ossilius. »Das ist unsere einzige Chance!«
Er schwang sein Schwert und streckte zwei untote Krieger mit einem Streich nieder. Gulph huschte an seinem Freund vorbei und stieß – eins, zwei – die Krieger mit Tritten an, so dass sie die steile Treppe hinunterstürzten und die heraufdrängenden feindlichen Soldaten wie Kegel umstießen.
»Das sollte uns etwas Zeit verschaffen«, keuchte er, »aber was ist ein Ausfalltor?«
»Unsere letzte Chance.«
Gemeinsam eilten Gulph und Ossilius die restlichen Stufen hinauf, liefen über die Zinne und dann über eine steile Rampe hinunter in einen kleinen, umschlossenen Burghof.
Hier blieben sie aneinandergelehnt stehen und rangen um Atem. Neben dem stattlichen grauhaarigen Hauptmann kam Gulph sich winzig vor, und er überlegte, ob er wohl immer so klein und dürr wie jetzt bleiben würde.
Was sorge ich mich um meine Größe, dachte er und massierte sich den schmerzenden, gekrümmten Rücken. Ich wäre schon froh, wenn ich nur gerade wachsen würde.
»Was ist nun mit deiner letzten Chance?«, fragte er und rückte etwas von seinem Gefährten ab, der noch immer schwer atmete. Ossilius fuhr sich mit der Hand durchs Haar und schob Gulph zu einer Lücke in der Mauer.
»Sieh dort«, keuchte er und deutete durch das geborstene Mauerwerk auf einen gedrungenen Turm in der Stadtmauer.
»Das sieht wie eine Tür aus«, antwortete Gulph. »Aber was ist das auf den Seiten? Statuen?«
Ossilius nickte. »Das ist das Ausfalltor.«
Gulph musterte misstrauisch die weite Fläche zwischen ihnen und ihrem Ziel. Ganze Schwärme von Untoten hieben sich den Weg frei durch Reihen fassungsloser Bürger, aber Genaues war im dichten Rauch, der alles einhüllte, kaum auszumachen. Die gellenden Schreie hörte Gulph allerdings nur allzu deutlich.
Alle Bewohner von Idilliam versuchten zu fliehen, die meisten wurden aber bei dem Versuch gestellt und in Untote verwandelt. Dies war der eigentliche Schrecken: Man wurde vom Feind nicht getötet.
Er machte einen stattdessen zu seinesgleichen.
»Mit jedem Soldaten, den wir verlieren«, flüsterte Gulph, »gewinnen sie einen dazu. Wie sollen wir da siegen?«
Für einen Moment lichtete sich um einen Turm in der Nähe der Rauch, und König Brutan persönlich war zu sehen. Von seinen Knochen hing das Fleisch herunter, von seiner Kleidung waren nur noch flatternde, bluttriefende Fetzen übrig, und in seinen Augen brannte rotes Feuer.
Gulph schloss die Augen und versuchte sich vorzustellen, wie Brutan im Leben ausgesehen hatte. Alles, was ihm in den Sinn kam, war der sich auf seinem Gesicht spiegelnde Verrat, als Gulph ihm die vergiftete Krone auf den Kopf gesetzt hatte.
Ich wusste nicht, dass sie dich umbringt, dachte Gulph. Und ich hätte niemals gedacht, dass dich das zum Ungeheuer macht. Er schüttelte den Kopf und korrigierte sich. Falsch – denn ein Ungeheuer warst du ja schon vorher.
Brutans linke Faust schloss sich um die Kehle eines Mannes; mit der rechten packte er eine Bäuerin. Er hob sie in die Höhe und drückte mit seinen Skelettfingern zu. Beide zappelten kurz, dann schlossen sie die Augen, und ihre Körper erschlafften. Ihre Haut färbte sich weiß, und ihr Fleisch sank in sich zusammen.
Als sie die Augen wieder aufschlugen, waren sie voller Feuer.
Gulph sah entgeistert zu. Bei ihrer überstürzten Flucht übers Schlachtfeld hatten sie dies viele Male geschehen sehen, und noch immer stieß es ihn ab. Noch schlimmer aber war, dass er nun wusste, wer Brutan war.
Du bist mehr als ein Ungeheuer. Du bist mein Vater.
Wieder ergoss sich eine Welle von Stadtbewohnern durch eine Bresche in der Mauer: ganz gewöhnliche Leute, beladen mit Taschen und Kisten und hastig verschnürten Stoffbündeln.
Gulph räumte etwas Schutt der geborstenen Mauer beiseite und winkte die Menge schweigend weiter. Er fragte sich, welche dürftigen Habseligkeiten sie hatten zusammenklauben können, und auch, wohin sie fliehen wollten.
»Sie wissen noch nichts von der Brücke«, sagte Ossilius.
Gulph hielt den Atem an, als die ersten Flüchtigen den Rand des Abgrunds erreichten. Dieser zog sich wie ein Burggraben um die ganze Stadt – nur dass dieser Abgrund bodenlos war. Ein Mann führte seine Kinder an den Rand, blieb stehen und starrte verblüfft auf die Überreste der Felsbrücke, die Idilliam mit dem Rest von Toronia verbunden hatte.
»Sie können nicht weg«, ächzte Gulph. »Es gibt keinen Ausweg. Sie sind hier gefangen. Wir alle sind hier gefangen.«
Er hob die goldene Krone hoch, die er übers Schlachtfeld getragen hatte. So fest hatte er sie gehalten, dass seine Hände verkrampft waren. Jetzt, wo er sie besaß, konnte er sich nicht vorstellen, sie jemals wieder loszulassen – und doch hätte ein Teil von ihm sie am liebsten in den Abgrund geschleudert.
»Noch heute Morgen hat Nynus sie getragen«, sagte er. Ihn schauderte bei dem Gedanken, was Nynus getan hatte, um sie für sich zu gewinnen – und sie zu behalten: Er hatte Gulph getäuscht, so dass dieser ungewollt Brutan tötete, und war dann auf die unselige Idee verfallen, die Brücke zu zerstören, um Idilliam vom übrigen Reich abzutrennen.
»Nynus war auch nicht besser als sein Vater«, sagte Gulph. »Unser Vater.«
»Gulph – Nynus ist tot.«
»Aber die Krone ist immer noch hier! War die Krone daran schuld, dass er all diese schrecklichen Dinge getan hat, Ossilius?« Was wird mit mir geschehen, wenn ich sie aufsetze? Wenn ich zu herrschen versuche? Nach der Prophezeiung bin ich einer der Drei; es ist mir bestimmt, Toronia zu regieren. Aber wenn ich nun auch zu einem solchen Ungeheuer werde wie Brutan oder Nynus?«
Er starrte Ossilius mit großen Augen an, die Krone fest in beiden Händen.
Ossilius sagte feierlich: »Es ist nur eine Krone, sonst nichts, Gulph. Ein Stück Metall. Was du mit ihr anstellst, das bestimmst einzig und allein du.«
Gulph starrte auf das goldene Geschmeide. Was spielte das überhaupt für eine Rolle? Als Nynus gerade gestorben war und Ossilius die Krone aufgehoben und ihm gegeben hatte, da hatte er einen kurzen Augenblick lang geglaubt, alles könnte gut werden. Aber nun herrschte der Tod über Idilliam, es gab nichts mehr zu regieren.
»Wir müssen los«, sagte Ossilius. Vorsichtig löste er eine von Gulphs Händen von der Krone und legte stattdessen ein Schwert hinein. »Bist du bereit?«
»Bereit war ich für nichts von alldem hier«, entgegnete Gulph. Aber er folgte Ossilius, sie zwängten sich mit eingezogenen Köpfen durch das Loch in der Mauer und traten hinaus auf das Schlachtfeld. Im Schatten des nahe gelegenen Turms schloss Brutan die knochigen Finger um den Hals eines etwa fünfzehnjährigen Jungen – Gulphs Alter. Der untote König hievte sein Opfer in die Höhe und betrachtete mit blutroten Augen sein Gesicht.
»Bist du mein Sohn?«, donnerte er. »Bist du der, der mich getötet hat?«
»Lass ihn in Frieden!«, zischte Gulph, aber als er auf die beiden zustürmen wollte, hielt ihn Ossilius zurück.
»Es ist zu spät«, knurrte Ossilius.
Das Gewimmer des Jungen verstummte, als Brutan zudrückte. Einen Moment später war sein Leben zu Ende, und es begann seine neue Existenz als Untoter.
»Rache!«, brüllte Brutan und marschierte weiter. »Das ist meine Rache an meinem Sohn und meinem verräterischen Volk!«
»Ich muss doch etwas tun!«, rief Gulph und schüttelte Ossilius’ Hand von seiner Schulter. »Es ist mir egal, wenn es hoffnungslos ist. Das ist mein Volk. Ich muss kämpfen!«
Er lief in die Rauchschwaden hinaus, aber wieder hielt der Hauptmann ihn fest. »Ich verstehe das, Gulph. Wirklich. Aber jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt zum Kämpfen für dich. Du musst dich jetzt erst einmal verstecken.«
Gulph hörte auf zu zappeln und starrte ihn an. »Verstecken? Was soll das für ein König sein, der sich versteckt, wenn sein Volk ihn braucht?«
»Ein König, der am Leben bleiben will.«
»Eher ein Feigling, finde ich.«
Ossilius schüttelte entnervt den Kopf. »Du weißt doch selbst, dass du diesen Kampf nicht gewinnen kannst, Gulph. Aber du kannst Pläne schmieden. Du kannst Verbündete finden und Waffen beschaffen. Wenn du dich jetzt unauffällig verhältst, kannst du eines Tages wieder aufsteigen.«
Gulph blickte dem Mann ins Gesicht, der dem Alter nach sein Vater, ja sogar sein Großvater hätte sein können. Einen treueren Gefährten konnte man sich gar nicht wünschen. Und trotzdem …
»Die Legion war mein Leben«, fuhr Ossilius fort. »Ich weiß, wann man kämpfen muss, Gulph. Und ich weiß, wann es taktisch klüger ist, sich zurückzuziehen. Und du musst mir glauben, dass das genau jetzt der Fall ist.«
»Aber meine Freunde sind irgendwo hier. Pip und Sidebottom John und die anderen. Ich kann sie doch nicht im Stich lassen. Ich kann niemanden im Stich lassen!«
»Du meinst die Gauklertruppe, mit der du hier angekommen bist? Gulph, das dürfen wir nicht riskieren.«
Gulph blickte auf die Armee der Untoten. Er wusste, dass sein Freund recht hatte. Was konnten sie beide schon ausrichten? Wenn sie versuchten, seine Freunde zu finden, würden sie umkommen.
»Also gut«, sagte er widerwillig. »Gehen wir. Aber wir werden alle mitnehmen, die wir retten können.«
Sie rannten weiter und hielten sich dabei dicht an der Stadtmauer, um dem ärgsten Kampfgetümmel auszuweichen. Der beißende Rauch stach ihnen in die Augen, und Gulph konnte durch den Strom seiner Tränen kaum etwas sehen.
»Pass auf!«, rief Ossilius, als ein verfaulender Krieger hinter einem Haufen von Leichen hervorsprang. Gulph knickte in den Beinen ein, duckte sich und rollte sich so flink von seinem Angreifer weg, dass ihm jedes Publikum begeistert Beifall geklatscht hätte.
Tja, die Tangletree-Truppe war eine gute Schule, dachte er fast übermütig. Ich hab’s noch nicht verlernt.
Als er wieder aufsprang, bemerkte er, dass er sein Schwert verloren hatte, entdeckte aber neben einem Felsblock ein Kurzschwert, das von der Festungsmauer herabgefallen sein musste. Er packte es am Heft, riss es los, wirbelte herum und hieb es dem Krieger quer durch die Brust. Statt Blut spritzten nur Knochensplitter und Staub. Der Untote grinste aus seinem Totenschädel, von dem nur noch Fleischfetzen herunterhingen.
Gulph ging in die Knie und schnellte in einem etwas ungelenken Salto nach hinten. Noch während er auf dem Felsblock landete, stieß er dem Krieger das Schwert in den Schädel. Im selben Augenblick hackte ihm Ossilius auf Kniehöhe die Beine durch.
Die zerstückelten Teile sanken zusammen und zuckten und zischten in einer grotesken Karikatur eines lebendigen Wesens.
»Weiter!«, schrie Ossilius. »Je länger wir hier draußen rumstehen, desto gefährlicher.«
Nach und nach tasteten sie sich vor zu ihrem Ziel.
Ich habe euch nicht verlassen, meine Freunde, dachte Gulph, während er sich durch ein kreischendes Getümmel von Untoten hindurchwand. Ich werde euch holen. Wenn nicht heute, dann morgen. Wenn nicht morgen, dann übermorgen. Ich werde euch holen. Das verspreche ich!
»Hilfe!«
Der Ruf kam von hinter dem Felsblock. Er klang nach einem Mädchen, das nicht älter als Gulph sein könnte.
»Pip?« Er spähte ins Halbdunkel zurück, und sein Herz schlug sehr schnell. »Pip, bist du das?«
Aber es war nicht seine gute alte Freundin, die zu ihm aufblickte. Das Mädchen war sehr viel jünger. Seine Wangen waren blutverschmiert und das blonde Haar völlig verfilzt. Es zitterte am ganzen Körper.
»Komm mit uns«, sagte Gulph, ohne zu zögern. Er streckte die Hand aus, aber das Mädchen starrte ihn nur entsetzt an und rührte sich nicht.
»Gulph, schnell!«, rief Ossilius von vorn. »Wir dürfen nicht stehen bleiben.«
»Warte, Ossilius!«
Der Hauptmann tauchte aus den Rauchschwaden auf. Seine Stirn war gerunzelt, aber seine Züge entspannten sich, als er das kleine Mädchen sah. Behutsam hob er es aus seinem Versteck; dann eilten sie weiter.
»Alles in Ordnung«, sagte Gulph zu dem Mädchen, während sie weiterrannten. »Jetzt bist du in Sicherheit.«
Hoffentlich stimmte das.
Vor ihnen ragte die Ruine des Mausoleums aus dem Rauch. Brutan hatte es einst als trutziges Denkmal des Todes bauen lassen, nun war nur noch eine gewaltige Schutthalde davon übrig. Während sie über die Trümmer kletterten, musste Gulph mit Schaudern an die überirdische Kraft denken, die das gewaltige Gebäude zum Einsturz gebracht hatte.
Limmonis Kraft.
Unter seinen Füßen knirschten zerbrochene Dachziegel – vielleicht dieselben, auf denen die erschöpfte Limmoni gestanden hatte. Ihr das Leben zu nehmen war der letzte Befehl von Nynus während seiner kurzen Herrschaft als König von Toronia gewesen. Eine kurze, wahrlich blutige Regierungszeit.
Wird die meine anders sein?
Ossilius war davon überzeugt, ganz im Gegensatz zu Gulph.
»Dort!«, rief Ossilius. »Das Ausfalltor!«
Gulph musste erst ein paarmal die verrußten Augen zukneifen, bis er den Turm sah, den sie aus der Ferne angepeilt hatten. An seinem Fuß lag das große Steintor mit den beiden Statuen, die Gulph zuvor aufgefallen waren – links ein Mann mit dem Kopf eines Stieres, rechts eine Frau mit Schlangenkopf.
»Dieses Tor meinst du?«, fragte Gulph. »Wo führt es hin?«
Die Kämpfer hatten sie inzwischen hinter sich gelassen. Vielleicht schreckte der dichte Rauch die Menschen – und Unmenschen – ab.
»Das Ausfalltor ist der Hintereingang zur Stadt.«
»Du meinst, es führt direkt zurück in den Kampf? Was wird es uns dann nützen?«
»Wir werden nicht durch dieses Tor gehen.«
»Aber ich dachte …«
Ossilius war schon wieder unterwegs und tauchte mit dem kleinen Mädchen, das er fest an seine Brust gedrückt hielt, in den Rauch ein. Gulph folgte ihm und erreichte den Turm nur wenige Schritte hinter dem Hauptmann.
Sie waren kaum stehen geblieben, als ein Mann hinter dem Standbild mit dem Stierkopf hervortrat. Er trug die Uniform eines Soldaten aus Idilliam und reckte ihnen ein Langschwert entgegen. Gulph fragte sich, was wohl mehr zitterte – sein Arm oder seine Knie.
»Zurück!«, rief der Mann.
»Ganz ruhig, Soldat« entgegnete Ossilius. Er setzte das Mädchen auf dem Boden ab und streckte die Hände aus. »Erkennst du mich?«
Der Mann musterte die völlig verdreckte Uniform des Hauptmanns und riss plötzlich die Augen auf. »Hauptmann Ossilius? Von der Legion?« Er senkte das Schwert und salutierte ungeschickt. »Was sind Eure Befehle, Herr?«
Gulph sah, dass sich hinter der Statue noch etwas bewegte. »Kommt heraus«, rief er. »Alle. Keine Sorge … Wir werden euch nichts tun.«
Es erschienen noch zwei Personen: eine Frau mit einer Bäckerschürze und ein Mann, den Gulph erkannte.
»Du warst mit uns in der Himmelsgruft«, sagte Gulph mit einem Blick auf die Fußeisen, die der Mann noch immer um die Fesseln trug.
»Hab dich noch nie gesehen«, erwiderte der Mann. »An eine Missgeburt wie dich würde ich mich erinnern.«
»Halt’s Maul, Slater«, sagte der Soldat. Er klang aber immer noch ängstlich.
»Soll ich ihn schlagen, mein König?«, fragte Ossilius ganz ruhig.
Slater zog die Augen zu Schlitzen zusammen – die anderen dagegen rissen die Augen auf.
»Nein«, antwortete Gulph prompt. »Er hat nur Angst.«
»König?«, meinte Slater argwöhnisch. »Was meinst du mit ›König‹?«
Ossilius ließ sich langsam auf ein Knie nieder. »Dies ist Agulphus, Sohn von Brutan, einer der Drei. Er ist ein Kind der Sterne der Prophezeiung, hat seinen Vater getötet und die Krone an sich genommen. Du siehst, er hält sie nun fest, bis die Drei wieder vereint sind und gemeinsam den Thron besteigen. Wenn du dich seiner Sache anschließen willst, knie jetzt mit mir nieder und zeige deine Gefolgschaft.«
Dem Soldaten klappte die Kinnlade herunter. Der Frau stockte der Atem. Das kleine Mädchen, das neben dem knienden Hauptmann kauerte, starrte verständnislos zu Gulph hinauf. Slater schnaubte und sah weg.
Gulph hob die Krone hoch; er hatte sie schon die ganze Zeit getragen, aber die kleine Gruppe entdeckte sie erst jetzt. Plötzlich schien sie unglaublich viel zu wiegen.
Fühlt sich so Macht an? Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schwer ist.
Langsam und mit unendlicher Sorgfalt setzte er sich die Krone auf.
»Die Prophezeiung!«, schrie die Frau, sank auf die Knie und rang die Hände vor ihrer Schürze.
»Mein Herr«, sagte der Soldat und presste die Faust an seinen bronzenen Brustschild. »Mein König. Ich, Markus von der königlichen Legion, stehe zu Euren Diensten.«
Slater sah wieder hin und schien Gulph zum ersten Mal zu sehen. Ganz allmählich wich sein unverschämter Gesichtsausdruck großem Erstaunen.
»Das kann doch nicht sein«, sagte er. »Unmöglich.«
»Doch«, antwortete Ossilius. »Das ist es.«
»Ich könnte tatsächlich einem König folgen«, sagte Slater nachdenklich. »Wenn er einen Ort wüsste, an den er mich führen kann.«
»Zufällig«, erwiderte Gulph, »weiß ich einen solchen.«
Kapitel 2
Schon beim Aufwachen wusste Elodie, dass etwas nicht stimmte. Sie kroch über die Decken nach vorn zum Zelteingang, klappte die Stoffbahn beiseite und trat auf die Waldlichtung hinaus.
Ihr Zelt war von einer Armee umringt. Hunderte von Männern und Pferden standen unter dem purpurfarben dämmernden Morgenhimmel und blickten sie an. Im Zwielicht verströmten ihre Gesichter einen schwachen Lichtschein. Sie waren durchsichtig, wie Soldaten aus mattem Glas.
Eine Geisterarmee.
»Was ist los?«, fragte sie, mit einem Mal hellwach.
Ein Ritter gab seinem Pferd die Sporen und kam heran. Er war alt und hager, hielt sich aber kerzengerade, und seine Phantomaugen funkelten hell.
»Wir möchten aufbrechen«, antwortete Sir Jaken.
Elodie war wie vor den Kopf geschlagen.
Sie blickte über die Reihen der Geistersoldaten hinüber zum Lager, wo der Dreizack eben erwachte. Durch die gläsern wirkenden Pferde sah sie gewöhnliche Männer und Frauen, die ihren morgendlichen Pflichten nachgingen: Wasser vom nahe gelegenen Bach herbeiholen, Feuer machen, Tiere füttern. Müde und mit gesenkten Köpfen schleppten sie sich voran.
Ihr habt die Schlacht um die Brücke verloren, ging es Elodie durch den Kopf, und dabei Freunde und Kameraden verloren. Kein Wunder, dass ihr niedergeschlagen ausseht.
Aber sie waren noch immer am Leben, die verbliebenen Rebellen des Dreizacks. Und das verdankten sie der Geisterarmee.
Eine Armee, die nur ich allein sehen kann.
Entschlossen strich sich Elodie das rotgoldene Haar aus dem Gesicht.
»Ihr dürft nicht gehen«, antwortete sie bestimmt. »Das geht einfach nicht. So weit sind wir nun schon gemeinsam gekommen. Diese Menschen brauchen euch. Ich brauche euch. Ihr dürft jetzt nicht umkehren.«
»Es geht nicht darum, umzukehren«, erwiderte Sir Jaken, »sondern darum, weiterzumachen.«
Elodie schüttelte ärgerlich den Kopf. »Da ist so viel zu tun. Gulph ist noch immer in Idilliam eingeschlossen. Ich muss … Tarlan finden. Wir drei müssen doch zusammenfinden. Ich dachte, Ihr wolltet das auch.«
»Nur das Schicksal kann entscheiden, ob du und deine Brüder wieder vereint sein werden. Wir haben unsere Aufgabe erfüllt. Nun suchen wir unseren Frieden.«
Elodie blickte in die Gesichter der Geister. Vom Horizont ergoss sich rotes Licht über den Himmel: ein feuriger Sonnenaufgang.
»Brutan ist ebenfalls in Idilliam«, sagte sie. »Er ist für euren Tod verantwortlich. Habt ihr den Blutkrieg schon vergessen? Sucht ihr keine Vergeltung?«
»Die Vergeltung haben wir hinter uns gelassen.«
Elodies Entsetzen wandelte sich in Verzweiflung. Sie hatte ihre Hoffnung – ihr Herz – auf diese verlorenen Seelen gesetzt.
»Bitte«, flehte sie und rieb sich die Augen. Sie wollte nicht weinen, nicht in ihrer Gegenwart. »Überlegt es euch noch einmal. Ihr wart unsere Brücke über den Abgrund nach Idilliam. Vielleicht brauchen wir diese Brücke noch einmal.«
»Unsere Brücke ist zerbrochen.«
»Und dabei habt ihr eine ganze Kompanie von Brutans untoten Monstern in den Abgrund geschickt! Seht ihr nicht, wie wichtig das für uns war? Ohne euch wäre alles verloren gewesen!«
Elodie brach erschrocken ab, denn sie hatte laut gerufen. Jedem Unbeteiligten musste es vorkommen, als ob sie ins Nichts hinausschrie.
In diesem Augenblick trat ein Junge in der Uniform eines Schildknappen hinter Sir Jakens Pferd hervor. Ihr ganzes Leben lang hatte Elodie Stimmen von Geistern gehört, auch wenn sie sich dessen erst vor wenigen Wochen bewusstgeworden war. Samial war aber der erste Geist, den sie tatsächlich gesehen und mit dem sie sich unterhalten hatte.
Und ihr Freund.
»Samial«, rief sie beschwörend und streckte ihm die Hände entgegen. »Du kannst es ihnen doch bestimmt erklären? Gemeinsam sind wir stark. Wenn wir uns jetzt trennen …«
»Wir verstehen dich«, antwortete Samial. Er warf einen besorgten Blick auf Sir Jaken, der ihm aufmunternd zunickte. »Du hast uns hierhergebracht, Elodie. Du hast uns aus den Weinenden Wäldern geführt, damit wir uns an Brutan rächen können. Du hast uns befreit.«
»Aber wir haben die Schlacht verloren«, widersprach Elodie. »Brutan hält Idilliam noch immer. Er –«
»Ihr habt uns befreit«, wandte Sir Jaken milde ein, »und dadurch aus dem Schatten des Todes geholt. Ihr habt uns unsere letzte Schlacht kämpfen lassen. Diese Schlacht ist nun vorüber. Es wurde Vergeltung geübt, und wir haben unseren Frieden gefunden.«
Die nebelhaften Gesichter der Geister nickten. Elodie stiegen Tränen in die Augen. »Aber ihr könnt doch nicht einfach verschwinden.«
Samial ergriff ihre Hand. So eisig seine geisterhaften Finger sein mochten, tat ihr die Berührung doch wohl. »Elodie, dieser Abschnitt geht zu Ende.«
Sie blickte ihrem Freund in die Augen. »Dann war’s das also? Ihr seid nur gekommen, um euch zu verabschieden?«
»Nein«, antwortete Sir Jaken. »Da ist noch etwas, das du für uns tun musst.«
»Ich? Was könnte ich für euch tun?«
»Du musst uns noch lossprechen.«
Elodie entzog Samial ihre Hand und wandte sich ab. Aber so war es mir doch bestimmt, dachte sie voller Verzweiflung. Ich wurde geboren, um eine Geisterarmee anzuführen. Das weiß ich. Ich bin die Einzige, die das kann. Ohne sie bin ich nur …
»Es sind noch andere Geister in dieser Welt«, hörte sie eine alte, brüchige Stimme sagen.
Elodie sprang auf. Sie hatte Melchior nicht kommen hören – der Zauberer war wie immer barfuß und die Lichtung von einem weichen Moosteppich bedeckt.
Vielleicht ist er auch gar nicht gelaufen, sondern einfach … erschienen.
»Du hast mich erschreckt«, murmelte sie. Dann kam ihr ein Gedanke. »Siehst du sie auch, Melchior?«
Der Zauberer starrte in Richtung der Reihen der angetretenen Ritter. Sein gelber Umhang leuchtete schwach im fahlen Morgenlicht. Seine Hände schlossen sich so fest um seinen hölzernen Stab, dass seine Knöchel weiß anliefen.
»Nein«, meinte er schließlich. »Das ist mir nicht möglich. Ich spüre aber ihren Überdruss mit ihrem Dasein – und du fühlst das auch, glaube ich.«
Elodie wollte widersprechen, aber Melchior hatte recht. Sie spürte es – als langsames, durchdringendes Pulsieren und Schlagen, wie von den Flügeln eines eingesperrten Vogels, der losfliegen möchte.
Sie seufzte. »Also, was soll ich tun?« Wie häufig, wenn sie nervös war, stahl sich ihre Hand zu dem grünen Edelstein, den sie um den Hals trug. Er war inzwischen genauso ein Teil von ihr wie das Blut in ihren Adern; wie das Blut, das sie mit ihren Brüdern verband.
»Es ist eine einfache, aber sehr machtvolle Handlung«, sagte Melchior. »Du musst einen Talisman annehmen – etwas, das diesen verlorenen Seelen etwas bedeutet – und ihn vergraben.«
»Ist das alles?«
»Das ist alles.«
»Wie bei einem Begräbnis?«
»Wie bei einem Begräbnis.«
»Deshalb haben wir dich nach der Schlacht hierhergeführt«, erklärte Samial.
Nun wichen die Phantompferde hinter ihm zurück – teils nach links, teils nach rechts –, so dass sich in der Geisterarmee eine Gasse bildete. An ihrem Ende sah Elodie eine riesige Eiche.
»Ich werde es dir zeigen«, sagte Samial.
Elodie blickte zu Melchior, der breitbeinig dastand und beide Hände auf seinen Stab stützte.
»Ich werde hier warten«, sagte der Zauberer.
Als Samial Elodie zum Baum führte, spürte sie auf urtümliche Weise die Gegenwart der Ritter und ihrer Rösser, die sich um sie drängten. Sie schritt benommen voran, wie im Traum.
Der Baum war riesig und uralt. Die unteren Äste waren dicker als die Stämme vieler Bäume und hingen fast bis zum Boden. Elodie folgte Samial bis an den gewaltigen Fuß der Eiche. Dort entdeckte sie zwischen grünen Flechten einen dunklen Hohlraum.
»Hier«, deutete Samial.
Als Elodie die Hand nach der Öffnung ausstreckte, ächzte der Baum. Erstaunt blickte sie nach oben.
»Hab keine Angst«, meinte Samial.
Sie biss sich auf die Lippe und griff in die Höhlung. Im Innern war es feucht, aber ihre Finger schlossen sich sogleich um etwas Weiches. Sie zog es heraus und hielt es in die Höhe.
»Es ist eine Fahne«, sagte sie verwundert.
»Die Standarte von Morlon«, sagte Samial. »Es sind die Farben, unter denen wir vor all diesen Jahren gekämpft haben.«
»Morlon. Das war Brutans Bruder, nicht wahr?«
Samial nickte. Er strich mit den durchsichtigen Fingern über den ramponierten Stoff der Fahne, zeichnete verblichene, purpurrote Streifen nach und ein Wappen, das vielleicht einmal golden gewesen sein mochte.
»Brutan raubte Morlon den Thron, und wir kämpften dafür, ihn zurückzugewinnen. Wir sind gescheitert. Der letzte unserer Fahnenträger hat sie hier versteckt, am letzten Tag unserer letzten Schlacht.«
Sie ließen den Baum hinter sich, und es öffnete sich eine zweite Gasse in den Reihen der Geisterarmee. Ehrfürchtig schritt Elodie durch die Reihen der toten Ritter voran, die ihr bei dieser letzten Aufgabe Geleit gaben.
Melchior wartete schon am anderen Ende der Gasse und stocherte mit seinem Stab in der weichen Erde.
»Hier ist er«, rief sie und hob die Flagge hoch.« Ihr Talisman.«
Der Zauberer nickte und warf ihr einen kurzen Stock zu. »Hilf mir beim Graben, Elodie.«
Sie machte sich mit dem Stock an die Arbeit, erkannte aber bald, dass sie mit bloßen Händen schneller vorankam. Auf Burg Vicerin hätte ich das einen Diener machen lassen. Einen Erdklumpen nach dem anderen löste sie heraus und legte sie neben dem Loch beiseite. Die Vicerins hatten Elodie wie eine Tochter großgezogen, wollten sie aber benutzen, um den Thron für sich selbst zu gewinnen. Jetzt würden sie mich wohl kaum wiedererkennen, dachte sie mit einem Blick auf ihre schmutzigen Hände.
Als die Grube ausgehoben war, blieb Elodie am Boden knien. Die Grube sah aus wie ein Grab.
»Was tun wir jetzt?«, fragte sie.
»Ich glaube, das weißt du«, antwortete Melchior sanft.
Elodie hob die Flagge auf, faltete sie und legte sie in die Grube.
»Und jetzt bedecke sie«, sagte Melchior.
»Sollten wir vielleicht etwas sagen?«
»Möchtest du das?«
Elodie schüttelte den Kopf. Sie war zu mitgenommen, um zu denken, geschweige denn zu sprechen.
Melchior berührte sie an der Schulter. »Gräme dich nicht, wenn dir die Worte fehlen, Elodie. Es ist schon alles gesagt. Hier geht es um Taten, nicht um Worte.«
Das Gefühl der Trauer wurde stärker, als sie eine Handvoll Erde aufnahm und über der Fahne verteilte. Im selben Augenblick lief es wie Wellen durch die Geisterarmee.
»Noch eine«, sagte Melchior.
Elodie gehorchte. Mit jeder Handvoll Erde wurden die Wellen stärker. Elodie schloss die Augen, und während sie mit den Händen weiterschaufelte, spürte sie eine seltsame Bewegung in der Luft, die sie umgab.
»Ah, hier seid Ihr, Prinzessin Elodie. Melchior – Euch einen guten Morgen.«
Die Stimme riss sie aus ihren Gedanken. Sie wandte sich um und sah Fessan, dessen hohe Gestalt sich vor dem roten Himmel abzeichnete, der sich rasch zu Orange aufhellte.
»Ein neuer Tag«, bemerkte Melchior und erhob sich mühsam.
»Und unser letzter hier, denke ich«, seufzte Fessan. Das flache Morgenlicht zeichnete scharfe Linien in sein Gesicht, so dass er müde und sehr viel älter wirkte als der jugendliche Kommandant, der Elodie noch von ihrem ersten Zusammentreffen in Erinnerung war.
»Ich denke, wir sollten das Lager morgen abbrechen«, fuhr Fessan fort. »Bei der Schlacht um die Brücke haben wir viele Kämpfer verloren und müssen unbedingt neue Soldaten anwerben. Außerdem brauchen die Leute ein Ziel. Der Dreizack muss auch weiterhin –« Er brach ab und schien das Loch im Boden erst jetzt zu bemerken. »Was tut Ihr da?«
Elodie ärgerte sich etwas über die Unterbrechung, stand auf und wischte sich die Erde von den Händen. »Ich ehre diejenigen, die uns geholfen haben, Fessan.«
»Ehren? Wen ehrt Ihr?« Die Narbe, die sich an seiner Wange seitlich herunterzog, zuckte, und er sah sich auf der Lichtung um, wobei sein Blick durch die Geister hindurchging.
»Meine Armee. Unsere Verbündeten. Die Ritter, die den Dreizack gerettet haben.«
»Die Geister?« Fessan machte große Augen. »Sind sie denn jetzt hier?«
»Das sind sie, aber sie verlassen uns. Ihre Aufgabe ist erfüllt, und es ist an der Zeit, dass ich sie losspreche.«
»Sie verlassen uns? Aber Prinzessin, die Hälfte unserer Soldaten ist auf der Brücke gefallen. Und viele der Überlebenden sind verwundet. Ohne Eure … Eure Freunde wären wir vernichtet worden. Ihr dürft sie nicht gehen lassen! Wir brauchen sie!«
Fessan bebte am ganzen Körper. Elodie war bestürzt. Hatte Fessan jemals in ihrer Gegenwart die Beherrschung verloren? Wohl kaum. Angesichts seiner Vorwürfe wurde sie nun selbst wütend.
»Wie könnt Ihr es wagen?«, blaffte sie. »Diese … diese Krieger haben das Recht, ihren Frieden zu finden. Es steht Euch nicht zu, das in Frage zu stellen. Sie haben ihre Pflicht getan. Und ich werde ihnen ihre Ruhe gewähren.«
»Das lasse ich nicht zu!« Fessan stemmte die Fäuste in die Seiten.
»Doch, das wirst du«, sagte Melchior und trat zwischen die beiden. Er tippte mit seinem Stab auf die zur Hälfte bedeckte Fahne. »Dies ist eine Blutschuld, Fessan. Als Mann des Schwertes solltest du das verstehen.«
Fessan ließ die Schultern sinken. Mit einem Mal wirkte er sehr erschöpft. »Der Dreizack setzt auf mich. Ich bin ihm verpflichtet.«
»Und die Geister setzen auf Elodie«, erwiderte Melchior. »Sie ist ihnen ebenfalls verpflichtet.«
Auf Fessans Gesicht waren die widerstrebenden Gefühle abzulesen. Schließlich sagte er knapp: »Also gut. Tut, was Ihr tun müsst. Ich hoffe nur, dass der Dreizack nicht mit weiteren Opfern dafür bezahlen wird.«
Er machte auf dem Absatz kehrt und stürmte zum Lager zurück. Elodie blickte ihm nach, bis er zwischen den Bäumen verschwunden war.
»Er hat so viel für mich getan«, sagte sie. »Er hat so hart dafür gekämpft, mich auf den Thron zu bringen. Und eine Armee für mich aufgestellt, Melchior. Auf der Brücke hat er so viele Männer verloren. Aber … warum muss er mir das alles noch schwerer machen?«
»Fessan ist ein großer Anführer«, antwortete Melchior, »und er trägt große Verantwortung. Ebenso wie du, Elodie. Jeder auf seine Weise. Er ist ein guter Mann. Deshalb habe ich ihn zum Anführer des Dreizacks gemacht.« Er wandte sich wieder dem Loch im Boden zu. »Und jetzt müssen wir zu Ende bringen, was wir begonnen haben.«
Schweigend machten sie sich wieder an die Arbeit. Während Elodie die Flagge begrub, ließ ihr Ärger über Fessan langsam nach. Auch alles andere schien von ihr abzufallen, und irgendwann gab es nur noch sie, ihre Hände und die feuchte Erde, die sie berührten.
»Es ist fast vollbracht«, sagte Melchior leise.
Blinzelnd tauchte Elodie aus ihren Gedanken auf. Nun war nur noch ein winziger Zipfel der Flagge zu sehen. Sie hielt mit der letzten Handvoll Erde inne. Alle Blicke der Geisterarmee waren auf sie gerichtet, lautlos wie angehaltener Atem.
Plötzlich riss sie den Kopf herum. Ja, sie musste die Armee freigeben, aber sie ertrug es nicht, alle zu verlieren – noch nicht. »Samial?«
»Ich bin hier.« Wie aus dem Nichts trat er vor, ein müdes Lächeln im schmalen, schmutzigen Gesicht.
Sie schloss die Augen und schlug sie wieder auf. »Samial, gib mir eine ehrliche Antwort. Möchtest du, dass ich dich losspreche?«
»Nicht wenn du möchtest, dass ich bleibe«, antwortete er sofort.
Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Das möchte ich aber, Samial. Wirklich.«
»Dann nimm dies hier.« Der jugendliche Geist zog eine Pfeilspitze aus seinem Waffenrock. Er hielt sie in die Höhe, und ein Lichtstrahl, der durch die Bäume herabfiel, zeichnete eine gelbe Spur auf die scharfe Kante. »Sie war immer mein Glücksbringer. Wenn du sie behältst, behältst du auch mich.«
Mit zitternden Fingern ergriff Elodie die Pfeilspitze und schob sie in die Tasche ihres Kleides. Sie musste schlucken. Dann hob sie den Kopf und sah sich mit einem unsicheren Lächeln zu Sir Jaken und den Reihen der Ritter um.
»Lebt wohl«, sagte sie. »Und habt Dank.« Dann streute sie den Rest der Erde über die Fahne.
Die Geister der Ritter und ihrer Pferde leuchteten hell auf, und Elodie wich geblendet einen Schritt zurück und schirmte die Augen mit der Hand ab. Die Kämpfer hoben die Arme zum letzten Gruß. Dann lösten sie sich im Morgenlicht auf und verblassten wie ein vergessener Traum.
Einen Augenblick lang starrte Elodie auf die leere Fläche vor den Bäumen. Samial neben ihr neigte den Kopf.
»Nun gut«, meinte Elodie mit einem langen, schwermütigen Seufzer. »Es ist geschehen. Ich hoffe nur, dass ich das Richtige getan habe.«
»Was sagt dir dein Herz?«, fragte Melchior. Er stand etwas abseits an einen Baum gelehnt.
»Dass ich mein Bestes getan habe. Aber reicht das?«
»Genau wie deine Mutter«, murmelte er.
Seine Worte rissen Elodie aus ihrer Trauer. Ihr Kopf schnellte zu ihm herum. »Meine Mutter? Du hast meine Mutter gekannt?«
»Ja.«
Er sagte das so beiläufig, dass Elodie zuerst dachte, sie hätte sich verhört. Sein feines Lächeln verriet ihr aber, dass es nicht so war. Sie ging auf ihn zu. »Erzähl mir von ihr!«
Der Zauberer blickte zur Seite und schien nachzudenken. Elodie kam er vor wie ein Reiher, der am Bachufer geduldig darauf wartete, dass ein Fisch vorüberkam.
»Sie hieß Kalia«, sagte er schließlich. »Sie war eine Erdhexe, und ich habe niemals eine Mutter gesehen, die ihre Kinder mehr geliebt hat. Sie war bereit, alles für euch aufzugeben. Selbst ihr eigenes Leben.«
Alles in Elodie kam abrupt zum Stehen: ihr Herzschlag, das Pulsieren des Blutes in ihren Adern, selbst ihr Atem.
»Die Vicerins haben mir erzählt, meine Mutter sei eine Bäuerin gewesen«, sagte sie stockend. »Aber das war wohl auch gelogen, nicht wahr? Sie war eine Hexe! Kein Wunder, dass sie mir das nicht erzählt haben.«
»Und wenn sie es getan hätten?«
Ihr zuckte ein Schmunzeln um die Lippen. »Dann hätte ich wohl nicht zugelassen, dass mich Lord Vicerin wie ein Püppchen behandelt. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie er versucht, ohne mich an die Krone zu kommen.« Sie blickte sich nach Samial um, der noch immer neben der begrabenen Standarte am Boden kniete. Da kam ihr ein Gedanke. »Dann hatte meine Mutter also magische Fähigkeiten! Ist das der Grund, weshalb ich so bin, Melchior? Konnte sie auch Geister sehen?«
»Das ist möglich.«
»Und wo ist sie jetzt?«
»Es tut mir leid, Elodie. Ich weiß nicht, wie ich dir das erklären soll. Als Brutan entdeckte, dass ihr drei noch am Leben seid, ließ er deine Mutter auf dem Scheiterhaufen verbrennen.«
Elodie war mit einem Mal eiskalt. »Dann ist sie …«
Der alte Zauberer nickte. »Ja. Ich fürchte, dass deine Mutter wahrscheinlich tot ist.«
Sie blickte ihn scharf an. »Wahrscheinlich?«
»So ist es. Als ich von der Hinrichtung erfuhr, versuchte ich einzugreifen. Aber Brutan hatte alle Zugänge zum Unteren Saal versperren lassen.«
»Welcher Untere Saal?«
»Egal. Ich musste einen anderen Weg finden. Ich schaffte es hinauf auf den Wehrgang, aber es war schon zu spät, um das Feuer zu ersticken, wie ich geplant hatte. Ich musste improvisieren.«
»Was ist geschehen?«
Melchior starrte mit seinen blauen Augen in die Ferne, vielleicht auch zurück in die Vergangenheit. Seine Finger strichen dabei rastlos über die Runen auf seinem Stab. Seine Zehen bohrten sich in die Erde.
»Ich versuchte einen Zauber, an den sich kein vernünftiger Zauberer jemals wagen würde. Einen Augenblick vor ihrem Tod versuchte ich, sie dieser Welt zu entrücken.
»Du … hast sie gerettet?«, fragte sie verwirrt. Bestand etwa Hoffnung, dass ihre Mutter noch am Leben war?
Melchiors Blick fand Elodies Augen. »Ich weiß es nicht. Diese Magie, die ich benutzte, ist uralt und … roh. Wer der Welt entrückt ist, befindet sich jenseits von Leben und Tod in einem Reich, das wenig mit beidem zu tun hat. Der Vorgang birgt viele Gefahren. Und um jemanden zurückzuholen …«
Elodies Begeisterung wuchs mit jedem seiner Worte. »Aber du glaubst, es könnte dir gelungen sein! Es ist doch so, nicht wahr?«
Der Zauberer schüttelte den Kopf. »Ich kann es nicht sagen. Auf dem Scheiterhaufen fand ich später nichts als Asche.« Er seufzte. »Je älter ich werde, desto mehr begreife ich, dass die Zauberei mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet.«
»Aber dein Zauberspruch könnte gewirkt haben.« Elodie rang noch immer mit der Vorstellung und versuchte, in ihrem Kopf dafür Platz zu schaffen. »Die Fragen kümmern mich nicht, Melchior – ich bin nur froh, dass wir einen Zauberer auf unserer Seite haben!«
»Ach, aber im Augenblick habt ihr das nicht.«
Elodie starrte ihn fassungslos an. »Was? Wie meinst du das, du bist nicht auf unserer Seite?«
Um den Mund des Zauberers spielte ein Lächeln. »So habe ich das nicht gemeint, Elodie. An meiner Treue darfst du nicht zweifeln, ich werde bis zum Ende zu euch halten. Ich wollte nur sagen, dass ich kein Zauberer mehr bin.«
Elodie starrte ihn an.
»Der Entrückungszauber ist verboten. Als ich ihn angewandt habe, um deine Mutter zu retten – es zu versuchen –, habe ich alle Gesetze der Zauberei gebrochen. In dem Augenblick, als ich den Spruch anwandte, entzogen mir die Sterne meine Fähigkeiten. Seit diesem Tag vor zwölf Jahren wandere ich machtlos durch die Welt. Ja, hier und da konnte ich mich nützlich machen; so habe ich Fessan geholfen, den Dreizack zu erschaffen. Aber jetzt, fürchte ich, brauchst du mehr als einen gebrechlichen alten Mann. Es ist Zeit, dass ich das Verlorene wiedererlange.«
»Du meinst, dass du deine magischen Kräfte zurückbekommst? Ist so etwas überhaupt möglich?«
»Ich weiß es nicht. Aber ich muss es versuchen. Dazu muss ich mich auf eine Reise machen und an ihrem Ende in den Ozean der Zeit eintauchen, um mich vor den Sternen zu rechtfertigen.«
Elodie bekam am ganzen Körper Gänsehaut. Ihr kam es vor, als wäre der gebeugte alte Mann mit dem zerschlissenen gelben Umhang, der vor ihr stand, überhaupt kein Mensch.
»Ich erzähle dir das alles im Vertrauen«, sagte Melchior und legte ihr die knorrige Hand auf die Schulter. »Der Dreizack braucht das nicht zu wissen. Fessan braucht das nicht zu wissen – seine Last ist auch so schon schwer genug. Bis ich meine Kräfte wiedererlange, soll das unser Geheimnis bleiben. Wirst du es bewahren?«
Elodie nickte stumm. Seit sie am Morgen aufgewacht war, schien die ganze Welt gekippt zu sein, so dass sie gefährlich zwischen Vergangenheit und Zukunft balancieren musste. Sie presste die Hand auf ihre Tasche und fand Trost in der Härte der Pfeilspitze, die Samial ihr gegeben hatte. Einen Glücksbringer hatte er sie genannt.
Nun, ein bisschen Glück könnte uns jetzt nicht schaden.
Und endlich hob sich weit hinter den Bäumen die Morgensonne über den Horizont.
Kapitel 3
»Festhalten!«, rief Tarlan. »Wir sind da!«
Er vergrub die Finger in Theetas goldener Halskrause und beugte sich vor, als der gewaltige Thorrod zu den Bäumen hinabtauchte. Den vier Frauen, die hinter ihm saßen, stockte der Atem und sie klammerten sich aneinander.
Tarlan blickte nach rechts und links, wo Nasheen und Kitheen in vollendeter Formation neben ihm flogen, jeder mit weiteren fünf Geretteten auf dem Rücken. Es war sehr gefährlich, diese armen Menschen vom rauchgeschwängerten Schlachtfeld in Idilliam aufzulesen, und auf dem Weg über den Abgrund, der die Stadt umgab, hatte er befürchtet, die Passagiere könnten abstürzen. Aber nun waren sie hier und schwebten über den Wäldern Isuriens zurück zum Lager des Dreizacks. Dies war nun schon der dritte Rettungsflug.
Wie viele werden es wohl noch sein, bis ich meinen Bruder finde?
Mit einem wilden Schrei breitete Theeta die Schwingen aus, bremste ihren Sinkflug und schwebte majestätisch auf die Waldlichtung. Unter ihnen zog eine Reihe Zelte vorbei, Tarlan sah viele verwundete Soldaten davorliegen und in die Morgensonne hinaufblicken. Sein Flügelross zog über eine Feldschmiede hinweg, wo man eifrig zerbrochene Waffen instand setzte. Er steuerte Theeta auf eine Freifläche zwischen einer riesigen Feuerstelle und einem Pferch mit Pferden, wo sie schließlich aufsetzten.

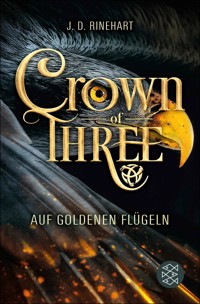













![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













