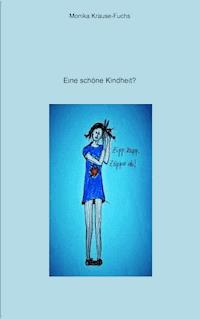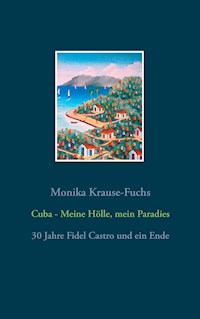
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit diesem beeindruckenden Werk, das drei Jahrzehnte ihres Lebens und Wirkens in Kuba widerspiegelt, bietet Monika Krause-Fuchs einen sehr realistischen Blick auf die kubanische Wirklichkeit nach dem Sieg der Revolution von Fidel Castro im Jahre 1959. Mit einem in Kuba lebenden Spanier verheiratet, gründet sie im Auftrag der Ersten Dame Kubas, der Präsidentin der Kubanischen Frauenföderation, Ehefrau von Rául Castro, des jetzigen Staatschefs, das Nationale Zentrum für Sexualerziehung. Sehr bald wird sie eine der bekanntesten Persönlichkeiten der Insel, geehrt, geliebt, gehasst und verteufelt. Inmitten des sozialen Chaos der Revolution hat sie die Zivilcourage, sich zur öffentlichen Verfechterin der sexuellen Gleichberechtigung der Frau zu etablieren. Für tausende und abertausende von Teenagern wird sie zur vertrauten Beraterin. Wie so viele andere, die einmal glaubten, dass die Revolution eine Utopie erfüllen würde, hat auch Monika Krause-Fuchs letztendlich begriffen, dass sich hinter den proklamierten Idealen die Diktatur eines Caudillo verbirgt und sie entschließt sich, zusammen mit ihren in Kuba geborenen Söhnen nach Deutschland zurückzukehren.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 666
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALT
Vorwort zur spanischen Ausgabe von Jesús Díaz
I. Kapitel:
Die Rückkehr
Nach Berlin
II. Kapitel:
Der Beginn
III. Kapitel:
Mit dem Schiff nach Havanna
Meine ersten Erfahrungen auf kubanischem Boden
Noch eine Barbarei!
IV. Kapitel
Gespräch mit dem Rektor der Universität Havanna
Der Mörder Ventura besucht Mary, und Paco und ich besuchen Victor Manuel
V. Kapitel:
Filmarbeiten mit der DEFA
Die Oktoberkrise von 1962
VI. Kapitel:
Unser Sohn erblickt das Licht der kubanischen Realität
VII. Kapitel:
Ein beinahe fataler Unfall
Meine Eltern in Havanna
Wir ziehen in den europäischen Eisschrank
VIII. Kapitel:
Von neuem in Havanna
Der erste hautnah erlebte Hurrikan
Dictys, der Tischtennisball
Unsere Familie vervollständigt sich
Wir reisen nach New York
Dani kehrt ins Leben zurück
Ferien bei den deutschen Großeltern
Aufnahmeprüfung in der Schwimmschule
Dani lockt uns total aus der Reserve
IX. Kapitel:
Vervollständigung meines Studiums
Die Kinder werden größer
Meine Diplomarbeit
Das „Jahr der 10 Millionen“
Eine feste Anstellung
X. Kapitel:
Wir ziehen um nach Chile
XI. Kapitel:
Es ist etwas Schreckliches passiert
Die Arbeit in der FMC, der Kubanischen
Frauenföderation
XII. Kapitel:
Danis ‚Promenadenmischungsschule’
Die beiden Jungen treiben Sport
XIII. Kapitel:
Beginn der Sexualerziehung
Mein Kapitän verschwindet
Überschwemmung in unserer Wohnung
Ein Unfall stellt die Weichen für mein weiteres Berufsleben
XIV. Kapitel:
Ein Pilotprogramm in Internatsschulen
Die ersten Bücher über Sexualität werden veröffentlicht
Ein sehr populäres Radioprogramm
Der unverhoffte Besuch eines „Macho herido“
Danis Elend in der Schule für besonders begabte Kinder
XV. Kapitel:
Dictys erlebt am eigenen Leib die „Wonnen“ des Volksbildungssystems
Vaters Tod
Mutter besucht uns zum letzten Mal
Ich, Mitglied des Nationalkomitees der Kubanischen Frauenföderation?
Meine Promotion und meine Habilitation, Ernennung
Zum Professor am Institut für Medizinische Wissenschaften
Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm:
Die kubanische Jugend ist von Machismo geprägt
Meine Jungen werden Männer
In Berlin öffnet sich die Mauer
Der Kreis schließt sich
Vorwort
(zu „Monika y la Revolución“)
Eine Liebesgeschichte
Die Geschichte zieht an unseren Augen vorüber, aber wir sehen sie nicht; die Turbulenzen der Ereignisse hindern uns daran. Nur der Ablauf der Zeit klärt, bringt die Dinge an ihren Platz und erlaubt den folgenden Generationen von Historikern, ihre Arbeit zu tun und auf ihre ganz eigene Art die Vergangenheit zu lesen.
Und dann geschieht es, dass einige Ereignisse, einige Bücher für immer bleiben, und sie erhalten unvermeidlich die Aufmerksamkeit aller Generationen von zukünftigen Historikern und werden Klassiker. Das ist zum Beispiel der Fall beim politischen Essay über die Insel Cuba von Alexander von Humboldt. Es war der erste Blick eines Deutschen auf unser Land, geschrieben zu Beginn des XIX. Jahrhunderts, und bis heute ist das die seriöseste Analyse des Werdens Kubas.
Die Arbeit Humboldts steht in der Tradition der Buchbetrachtungen von Europäern über Amerika, begonnen von Christoph Kolumbus mit seinem unentbehrlichen TAGEBUCH und fortgesetzt von einem Heer von Reisenden – Militärs, Handelsleute oder Wissenschaftler –, ohne deren Werk es einfach unmöglich wäre, die Welt, in der wir leben, zu verstehen.
Die erwähnten Autoren waren fast immer Männer; aber dennoch gab es auch einige Frauen, die sich, Nachteile in Kauf nehmend und Vorurteile besiegend, aus eigenem Recht in diese Tradition einschrieben. Sicherlich wären wir ohne das Vermächtnis dieser Frauen spirituell viel ärmer. Im kubanischen Fall brillieren zwei, die Schwedin Frederica Bremer und die Frankokreolin Mercedes de Santa Cruz y Montalvo, Gräfin von Merlin. Mit diesem Buch reiht sich der Name der Deutschkubanerin Monika Krause in die Liste der auserwählten Europäerinnen ein, ohne deren Werk es nicht möglich wäre, Kuba zu verstehen.
Die junge Monika lebte in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, sie zog auf die Insel aus Liebe, und sie blieb dort aus Liebe zur Insel, viele Jahre lang. Sie hat zwei kubanische Söhne. Es gelang ihr, den hervorragenden Blick eines Sozialwissenschaftlers zu entwickeln, den Blick dessen, der mitten in den Ereignissen steht, wobei sie gleichzeitig eine hinreichend distanzierte Perspektive behielt, um sie mit kritischen Augen zu analysieren.
Während ihrer kubanischen Jahre – in Wirklichkeit ein ganzes Leben – hat Monika Krause ihre Intelligenz und Sensibilität dem Studium eines zentralen Themas gewidmet: der Sexualität. Ein ganz besonders dorniges Thema inmitten des sozialen Chaos der Revolution.
Tatsächlich, Kuba hatte noch nicht zu einer Nation gefunden – hat es bis heute nicht –, und die Familie als einzige Struktur, die eine gewisse Ordnung, einen gewissen Zusammenhalt garantierte, löste sich in Luft auf seit dem Erdbeben, das 1959 begann und bis heute anhält.
In Sachen Sexualerziehung – und in vielen anderen auch, die hier nicht behandelt werden können – war die Gesellschaft im wörtlichen Sinne blind und bewegte sich tastend zwischen Ignoranz und Vorurteil.
Monika Krause hatte den Mut der Wissenschaftlerin, in dieses schattenhafte Labyrinth einzudringen. Dabei begrenzte sie sich nicht auf kleinen Raum, nein, sie hatte die Zivilcourage, sich zur öffentlichen Verfechterin einer kohärenten Politik auf dem Gebiet der Sexualität zu etablieren.
Systematisch zeigte sie sich im Radio, im Fernsehen, in der schriftlichen Presse und in gesellschaftlichen Organisationen. Und sie wurde eine der beliebtesten Personen des Landes, mehr noch, sie wurde ein Symbol, und noch mehr als das: Sie wurde die vertraute Beraterin für Tausende und Abertausende von Jugendlichen, vor allem von jungen Mädchen, die nicht wussten, wie sie ihre Pubertät und das Heranwachsen bewältigen sollten.
Ebenso wie so viele andere Kubaner, die einmal glaubten, dass die Revolution eine Utopie erfüllen würde, wie zum Beispiel auch ich, hatte auch Monika Krause letztendlich begriffen, dass sich hinter den proklamierten Idealen die Diktatur eines Caudillo verbarg, und sie entschloss sich, zu ihren Wurzeln, nach Deutschland, zurückzukehren.
Aber sie wird nie aufhören, Kubanerin zu sein, sie wird nie aufhören, in die besten humanistischen Traditionen unseres Landes eingeprägt zu sein, wie es dieses wunderbare Buch beweist, wofür wir ihr nie genug danken können.
Jesús Díaz
Schriftsteller
I. Kapitel
Die Rückkehr
Es ist vier Uhr nachmittags am 10. November 1990. Ein letzter Blick auf den Garten, die Zimmer, die Hunderte von Büchern, auf unsere geliebten Gemälde – eine Sammlung von Werken zeitgenössischer kubanischer Maler. Fast alle Bilder sind persönliche Geschenke. Rumba, unsere entzückende, unerziehbare Foxterrierhündin, folgt mir auf Schritt und Tritt. Sie hat gemerkt, dass etwas Ungewöhnliches in der Luft liegt. Es scheint, als ob wir sie angesteckt haben mit der Traurigkeit und der Angst so kurz vor Beginn unseres Abenteuers.
Glücklicherweise haben wir keine Zeit mehr nachzudenken. Nach einer endgültigen Durchsicht aller unserer Papiere brechen wir zum Flughafen auf. Diese Fahrt habe ich schon so oft gemacht, dass ich jedes Schlagloch kenne.
Drei Stunden vor der geplanten Abflugszeit müssen wir auf dem Flugplatz sein; drei Stunden, die mir wie drei Jahre vorkommen. Mein angerosteter, verbeulter Pannenrekordhalter, ein „Sowjet-Mercedes“ Marke Lada, fährt schnaufend wie ein asthmageplagtes Nilpferd. Sein Zustand ist bedauernswert; nach einem Zusammenstoß mit einem Bus vor einigen Wochen hat er fast aufgehört, ein Auto zu sein, aber heute benimmt er sich heldenhaft. Kein einziger Aussetzer während der langen Fahrt zum Flughafen.
Begleitpersonen haben keinen Zugang zum Abfertigungsbereich auf dem Flughafen. Jesús, mein Exliebster, mein Exehemann und jetziger Freund auf Lebenszeit, verabschiedet sich von mir und von Dani, unserem jüngsten Sohn. Ich setze den Schlusspunkt unter mein fast drei Jahrzehnte langes Leben in Kuba.
Für unsere Freunde, Kollegen und Angehörigen machen Dani und ich eine Urlaubsreise zu meiner Mutter. In einem Monat werden wir wieder in Havanna sein. Bevor ich an meinen Geburtsort weiterreisen kann, muss ich an einem Fachkongress teilnehmen. Dani und ich wissen, dass wir nicht nach Kuba zurückkommen. Alle anderen wissen von nichts. Sie dürfen nichts wissen, damit man ihnen nicht den Vorwurf machen kann, unsere Ausreise nicht verhindert zu haben. Mir ist, als hätte ich ein leuchtfarbenes Spruchband auf der Stirn, auf dem geschrieben steht: „Wir kommen nicht zurück!“ Ich habe Angst. Wenn man mich sorgfältig kontrolliert, wird man alle Dokumente, alle Diplome, Zertifikate, sogar Bücher finden, die bei einer Reise zu einem Kongress oder in den Urlaub nichts im Koffer zu suchen haben. Und man wird meinen deutschen Pass finden. „Warum“, können sie dann fragen, „hast du zwei Pässe?“ Und ich bin mir nicht sicher, ob meine Antwort sie überzeugen würde.
Die vorgeschriebenen Formalitäten umfassen drei wesentliche Schritte: Gepäckaufgabe, Passkontrolle, Zollkontrolle. Bei jedem einzelnen dieser drei Schritte kann sich eine Katastrophe ereignen. Die Gepäckabfertigung ist an der Reihe. Der kubanische Beamte schaut auf die Waage. „Ihr Koffer wiegt zehn Kilo mehr als erlaubt. Sie müssen alles, was Sie nicht unbedingt benötigen, rausnehmen und hierlassen, denn sooo geht das nicht!“ Verzweifelt frage ich ihn: „Ist das Flugzeug voll besetzt?“
Der Beamte antwortet nicht, er sieht sich nur meine Papiere an. Ich bemerke, wie sein Gesicht zu strahlen beginnt, und statt meine Frage zu beantworten, sagt er: „Mónica, endlich habe ich Sie persönlich vor mir! Ich will Ihnen mal was sagen: Ihr letztes Radioprogramm hat ja eine Menge Staub aufgewirbelt. Verrückt! Ihre Behauptung, Frauen hätten die gleichen Bedürfnisse wie Männer ... Mir scheint, Sie haben da ziemlich übertrieben, aber, ja sicher, es gibt tollpatschige und reichlich dämliche Männer ...“
Ich habe keine Lust, mir seine Analyse meiner letzten Radiosendung über die angeblichen und realen Unterschiede zwischen Mann und Frau in Sachen Sexualität anzuhören. Ich will ganz einfach wissen, ob mein Koffer komplett mit allem, was in ihm steckt, die Reise mitmachen kann oder nicht.
Endlich merkt der Beamte, dass wir auf dem Flugplatz sind, dass er das gesamte Gepäck für diesen, auch meinen Flug abfertigen und eine Entscheidung wegen meines Übergepäcks treffen muss.
„Mónica, das Problem wird sofort gelöst, machen Sie sich keine Sorge! Es hat mich sehr gefreut, Sie kennengelernt zu haben. Wie heißt das Thema Ihrer nächsten Radiosendung? Werden Sie auch rechtzeitig wieder zurück sein?“
„Natürlich“, antworte ich. Schon etwas unruhig geworden, versuche ich, seine Aufmerksamkeit wieder auf die Kofferangelegenheit zu lenken: „Und was können wir mit meinem Gepäck machen? Ich kann nichts rausnehmen, ich brauche alles, was drin ist.“
„Mónica, Ihnen zuliebe mache ich alles! Ihr Koffer wiegt nur zwanzig Kilo. Die restlichen zehn werde ich dem Passagier, der hinter Ihnen steht, berechnen. Der hat ja nur eine leichte Tragetasche, und außerdem – für diesen Flug ist nur die Hälfte des Laderaums belegt. Da gibt es überhaupt kein Problem. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise und kommen Sie bald wieder. Ich lasse keins Ihrer Programme aus. Warum erweitern Sie das Thema der letzten Woche nicht ein wenig? Oder vielleicht schreibe ich Ihnen, damit Sie mir direkt antworten. Stimmt es, dass Sie mir, nur mir, ausschließlich mir, antworten werden?“
„Natürlich, immer antworte ich ausschließlich denen, die persönliche Fragen an mich richten!“, antworte ich, und es tut mir leid, diesen liebenswürdigen Beamten zu belügen, der mir gerade aus der Patsche geholfen hat.
Und es geht weiter zur Passkontrolle. Das ist die schwierigste Hürde, die ich überspringen muss.
Eine Genossin Leutnant lässt sich Danis Pass zeigen. „Hoffentlich verwechselt der Junge nicht die Hosentaschen, denn wenn er den deutschen Pass rauszieht, dann ist unser Plan schon hier geplatzt“, denke ich und täusche Unbekümmertheit vor.
Mir kommt es vor, als ob die Zeit, die sich die Genossin Leutnant zur Kontrolle der Dokumente meines Sohnes nimmt, nie endet. Endlich wird er durch die Sperre gelassen, und jetzt muss er die nächste Prüfung bestehen, beim Zoll. Ich bin an der Reihe, von der Genossin Leutnant durchleuchtet zu werden.
In der rechten Hosentasche habe ich meinen kubanischen Pass, den ich jetzt vorzeigen muss. In der linken steckt der deutsche Pass, den ich versteckt lassen muss. Die Genossin Leutnant blättert meinen „richtigen“ Pass Seite für Seite um, als ob ich die einzige Passagierin des Fluges nach Berlin wäre. Ab und zu hebt sie den Blick, um mein Gesicht aufmerksam zu prüfen. Tausend Gedanken schwirren in meinem Kopf herum. Die Genossin Leutnant erhebt sich und verschwindet. Meinen Pass nimmt sie mit sich. Die nervöse Spannung ist unerträglich. „Das verdammte Foto ist schuld. Das hat man ja auch im berühmten Haus der Monster aufgenommen“, denke ich. (So hieß im Volksmund das in jener Zeit einzige in Havanna existierende Geschäft, das Passfotos anfertigte.) Man braucht tatsächlich viel Fantasie, um die notwendige Ähnlichkeit zwischen Foto und Original zu erkennen.
Glücklicherweise ist auch diese nervende Warterei bald zu Ende. Die Genossin Leutnant kehrt zurück und händigt mir meinen kubanischen Pass wieder aus. Sie weiß nicht, dass ich ihn nie wieder in meinem Leben benutzen werde. Sie sagt: „Ja, dann gute Reise!“, drückt auf einen Knopf in ihrem durchsichtigen Käfig und öffnet die für mich in diesem Moment wichtigste Tür. Theoretisch gibt es jetzt kein Hindernis mehr zwischen uns und dem Flugzeug nach Deutschland. Eine ungeheure Last fällt von mir ab, aber genug Misstrauen und Angst bleiben sitzen, und ich denke ein ums andere Mal: „Du kannst nicht sicher sein, bevor das Flugzeug nicht zumindest die Bahamas erreicht hat.“ (Ich habe mehr als eine Dienstreise gemacht, bei denen das jeweilige Flugzeug wegen eines technischen Problems nach Havanna zurückkehrte, nachdem es schon über eine halbe Stunde in der Luft war.)
Zwei Stunden sind vergangen, seit Jesús uns am Terminal verabschiedet hat. Die Zollkontrolle dürfte schnell vonstattengehen. Der große Koffer ist ja schon zu Beginn unserer Reise abgefertigt worden und befindet sich sicherlich schon im Container neben dem Flugzeug. Nur das Handgepäck muss noch kontrolliert werden. Wenn die Zollbeamten eine Person ausfindig machen, die sie verdächtigen, etwas Verbotenes bei sich zu haben, dann, ja dann kann es passieren, dass man auch noch eine gründliche, langwierige Leibesvisitation über sich ergehen lassen muss. Hoffentlich werde ich davon verschont!
Heute Nachmittag sind blutjunge Zollbeamte für die Abfertigung verantwortlich. Sie ähneln eher einer Gruppe von Mittelschülern. Als Zollbeamte kann man sie kaum für voll nehmen. Sie lachen, machen Witze, sind albern und erzählen sich gegenseitig von den letzten Ereignissen aus ihrem Privatleben. Dani wird blitzschnell abgefertigt. Jetzt bin ich an der Reihe. Ich beobachte, wie sich zwei Jugendliche mit den Ellenbogen anstoßen. Einer weist den anderen auf meine Anwesenheit hin, er nennt meinen Namen, und ich höre, wie er ihm zuflüstert: „Frag sie doch, Manolo, Mann, diese Gelegenheit darfst du dir nicht entgehen lassen!“ Wie ein kleiner Schuljunge, der bei einem Schabernack erwischt wurde, schaut er mich von der Seite an und bittet dann seine Kollegin, sie soll mir doch seine Frage stellen. Er traut sich nicht, sie selber auszusprechen. Mit einem nervösen Kichern, den Blick auf den Boden geheftet und krampfhaft nach Worten suchend, versucht sie, ihrem Kameraden Hilfestellung zu leisten. Ich bin es gewohnt zu raten, wenn Leute mir ihre Sexualprobleme anvertrauen. Und so wie ich auch bei meinem Radioprogramm vorgehe, wiederhole ich mit schlichten Worten die mir von der jungen Zöllnerin umständlich vorgetragene Geschichte. Die Gesichter der jungen Leute spiegeln Erleichterung wider. Um sicher zu gehen, dass ich die Sorgen ihres Kollegen nach dem sprachlichen Versteckspiel auch richtig verstanden habe, frage ich: „Ist es das, was du, was ihr wissen wollt?“ Ein dissonanter Chor, begleitet von Gekicher und Lachen, ist die Antwort: „Jaaa ...“ Das Eis ist gebrochen. Wir debattieren noch lange. Ich habe schon immer gern mit Jugendlichen diskutiert. Einen Moment vergesse ich sogar, dass ich nicht auf dem Flugplatz bin, um einen Vortrag zu halten und mit den jungen Zollbeamten über Partnerschaftsprobleme und Generationenkonflikte zu reden. Als sie die fünfte oder sechste Frage stellen, merke ich, dass sich hinter mir eine lange Schlange gebildet hat: Passagiere, die auf die Zollabfertigung warten, um endlich mit ihrem Flugzeug wegzufliegen. Die Jugendlichen verabschieden sich sehr herzlich von mir, sie bedanken sich, sie wünschen mir eine gute Reise und sie bitten mich, so bald wie möglich wieder zurückzukommen. „Aber sicher, ich werde schnell wieder hier sein!“, lüge ich. Mein schlechtes Gewissen plagt mich, und die Schuldgefühle wegen meiner Abreise aus Kuba wachsen weiter.
Noch fast eine Stunde Wartezeit. Dani und ich gehen in die Cafeteria. Die Klimaanlage funktioniert nicht, eine erstickende, klebrige Hitze schlägt uns entgegen. Es stinkt nach Schweiß, vermischt mit verschiedenen Arten von Sonnencremes, nach „café revolucionario“ (eine Mischung aus gerösteten, fast verbrannten Erbsen und echtem Kaffee), nach angesengtem Toastbrot und nach Pommes, die in wochenaltem, schon ranzigem Öl frittiert werden. Der Raum ist überfüllt mit Touristen, die wie Exhibitionisten ihre am Strand von Varadero sonnenverbrannte Haut zur Schau stellen. Einige haben einen so starken Sonnenbrand, dass sie sich wohl noch Wochen nach der Heimkehr in ihre nordischen Länder an die tropische Sonne erinnern werden. Sie unterhalten sich, trinken Bier der Marke „Hatuey“ oder einen letzten „Mojito“, dieses herrlich schmeckende, vorgeblich leichte, süße, eiskalte Mixgetränk mit Rum, das nur allzu schnell die Sinne verwirrt und schon viele Urlauber zu Fall gebracht hat. So verbringen sie die letzten Momente, bevor sie sich nach überstandenem Rückflug dem Alltag wieder ausliefern müssen. Ich höre Gespräche auf Holländisch, Deutsch, Französisch und Englisch. Ich versuche, den Faden irgendeiner Unterhaltung zu verfolgen. Aber ich kann mich nicht konzentrieren. Durch meinen Kopf schwirren so viele Erlebnisse und Vorstellungen, dass mir schwindelt. Und immer wieder kommt die Angst hoch, die Furcht, dass uns jemand auffordert mitzukommen, dass wir die Reise nicht machen dürfen, dass wir nach Hause geschickt werden. Ich halte diese stinkende, laute Atmosphäre nicht mehr aus. „Komm, begleite mich nach unten in die Läden“, bitte ich Dani.
In den Läden sind keine Kunden, dafür sind sie voll mit Verkäuferinnen, die sich in Gruppen unterhalten. Sie lassen es kaum zu, dass ich mir das mickrige Warensortiment ansehe. Sie haben mich erkannt und stürzen sich auf mich, um mich mit Fragen zu bombardieren. Sie wenden sich an mich, als ob ich eine altbekannte Vertraute wäre. Sie duzen mich. Meine letzte Radiosendung, bei der ich ein für Kubaner höchst haariges und schlüpfriges Thema behandelt habe, scheint die Zustimmung der Mehrheit der weiblichen Zuhörer gefunden zu haben. Ich erinnere mich, dass nach der Sendung eine heiße Debatte begann. Von Aggressivität strotzende Anrufe brachten die Leitungen des Senders zum Kochen. Aber es gab auch viel Applaus und Glückwünsche. Thema waren die sexuellen Bedürfnisse von Mann und Frau und das Recht beider Geschlechter, ihre Bedürfnisse zu befriedigen. Einige Männer riefen mich an, als die Sendung noch lief, und sie äußerten unter Schimpftiraden ihre Empörung. Andere hatten wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben darüber nachgedacht, dass die Frau die gleichen sexuellen Bedürfnisse hat wie der Mann, die sich allerdings individuell verschieden äußern und dass Befriedigung in großem Maße von den Umständen abhängt. Ich erinnere mich, dass ich ganz besonders auf die Bedeutung der wahren Liebe hingewiesen habe und darauf, dass viele Männer sich verpflichtet fühlen, jeden Tag ein sexuelles Leistungssportprogramm absolvieren zu müssen. Ich habe vom Austausch von Zärtlichkeiten, von gegenseitiger Achtung und Rücksichtnahme gesprochen und darauf hingewiesen, dass man keine sexuellen Handlungen verlangen darf, die die Partnerin nicht akzeptieren kann. Es ging auch darum, dass beim Sex niemand seiner Partnerin seinen Willen aufzwingen darf, dass Nötigung ein Delikt ist. Ich hatte tatsächlich bei den kubanischen Machos einen empfindlichen Punkt getroffen: Sie verfolgen immer noch ein rigoroses Sexprogramm, und dabei verzeihen sie weder sich selbst noch ihren Partnerinnen ein einziges Versagen. Diesem Programm zufolge muss der Mann täglich sexuell aktiv werden, selbst, wenn er sich nicht wohlfühlt oder keine Lust auf Sex hat. Ja, und die Frau hat ihm dabei als Sexualobjekt zur Verfügung zu stehen. Für einen großen Teil der kubanischen Männer ist Sex ein mechanischer Akt, mit dem man Männlichkeit misst. Und wenn dabei eine ungewollte Schwangerschaft verursacht wird, fühlt der Mann sich als potenter Zuchtstier bestätigt. Er schickt die Frau zur Abtreibung in die Klinik. Das ist ja schließlich ein Routineeingriff, der kostet nichts, und die Ärzte machen das Ganze im Handumdrehen, dafür sind sie gut ausgebildet. Was man über Risiken zu hören bekommt, über Gesundheitsschäden für die Frau, dass sie sogar daran sterben könnte, das sind doch alles nur blöde Geschichten. Und ethische oder moralische Bedenken beim Schwangerschaftsabbruch haben im Kopf eines Machos keinen Platz. Diese Männer betreiben Sex als ganz besonderen Sport. Das ganze nennen sie „Liebe machen“, ein Programm auf der Matratze, am Strand, im Wasser, auf dem Rasen, im Liegen oder im Stehen, wobei die Häufigkeit die Messlatte ist. Für den Macho ist der beste Liebhaber derjenige, der auf seiner Liste die größte Anzahl von Sexwettkämpfen und von Namen eroberter Frauen verzeichnen kann. All diese Argumente habe ich einem Mann an den Kopf geworfen, der mich noch während der besagten letzten Sendung angerufen hatte, der sich seiner superpotenten Männlichkeit rühmte und seine unvergleichlichen Qualitäten auf dem „Feld der Liebe“ pries. Und dieser Mann beschwerte sich gleichzeitig über die „kindlichen, absonderlichen und unreifen Wünsche“ vieler Frauen, die lieber gestreichelt werden wollen als die Vorführung des wunderbaren „Herrn Penis“ zu erleben.
Die Verkäuferinnen kommentieren im dissonanten Chor lebhaft meine Argumente wie auch die der Widersacher. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber keinen Streit. Als sie mich endlich gehen lassen, geben mir zwei der Frauen zu verstehen, ich möge doch bitte auf sie warten. Diejenige von beiden, die Rat und Beistand sucht, lässt ihr Anliegen – sei es aus Verlegenheit, sei es aus Scham – durch ihre Kollegin vortragen. Sie schaut sich um, will sicher sein, dass niemand zuhört und flüstert mir das Problem ihrer Kollegin ins Ohr: „Sie hat vor Kurzem einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen. Die Schonzeit ist noch nicht einmal abgelaufen, und sie ist schon wieder schwanger.“ Sie flüstert weiter, dass auch diese Schwangerschaft von ihrer Kollegin nicht gewollt sei, dass sie sie nicht austragen könne, dass ihr Mann einfach nicht hat warten wollen. „Und sie hat sich seinem Willen gefügt, sie hat ihm gehorcht, hat seiner Forderung nachgegeben.“
Ja, so stehe ich wieder einmal – nur einige Minuten vor dem Ende meines Lebens in Kuba – vor dem häufigsten, dem widersprüchlichsten und am schwierigsten zu lösenden Problem, einem der unzählbar vielen Probleme, die in den letzten zehn Jahren Gegenstand meiner täglichen Arbeit waren: Schwangerschaftsabbrüche. Diese arme Frau tut mir leid, und gleichzeitig bin ich empört und frustriert. Hunderte, Tausende kubanischer Frauen spielen mit ihrer Gesundheit, mit ihrem Leben, wohl wissend um die Gefahren, die der Abbruch mit sich bringt. Und immer wieder haben sie wie kleine Kinder den magischen Gedanken: „Mir wird schon nichts passieren!“ Auf ein Zettelchen schreibe ich ihr Namen, Anschrift und Telefonnummer eines meiner Exkollegen, eines Gynäkologen, der nicht nur sehr kompetent ist, sondern auch Erfahrung hat mit dieser Art von Konfliktsituationen. Ich bin ja schon fast mit einem Fuß im Flugzeug und kann nichts anderes mehr tun, als die schwere Aufgabe an ihn weiterzugeben. Vielleicht würde er ihr helfen können, die schon verursachten Schäden zu minimieren. Mir bleibt nicht mehr, als ihr viel Glück zu wünschen, denn das braucht sie ja wirklich in ihrer Situation. Mit Tränen in den Augen dankt sie mir und verabschiedet sich.
Noch dreißig Minuten bis zum Aufruf, in den Bus zu steigen. Die Verkäuferin vom Tabakwaren- und Bücherkiosk hat von ihrem Stand aus die Unterhaltung mit ihren Kolleginnen aus dem Eckladen beobachtet. Jetzt bittet sie mich zu sich. Sie beginnt, mit einer Lobeshymne auf meine Arbeit, unterstützt durch theatralische Gesten und schwülstige Worte, meine Aufmerksamkeit auf ihr Problem zu lenken. María Antonia erzählt mir in geradezu aufdringlicher Offenheit all ihren Ehekummer. Wieder einmal bin ich erstaunt, mit welcher Freimütigkeit Personen, die ich nie gesehen habe, ihre intimsten Liebeserlebnisse, -abenteuer und -schmerzen vor mir ausbreiten.
„Mein Mann hat nervöse Störungen, und um sich zu beruhigen, nimmt er täglich mehrere Kapseln Valium. Das hilft zwar gewaltig, aber wenn wir uns lieben wollen, dann versagt die Natur ihm den Dienst, dann kann er nicht.“
„Wenn er könnte, wäre es ein Wunder!“, erwidere ich. „Hat der Arzt ihm diese Menge Beruhigungsmittel verschrieben?“ „I wo, nein, du weißt, dass die schwer zu kriegen sind, in der Apotheke gibt’s die doch schon lange nicht mehr. Und der Arzt? Der behandelt ihn mit reinstem Blabla, er soll dies und das machen, aber ohne Medikamente kann mein Mann die Probleme nicht in den Griff kriegen. Unser Freund, ein Apotheker, besorgt ihm die Kapseln. Glücklicherweise!“
„Ich würde sagen: Unglücklicherweise! Denn wenn er dieses Medikament ohne ärztliche Kontrolle einnimmt, verschlimmert sich das Potenzproblem, anstatt sich zu verbessern, und mit der Zeit wird es dann sehr schwierig, aus dem Teufelskreis rauszukommen. Denn Valium ist ein Erektionshemmer erster Klasse, das heißt, selbst wenn er ständig wollte, würde ihn die Natur – wie Sie es bezeichnen – immer wieder im Stich lassen.“
María Antonia ist ganz perplex. Sie will mir nicht glauben. Ich erkläre ihr, wie die Beruhigungsmittel funktionieren, wie sie den ganzen Körper erschlaffen lassen und ermüden. Stockend bringt sie Dankesworte hervor und umarmt mich herzlich. „Ach du lieber Gott, da machen wir ja ganz das Gegenteil von dem, was wir machen sollten!“, meint sie mit noch einem Rest von Skepsis in der Stimme.
In dem sonst leeren Bücherregal ihres Verkaufsstands habe ich mehrere Exemplare des Buches „El hombre y la mujer en la intimidad“ („Mann und Frau intim“, ich hatte die wissenschaftliche Bearbeitung des Buches übernommen) entdeckt, das María Antonia gegen Dollar an ausländische Touristen verkaufen soll. Mit dem Zeigefinger zeige ich auf den Stapel, nehme eins heraus und empfehle ihr, das Kapitel zu lesen, in dem ihr Problem beschrieben wird.
„Zeigen Sie es auch Ihrem Mann, damit er erfährt, dass er nicht der Einzige ist, der diese Schwierigkeiten hat, damit Sie beide zusammen versuchen können, sie zu überwinden. Sie brauchen keine Beruhigungsmittel, dafür wird eine gute Dosis Wissen, Wille, Einfühlsamkeit und professionelle Hilfe vonnöten sein. Hier haben Sie den Namen und die Telefonnummer eines meiner besten Kollegen, der Ihnen helfen kann. Er ist ein sehr guter Facharzt und ich versichere Ihnen, dass er die Angelegenheit mit Diskretion behandeln wird. Und wenn Sie ihm noch sagen, dass ich ihn empfohlen habe, dann wird er Ihnen sicherlich bald einen Termin geben. Oh, wir werden zum Ausgang gerufen, unser Flugzeug ist startbereit! Tschüss, machen Sie’s gut, und ich wünsche Ihnen viel Glück!“
„Mónica, warte einen Moment, geh noch nicht weg! Ich möchte dich noch um einen letzten Gefallen bitten: Signier mir dieses Buch!“ Sie nimmt ein Exemplar aus dem Bücherregal, drückt mir das Buch in die Hand und reicht mir dazu einen Kugelschreiber. „Aber María Antonia, dieses Buch gehört doch gar nicht Ihnen, es ist Ware, die Sie verkaufen sollen.“
„Jetzt, wo ich weiß, dass in diesem Buch auch unser Problem beschrieben wird, gehört das Buch mir. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin, dich gesehen und mit dir geredet zu haben. Ja, schau nur, liebes Mädchen, dieses Glück kriegt noch eine Krone aufgesetzt mit deinem Autogramm in meinem Buch!“
María Antonia besteht darauf: Ich soll „ihr“ Buch signieren. Ich tue ihr den Gefallen. Mit dieser meiner letzten Signierung eines in Kuba veröffentlichten Buches, das mit der sensationellen Auflagenzahl von dreihunderttausend Exemplaren die gesamte Bevölkerung des Landes erreicht hat dank meiner Hartnäckigkeit und meines zähen Kampfes gegen Bastionen von Heuchlern, Scheinheiligen und Bürokraten, die in dem Buch eine kapitale Bedrohung der Moral, einen Zünder vermuteten, der die Sexualität unbeherrschbar explodieren lassen würde (als ob auf Kuba nicht schon vorher die Sexualität jeden Tag explodierte), werde ich mir auf einmal bewusst, dass ich eine wichtige Etappe meines Lebens beendet habe. In diesem Moment weiß ich, dass ich nie wieder so viele glückliche, wunderbare Erfolgserlebnisse in meinem Berufsleben haben werde und auch nie wieder so viele Enttäuschungen, Ängste und Unannehmlichkeiten, die meine Arbeit in der Sexualerziehung, -beratung und -therapie zum täglichen Kampf werden ließen.
Niemand würde mich jemals wieder „die Gefürchtete“, „die Kindesverderberin“, „die Sexbesessene“, „die Verteidigerin der Frauen“ oder „die Königin des Kondoms“ oder ganz einfach „Mónica, die von der Sexualerziehung“ nennen, das Letzte ein Ehrentitel, der jahrelang meinen eigentlichen Nachnamen ersetzt hat. Ich würde nie wieder Hunderte von Briefen, nie mehr unzählige Telefonanrufe von mir völlig unbekannten Personen aus allen Ecken und Enden des Landes, von Angehörigen aller sozialen Schichten beantworten. Sie alle spiegelten die unterschiedlichsten und widersprüchlichsten, ja oft wirklich folkloristischen Vorstellungen von Partnerschaft und Sexualität wider.
Ich würde nie wieder anonyme Briefe erhalten, in denen man mich beschimpfte und die von grotesken Beschuldigungen strotzten. Niemand würde sich mehr gezwungen fühlen, die absolute Anonymität zu suchen und aus Zeitschriften und Zeitungen die erforderlichen Buchstaben herausschneiden, um Drohbriefe in mühsamer Collagearbeit zu basteln.
Und ich würde auch keine Bitten um Hilfe, keine angekündigten und unangekündigten Besuche mehr bekommen. Niemand würde mich wieder an einer Verkehrsampel, in dem kurzen Moment, den ich auf das grüne Licht warte, ansprechen oder auf dem Weg in die Kantine und in der Warteschlange beim Lebensmittelladen um Rat fragen. Nie wieder würde ich ein Fernsehstudio oder einen Radiosender betreten, um „en vivo y en directo“ (live und direkt) mit Hunderten von Teilnehmern Gespräche zu führen. Mónica mit c hat aufgehört zu existieren, um sich wieder in Monika mit k zu verwandeln: ein ganz kleiner Unterschied, eine Veränderung wie zwischen Tag und Nacht.
Die Metamorphose vom Löwenkopf zum Mäuschenschwanz hat sich vollzogen. Eine schreckliche Zwiespältigkeit von Gefühlen übermannt mich, und während der Busfahrt vom Terminal zum Flugzeug empfinde ich eine Nostalgie für die Insel, die mich lange Jahre nicht verlassen sollte. Ich träume immer noch auf Spanisch und auf Deutsch. Wenn ich mich mit meinen Söhnen unterhalte, vermengen wir beide Sprachen, und wir springen von einer zur anderen, ohne dass wir es merken. Wenn Freunde bisweilen solche Treffen miterleben, sind sie fassungslos. Sie können den radikalen, magischen Umschwung nicht nachvollziehen, der sich ereignet, wenn wir von Deutschen zu Kubanern werden, wenn die ruhige deutsche Sprachweise in kubanisches Spanisch überwechselt, das sich anhört, als ratterte ein Maschinengewehr. „Wie kann man nur so schnell reden?“, „Wie kann man dabei was verstehen?“, „Warum schreit ihr so laut, streitet ihr euch, eben war doch noch alles friedlich?“, fragen besorgt unsere Gäste, die nicht wissen, dass Kubanisch sprechen bedeutet, sich laut, schnell und mit Einsatz des ganzen Körpers zu artikulieren. Die bedeutungsloseste Nachricht aus Kuba provoziert intensive nächtliche Träume. Oft wache ich schweißgebadet und erschöpft auf, manchmal weinend, manchmal lachend, und sage mir erleichtert: Es sind nur Träume. Ich stehe auf, und unter der Dusche vollendet sich wieder der Sprung von 110 Volt (die Stromspannung auf Kuba) auf 220 Volt. Und ich begebe mich auf den Weg zur Arbeit, bin von Kopf bis Fuß eine Deutsche, als ob Kuba nie in meinem Leben eine Rolle gespielt hätte. Aber die Insel ist ein allgegenwärtiges Phantom. Wenn ich am wenigsten damit rechne, überkommt es mich, foltert es mich, verfolgt es mich, macht es mich gleichzeitig froh und traurig. Es übt auf mich einen Zauber aus, der es mir jetzt erlaubt, die wankelmütige Haltung der in Kuba lebenden Spanier zu verstehen, die da sagen: „Wenn ich in Madrid sterbe, will ich in Havanna begraben werden; und wenn ich in Havanna sterbe, will ich in Madrid begraben werden.“
Nach Berlin
Schließlich, nach endlos scheinendem Zeitablauf, die Nerven zum Zerreißen gespannt, besteigen wir das Flugzeug. Wir erleben einen der letzten Flüge der ehemaligen DDR-Fluggesellschaft INTERFLUG. Sie wird einige Wochen später von der LUFTHANSA übernommen, wobei Hunderte ihrer Angestellten ihre Arbeit verlieren und nach der Euphorie über die Wiedervereinigung Deutschlands den Zusammenstoß mit den dunklen Seiten des für sie noch unbekannten Kapitalismus erleben. Einige sehr nette Stewardessen (haben sie etwa einen Intensivkurs über die korrekte Behandlung der Fluggäste erhalten?) heißen uns willkommen, verteilen Broschüren und deutsche Tageszeitungen. Meine erste Lektüre deutscher Zeitungen seit der Wiedervereinigung! Alles ist neu. Alles ist anders. Während der Startvorbereitung wird die gesamte Besatzung vorgestellt, mit Namen und den ihnen jeweils zugehörigen Aufgaben! Wer hat so etwas bei vorherigen Flügen erlebt? Wir werden detailliert über den gesamten Ablauf des Fluges informiert.
„Jetzt fliegen wir gerade über Varadero, den schönsten Strand der Welt.“
Das sagt mir, dass wir in etwa einer halben Stunde über den Bahamas sein werden, und solange wir noch nicht da angekommen sind, können wir nicht sicher sein, unsere Flucht geschafft zu haben, denn wer kann sicher sein, dass wir nicht nach Kuba zurückfliegen müssen, weil irgendein technischer Defekt uns dazu zwingt? Oft genug habe ich auf Dienstreisen erlebt, dass ich mich nach einer Flugstunde in Havanna wiederfand, nur weil wegen des Landeverbotes für Maschinen aus Kuba und anderen sozialistischen Ländern auf amerikanischem Boden selbst bei Notsituationen ein Rückflug erzwungen wurde.
Erst wenn wir über den Bahamas sind, werden wir mit einem Schnaps anstoßen, denn dann gibt es kein Zurück mehr. Selbst wenn es zu einem Notfall kommen sollte, der eine Landung erfordern würde, müsste das Flugzeug nicht wieder nach Havanna zurück, jetzt dürfte es auf nordamerikanischem Territorium landen. Flügen der INTERFLUG, die aus Kuba kommen, ist das nicht mehr verboten.
Ich bin immer noch angespannt. Dani versucht mich abzulenken. Ich höre ihm gar nicht zu, und er könnte genauso gut gegen die Wand reden, die Wirkung wäre die gleiche. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sich unser Projekt „Flucht“ ohne Zwischenfälle verwirklicht. Dass ausgerechnet ich, von meinen Kollegen einer Unzahl schlimmer Unfälle wegen, von denen einige fast tödlich endeten, Unglücksrabe, auf Spanisch „saco de sal“ (Salzsack), genannt, ein so gewaltiges Unternehmen erfolgreich abschließen würde, kann ich immer noch nicht fassen. Wurde bisher doch allen, die mit mir eine Dienstreise antreten sollten, geraten: „Mit Monika nicht einmal bis zur nächsten Ecke!“ Und der Gipfel ist, dieses Mal handelt es sich um eine völlig eigenständige Aktion, von mir selbst geplant und beschlossen. Und das unter Verletzung aller Vorschriften. Das ist Verrat, das ist Betrug. Ich habe mir nahestehende hochrangige Persönlichkeiten ausgenutzt. Sie haben mir und meinem Sohn in gutem Glauben die sonst nicht erhältlichen Ausreisepapiere besorgt, damit wir bei meiner Mutter Urlaub machen können, aber ganz sicher nicht, um die Insel für immer zu verlassen. Und das soll der Dank sein! Was für eine Unverfrorenheit, was für eine Schande, was für eine Niederträchtigkeit!
Ich hatte mich in Kuba schon vollkommen an den Status einer Kubanerin mit kollektiver Persönlichkeit gewöhnt, eines Wesens, dessen Handeln und Denken im Plural, im „Wir“ erfolgt. (In Kuba wurde das institutionalisierte „Wir“ benutzt. Die erste Person Singular, das „Ich“, war aus der kubanischen Grammatik verschwunden.) Ich war eine Person mit kollektiver Meinung, die den Richtlinien der Partei zu gehorchen hatte. Ich hatte Schuldgefühle, ich sah mich als die Undankbare, als ein verräterisches Monster, weil ich und nur ich allein diese Entscheidung getroffen hatte.
Ich gestehe, dass diese Schuldgefühle mich noch lange Zeit verfolgt haben. Erst mit Hilfe von Verwandten und Freunden und nach psychotherapeutischen Diskussionen konnte ich anfangen, mein Ich wieder aufzubauen. Ich begann meine Angelegenheiten in eigener Verantwortung, ohne Erlaubnis der höheren Instanzen zu regeln. Ich verstand endlich, dass die Verletzung von Anordnungen, dass Tricks und Betrug durchaus erlaubt sind, wenn man sich in einer Situation befindet, in der individuelle Rechte und eigene Entscheidungen nicht gelten. Ich schickte die Scham zum Teufel und hörte auf, mich selbst zu verurteilen und zu zensieren. Es interessierte mich nicht mehr, was meine kubanischen Exvorgesetzten und Exkollegen von mir denken.
„Die fernen Lichter, die Sie von beiden Seiten des Flugzeuges aus sehen können, sind die der Bahamas“, kündigt der Kapitän unseres Airbus an, und er informiert uns detailliert über den nächsten Abschnitt des Fluges.
„Dani, es hat geklappt! Begreifst du das? Wir haben die Partie gewonnen!“ Alle Nervosität fällt ab von mir. Eine ungewöhnliche Erschöpfung breitet sich aus nach Monaten der Anspannung, Angst, Ungewissheit und Zwiespältigkeit. Ich fühle mich furchtbar müde, aber auch zum ersten Mal seit Jahren sehr ruhig und entspannt.
Der Flug verläuft weiterhin ohne Zwischenfälle. Wir landen pünktlich am Tag nach unserer Abreise in Berlin.
Es ist November, der traurigste, dunkelste und feuchteste Monat des Jahres in Deutschland. Die blattlosen Bäume strecken ihre grauen, nackten Zweige in den Himmel. Es regnet und regnet und regnet. Dieser Nieselregen scheint nie enden zu wollen. Wie winzig kleine Nadeln stechen eisige Wassertropfen ins Gesicht, zwingen mich, schneller zu gehen und ein Dach zu suchen, unter dem ich mich schützen kann.
So viele Jahre Sonne, Hitze, ständiges Schwitzen am Tag und in der Nacht haben die Batterien meines Körpers langfristig aufgeladen. Ich fühle mich wie neu, voller Energie, als könnte ich die Welt erobern.
Diese Kraft werde ich dringend benötigen, denn mit meiner Ankunft in Deutschland, fast drei Jahrzehnte nach meiner Ausreise Richtung Kuba, beginnt für mich eine ungewisse, komplizierte, unsichere Zeit, die gewiss angefüllt sein wird mit Überraschungen, Überraschungen, die ab und zu Freude und Genugtuung bedeuten werden. Ich bin von Natur aus optimistisch und glaube an das Gute im Menschen und an das Glück. Aber mit Sicherheit erwarten mich auch viele Probleme und Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz, ich habe diese Entscheidung getroffen und stehe dazu!
Die ersten Tage in Berlin verlaufen mit der Suche nach Lösungen für uns drei, für meinen ältesten Sohn Dictys, für Dani und für mich.
Dictys befindet sich schon seit drei Wochen bei meinem Bruder, der in Berlin wohnt. Sein Urlaub, von seiner Dienststelle, der kubanischen Presseagentur „Prensa Latina“, genehmigt, ist schon abgelaufen, und in Havanna erwartet man seine Rückkehr. (Weil er nicht wiederkam, wurde in seiner Abwesenheit unter der pflichtgemäßen Beteiligung seiner gesamten Journalistenkollegen von Prensa Latina ein Ausschließungs- und Verdammungsverfahren wegen Verrats, wegen Vaterlandsverkaufs – weil er sich dem kapitalistischen Feind ausgeliefert hatte – inszeniert. Er bekam den „Ehrentitel“ „Escoria“, das heißt Schlacke, Müll, Abfall. Diese Bezeichnung ist all denen vorbehalten, die es wagen, eine eigene Entscheidung zu treffen, die nicht von den höheren Instanzen autorisiert ist. Eine Kollegin, die einige Wochen später in Kanada Exil fand und die an dieser Pflichtübung zu Dictys’ Verdammung teilgenommen hatte, erzählte ihm davon mit allen Einzelheiten.) Dictys hatte im Auftrag der Presseagentur ein Jahr als Auslandskorrespondent in Nicaragua gearbeitet. Mitten im Bürgerkrieg. Er hatte über die Vorbereitungen der von der Ortega-Regierung erlaubten und angeordneten Wahlen zu berichten. Prensa Latina hatte ihn mit einem Dauerreisepass ausgestattet, einem Dokument, das ohne staatlichen Auftrag niemand erhalten kann. Er durfte permanent nach Nicaragua und von dort zurück nach Havanna reisen. So war es einfach für ihn gewesen, die Insel Kuba zu verlassen. Statt sich nach Ablauf des Urlaubs in seiner Dienststelle PRELA wieder einzufinden, blieb er in Berlin. Dort musste er nach wochenlangem Klinkenputzen und Vorstellungen bei Agenturen, Institutionen, Unternehmen und Handelsgesellschaften aller Couleur, denen er seine Dienste anbot, eine frustrierende Wirklichkeit erfahren: Es gibt ein Heer von hochkarätigen arbeitslosen Journalisten. Und Dictys schlussfolgerte, dass er sein Berufsleben auf einem anderen Gebiet als dem des Journalismus neu aufbauen muss. Es schien sich die von ihm schon bei Beginn des Studiums im kalten, ungastlichen Moskau getroffene Feststellung zu bestätigen: „Das Journalistikstudium ist schlicht und einfach Scheiße! Aber es ist die einzige Studienrichtung und der einzige Studienort, die mir zugeteilt wurden. Entweder akzeptierte ich sie oder ich konnte das Studium vergessen! Mir wurde nicht erlaubt, meinen gewünschten Berufsweg zu wählen.“ Und dennoch schmerzte es ihn sehr, auf seinen Beruf verzichten und völlig von Neuem beginnen zu müssen.
Dani hat sich entschlossen, an „seine“ alte Alma Mater, die Technische Universität Dresden, zurückzukehren. Dort hat er Mathematik studiert, ist als bester Absolvent seines Jahrgangs ausgezeichnet worden und hat das Angebot bekommen, sofort postgraduale Studien mit einem Stipendium, das jegliche ökonomischen Sorgen vergessen lässt, aufzunehmen. Dieser Junge ist mit dem rechten Bein zuerst auf die Welt gekommen. Einige Tage nach seiner Vorstellung beim wissenschaftlichen Rat teilt man ihm mit, dass das Stipendium und die weiterführenden Studien bewilligt sind. Seine unmittelbare Zukunft ist vorerst gesichert.
Mein beruflicher Neubeginn sieht sehr hässlich aus. Schneller als ich es mir je vorstellen konnte, muss ich die Tatsache verinnerlichen, dass ich, die ich bis in den letzten Winkel Kubas bekannt war, in Kuba eine Autorität darstellte, in die absolute Anonymität zurückgefallen bin. Meine Arbeitsinstrumente – Fachbibliothek und Fachvideothek, Forschungsprotokolle, Lehrprogramme für die medizinische prä- und postgraduale Ausbildung, kurz, alles, was ich für den ordentlichen Arbeitsablauf benötige – sind in Havanna geblieben. Mit meinem Entschluss, nach Deutschland zurückzukehren, habe ich akzeptiert, einen Schlusspunkt unter mein bisheriges Berufsleben zu setzen. Meinen Lebensunterhalt muss ich mir mit einer Tätigkeit, bei der ich meine Sprachkenntnisse einsetzen kann, erwerben. Alles andere muss ich vergessen. In solchen Situationen hat man viel Flexibilität zu beweisen, muss man eine gute Dosis an Willen und Mut aufbringen, um akzeptieren zu können, Arbeiten auszuführen, die Unzufriedenheit und Frustration hervorrufen, weil arrogante, mit wenig grauen Zellen, dafür aber mit Kapital ausgerüstete Chefs sich das Recht nehmen, ihre „Untergebenen“ zu drangsalieren, zu erniedrigen und zu unterwerfen.
„Du musst deine Kenntnisse und Fertigkeiten, dein Geschick, deine Erfahrungen wie auf einem goldenen Tablett anbieten! Und dabei kannst du auch gut und gerne übertreiben!“, raten mir Leute, die etwas davon verstehen, und sie geben mir noch eine Menge anderer Ratschläge und Empfehlungen, die sehr wirksam sein sollen, wenn man Arbeit sucht. Fast drei Jahrzehnte auf Kuba haben aus mir ein für das kapitalistische System untaugliches Wesen gemacht. Ich bin völlig ahnungslos. Ich weiß nichts von Steuern, von Versicherungen, von Arbeitsrecht, anderen Rechten und Möglichkeiten. Und meiner Ignoranz ist es zuzuschreiben, dass ich eine Menge günstiger Gelegenheiten, Arbeit zu finden, verpasse, weil die nur denen zugänglich sind, die sie kennen und für sich reklamieren.
Bewerbungen schreiben heißt jetzt das Tagesprogramm. Dutzende von Briefen mit Kopien der Dokumente, die den Beweis meiner Qualifikationen, bisherigen beruflichen Tätigkeiten und langjährigen Erfahrungen zeigen, landen in den Personalabteilungen von Unternehmen, Forschungszentren, Gesundheitseinrichtungen und anderen Institutionen, die in irgendeiner Weise mit Beschäftigungen zu tun haben, die ich eventuell erledigen könnte.
Ich muss die traurige Wahrheit erfahren, dass meine vielen Universitätstitel und -grade zu nichts nutze sind. Ein interessanter Dokumentarfilm über arbeitslose deutsche Akademiker – ein Physiker, der Kartoffelpuffer herstellt und sie an einem Kiosk zum Verkauf anbietet; eine Biologin, die im Auftrag einer Müllentsorgungsfirma in Parkanlagen die Müllbehälter leert und den von Besuchern weggeworfenen Abfall aufsammelt; ein Jurist, der froh ist, eine Halbtagsstelle als Sekretär bekommen zu haben, dabei hat er zwei Doktorgrade und spricht sieben Sprachen, die ihm zu nichts nützen, denn er verdient gerade mal so viel oder so wenig, dass er seine Einzimmerwohnung, so klein wie ein Kaninchenstall, bezahlen kann – wäscht mir gründlich den Kopf und lässt mich die Dimension meiner Schwierigkeiten in puncto Arbeitssuche verstehen. Dazu kommt noch, dass ich in wenigen Tagen fünfzig Jahre alt werde. Wer so alt ist, fängt doch nicht an, Arbeit zu suchen! Die deutschen Frauen meines Alters, die eine normale Berufsentwicklung hinter sich haben, gehen mit sechzig in Rente. Nur eine Ignorantin wie ich, eine, die gerade vom Mond gekommen zu sein scheint, hat die Illusion, dass Wissen das Wichtigste ist und nicht das Alter. Wir haben doch in Deutschland einen Staatschef, der zehn Jahre älter ist als ich, und der ist sich sicher, bei den nächsten Wahlen wieder für vier Jahre gewählt zu werden!
Die Universitäten, an die ich mich wende, weisen meine Bewerbungen zurück, denn ich habe keinerlei Dozententätigkeit an keiner deutschen Universität aufzuweisen. Meine geliebte Universität Rostock, an der ich mein Studium begonnen und wo ich meinen Doktorgrad mit summa cum laude erworben habe, befindet sich in einem schmerzhaften Prozess der Umstrukturierung, wobei international anerkannte Institute aufgelöst und Akademiker, die der Uni zu Ansehen verholfen haben, entlassen werden. Da ist kein Platz für mich. Und Kuba ist so weit entfernt. Die Leute assoziieren mit der Insel höchstens Strände, Sonne, Rum, Zigarren, Musik und schöne Mulattinnen. Jedes Mal, wenn sie hören, dass es auf der Insel ein außergewöhnliches, ein komplexes, ernsthaftes, systematisches Programm für Sexualerziehung, -beratung, -therapie und Familienplanung gibt, will mir niemand Glauben schenken, und am Ende erfahre ich immer wieder die gleiche Antwort auf meine Bemühungen, eine Stelle zu bekommen: „Hier in Deutschland ist doch alles anders: die Einstellungen, die Gesetze, die Philosophie, die Politik, eben alles.“
Es gibt keine freien Stellen im Bereich der Familienplanungsberatung oder für Sexualtherapie; die gehören zum unproduktiven Sektor. Die Ressourcen reichen nicht, um den Bedarf an Beratung und Hilfe für mittellose Menschen zu decken, und reiche Leute haben ihre Privattherapeuten. Die brauchen keine Deutschkubanerin, welche die ihr völlig neue Welt nicht kennt, in die sie gerade gekommen ist.
Man empfiehlt mir, eine Finanzquelle zu finden, um mich selbstständig zu machen und meine eigene Praxis zu eröffnen. Ich bin realistisch genug, um zu wissen, dass dieser Ratschlag sich nicht verwirklichen wird, denn die erforderliche Finanzquelle existiert nicht. Und auf einen Lottogewinn zu hoffen, erscheint mir zu unsicher, denn nie in meinem Leben habe ich bei Tombolas – sei es in der Schule, in der Gemeinde oder bei Benefizveranstaltungen – gewonnen. In Kuba waren Lotterie und andere Gewinnspiele verboten. Meine Schwägerin musste einen Tag im Gefängnis verbringen, weil man sie dabei erwischt hatte, wie sie mit einer Nachbarin „Monopoly“ spielte. Statt Geld setzten sie schwarze Bohnen ein, die hatten mehr Wert als das damals zirkulierende Geld. Ich habe also in Kuba vergessen, wie man Lotto spielt, und hier in Deutschland fehlt mir das Geld dazu. Und die seltenen Male, die ich es versuche, werde ich grundsätzlich diskriminiert. Ich gewinne nie, zumindest nie die Summe, die erwähnenswert wäre. Einmal habe ich genau den Betrag, den ich für das Los bezahlt habe, zurückbekommen.
„Hast du nicht vielleicht irgendeine Erbschaft in Aussicht?“, fragen mich Freunde, die mich gerne in einer würdigen Stellung wissen möchten.
Am Horizont lässt sich kein Geldsegen erkennen, und meine realistische Einstellung hilft mir zu verstehen, dass es sinnlos ist, von meiner deutschen Familie Wunder zu erwarten.
Das Hamburger Arbeitsamt empfiehlt mir, eine Stelle als Deutschlehrerin anzunehmen. Es handelt sich um eine Schule, an der Asylanten, unglückliche Menschen aus der ganzen Welt, Russen und Polen deutscher Abstammung die deutsche Sprache erlernen müssen, bevor sie in Deutschland eine Arbeitserlaubnis bekommen können. Ich akzeptiere hocherfreut, obwohl ich weiß, dass das Gehalt, das nur etwa einem Viertel des offiziellen Tarifes entspricht, nicht einmal reicht, um als Asket zu leben.
Ich bekomme zwei Klassen zugeteilt: eine, die aus Teilnehmern besteht, die schon recht gut Deutsch beherrschen und jetzt nur noch befähigt werden müssen, selber auf Arbeitssuche zu gehen, möglichst in einem Sektor, der ihrer Ausbildung angemessen ist. Die andere Gruppe besteht aus Männern und Frauen, die weder lesen noch schreiben können oder das lateinische Alphabet nicht kennen. Ihr kulturelles Niveau ist sehr niedrig, jede und jeder Einzelne ist in einer Umwelt aufgewachsen, in der unmenschliche, autoritäre, despotische Regime herrschten, die Individualitäten zerstört haben. Es sind Personen, deren Psyche ernsthaft geschädigt ist, ohne Toleranz gegenüber anderem, die unermessliche Qualen erleiden, weil sie jetzt in einer offenen, multikulturellen Welt leben, die ihnen Freiheiten bietet, die sie nicht begreifen können.
Die erste Gruppe verursacht mir überhaupt keine Schwierigkeiten, und ich erfülle einfach das von der Schulleitung bestimmte offizielle Lehrprogramm.
Die Arbeit mit der zweiten Gruppe, den Analphabeten, bedeutet für mich eine enorme Herausforderung. Nach Kuba war ich zu spät gekommen, um noch aktiv an der Alphabetisierungskampagne teilzunehmen, die 1960 schon stattfand. Und ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich irgendwann meinen Beitrag als alphabetisierende Lehrerin in einem der meistentwickelten Länder der Welt leisten würde. Es scheint so, als ob mein Schicksal wundersame Missionen für mich bereithält.
Die Schule kann meiner Analphabetengruppe keine besondere Betreuung zukommen lassen, und um sich von der unangenehmen Verpflichtung zu befreien, dieser Randgruppe Deutschunterricht erteilen zu müssen, stattet die Schulleitung mich mit der Vollmacht aus, nach Gutdünken zu verfahren. Also habe ich keinem rigiden Programm zu folgen, sondern ich kann meine eigenen Methoden entwickeln. Ziel ist es, dass meine Schülerinnen und Schüler lernen, zumindest ihren Namen zu schreiben, dass sie ganz einfache Texte lesen lernen; sie sollen Straßennamen erkennen, allein öffentliche Verkehrsmittel benutzen können, im Supermarkt oder in anderen Einkaufseinrichtungen zurechtkommen, Geld handhaben und sich so verständigen können, dass sie die einfachsten und die im Alltag elementar notwendigen Angelegenheiten ohne einen Dolmetscher erledigen können.
Wir haben eine Menge Spaß in meiner „Analphigruppe“. Dafür muss ich aber auch ständig improvisieren und attraktive Methoden erfinden. Meine Leute sprechen Kurdisch, Polnisch, Russisch, Bulgarisch, Persisch, Türkisch, Arabisch und Chinesisch. Keiner kennt die Gewohnheiten, Traditionen und die Sprache des anderen. Und jeder idealisiert seine ferne Heimat, die ihm so viel Leid zugefügt hat.
Der Jüngste ist 45 Jahre, der Älteste 70 Jahre alt. Jeder von ihnen hat Schreckliches hinter sich: Folter, Verfolgung, Vertreibung, Haft, Flucht, Terror, Exil. Sie alle sind körperlich und seelisch krank. Das bisschen Nervenstärke, das ihnen bleibt, wird arg strapaziert im täglichen Kampf gegen die schier unüberwindbare, gnadenlose allbekannte deutsche Pingeligkeit und Bürokratie. Selbst ich, die ich in diesem Land geboren wurde, die ich seit meiner jüngsten Kindheit die Spielregeln, die Regeln des Zusammenlebens, die Sprache, die Kultur erlernt habe, fühle mich wie auf einem anderen Planeten, denn fast drei Jahrzehnte „ambiente cubano“ haben mich „verdorben“. Wie fühlen sich dann meine Analphabeten, diese armen Unglückswesen, die die Sprache nicht sprechen und nichts, aber auch gar nichts in der ihnen so fremden Welt verstehen. Aber man verlangt von ihnen, dass sie alle Normen und Gesetze ihres Gastgeberlandes beachten.
Jeden Tag bringen sie mir irgendein Papier vom Arbeitsamt, vom Sozialamt, von der Einwanderungs- und Ausländerbehörde oder von der Polizei.
Ich habe mich nie für juristische Belange interessiert, aber jetzt fühle ich mich verpflichtet, eine Reihe von gesetzlichen Bestimmungen kennenzulernen, denn ob man die Gesetze in Deutschland nun kennt oder nicht, sie müssen ausnahmslos befolgt werden. In Kuba war ich es gewohnt, ebenso wie alle um mich herum, ständig „Probleme zu lösen“, wobei man sich der verschiedensten Tricks bediente. Man suchte irgendeine Hintertür mithilfe eines „Sozius“, eines Freundes oder Bekannten („Wer einen Freund hat, hat eine Zuckerfabrik“, ist die geläufige kubanische Redewendung), um Hindernisse zu umgehen, die uns in Form von absurden Bestimmungen oder sich wichtig tuenden Beamten das Leben zur Hölle machten. Aber in Deutschland geht das nicht. Der Unterschied zwischen der Art, wie in Deutschland die Gesetze befolgt werden und der in Kuba ist wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Heute noch fällt es mir schwer zu verstehen, wie das funktioniert, aber es funktioniert (man sagt ja, die Franzosen brüten ein Gesetz aus, die Italiener lachen sich tot, wenn sie es lesen und die Deutschen respektieren und befolgen es). Meine Schüler jedenfalls haben vielleicht schlimmere Albträume als die, die sie in ihrem Leben in einem diktatorischen Regime verfolgten. Früher erlebte Folter und körperliches wie psychisches Unwohlsein werden jetzt durch Papiere ersetzt, die Bedrohungen und Strafen bedeuten. Mit zitternden Händen reichen sie mir Briefe, deren Absender irgendeins der erwähnten Ämter ist. Und jeder Brief enthält ausnahmslos entweder eine Abmahnung, eine Aufforderung, diese oder jene Menge an Geldstrafe zu zahlen oder eine andere Ahndung, weil der Empfänger die eine oder die andere Bestimmung nicht befolgt hat. Ich werde Anwältin meiner Schüler, streite mich mit Beamten, deren Aufgabe es ist, recht zu behalten und für Ordnung zu sorgen unter diesen Leuten, die für Bürokraten das perfekte Chaos bedeuten.
Ich nutze in meinem Unterricht psychotherapeutische Techniken. So verhindere ich einerseits, dass mein Gedächtnis, das berufliche Kenntnisse und Erfahrungen gespeichert hat, schrumpft, und andererseits erreiche ich, dass meine Schüler sich geschützt fühlen und die Reglementierung durch Paragrafen und strenge Beamte zeitweilig vergessen. Zumindest während des Deutschunterrichts können sie die legalen Probleme beiseitelassen. Im Klassenzimmer fühlen sie sich wie in einer Oase, unbesorgt, sicher und, vielleicht das Wichtigste, von ihrer Lehrerin verstanden und respektiert. Sie lieben mich. Wir verstehen uns, obwohl niemand die Sprache des anderen spricht. Manchmal, wenn die Atmosphäre mit Aggressivität aufgeladen ist, weil eine Seite sich lustig gemacht oder erregt hat über die nach Knoblauch und Hammel stinkenden Mitschüler und die andere Seite über jene, die Schweinefleisch futtern und unerträglichen Schweißgeruch verbreiten, muss ich alles Mögliche unternehmen, um zu verhindern, dass das Geschrei nicht in Schlägerei ausartet.
Von montags bis freitags haben die Schüler sechs Unterrichtsstunden täglich auszuhalten. Sie sind an schwere körperliche Arbeit gewöhnt, aber einen Bleistift zwischen drei Fingern festzuhalten und damit Buchstaben, sogar ganze Wörter aufs Papier zu bringen, bringt sie zum Schwitzen, verursacht bei einigen manchmal regelrechte Depressionen. Wenn Yuris Hand verkrampft, schreit er, dass es mir durch Mark und Bein fährt. Blind vor Zorn und Verachtung schmeißt er den Bleistift in die Ecke und auf Russisch mit einigen deutschen Wörtern vermengt flucht er: „Ich halte es nicht mehr aus! Mein ganzes Leben lang habe ich auf dem Lande geschuftet, war Pferd und Pflug zugleich. Bei vierzig Grad unter null musste ich draußen sein, und um nicht vor Kälte zu krepieren, musste ich arbeiten, arbeiten, arbeiten, mich bewegen, die schwersten Lasten schleppen. Und hier verlangt man jetzt von mir, idiotische Buchstaben zu malen, die ich zu nichts gebrauchen kann!“
Es fällt mir nicht leicht, Yuri zu trösten. Ich nehme seine steife Hand, massiere sie und rede mit leiser Stimme auf ihn ein, auf Russisch, mit meinem äußerst geschrumpften Vokabular, das ich noch aus meiner Schulzeit erinnere. Und, oh Wunder, Yuri lacht.
Ich mache mit ihnen jetzt Entspannungsübungen und singe dazu ein Kinderlied. Das macht ihnen so viel Spaß, dass sie es sehr schnell auswendig können und mitsingen. Wie im Kindergarten!
Jeden Abend, wenn ich den Unterricht für den nächsten Tag vorbereite, brüte ich Ratespiele aus, um das Lernen unterhaltsamer, erträglicher gestalten zu können. Wir spielen Bilderlotto. Ich verteile Lob und beruhige Wutausbrüche, wenn bisweilen der eine oder andere verzweifelt, weil das Gedächtnis ihn im Stich lässt oder die ungeschickte Hand keine lesbaren Buchstaben schreiben will.
Yuri kann endlich seinen Nachnamen schreiben, er ist befähigt, unter Dokumente mit eigener Hand seinen Namen zu setzen. Und dabei stelle ich fest, dass dieser alte, von Deutschen abstammende Bauer, dessen Vorfahren von der Zarin Katharina angeworben wurden, um das Gebiet um die Wolga urbar zu machen, der, aus seiner Heimat von Stalins Schergen während des Zweiten Weltkriegs vertrieben und in Arbeitslager nach Sibirien verbannt, kurz nach seiner Ankunft in Deutschland schneller merkt, als man sich das vorstellen kann, dass die Bequemlichkeit nicht nur für Reiche erfunden wurde. Ich gebe ihm die Aufgabe, seinen vollständigen Namen, der sich aus acht Buchstaben zusammensetzt, fünfmal zu schreiben. Und siehe da, was macht Yuri? Er schreibt fünfmal nur den ersten Buchstaben seines Namens. Als ich ihn frage: „Yuri, warum schreibst du nicht deinen kompletten Namen?“, antwortet er: „Der ist viel zu lang, so ist es genug. Der ganze Schwanz ist überflüssig.“
Ich bin inzwischen ein halbes Jahr in Deutschland und habe gerade eine bequeme, bezahlbare Wohnung gefunden. Die sehr alte Besitzerin einer Villa in einem der exklusivsten Stadtteile Hamburgs überlässt mir das gesamte Erdgeschoss. Ihre ausdrückliche Bedingung: Nichts darf verändert werden. Alle Möbel und ihr alter Trödelkram müssen bleiben wie und wo sie sind. Die Dame ist schon neunzig Jahre alt, hat die Schrecken zweier Weltkriege, Weltwirtschaftskrise und Inflation, die Zerstörung des Landes miterlitten. Sie hat das Wiedererstehen einer starken Nation miterlebt, aber Misstrauen und Angst sind geblieben. In ihrem Keller hortet sie massenweise Konserven in Dosen und Gläsern, die kurz nach Kriegsende produziert worden waren, vor einem halben Jahrhundert! Aber das Depot darf nicht angerührt werden. Man kann ja nie wissen! Nicht einmal ihr Sohn, der sich um den Erhalt der Villa kümmert, Reparaturen erledigt und Müll beseitigt, darf ihr Warenlager antasten. Und wieder einmal sehe ich mich in der Lage, Despotismus und Subordination ertragen zu müssen. Es ist zwar wahr, dass die Miete, die ich für diese riesige Wohnung bezahle, fast symbolisch ist, aber es ist ebenso eine Tatsache, dass die alten, abgenutzten, billigen Möbel und Utensilien, die muffig und nach Schmutz riechen, geradezu eine Beleidigung für jeden Mieter bedeuten müssen. Auf sehr diplomatische Weise versuche ich, die Dame davon zu überzeugen, dass einige Veränderungen notwendig sind und dass sie mir erlauben möge, die in Angriff zu nehmen. Sie bleibt stur. Und von Neuem in meinem Leben muss ich mir Tricks und Listen einfallen lassen und mich anderer Mittel bedienen, um meine Bleibe in ein angenehmes Fleckchen zu verwandeln. Ich nutze ihre Abwesenheit – sie ist für eine Woche an die Nordsee gereist –, um den Dielenfußboden komplett zu schleifen und zu versiegeln. Mein Sohn und ein Neffe, ein wahrer zwei Meter langer rotbärtiger, blauäugiger Teutone, der stark ist wie ein Stier, beteiligen sich an dem Komplott. Ich miete eine Schleifmaschine. Die wiegt mehr als ich, verursacht einen Lärm, der einen Toten erwecken kann und frisst die Dielen vollkommen weg, wenn man nicht korrekt mit ihr umgeht. Ich versuche, die Maschine zu führen, aber sie hebt mich in die Luft, als ob ich eine Feder wäre. Ich muss „meine“ beiden Männer bitten, die Holzfressmaschine zu bedienen, und nach drei Stunden intensiver Schleifarbeit habe ich einen nagelneuen Dielenfußboden, der intensiv nach Kiefernholz duftet.
Wenn ich die schrecklichen Möbel doch auf den Sperrmüll werfen dürfte, dann wäre die Wohnung perfekt, aber ich kann keinen Krieg mit der Besitzerin riskieren. Wieder einmal strenge ich meine Fantasie an, plane, mache Skizzen, stelle Berechnungen an, kaufe Dekorationsstoffe, Stühle und viele lebende Pflanzen, um das Hässliche zu verbergen. Natürlich kann ich nicht anders, als einige der schrecklichsten Gegenstände in den Keller zu schaffen. Ich bin mir sicher, dass die Dame sie dort nie finden wird und ich hoffe, dass, wenn ich Glück habe, meine Überschreitungen ihrer Anordnungen nicht bemerkt werden. Einige Tage nach Beendigung meines unerlaubten Meisterwerkes kehrt die alte Dame vom Urlaub heim. Es scheint so, dass ein Nachbar, der den Lärm und das ständige Rein und Raus verschiedener Personen, das Ein- und Ausladen von Arbeitsinstrumenten und -materialien während ihrer Abwesenheit beobachtet und mich bei ihr verpetzt hat.
Sie begrüßt mich sehr kalt und fordert mich auf, ihr die Wohnung zu zeigen. Ihre Augen werden tellergroß, und sie sagt: „Was ist denn hier geschehen? Alles ist verändert, der Fußboden – was haben Sie mit dem Fußboden gemacht?“
Wie ein kleines Kind, das bei einem bösen Streich erwischt wurde, antworte ich: „Frau S., haben Sie gesehen, wie schön der Fußboden geworden ist?“
„Ja, aber ich habe es Ihnen nicht erlaubt, und Sie haben mich nicht gefragt und haben meine Abwesenheit ausgenutzt, hinter meinem Rücken!“
Nur nachdem ich ihr versichere, dass ich alle Kosten für die Renovierung übernommen habe, fällt ihr nichts anderes ein, als mit strenger, strafender Miene zu sagen: „Wer’s schön haben will, muss zahlen!“ Und ich: „Genauso ist es!“
Allmählich fülle ich „meine“ Wohnung mit Dingen, die das Leben angenehm machen. Freunde schenken mir Geschirr, Küchenutensilien und vor allem Bücher. Ein Stereo-Radio-Plattenspieler ist das erste große Weihnachtsgeschenk meiner Söhne. Zum x-ten Mal beginne ich, eine Bibliothek und eine Schallplattensammlung zusammenzustellen. Wäre mein Gehalt, das mir die Sprachschule zahlt und bei dem ich nicht wagen darf, tief durchzuatmen, nicht so miserabel, dann könnte ich tatsächlich zufrieden sein.
In der Schule läuft das Gerücht, dass man die Institution schließen wolle, weil der Vertrag mit dem Arbeitsamt nicht verlängert werde. Ich forsche nach und schlussfolgere, dass die Suche einer anderen Stelle alsbald erforderlich wird, denn ich habe keinerlei Mittel und Reserven, wenn ich von heute auf morgen auf die Straße gesetzt werde. Außerdem muss ich mindestens bis zum 65. Lebensjahr für das Alter eine Mindestvorsorge treffen, denn meine drei Jahrzehnte, die ich durchgehend berufstätig war, zählen nicht für die Rente in Deutschland.
In der anzeigenreichsten Hamburger Tageszeitung, dem „Hamburger Abendblatt“, finde ich ein Stellenangebot bei einem Schiffsausrüster. Die Geschäftsleitung braucht eine Fremdsprachenkundige für Englisch, Spanisch und Französisch, die ihr als Sekretärin und Assistentin zur Hand geht. Ich bin überzeugt, dass diese Stelle extra für mich reserviert ist, zumal versichert wird, dass eine Einarbeitung erfolgen soll. Meine Bewerbung geht noch am selben Tag zur Post.
Die Unterlagen sind kaum beim Empfänger angekommen, als ich schon telefonisch zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen werde.
Der Personalchef spricht erst einige Minuten mit mir, als ich Getuschel und Bewegungen hinter mir verspüre. Ich sitze mit dem Rücken zur offenen Tür des großen Konferenzsalons und kann mich leider nicht umdrehen, um zu sehen, was dort geschieht. Später wird mir erzählt, dass meine Bewerbung als Übersetzerin, Dolmetscherin und Sekretärin eine Welle der Neugier und des Erstaunens bei den Geschäftsleitern des Unternehmens – vier an der Zahl! – hervorgerufen hatte. Der technische Direktor, der offenbar am meisten daran interessiert ist, dass ich seine allgegenwärtige Bedienstete werde, redet mit mir, als sei ich schon eingestellt. Plötzlich tritt eine Dame ein und stellt sich vor. Aber ich bekomme ihren Namen gar nicht mit und merke auch nicht, dass sie Eigentümerin und Geschäftsleiterin der Firma ist. Sie schaut mich an und spricht mit mir, als ob ich ein seltener Vogel wäre. Mehrmals wiederholt sie die Frage: „Stimmt es, dass Sie fast dreißig Jahre in Kuba gelebt haben? Mein Gott, wie konnten Sie es so lange in diesem Land aushalten!“