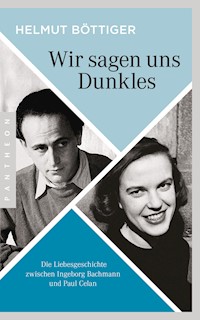Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Berenberg Verlag GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dreimal ist Helmut Böttiger während der letzten dreißig Jahre nach Czernowitz gereist, in die Stadt am östlichen Rand der alten Habsburgermonarchie, heute eine Stadt im Westen der Ukraine – und längst ein mythischer Ort. Jedes Mal hatte sich die Stadt verändert: von einem eben noch sowjetischen Vielvölker-Labor zum Schauplatz der Orangenen Revolution. Und schließlich zu einer Stadt in der neuen, eigenständigen Ukraine, die sich gegen die alten Besatzer verteidigen muss. Nicht nur ihre jüdischen Wurzeln hat die Stadt neu entdeckt. Helmut Böttiger ist auch den Spuren der Literatur gefolgt. Von Paul Celan bis zu den Autorinnen und Autoren der modernen Ukraine, die sehnsüchtig nach Westen blickt und vom Osten nicht loskommt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 92
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Böttiger
Stadt der Zeitenwenden
BERENBERG
Vorbemerkung
I.
Juli 1993
II.
Mai 2005
III.
September 2022
Erwähnte Bücher
Über den Autor
Vorbemerkung
Anfang der siebziger Jahre trampten wir an den verkaufsoffenen Samstagen nach Würzburg, in die nächstgelegene größere Stadt, um im studentisch-alternativen Buchladen Colibri die dort ausliegenden Neuerscheinungen anzuschauen. Das war für uns Sechzehn-, Siebzehnjährige die wichtigste Informationsquelle. Maßgeblich waren die schwarzen Quarthefte des Wagenbach-Verlags, mit Lyrik von Erich Fried und Wolf Biermann oder den politisch-dokumentarischen Texten von F. C. Delius, aber auch die edition suhrkamp war regelmäßig vertreten. Wir blätterten immer aufs Geratewohl herum, und so geriet ich einmal an die Ausgewählten Gedichte des mir völlig unbekannten Paul Celan. Es wurde zu einem herausgehobenen Moment. Die Gedichte von Fried oder Biermann verstand ich auf Anhieb. Was mir aber bei Celan entgegenkam, war etwas völlig anderes – eine Sprache, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich las: »Wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis, / wir schlafen wie Wein in den Muscheln, / wie das Meer im Blutstrahl des Mondes« – das war ein Sog von Bildern, ein dunkler Rhythmus, ein Rausch der Sprache. Ich begriff nichts, aber ich war vollkommen elektrisiert. Ich ahnte, dass hier etwas verborgen war, von dem ich unbedingt mehr wissen wollte, und dieses produktive Nicht-Verstehen war ein Schlüsselerlebnis.
Jenseits seiner Gedichte war über diesen Autor nicht viel zu erfahren, außer, dass er 1920 in »Czernowitz« geboren war. Das schien ebenfalls einer mir völlig unerreichbaren, imaginären Sphäre anzugehören. Czernowitz lag bis 1918 am östlichen Ende der ehemaligen, sagenhaften Habsburgermonarchie, in der Bukowina, und wurde danach dem Königreich Rumänien zugeschlagen. Jetzt gehörte die Stadt zur Sowjetunion und lag in einem militärischen Sperrbezirk an der Grenze. Das befeuerte noch das Mythische daran. Es war ein Ort, der einmal in einer unerhörten Blüte gestanden haben musste, aber jetzt jeglicher Vorstellbarkeit entzogen war. Ich wusste: Wenn sich jemals die Möglichkeit eröffnen würde, in dieses magische Czernowitz zu gelangen, würde ich das versuchen.
Ab 1991 gehörte Czernowitz zum neuen, unabhängigen Staat Ukraine, und damit war eine Reise in diese Stadt theoretisch möglich. Wie das dann im Juli 1993 vonstattenging, war zwar ein Abenteuer, aber vor allem eines dieser Erlebnisse, die man nie mehr vergisst. Ich spürte bald, dass diese Stadt auf ihre Weise frappierende Gemeinsamkeiten mit dem Lebensweg Paul Celans hat, sie zeichnet mit allen Schattierungen die Verwerfungen des 20. Jahrhunderts nach. Bis 1918 war Czernowitz mehrsprachig, mit vielen kleinen ethnischen Minderheiten, und noch bis zum Zweiten Weltkrieg bildete das deutschsprachige Judentum, zu dem auch Celan gehörte, den größten Bevölkerungsanteil. Czernowitz schien außerhalb der üblichen Zeitläufte zu existieren, eine historische Insel, und im Nachhinein nahm dieses Völkergemisch mit seiner Vielfalt an Kulturen und Religionen in Büchern und Erinnerungen legendäre, oft verklärte Züge an. Im Jahr 1993 jedoch spielte sich vor den fast lückenlos erhaltenen habsburgischen Fassaden ein ganz anderes Leben ab. Die Juden, die die Atmosphäre dieser Stadt geprägt hatten, waren nahezu vollständig ermordet worden, und jetzt lebte dort eine Bevölkerung, die zumeist aus den östlichen Gebieten der Sowjetunion umgesiedelt worden war und keine Beziehung zur Geschichte von Czernowitz hatte, das auf Russisch »Tschernowzi« genannt worden war und jetzt auf Ukrainisch »Tscherniwzi« hieß. Das Aufeinanderprallen unterschiedlicher Zeiten auf engstem Raum beschäftigte mich in der Folge immer mehr.
Die Faszination durch die Stadt Czernowitz, dieses lange unbekannte kultur- und zeitgeschichtliche Labor, führte auch zu einem verstärkten Interesse für die Entwicklungen in der Ukraine. Vorher hatte ich sie nur als einen Bestandteil der Sowjetunion wahrgenommen, nicht als ein von Russland deutlich zu unterscheidendes Land mit einer eigenen Sprache. Nach 1991 begann aber ein Prozess, in dem die Ukraine sich ihrer Traditionen vergewisserte und sich dem imperialen Zugriff Russlands immer selbstbewusster entzog. Das war auch für die Ukrainer selbst, denen die russische Sprache ständig, und im 20. Jahrhundert unter Stalin erst recht, als die eigentliche Hochsprache aufoktroyiert worden war, eine spannende Entwicklung. Ein Schriftsteller wie Juri Andruchowytsch erregte in den neunziger Jahren Aufsehen damit, dass er die ukrainische Sprache, die oft als Sprache der Bauern und des einfachen Volks verunglimpft worden war, plötzlich zur Sprache einer Avantgarde machte: gegen die reaktionäre Macht des Russischen, mit allen formalen Mitteln wahrhaft zeitgenössischer Literatur. Andruchowytsch wurde in Iwano-Frankiwsk geboren, dem früheren Stanislau, und er verband auf ästhetisch schillernde Weise den Staat Ukraine mit der alten galizischen Tradition. Das neue Geschichtsbewusstsein dieses Landes bezog sich auf lange verschüttete historische Schichten, und plötzlich wurde auch die Vielsprachigkeit und die Multikulturalität von Czernowitz wieder zu einem aktuellen Anknüpfungspunkt.
Als ich dann 2005, nach der Orangenen Revolution gegen die Statthalter Moskaus in Kiew, in die Ukraine reiste, gehörte die deutschjüdische Literatur der Bukowina, aus der Celan als ein Dichter von Weltrang herausgewachsen war, in gewisser Weise schon zur nationalen Identität. Die Ukraine wurde, und das war ein völlig ungeahntes und einzigartiges Phänomen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, zu einem phantastisch anmutenden Experimentierfeld. Dazu gehörten sogar solch flirrende Ereignisse wie der Sieg der Sängerin Ruslana beim European Song Contest 2004. Czernowitz suchte in diesen Nullerjahren wieder verstärkt nach seinen Wurzeln, und das Neben- und Ineinander von alten sowjetischen Prägungen, die 1993 noch übermächtig zu sein schienen, und den neuen Bewegungen auf kulturellem und gesellschaftlichem Terrain wirkte spektakulär.
Im Herbst 2022, meiner dritten Reise nach Czernowitz, hatten sich die Rahmenbedingungen dann grundsätzlich verändert. Seit Februar führte Russland einen brutalen Krieg gegen die gesamte Ukraine, die Stadt befand sich in höchster Alarmbereitschaft, es herrschte Ausnahmezustand mit einer Ausgangssperre nach 22 Uhr, Sirenenwarnungen und Wasserabstellungen. Doch Czernowitz hatte sich längst emanzipiert und beschäftigte sich mit großem Selbstbewusstsein mit seiner vielfältigen und widerspruchsvollen Geschichte. Es ist auch die Literatur, die Verankerung in einer pluralistischen europäischen Kultur, die in diesem Krieg verteidigt werden muss.
Diese Stadt hat bereits einige Zeitenwenden erlebt. Zum ersten Mal wurde mir diese Dimension bewusst, als die fast neunzigjährige Deutschjüdin Lydia Harnik, die ihre Heimatstadt Czernowitz nie verlassen hatte, mir 1993 ihre verschiedenen Staatsangehörigkeiten aufzählte: österreichisch-ungarisch, rumänisch, sowjetisch und ukrainisch. Die drei Momentaufnahmen dieses Buches – 1993, 2005 und 2022 – versuchen, eine dramatische Periode in einzelnen, prägnanten Ereignissen zu spiegeln. Gerade heute ist Czernowitz wieder ein Schauplatz, an dem sich die zeitgeschichtliche Entwicklung symbolisch zu verdichten scheint.
Das erste Kapitel erweitert eine Passage aus meinem Buch Orte Paul Celans, das 1996 erschien und nicht mehr lieferbar ist. Die beiden anderen Kapitel greifen zum Teil Zeitungsartikel auf, sind aber zu viel längeren und eigenständigen Texten geworden. Zu danken habe ich vor allem Stefanie Stegmann vom Literaturhaus Stuttgart, die mir im Rahmen des Projekts Fragile die Reise zum Meridian-Lyriktreffen in Czernowitz 2022 ermöglicht hat, Petro Rychlo, der mir 1993 unter anderem die Begegnung mit Lydia Harnik vermittelte, sowie Jurko Prochasko für die gemeinsame Veranstaltung in Czernowitz.
Berlin, im März 2023
Helmut Böttiger
I.
Juli 1993
Es gibt eine ukrainische Stadt, die »Tscherniwzi« heißt und am Rand gelegen ist, vierzig Kilometer vor der Grenze zu Rumänien. Dorthin zu kommen ist nicht leicht – als es noch die Sowjetunion gab, war es als Tourismusziel nicht vorgesehen. Die Stadt lag in einem militärischen Sperrgebiet und war für Ausländer unzugänglich. Seit die Ukraine 1991 ein selbständiger Staat wurde, hat sich das geändert. Das Land ist allerdings immer noch dabei, sich als ein solches zu definieren. Die verkehrstechnischen wie die politischen Umstände sind unwägbar, zumal, wenn man nicht in einer organisierten Gruppe reist, sondern einzeln oder zu zweit unterwegs ist und auch nicht mit dem Auto kommt. Fahrkarten sind im Land selbst kaum zu haben, weil eine darauf spezialisierte Mafia sofort alle aufkauft und zu Sonderbedingungen unter der Hand weitergibt; man wartet oft tagelang auf eine Reise. Die Eisenbahnfahrt von Berlin dauert planmäßig 38 Stunden. Es gibt wohl auch eine Flugverbindung mit der Hauptstadt Kiew, aber »Tscherniwzi« – die Angestellte im Berliner Büro der Aeroflot fragt mehrfach nach, wie diese Stadt denn noch mal heiße, und sie findet schließlich auch heraus, dass es einmal am Tag einen Flug von Kiew in dieses Tscherniwzi gibt: aber »ohne Gewähr«, und ein Ticket könne nur in Kiew ausgestellt werden.
Der Weg über Rumänien, der Weg, den auch die Geschichte gegangen ist, wirkt am plausibelsten. Paul Celan hat sich 1945 von Czernowitz, als es der Sowjetunion zugeschlagen wurde, nach Bukarest durchgeschlagen. Czernowitz, bis 1918 Hauptstadt des am östlichen Rand des Habsburgerreichs gelegenen Kronlands Bukowina, gehörte ab 1918 zu Rumänien und hieß Cernăuţi. Um ins heutige Tscherniwzi zu kommen, scheint Rumänien immer noch am naheliegendsten zu sein. In Suceava, dem Zentrum des rumänischen Teils der früheren Bukowina und ungefähr vierzig Kilometer von der Grenze entfernt, gibt es einen Flugplatz. Es ist kein Problem, von Berlin über Bukarest dorthin zu kommen. Es bleiben nur noch die achtzig Kilometer bis Tscherniwzi, es bleibt der Grenzübertritt.
Der Flughafen von Suceava, auf dem die Propellermaschine mit dreißig Insassen im Juli 1993 landet, liegt auf einer kahlen, menschenleeren Hochfläche, die schrägen blauen Buchstaben »Suceava« auf dem kleinen Flughafengebäude künden von Ferne und Entlegenheit. Ich bin mit Axel unterwegs, einem Freund aus der DDR, auf dessen Erfahrungen im ehemaligen sowjetischen Einflussgebiet ich vertraue. Wir steigen in einen klapprigen Dacia, die rumänische Lizenzversion des Renault. Der Taxifahrer will uns für dreißig Dollar zur Grenze fahren. Nach zwei Kilometern platzt ein Hinterreifen, und wir sitzen, während der Fahrer das Reserverad auspackt, unter den ausgreifenden Kirschbäumen der Bukowina. Die einstöckigen Bauernhäuser drumherum sind alle in leuchtenden Farben bemalt und, auch wenn Jahreszahlen wie 1969 oder 1980 über der Tür stehen, im traditionellen Stil gebaut. Bei der Weiterfahrt sehen wir manchmal Mädchen an der Straße, die eine Kuh an einem Strick halten und am Straßenrand grasen lassen, die Fahrzeuge sind meistens Pferdefuhrwerke.
Vor der Grenze steht eine lange, bewegungslose Schlange von Lastwagen, keine Autos. Halt ist an einer Eisentür und einem Stacheldrahtzaun. Der rumänische Grenzposten in seinem Wärterhäuschen kann mit uns wenig anfangen. Als wir ihm das ukrainische Visum zeigen, führt er uns nach einer Weile zu einer Baracke, vor der wir warten sollen.
Die Mittagshitze breitet sich langsam aus, und wir warten lange. Drinnen schart sich eine Gruppe um einen großen steinernen Tisch, es handelt sich wohl um den Zoll. Wir gehen hinein. Einer der Uniformierten erklärt sich für nicht zuständig, das seien die in den anderen Uniformen, die ab und zu mal durch den Raum gehen. Sie gehen ziemlich schnell und betriebsam durch den Raum, verschwinden hinter Türen und kommen wieder daraus hervor; was sie machen, ist völlig unklar. Als sich einer von ihnen von uns angesprochen fühlt, hält er kurz inne, betrachtet die Pässe und verschwindet mit ihnen. Kurze Zeit später kommt von dort ein beleibter, großer Mann mit vielen Abzeichen auf der Uniform und beginnt plötzlich ungeheuer laut zu brüllen; er meint die Leute, die um den steinernen Tisch herumstehen und Lastwagenfahrer zu sein scheinen. »Raus«, schreit der Beleibte unmissverständlich, dann geht er wieder.
Zu uns kommt dann ein Beamter, der ein bisschen Deutsch spricht und sagt: »Sie können weiter. Aber der Russe macht Schwierigkeiten!«
Es sind ein paar hundert Meter Niemandsland zwischen der rumänischen Seite und dem ukrainischen Zaun. Auf der schmalen