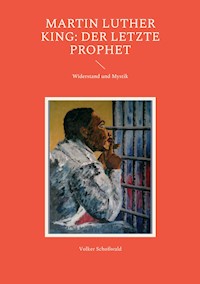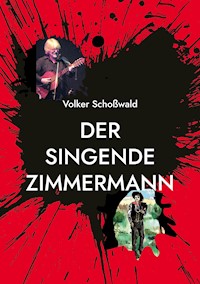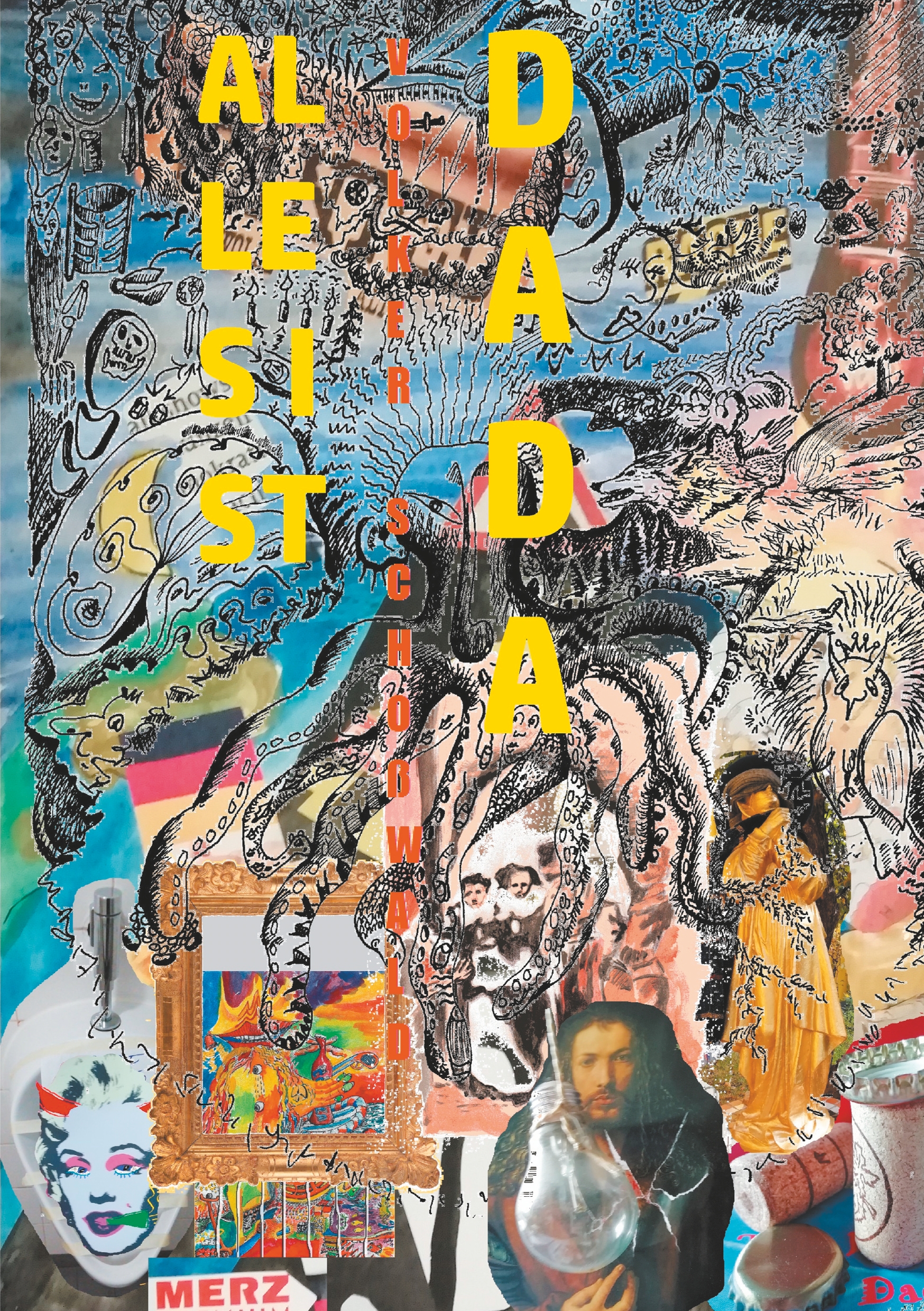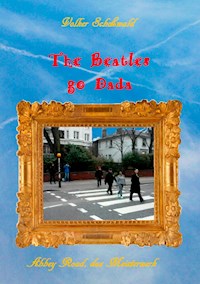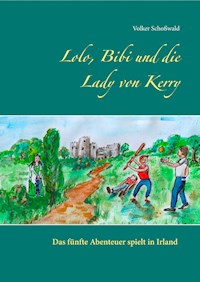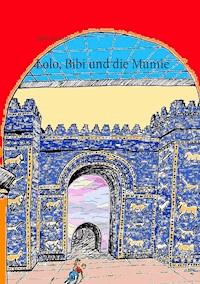Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Da war doch was ... denken wir mitunter, wenn wir beispielsweise bei der Zeitungslektüre auf einen Hinweis auf ein Ereignis oder eine Person stoßen, um die einige Zeit in der Öffentlichkeit Wirbel gemacht wurde. Volker Schoßwald sammelte solche willkürlichen Erinnerungspunkte und verpackt sie in eine zeitgemäße Sicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 105
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Uns bewegt so vieles
und unserer Erinnerung entschwindet so vieles
Da war doch was…
all denen, die sich ein „Aha-
Erlebnis“ gönnen möchten
Inhaltsverzeichnis
Ach ja, Rosa Parks! Da war doch was … 2/13
Ein Geistlicher kehrt zu sich zurück 08/14
Die Theologie der Hoffnung 08/14
Erich Kästner 07/14
Da war doch was oder ist es noch immer? Kruzifix
Sartre lehnt 1964 Literaturnobelpreis ab und… 10/14
1984 - 06/14
Exxon Valdez ….03/14
Game Boy? 04/14
EinStein, der zum Eckstein wurde 04/15
Dachau: vor 80 Jahren 03/13
Che Guevara würde 85 8/13
Albert Camus, jetzt wäre er 100 11/13
Georg Büchner, vor 200 Jahren geboren 10/13
Willy Brandt
August Bebel starb vor 100 Jahren 08/13
Heinrich Albertz 02/15
Lysergsäurediethylamid 05/13
Johannes XXIII 04/13
Satanische Verse: Fatwa gegen Salman Rushdie
Nicht nur zur Weihnachtszeit: Nostradamus, Galilei und Hubble, die heiligen drei Könige
Außenbordeinsatz 18 03 65
Vergessen, verdrängt, verleugnet 05/15
Keine Apokalypse
1965
Like a Rolling Stone
oder wie ich nie werden will…
Der Papst und der Islam
Rom gelingt der Sprung ins 19. Jahrhundert
Das Jubiläum und die geschenkte Freiheit
…ein Komet?
Penny Lane und Carnaby-Street
Da war doch was im März 2007
April vor 20(00) Jahren 04/17
1967 - von Hendrix bis Ohnesorg 06/17
Harry Potter und der Stein der Weisen 07/17
2013 begann die Reihe „Da war doch was…“ mit Rosa Parks. Ich hatte die Geschichte fast vergessen und holte sie dann aus dem Gedächtnis, aufgefrischt und erweitert durch ein paar Recherchen. Das fand ich so interessant, dass ich begann, daraus eine Reihe zu machen, die monatlich in unserer bayerischen Pfarrerzeitung erschien. Dabei bemühte ich mich um abwechslungsreiche Themen und wollte nach Möglichkeit von den „großen Erinnerungen“, über die ohnedies geschrieben würde, wegbleiben. Aber auch ohne Jubiläumsjahr finde ich die Rückblicke bedenkenswert und bringe sie daher in diesem Sammelband heraus.
Es ist immer eine lebhafte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, bei der die Gegenwart nicht auf der Strecke bleibt. Man kann auch aus der Geschichte lernen. Ich aber habe aus diesen Geschichten vor allem gelernt, dass die Menschheit als politische Größe aus der Geschichte nicht gelernt hat – wenngleich es für einzelne, ja, für ganze Gruppen zutrifft. Vermutlich hat die biblische Anthropologie recht, wenn dort betont wird, dass das Trachten und Denken des Menschen böse ist von Kindesbeinen an. Wir können dem freilich etwas entgegenstellen, gespeist aus der Kraft der Hoffnung und durch die Macht der Liebe.
Volker Schoßwald, im Dezember 2017
1 Ach ja, Rosa Parks! Da war doch was … 2/13
Sie wäre am 4. Februar 2013 hundert Jahre alt geworden; vor acht Jahren verstarb sie: Rosa Parks. Eine kleine Szene der kleinen Frau wurde zur Legende, eine kleine Szene, ohne die Barak Obama heute wohl nicht Präsident der Vereinigten Staaten sein könnte: Montgomery, Alabama, 1. Dezember 1955, in einem öffentlichen Bus: In einem Busabschnitt, der mit coloured gekennzeichnet ist, will sich ein weißer Fahrgast hinsetzen. Kein Problem. Aber alle drei schwarzen Fahrgäste, die in dieser Reihe sitzen, müssen nun aufstehen und ihren Platz freimachen. Alle! Weil ansonsten die Rassentrennung gefährdet wäre und mit ihr die öffentliche Ordnung. Rosa Parks bleibt sitzen. Sie ist nicht einfach müde vom Arbeiten, sie ist auch müde, immer wieder aufgrund ihrer Hautfarbe schikaniert zu werden: Bereits als Grundschülerin hatte sie zur Schule laufen müssen, weil der Schulbus für weiße Kinder reserviert war. Der Fahrgast insistiert auf seinem Recht - Rosa Parks, 42, bleibt sitzen. Der Busfahrer ruft die Polizei. Die Sekretärin der NAACP (National Association for the Advancement of Colored People) wird verhaftet und verurteilt, wegen Störung der öffentlichen Ordnung.
Pfarrer der Methodistin war ein gewisser, damals noch unbedeutender Martin Luther King. Für ihn war diese Szene der Auslöser für den effektivsten Einsatz von zivilem Ungehorsam, dem die vorgebliche Schutzmacht der Freiheit, die USA, ausgesetzt war. Freiheit war auch fast hundert Jahre nach Lincoln und dem Sezessionskrieg die weiße Freiheit. Unter der Führung von Martin Luther King nahmen sich nun die Schwarzen in Montgomery die Freiheit, keine öffentlichen Busse mehr zu benutzen. Dieser Boykott wurde freilich auch von weißen Mitbürgern unterstützt, nicht zuletzt durch Mitfahrgelegenheiten und Taxidumpingpreisen (10Ct); die Protestaktion wurde durch Demonstrationen inhaltlich geführt. Und die weiße Polizei Alabamas schützte die weiße Freiheit vor dem Begehren der Schwarzen nach ihrem Recht, bis die Bundespolizei einschritt.
Weniger geschützt wurde Rosa Parks, die als Symbolfigur galt, wenn auch Martin Luther King (damals Mitte 20) die Führungsrolle längst übernommen hatte. Rosa Parks musste mit ihrem Mann fliehen - nach Detroit. Über 1000km von den Südstaaten in die Nordstaaten, wie vor dem Ende der Sklaverei.
Rosa Parks erlebte den Erfolg ihres Engagements noch in Montgomery, als der Boykott nach über einem Jahr (!) durch ein höchstrichterliches Urteil beendet wurde, in dem die Rassentrennung im öffentlichen Bereich für verfassungswidrig erklärt wurde und in der Folge die sog. Jim-Crow-Gesetze vollständig abgeschafft wurden (das galt schon 1954 für die Schulen, aber erst 1964 allgemein).
Rosa Parks stammte aus Tuskegee / Alabama: Dort wurden die Tuskegee Airmen ausgebildet: Schwarze Kampfpiloten, die im Einsatz gegen Deutschland im zweiten Weltkrieg besonders erfolgreich waren. Trotzdem galt auch in der Armee die Rassentrennung. Empörend ist des Weiteren die sog. Tuskegee-Syphilis-Studie: Seit 1932 wurden 400 schwarze Einwohner, die an Syphilis erkrankt waren, ohne ihr Wissen nicht mit Penicillin behandelt, um die Spätfolgen beobachten zu können. Diese an die Nazis (Mengele) erinnernde Studie wurde erste 1972 (!) abgebrochen.
Diese beiden Seiteninformationen zu Rosa Parks Heimatstadt lassen dann vielleicht wieder eine Ahnung davon aufsteigen, was Rassendiskrimierung in ihrer Totalität und Brutalität bedeutet und zugleich, dass selbst Demokratie und freie Presse kein Garant für Gerechtigkeit sind. Zivilcourage (Parks) und Charismatik (King) gehören unverzichtbar zum erfolgreichen Engagement für eine gerechtere Welt.
2 Ein Geistlicher kehrt zu sich zurück 08/14
Kirche in der Kritik: Wie leicht fühlen wir uns verletzt, wenn jemand oberflächlich oder mit abgenutzten Argumenten über unsere Kirche herzieht. Wie gut tut es uns, wenn ein Kollege pointiert ausspricht, was uns an unserer Kirche alles so stört. Wie wäre es, wenn einer eine überzeugende Kritik an den Kritikern artikulieren kann und zugleich so manches in Frage stellt, was in unserer Kirche wirklich nicht stimmt? Ich stieß auf dem Flohmarkt auf eine solche anonyme Kritik, die immerhin 200 Seiten füllt. Herrlich, dass das mal jemand so klar sieht. Ich greife einige seiner Gedanken auf, doch sein Name erscheint erst am Schluss, da er sich vielleicht verändernd auf die Rezeption auswirkt.
Unsere Kirche nimmt immer wieder neue Mitglieder auf durch Anlässe, die nicht unbedingt mit ihrem Glauben zu tun haben, sondern auch oder sogar vorwiegend mit anderen Faktoren; dazu gehört natürlich die Säuglingstaufe1, aber auch der Kircheneintritt, um einen Arbeitsplatz in der Kirche zu bekommen. Der Kollege konnotiert: Wir haben so schon zu viele „Christen, die keine Christen sind“: Unsere Kirche lebt vom Glauben an Jesus als den Christus und unseren Kirchenmitgliedern wird unterstellt, dass sie diesen Glauben haben, während sie faktisch zu einem hohen Anteil von der Bedeutung Jesu wenig bis nichts wissen und dies auch gar nicht wollen2. Wie weitherzig oder wie eng wir auch immer dies sehen: Letztlich steht unsere Substanz auf dem Spiel. Apropos Spiel: Wenn mein „Club“ in Nürnberg überwiegend Mitglieder hätte, denen Fußball egal ist, dann hätte sein Totenglöckchen bereits geläutet, auch wenn er eine noch so glorreiche Vergangenheit hat.
Doch die systemimmanente Kritik steht bei unserem Autor nicht im Vordergrund. Vor allem wendet er sich an die Intellektuellen und Pseudogelehrten, die von außen die Kirche herablassend anschauen: Ihr interessiert euch für alles und jedes; ihr geht in die Details des Alltagslebens wie auch der Wissenschaften hinein und achtet ihre Fachleute hoch, aber wenn es um die Theologie geht, dann sind euch die Fachleute auf einmal verdächtig3. Da ihr aber von der Theologie kein fundiertes Wissen habt, ist eure Verachtung allemal billig. Er nennt sie die „rüstigen Verächter, die… sich nicht die Mühe genommen haben, eine genaue Kenntnis der Sache, wie sie liegt, zu erwerben.“
Doch obwohl er für die Volkskirche arbeitet und die sichtbare Kirche für wichtig, ja sogar unverzichtbar hält, überzeugt ihn dieses Modell religiös nicht: „Von altersher ist der Glaube nicht jedermanns Ding gewesen, von der Religion haben immer nur wenige etwas verstanden, wenn Millionen auf mancherlei Art mit den Umhüllungen gegaukelt haben, mit denen sie sich aus Herablassung willig umhängen ließ.“ Die Sprache wirkt antiquiert, aber der Inhalt ist für den stimmig, der die Erfahrung mit seinem eigenen Glauben mit der Wirklichkeit unserer Kirchenlandschaft konfrontiert. Der Autor warnt den Leser, damit anzufangen, dass „ihr“ die Hörer „betrügt und ihnen etwas für heilig und wirksam hingebt, was euch selbst höchst gleichgültig ist und was sie wegwerfen sollen, sobald sie sich auf dieselbe Stufe mit euch erhoben haben.“ Damit meint er freilich nicht uns einfache Dorf- und Stadtpfarrer, sondern die gesellschaftlich arrivierten Vertreter der Religion wie auch der Gesellschaft.
Zugleich sind seine Ansprüche an uns Geistliche erheblich; er tituliert uns nicht zufällig als „Priester des Höchsten“, weil er erwartet, dass wir den Glauben, den wir selbst aus unserer Tiefe erfahren, denen näher bringen, die nur das „Endliche und Geringe zu fassen gewohnt sind“. Es klingt beim ihm verlockend, denn da ist es unsere Aufgabe, „das Himmlische und Ewige als einen Gegenstand des Genusses und der Vereinigung“ darzustellen; die Verkündigungen in der Landeskirche und der EKD sollten wohl orgiastisch werden…4
Dem Genussfaktor der Religion stellt er nüchtern zur Seite, dass solche Darstellung nur immer voller Demut gehen kann. Religion ohne Demut geht nicht, weil wir nicht über sie verfügen können. Auch nach seiner Erfahrung ist es selten, dass berufene Menschen ihre Erfahrung mit dem Göttlichen weitersagen können. Die klugen Richter der Religion könnten den Predigern also überheblich lächelnd sagen: Das habt Ihr Euch doch angelesen.5 Er aber hält dem entgegen: Wer wirklich spürbar von der Religion spricht, muss sie erlebt haben. Das habe ich als Ermunterung gelesen, mir wieder mehr die Offenheit für Begegnung mit Gott zu gönnen, die im Alltagsgetriebe eines Pfarrers verschüttet gehen kann.
Amüsant klingt seine Beschreibung für die theologische Ausbildung: „Der Geist lässt sich weder in Akademien festhalten, noch der Reihe nach in bereitwillige Köpfe ausgießen, er verdampft gewöhnlich auf dem Wege aus dem ersten Munde in das erste Ohr.“ Trotzdem ermuntert er dazu, genau hinzuhören, weil in den Worten etwa der systematischen Theologie Einzelnes auftaucht, das wirklich in die Tiefe führt. Dies solle man jedoch nicht mit Moralvorstellungen verbinden; das klänge zwar gut, bliebe aber an der Oberfläche, statt in die Tiefe zu führen.
Wenn die Vertreter der Gesellschaft erwarten: Die Religion diene der Sittlichkeit! Nützlich soll sie sich erweisen! kommentiert er: „Welche Erniedrigung!... Ein schöner Ruhm für die Himmlische, wenn sie nun die irdischen Angelegenheiten der Menschen so leidlich versehen könnte!“ Das gilt über kleinbürgerliche Moralvorstellungen hinaus auch für die Funktionalisierung der Religion bei politischen Fragestellungen wie Krieg und Frieden, Ökologie oder Gerechtigkeit in der Wirtschaftswelt.
Die Religion muss sich aus eigener Erfahrung speisen; man könnte auch formulieren: Prediger und Predigerin müssen identisch sein. Den Worten muss man abspüren, dass sie nicht nur Fremderfahrungen artikulieren.
Obwohl ich mit ganzem Herzen systematischer6 und biblischer Theologe bin, begeistert mich an diesem Theologen die Vehemenz, mit der er seine mystischen Erfahrungen und Erkenntnisse in den gesellschaftlichen Dialog einbringt. Man schrieb das Jahr 1799, als Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher mit 31 Jahren seine Schrift „Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern“7 veröffentlichte. Er überlegte sich: Was hat mich zum Glauben gebracht? Zu dieser Quelle8 ging er zurück, denn er erkannte sie als das einzig Tragfähige. Seine Erfahrung mit Gott ließ er sich nicht madig machen und er unterstellte solche Erfahrungen auch bei anderen „Religiösen“. Diese entscheidende Qualifizierung hatte für ihn den selben Stellenwert wie wissenschaftliche Qualifikation. Seine Biografie ließ ihn die eigene Erfahrung als die eigentliche Substanz bei religiöser Kommunikation erkennen. Dass er nicht nur deduziert, sondern reflektiert von sich redet, gibt ihm Power!
1 Diese zieht sich durch die Generationen. Die Personen, für die der Kircheneintritt eine persönliche Glaubensentscheidung war, lebten irgendwann in grauer Vergangenheit. Entsprechend haben wir viele Kirchenmitglieder, die sich „Christen“ nennen, aus Tradition, nicht aus Glauben.
2 Ich gehe einmal davon aus, dass sich dieser Personenkreis nicht nur mir gegenüber so äußert, sondern auch bei anderen KollegInnen.
3