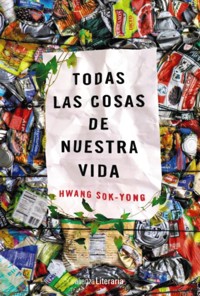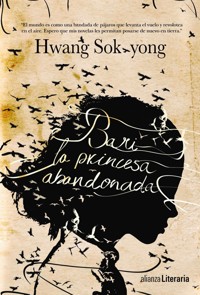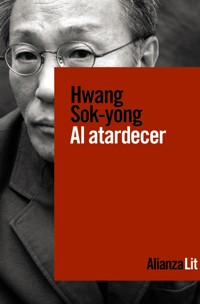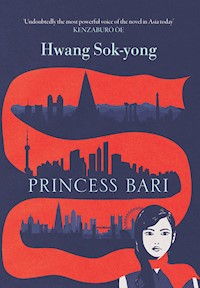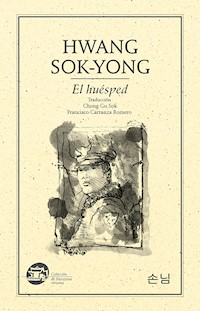Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Am Rand der südkoreanischen Megacity Seoul wächst Minu in einem von Bandenkriminalität beherrschten Armutsviertel auf. Er kann studieren, arbeitet sich hoch und bringt es als Architekt mit eigener Baufirma zu Ansehen und Wohlstand. Eines Tages erhält er eine Nachricht von seiner Jugendliebe, und auf einmal erwachen alte Erinnerungen. Als er den Ort seiner Kindheit aufsucht, findet er aber keinerlei Spuren der Vergangenheit mehr. Seine Geschichte kreuzt sich mit der einer jungen Frau. Uhi will ihren Traum, sich als Theaterregisseurin durchzusetzen, nicht aufgeben. Mit Nachtschichten in einem 24-Stunden-Nahversorger kann sie kaum die Miete stemmen, doch sie verfolgt ihr Ziel, während Minu den Versäumnissen in seinem Leben nachgrübelt. "Dämmerstunde" bildet eine tiefgründige Ergänzung zu "Vertraute Welt", diesem märchenhaften Roman, der auf der großen Mülldeponie am Rand von Seoul spielt. Hier wie dort geht es um die unterschwellige Wirkung einer fast ausgetilgten Welt auf die modernen Verhältnisse in einem Land, in dem beim Streben nach wirtschaftlicher Entwicklung wenig Rücksicht auf Verluste genommen wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HWANG SOK-YONG
DÄMMERSTUNDE
ROMAN
Aus dem Koreanischen übersetztvon Andreas Schirmer
INHALT
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
NACHBEMERKUNG DES AUTORS
KAPITEL 1
Der Vortrag war zu Ende.
Der Projektor wurde ausgeschaltet, die Präsentation verschwand von der Leinwand.
Ich trank das Glas Wasser, das man mir aufs Rednerpult gestellt hatte, zur Hälfte aus und stieg vom Podium hinunter zum Publikum, wo sich schon viele von ihren Plätzen erhoben hatten und eifrig miteinander tratschten. »Die Entwicklung alter Stadtzentren und urbanes Gestalten« war mein Thema gewesen, und dass es auf Interesse stieß, bezeugte die beträchtliche Zuhörerschar, die sich heute hier eingefunden hatte. Ein Magistratsdirektor, Leiter des Planungsausschusses für den Privatsektor, nahm sich meiner an, und ich folgte ihm in die Aula vor dem Hörsaal. Alle strebten schon dem Ausgang zu, als sich eine junge Frau gegen den Strom durch die Menge zwängte und auf mich zusteuerte:
»Einen Moment, bitte!«
Ich blieb stehen, um sie näher in Augenschein zu nehmen. Zu Jeans trug die Frau ein T-Shirt, alles sehr gewöhnlich, und das ungeschminkte Gesicht wurde von einem Kurzhaarschnitt umrahmt.
»Ich habe Ihnen etwas zu geben.«
Ich starrte sie nur verdutzt an, während sie mir einen Zettel hinhielt, auf dem groß ein Name prangte. Darunter standen in kleinerer Schrift Zahlen, die wohl eine Telefonnummer ergaben.
»Was soll das sein?«, fragte ich, während ich den Zettel in Empfang nahm. Inzwischen befand sich die Frau bereits wieder in einer Art Rückwärtsgang.
»Das ist die Nummer von jemandem, den Sie gut kennen, von früher«, antwortete sie, wobei sie den Abstand zu mir weiter vergrößerte. »Sie sollen sich unbedingt einmal bei ihm melden«, rief sie noch.
Ehe ich eine weitere Frage stellen konnte, war die junge Frau in der Menschenmenge verschwunden.
Dass ich gut eine Woche später nach Yeongsan aufbrach, lag an einer Textnachricht von Gus Frau. Gu war ein Freund aus Kindertagen. Ich stamme aus Yeongsan, habe dort meine gesamte Volksschulzeit verbracht, und das Nachbarskind Gu drückte mit mir zusammen die Schulbank. Die meisten Leute, die im Kreiszentrum lebten, besaßen entweder ein kleines Geschäft an der neu angelegten zentralen Hauptstraße, oder sie waren in den diversen Amtsgebäuden und Schulen angestellt. Diejenigen, die noch in den althergebrachten Anwesen hausten, diesen gefälligen Bauwerken mit ihren geräumigen Innenhöfen, das waren die Grundbesitzer. Ihnen gehörten die Äcker und Reisfelder draußen vor der Stadt. Mit dem Pappenstiel, den ihm seine Anstellung als Schreiber im Kreisamt einbrachte, konnte mein Vater unsere Familie gerade so erhalten.
Yeongsan lag am sicheren Ufer des Nakdong; nach dem Krieg war es dort nicht viel anders als vorher. Nachdem mein Vater mit heiler Haut aus dem Krieg zurückgekehrt war, verschaffte man ihm im Kreisamt von Yeongsan einen Posten als Hilfskraft. Meiner Mutter zufolge hing das damit zusammen, dass er sich in irgendeiner Gebirgsschlacht mit Waffenruhm bekleckert hatte, aber auch damit, dass er sich im Kreisamt schon unter den Japanern als Laufbursche die ersten Sporen verdient hatte. Unter den Bauerntölpeln vor Ort stach mein Vater heraus, hatte er doch zumindest sechs Jahre lang die Volksschule besucht; er beherrschte Japanisch in Wort und Schrift und kam mit chinesischen Schriftzeichen zurecht. Auf seinem kurzbeinigen Schreibtisch, vor dem er im Schneidersitz zu hocken pflegte, lagen alte Schwarten ordentlich Kante auf Kante: ein juristisches Kompendium, eine Einführung in die Verwaltungswissenschaft und dergleichen mehr, die Seiten vergilbt, Eselsohren anstelle von Lesezeichen. Dass wir später den Schritt in die Stadt wagen konnten, das war letzten Endes Vaters überdurchschnittlicher Bildung zu verdanken. Wir waren zwar arm, aber immerhin stellte Vaters Monatslohn ein verlässliches Einkommen dar. Einmal im Jahr kam sogar noch, in Form von ein paar Säcken Reis, ein Pachtzins hinzu, den ein kleines Stück Land abwarf. Die gut fünf Ar Grund hatte meine Mutter in die Ehe eingebracht.
Das Haus, in dem wir lebten, lag am Fuß eines kleinen Berges, der sich am Ortsende erhob. Es hatte neben einer Küche drei weitere Zimmer, die alle in einer Reihe angeordnet waren, mit einer großen offenen Diele in der Mitte. Das Elternhaus von Gu lag höher, das Grundstück war von unserem durch eine Mauer aus groben Steinen getrennt. Dabei handelte es sich um eine noch wesentlich simplere Hütte mit zwei Zimmern und einer Küche. In beiden Fällen war fachwerkverstärkten Lehmmauern ein herkömmliches Strohdach aufgesetzt. Später tauschte man diese Bedachung gegen Wellplatten aus Faserzement aus.
Wir waren damals eng befreundet, aber es gibt auch vieles, was ich von Gu nicht weiß. Meine Eltern zogen nämlich mit mir und meinem Bruder nach Seoul. Ich hatte damals gerade die Volksschule abgeschlossen. Dass Gu und ich uns wiedersahen, fand erst Jahrzehnte später statt, als wir schon auf die Vierzig zugingen. Ich bilde mir ein, es war in einem Hotelcafé im Zentrum von Seoul.
»Ergennst du mik wieda?«
Die mundartliche Färbung der Südostprovinz war bei dieser Frage unüberhörbar, aber der Groschen fiel nicht sofort. Der Fragesteller steckte in einem dunkelblauen Anzug und hatte den Hemdkragen über den Reverskragen seines Sakkos geschlagen – eine damals vor allem unter höheren Beamten sehr verbreitete Mode. Als er jedoch sagte, er sei Yun Byeong-gu aus Yeongsan, rutschte mir wie durch wundersame Zauberei sofort jener Spitzname heraus, den ich doch eigentlich schon längst vergessen hatte:
»Kokelbatate! Bist du’s wirklich? Kokelbatate!«
Da mag man sogar blutsverwandt sein – wenn man sich erst nach vollen zwanzig Jahren wiedersieht, hat man einander im Normalfall kaum noch etwas zu sagen. Gewiss, man fragt sich gegenseitig aus, gibt Auskunft über die eigene Familie und die momentanen Lebensumstände, geht selbstverständlich gleich mal auf einen Kaffee, tauscht Visitenkarten oder wenigstens Kontaktdaten, verspricht einander, vage und unverbindlich, bald einmal einen zusammen zu heben, und geht wieder auseinander. Dann ist es aber oft so, dass man sich für den Rest seines Lebens überhaupt nicht mehr sieht. Bestenfalls telefoniert man noch ein paarmal miteinander; und selbst wenn es ausnahmsweise dazu kommt, dass man sich tatsächlich auf ein Gläschen verabredet, so hält eine derartige wiederaufgewärmte Verbindung für gewöhnlich nicht lange an. Schließlich pflegt man in aller Regel nur Interessensbeziehungen, die sich aus den konkreten Lebensumständen ergeben; fehlt ein echter Berührungspunkt, treffen einander sogar nahe Familienangehörige höchstens zum Ahnengedenken oder wenn jemand gestorben ist. Dass Gu und ich an unsere einstige Freundschaft hatten anknüpfen können, lag letzten Endes daran, dass mir das Planungsbüro San-Plan gehörte und er gerade das mittelständische Unternehmen Nam-Bau übernommen hatte. »Kokelbatate« – kaum hatte ich seinen Spitznamen ausgesprochen, begann sich in Gus Augenwinkeln Wasser zu sammeln. Er packte meine Hände und stammelte ganz ergriffen: »Das hast du also nicht vergessen?«
Wenn man vor unserem Haus saß und auf den kleinen Hof hinausblickte, so stand da linker Hand eine schöne Ulme, und dahinter kam gleich die Grundstücksmauer. Hinter dieser wiederum war Gu zu Hause. Jeden Morgen streckte er seinen Kopf über die Mauer und forderte mich lauthals auf, den Weg zur Schule gemeinsam zu gehen. Gleich hinter seinem Elternhaus führte ein steiler Hang in die Höhe, mit einem schütteren Bestand an jungen Pinien. Alle wohnten auf Land, das eigentlich dem Staat gehörte; es war kein Baugrund. Nach dem Krieg wurden viele kleinere Pächter in der Gegend betrogen und mussten die Felder aufgeben, die sie mühevoll bewirtschaftet hatten; sie schlossen sich zusammen und begannen, aus Lehm und Steinen behelfsmäßige Hütten hochzuziehen; Dutzende solcher Behausungen entstanden. In der Kreisstadt verdingten sich diese ehemaligen Pächter als Mädchen für alles. Sie betätigten sich beispielsweise als Friseur, Schreiner oder Kreisamts-Faktotum; manche arbeiteten auch als Erntehelfer für diejenigen Landwirte, die sich hatten halten können.
Auch ich wurde in einer dieser improvisierten Hütten geboren. Die Familie von Gu siedelte sich erst viel später an, ich ging damals schon in die dritte Klasse Volksschule. Am Tag, als sie eintrafen, suchte Gu sofort Anschluss, und tatsächlich trieben wir uns gleich den ganzen Nachmittag draußen herum und spielten in der Wildnis am Hügel. Gus Mutter hatte ein großes Herz. Sie stand bei einem Bauern im Dienst, wo sie nach der Süßkartoffelernte immer ausbuddelte, was den Rodern durch die Lappen gegangen war. Ich kann mich noch gut erinnern, wie sie uns eine Korbschüssel voller gedämpfter Bataten vorbeibrachte – für die werten Nachbarn zum Kosten, wie sie meinte. Gu nahm oft welche in die Schule mit, sie bildeten dann sein Mittagsmahl. Gus Vater ließ sich meist längere Zeit nicht zu Hause blicken, und wenn er einmal heimkam, war er in der Regel derart betrunken, dass er wild herumbrüllte oder seine Frau verprügelte. Dem Vernehmen nach war er als Vorarbeiter auf Baustellen in der nächsten Stadt beschäftigt.
Wenn mir Gu doch nie ganz aus dem Sinn gegangen war, so lag das nicht zuletzt daran, dass wir eines Tages unabsichtlich einen kleinen Waldbrand verursachten. Oben am unverbauten Hügel hatten wir ein kleines Lagerfeuer gemacht, um in der Asche Süßkartoffeln zu garen. Wir plagten uns mit dem Schälen der heißen Wurzelknollen, als von einem Moment auf den anderen das trockene Gras Feuer fing und wie Zunder zu brennen begann. In Panik versuchten wir, die Flammen zu löschen, stampften mit den Füßen darauf, rissen uns die Hemden vom Leib, um etwas zu haben, womit wir auf das Feuer eindreschen konnten, aber die Flammen breiteten sich trotzdem binnen kürzester Zeit in alle Windrichtungen aus. Als ich in heller Aufregung und mit der gellenden Botschaft »Es brennt, es brennt!« zu den Hütten hinunterrannte, stürzten sofort Dutzende Erwachsene auf die Gasse. Alles eilte hinauf zur Brandstätte, es war ein heilloses Durcheinander, aber das Feuer wurde letztlich doch – und das zum Glück noch vor Einbruch der Nacht – unter Kontrolle gebracht.
Mitten in dem ganzen Wirbel verkroch ich mich mit Gu im Veranstaltungsgebäude, das dem Bezirksamt gegenüberlag. Es hatte während der japanischen Herrschaft als Shinto-Schrein gedient und wurde seither als Festhalle oder Turnsaal genutzt. Wir saßen in dem großen dunklen Raum, Rücken an Rücken, und schliefen irgendwann ein. Natürlich irrten deshalb unsere Familien und die Nachbarn auf der Suche nach uns bis spät in die Nacht auf dem Hügel herum. Als wir tags darauf in die Schule gingen, wurde uns klar, dass wir es zu lokaler Berühmtheit gebracht hatten. Zur Strafe mussten wir vor dem Lehrerzimmer knien und dabei Schilder hochhalten, auf denen »Mit Feuer spielt man nicht!« stand. Dass Gu dieser Spitzname »Kokelbatate« verpasst wurde, passierte in etwa um diese Zeit herum. Wer ihn zuerst so nannte, weiß ich nicht mehr. Aber pummelig, pausbäckig und dunkelhäutig wie er war, mit listig funkelnden Augen, passte dieser Spitzname perfekt zu ihm wie die Faust aufs Auge.
Dass ich Architektur studierte und daraus einen Beruf machte, der mir ein gutes Auskommen garantierte, und dass Gu Chef einer Baufirma wurde: Beides war eigentlich nur Zufall, aber dass wir später so gut miteinander harmonierten, das folgte einer echten Notwendigkeit, konnten wir uns doch gegenseitig sehr gut unterstützen. Wie es ihm erging, nachdem meine Familie aus Yeongsan weggezogen war, das hörte ich an dem Tag, an dem wir uns – das erste Mal nach fast drei Jahrzehnten – wieder zufällig über den Weg liefen. Aber wer wirklich harte Zeiten durchgemacht hat, wer Blut und Tränen hinter sich hat, der weiß, dass einem darüber selten etwas Konkretes über die Lippen kommt, weil man sich seiner schwierigen Vergangenheit nicht rühmen will. Man kommt damit ja auch nicht gut an. Das ist etwa so, als ob man vor jungen Leuten lamentiert: »Ihr kennt keinen Hunger; ihr wisst nicht, wie es für ein Schulkind ist, wenn es sich am Sportplatzbrunnen den leeren Magen mit nichts als Wasser auffüllen muss.«
Gu hatte immer grottenschlechte Noten, und da seine Eltern das Schulgeld ohnedies stets nur mit Ach und Krach zusammenkratzen konnten, brach er in der fünften Klasse die Schule einfach ab. In der Folge bummelte er zunächst eine Zeit lang herum, ehe er einen Job als Zeitungsausträger annahm. Allmählich mauserte er sich zum Straßenhändler an einem Busbahnhof, wo es nicht lange dauerte, bis er es zum Kraftfahrergehilfen gebracht hatte. Sein Vater kehrte der eigenen Familie den Rücken oder kam jedenfalls überhaupt nicht mehr heim, und Gus herzensgute Mutter begann, in einem Restaurant zu arbeiten. Eine jüngere Schwester von ihm, die Friseurin werden wollte, riss von zu Hause aus und ließ sich nie wieder blicken.
Um die Mitte der Siebzigerjahre herum wurden Gu und ich zum Militärdienst einberufen. Als Universitätsstudent rückte ich wahrscheinlich später ein als er. Gu wurde den Pionieren zugeteilt und an schwerem Baugerät ausgebildet – und das gab seinem Leben die entscheidende Wende. Kaum war er wieder Zivilist, erwarb er eine Zulassung für die Steuerung von Baumaschinen und stieg ins Geschäft mit der Modernisierung ein, die auf dem Land zu dieser Zeit gerade voll in Schwung kam.
Seine ersten Schritte als Unternehmer tat er mit einem geleasten Bagger, mit dem er bei der Optimierung landwirtschaftlicher Nutzflächen mitmischte. Diese Kampagne florierte während der Ära der »Neues Dorf Bewegung«, als zuerst die Pächter aufgaben und dann auch jene Kleinbauern nicht mehr über die Runden kamen, die unter zehn Ar Grund bewirtschafteten. Die Flächen derjenigen, die unter die Räder gekommen waren, wurden von den solideren Landwirten erworben, und auf diese Schicht konzentrierte man sich nun bei der Neuordnung. Es ging um Flurbereinigungen und Gewässerregulierung. Bei diesen Projekten waren die Dorfhäuptlinge tonangebend, die einen guten Draht zur Bezirksverwaltung hatten, und Gu setzte ihre Ideen in Taten um. In seinen ersten Jahren begnügte er sich damit, seinen Maschinenpark sukzessive zu erweitern, aber als er den Bau einer lokalen Ausfallstraße übertragen bekam, wagte er sich über die Grenzen seines Heimatbezirks hinaus und begann, auf Provinzebene zu operieren.
Im Verlauf seiner Karriere weitete er das Spektrum seiner guten Kontakte auf Parlamentarier, Richter und Staatsanwälte aus. Er verfügte über ein reiches Arsenal an unterschiedlichen Visitenkarten, und welche davon er zückte, kam ganz auf den Zweck an; aber immer war das kleine Format eng mit diversen Titeln und Funktionen bedruckt. Angefangen von CEO einer Baufirma über Berater einer politischen Partei, Jugendmentor, Vorsitzender einer Kommission für Stipendienvergabe, Vorstandsmitglied der koreanischen Junior Chamber International, Rotarier bis hin zum Mitglied im Lions Club war es insgesamt eine ganze Litanei. Als ich ihm wiederbegegnete, hatte er gerade eine bankrotte Baufirma übernommen. Gerade um diese Zeit ging alles erst so richtig los: In allen Großstädten wurden große Apartmentkomplexe aus dem Boden gestampft. Völlig ungezwungen und ohne große Hintergedanken telefonierten wir regelmäßig miteinander, trafen uns auch persönlich. Wir konnten einander eben immer wieder gut brauchen, und dementsprechend zogen wir so manches Projekt gemeinsam durch.
Die Nachricht, die mir seine Frau geschickt hatte, lautete wörtlich: »Er ist zusammengebrochen. In der letzten Zeit hat er oft im Sinn gehabt, sich mit Ihnen treffen. Könnten Sie nicht kommen?«
Obwohl es mir eigentlich widerstrebte, beschloss ich, ihr diesen Gefallen zu tun. Das wirklich dafür Ausschlaggebende war mir selbst nicht ganz klar. Möglicherweise war es indirekt ein Ausspruch von Ki, den er mir bei einem Telefonat einige Tage zuvor entgegengeschleudert hatte. »Raum, Zeit, Mensch? Höre ich recht? Gab es je Humanität in unserer Architektur? Wenn da je ein Mensch mit am Werk war, dann soll sich der gefälligst noch rechtzeitig vor seinem Tod reuig in den Hintern beißen. San-Plan, Du, die ganze Bande – geht doch einmal in euch.«
Ki hatte dieselbe Universität besucht wie ich, aber vor mir, und war dementsprechend ein »Senior« für mich. Dass ich angesichts seiner harschen Kritik nur zahme Laute von mir gab und jedes Widerwort vermied, lag keineswegs daran, dass er in seinem Kampf mit einem bösartigen Krebs sicher bald die Waffen strecken musste. Ich mochte ihn einfach. Die Liebe, die er der Welt und den Menschen entgegenbrachte, war eine einseitige, aber ich fand diese unerwiderte Liebe nie lächerlich, sondern stets bewundernswert. Die Leute rund um ihn herum meinten, sein Idealismus sei auf einen Mangel an spezifischen Talenten zurückzuführen, aber ich erachtete gerade seinen Idealismus als sein besonderes Talent. Doch meine Nachsicht ihm gegenüber hatte auch mit Distanz zu tun. Meine Entscheidung, mich auf keine einseitige Weltliebe einzulassen, machte mich ungebunden. Schon früh war ich zu dem Schluss gelangt, dass man nichts und niemandem vertrauen kann. Im Lauf der Zeit sorgt menschliche Schwäche dafür, dass man nur einen Bruchteil von seinen ursprünglichen Idealen aufrechterhält – den Rest passt man eben an, sofern man ihn nicht vollkommen über Bord wirft. Aber selbst das wenige, das man eigentlich aufrechterhalten wollte, landet letztendlich oft in einer Rumpelkammer der bloßen Erinnerung – das übliche Schicksal von altem Krempel, für den man schon die längste Zeit keine Verwendung mehr hatte. »Was man zum Bauen braucht?« Am Ende entschieden Geld und Macht. Im Rückblick gesehen, war es immer nur das, worauf es ankam und worauf man bauen konnte.
Eine Bergkuppe noch, dann kam das Kreiszentrum Yeongsan. Ich musste wieder an jene Nacht denken, als wir diesen Ort verließen. Neben dem Fahrer saßen mein Vater und meine Mutter; ich hockte mit meinem kleinen Bruder zwischen den Gepäckstücken auf der Ladefläche. Der Lastwagen holperte und polterte über die nicht asphaltierten Straßen dahin, und bei jedem heftigeren Stoß klapperte und klirrte es in der Kiste, in der wir unser Geschirr verstaut hatten. In der Tat lag bei unserer Ankunft die Hälfte in Scherben. Erst als wir gegen Morgengrauen die Schnellstraße erreicht hatten, die nach Seoul führte, kehrten wir kurz in einem Rasthaus ein, um Reis in heißer Suppe zu essen. Vor unserem Fahrtantritt hatten wir nicht einmal Zeit zum Abendessen gehabt, und so schlangen wir den Eintopf mit Heißhunger herunter. »Da stehlen wir uns fort wie Diebe in der Nacht«, sagte meine Mutter und brach in Tränen aus.
Dass ich als Erwachsener dem Ort meiner Kindheit erstmals einen Besuch abstattete, ist nunmehr auch schon wieder 15 Jahre her. Damals fuhr Gu ständig hin, weil er in seiner einstigen Heimat ein Haus erwerben wollte. Mit vollkommenem Bierernst verkündete er, kein Mensch dürfe seine Wurzeln vergessen. Nach außen hin wollte ich kein Spielverderber sein, aber insgeheim fand ich ihn nur peinlich. Das Stammhaus der Dscho, die in Yeongsan immer die größten Grundherren gewesen waren, hatte er abreißen lassen und ein ganzes Pinienwäldchen lediglich deshalb erworben, um es zu roden und eine Immobilie (mit grandiosem Blick auf den Stausee) hinzustellen. Schon damals hätte sich ein Fremder auf Basis des Gegenwärtigen unmöglich eine Vorstellung von der ehemaligen Ortschaft machen können. Im Vergleich zur Stadt verändert sich die Provinz viel langsamer, so glaubt man gern, aber in den Augen jedes ehemaligen Provinzlers spielt sich dort erst recht alles im Zeitraffer ab. Alle heiligen Zeiten geht es einem durch den Kopf, dass man sich vielleicht wieder einmal hinbemühen sollte. Sachen, die schon vor zehn Jahren aus und vorbei waren, kommen einem darum vor, als seien sie erst gestern passiert. Dann aber findet man kein gewohntes Gesicht mehr vor; dafür etwas, das einem ohnedies bis zum Überdruss geläufig ist, nämlich die Allerweltsbauten und Standardfassaden. Wie das Strauchwerk am Bahndamm beim Blick aus einem dahinbrausenden Zug, so rasend schnell ist die Zeit verflogen.
Als Gus Frau mich erblickte, wischte sie sich schnell mit einem Taschentuch ein paar Tränen aus dem Gesicht. Sie war eine ausgebildete Volksschullehrerin. Geheiratet hatten die beiden in den frühen 1980er-Jahren, als Gu gerade begann, so richtig abzuheben. Ich dachte oft, dass seine Ehe so war wie alles, was er anpackte: Da war nichts aufgeblasen oder aufgesetzt, sondern alles nüchtern und mit praktischem Hausverstand geregelt. Wir standen uns im Korridor gegenüber, und seine Frau murmelte wie zu sich selbst:
»Hab doch immer gesagt, er soll sich bloß aus der Politik raushalten.«
Gu war schon operiert, lag allerdings nun im Koma. Das konnte auch ein Segen sein. Sein Termin bei der Staatsanwaltschaft, die ihn zur Einvernahme vorgeladen hatte, war in einer Woche. Allen, die in die Affäre verwickelt waren, war bei der Nachricht von seinem Zustand höchstwahrscheinlich ein Stein vom Herzen gefallen. Eine Weile lang saß ich bei ihm an seinem Bett, das von medizinischen Gerätschaften aller Art umstellt war. Das Gesicht des Patienten war zur Hälfte von einer Sauerstoffmaske bedeckt. Sein Sohn wollte ihn unbedingt in ein Landeskrankenhaus bringen lassen, aber weil man nicht sicher sein konnte, dass er den Transport überstand, war er nur hier ins nächste Spital eingeliefert worden, erklärte Gus Frau. Der Sohn leistete mir am Abend Gesellschaft. Ich fragte ihn nach dem Grund, warum mich sein Vater zuletzt hatte sehen wollen. So erfuhr ich, dass Gu schon seit Langem vorhatte, in seiner Heimat ein Museum zu errichten.
»Mein Vater hat oft davon gesprochen. Beide Grundstücke zusammen, das Ihrer und seiner Eltern, nahmen wohl eine Fläche von rund 1600 Quadratmetern ein. Wenn Sie den Plan zeichnen, steht dem Baubeginn nichts mehr im Wege, und wir können eine Kulturstiftung ins Leben rufen.«
Bei dieser feierlichen Erklärung entrang sich mir fast ein Lachen, aber ich riss mich zusammen und beschied mit großem Ernst: »Ich überlege es mir, wenn Ihr Vater wieder auf den Beinen ist.« Der Sohn leitete von Seoul aus als Geschäftsführer das von seinem Vater gegründete Unternehmen. Auch ihm schien das ganze Thema eher peinlich zu sein. Während des Essens schaute er mehrmals auf sein Handy und ging mitunter nach draußen, um mit lauter Stimme Anweisungen zu geben. Dieser Bevölkerungsrückgang, den man mittlerweile in der Provinz verzeichne, wie eben auch in Yeongsan, der mache ihm Sorgen, klagte er. In vielen Gegenden stehe die Mehrheit der Häuser entweder leer, oder allenfalls wohne dort noch eine einzelne betagte Person. Die Jungen seien alle weggezogen, es komme nichts nach, und das nicht erst seit gestern. Mit solchen und ähnlichen Betrachtungen wollte er wohl vermitteln, dass er bestens Bescheid wusste. Gar so unrecht hatte er ja auch gar nicht. Im Grunde war er wie ich; einer, der maximal ein- oder zweimal im Jahr überlegte, ob er wieder mal die Provinz beehren sollte.
Die Dunkelheit brach früh herein. Ich spazierte zum Motel, das mir Gus Sohn genannt hatte. Er habe dort ein Zimmer für mich reserviert. Am Korridor waren an beiden Enden Überwachungskameras installiert, und im Zimmer konnte alles – von der Beleuchtung über den Fernseher bis hin zur Klimaanlage – per Fernbedienung gesteuert werden. Es handelte sich hier um einen hochmodernen Beherbergungsbetrieb. In der Fremde fiel mir das Einschlafen schwer. »Für was braucht dieses Kaff am Arsch der Welt so viele Straßenlaternen?«, knurrte ich vor mich hin, während ich pedantisch an den Vorhängen herumzerrte, um auch noch den letzten Lichtstrahl zu blockieren, der sich durchs Fenster stehlen wollte.
Früh, zumindest für meine Begriffe, war ich wieder hellwach. Ich schaute auf die Leuchtanzeige des Digitalweckers am Nachtkästchen: Es war zehn nach sieben. Schon in jungen Jahren schlief ich oft bis spät in den Vormittag hinein. In meinem Metier hat man klar definierte Aufträge, und das war’s. Als sogenannter Kreativer brauchte ich mich nie um den ganzen öden Kram drum herum zu scheren. Solange ich die Firma noch allein leitete, ging ich lediglich zwei- bis dreimal pro Woche ins Büro, trudelte dabei aber irgendwann nach zehn am Vormittag ein, und wenn nichts Besonderes los war, ging ich bereits am frühen Nachmittag wieder nach Hause. Mein Leben lang war ich eine Nachteule gewesen. Wenn die meisten anderen schon längst ihren Dienst angetreten hatten, kroch ich erst unter der Decke hervor, um langsam in die Gänge zu kommen.
Nun aber hielt es mich trotz der frühen Morgenstunde nicht länger im Bett und auch nicht mehr diesem Zimmer. Ich marschierte vom Motel Richtung Hauptstraße und gelangte zum Busbahnhof. Die Provinzler waren offenbar emsige Leute, der Platz vor dem Terminal zeigte sich jedenfalls überfüllt mit Pendlern und Taxis. Während ich die Hauptstraße weiter entlangging, grummelte wieder etwas Böses in mich hinein, dieses Mal über die exzessiv vielen Autos in diesem Provinzkaff. Die seinerzeitigen einstöckigen Läden waren alle verschwunden, links und rechts reihten sich zwei- oder dreigeschossige Gebäude aneinander. Einzig der Verlauf der Straße war noch der gleiche, doch hatte man sie wesentlich verbreitert.
An der großen Kreuzung wandte ich mich nach rechts, passierte das Bezirksamt, dann das Kulturzentrum; als es bergan ging, hielt ich angestrengt Ausschau, aber vom Kiefernhain, der sich hier befunden hatte, fehlte jede Spur. Die alte Gasse war verschwunden, und die zweispurige Straße, die sie ersetzte, war wie eine Schneise durch das Gelände geschlagen. Entlang dieser Straße gab es keine Steinmauern mehr mit Höfen dahinter, vielmehr wurde auch sie von zwei- bis dreistöckigen Gebäuden gesäumt, diesen allgegenwärtigen kastenförmigen Gebilden. Trotz all der Verbauung konnte ich im Geist noch die Form des einstigen Hügels abstrahieren, und als ich bald darauf in eine Seitenstraße nach links abbog, stieß ich auf Kanaldeckel aus Beton. Sie bestätigten mir, dass mich mein Orientierungssinn nicht trog, denn früher hatte hier ein kleiner Bach geplätschert. Einmal war mein Vater besoffen reingefallen. Für mich war es ein Spielplatz gewesen, wo ich Frösche fing oder Steine ins Wasser warf.
Zwischen den Feldern waren auch einige Behausungen zu sehen. Das Haus meiner Kindheit war freilich restlos verschwunden. Bei meiner ersten Rückkehr vor 15 Jahren hatte es noch gestanden, eine desolate Bruchbude zwar, aber trotzdem nach wie vor bewohnt. Die prächtige Ulme im Hof, an die ich mich bestens erinnern konnte, war nun ebenfalls weg. Oder vielmehr existierte ja noch etwas von ihr. Man hatte sie zwar schon vor langer Zeit gefällt, den Stumpf aber zum Verrotten in der Erde gelassen. An diesem toten Überrest wucherten Baumschwämme, riesengroße ebenso wie winzig kleine. Am Fleck, wo einst Gus Elternhaus gestanden hatte, war überhaupt das Unterste zuoberst gekehrt: Die Fläche wurde landwirtschaftlich genutzt, offenbar kultivierte man hier Pfefferschoten. Die Saat reifte in terrassenförmig angelegten, schmalen Beeten, die mit gelochten schwarzen Plastikbahnen abgedeckt waren. Die ungezähmte Vegetation am ansteigenden Hang dahinter kam mir grüner und üppiger vor als zu meiner Schulzeit.
Die Leute, die dageblieben waren, bildeten eine Minderheit gegenüber denen, die fortgezogen waren. Wie sich der Ort meiner Kindheit dennoch entwickelt hatte, war kaum zu fassen. So wie auch dieses Motel war vom Geschäftsviertel bis hin zu den Wohngegenden alles in Form von zwei- oder dreigeschossigen Betonbauten ausgeführt, und damit wirkte das Kreiszentrum trister denn je. Weit und breit kein Herdrauch mehr, der früher doch überall von den niedrigen Hütten aufstieg. Blickte man von der Spitze des Hügels hinunter auf diese Bebauung, mutete alles an wie in jeder x-beliebigen Kleinstadt, ja sogar wie am Stadtrand von Seoul. Ob ich selbst, ob Kokelbatate, ob meine Schulfreunde oder meine längst aus dieser Welt geschiedenen Eltern – es war, als hätten wir alle nie existiert.
Am Samstagvormittag erhielt ich einen Anruf aus Amerika. Meine Tochter berichtete ganz geschäftsmäßig von allen Begebenheiten des vergangenen Monats. Mein einziges Kind lebte nun schon seit Langem in den USA, hatte dort Medizin studiert, es zur Krankenhausärztin gebracht und einen amerikanischen Universitätsprofessor geheiratet. In einer ganz organischen Entwicklung war aus ihr eine Amerikanerin geworden. Von Anfang an fuhr meine Frau oft zu ihr auf Besuch, inzwischen ist sie aber seit Jahren nicht mehr nach Korea zurückgekehrt. Die gesamte engere Blutsverwandtschaft meiner Frau war in den Vereinigten Staaten sesshaft geworden. Unsere Ehe zeigte schon vor einem Jahrzehnt so manchen Riss, in den letzten Jahren geriet sie allerdings völlig aus dem Lot und war mittlerweile wohl irreparabel. Meine Tochter erzählte mir von der Wohnung, in die ihre Mutter nun eingezogen war. Ihre Tanten, also die Schwestern meiner Frau, waren alle angetanzt, um eine »house warming party« zu veranstalten.
»Bist du gesund? Mama sagt, du sollst deine Blutdruckmedikamente regelmäßig einnehmen.« Jetzt, wo diese Mama in ein Apartment nicht weit vom Wohnsitz ihrer Tochter eingezogen war, dachte sie nicht mehr daran, jemals zurückzukommen, das war schon ziemlich klar.
Erstmals seit längerer Zeit verspürte ich wieder das Verlangen nach einer Zigarette, und so begann ich herumzuwühlen – irgendwo musste ich ja noch eine Schachtel haben. Manchmal will keine Skizze richtig gelingen, und man möchte deswegen aus der Haut fahren – in solchen Phasen brauchte ich immer eine Marlboro. Das Feuerzeug entdeckte ich immerhin gleich auf dem Schreibtisch neben der Lampe. Irgendwo musste die rote Schachtel sein. Nachdem ich vergebens alle Schreibtischschubladen herausgezogen hatte, nahm ich mir die Anzüge im Kleiderschrank vor, einen nach dem anderen. Bei einem ertastete ich unter dem Stoff endlich, wonach ich so lechzte.
Als ich die Packung aus der Tasche zog, fiel etwas heraus. Zu meinen Füßen lagen zwei Visitenkarten und ein kleiner Zettel. Was die Visitenkarten anlangte, so stammte eine von einem Rathausbeamten, die andere vom Redakteur irgendeines Magazins, nichts weiter dabei. Der Zettel aber gab mir zu denken. Ich legte alles auf den Schreibtisch und fischte mir eine Zigarette aus der Packung. Dabei stierte ich die ganze Zeit auf den Namen, der groß über der Telefonnummer auf dem Zettel stand, und wiederholte lautlos die einzelnen Silben: Tscha – Sun – A. Tscha Suna. Ein Name, der mir schon lange nicht mehr in den Sinn gekommen war, nun aber Jahrzehnte alte Erinnerungen heraufbeschwor. Jetzt fiel mir auch die Szene ein – bereits wieder eine Woche her –, wie ich diesen Zettel nach meinem Vortrag von einer jungen Frau in die Hand gedrückt bekam. Gleich darauf hatte ich einem Architekturmagazin ein Interview gegeben und war im Anschluss daran mit ein paar Leuten in ein Lokal gegangen, um einen zur Brust zu nehmen. In den folgenden Tagen war ziemlich viel los gewesen, und mein Terminkalender war dermaßen voll, dass ich sogar die bloße Tatsache, dass mir dieser Zettel ausgehändigt worden war, vollkommen vergessen hatte.
Eine Weile lang war ich unschlüssig, setzte mich aber letzten Endes an den Schreibtisch, um das Festnetztelefon zu mir herzuziehen. Ich hob den Hörer ab und tippte sorgsam die Ziffern ein, die auf dem Zettel standen. Lange wiederholte sich das Freizeichen, ehe sich das Tonband eines Anrufbeantworters einschaltete. Mir lag schon etwas auf der Zunge, doch dann warf ich den Hörer auf die Gabel und kramte mein Handy hervor, um lieber eine Nachricht zu senden:
Rückruf erbeten. Bak Minu.
Als ich Anfang der folgenden Woche wieder im Büro vorbeischaute, sagte einer meiner Kompagnons, der Architekt Song:
»Heute soll dieses Treffen mit Kim Ki stattfinden – Sie kommen doch mit, nicht wahr?«
»Was denn für ein Treffen?«
»Sein Arzt meinte, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Es ist nur eine kleine Gruppe. Und man kommt bei der Gelegenheit wieder mal an die frische Luft.«
»Verstehe. Und wohin soll es gehen?
»Auf die Insel Ganghwa.«
Ich beschloss, mit Song mitzufahren, anstatt mich vom Chauffeur im Firmenwagen kutschieren zu lassen. Während wir über die achtspurige Olympia-Autobahn dahinbrausten, meinte Song:
»Man hat jetzt Herrn Im, den Vorsitzenden von Daedong-Bau, im Visier.«
Ich konnte mir ja denken, welches Gerücht dem lieben Song da zu Ohren gekommen war, aber ich stellte mich dumm.
»Im Visier? Was soll das heißen?«
»Man munkelt von einem angespannten Verhältnis zur gegenwärtigen Regierung.«
Daedong-Bau hatte uns das Hangang Digital Center als Projekt übertragen. Die Wolkenkratzer standen momentan auf knapp halber Höhe. Ich gab mich bewusst ungerührt:
»Solange wir uns an unsere Aufträge halten, kann uns nichts passieren.«
»Schon, aber trotzdem heißt es jetzt höllisch aufpassen bis zur Fertigstellung. Es darf zu keinen Schlampereien kommen.«
Er hatte wohl in der Zeitung davon gelesen. Das Gerücht ging um, die Behörden hätten schon längst mit versteckten Ermittlungen begonnen. Das Asia-World-Projekt von Daedong-Bau stand mittlerweile wegen Finanzproblemen auf der Kippe.
»Es ist das erste Mal seit langer Zeit, dass ich wieder mal rein zum Vergnügen rauskomme aus der Stadt, da werden Sie mir doch nicht die Laune verderben?«
Ich sagte das mit gespielter Heiterkeit. Song wechselte daher das Thema:
»Unser Kommen wird ihn körperlich strapazieren, aber seelisch wird es ihm ein Trost sein.«
»Da ist was dran. Ki war ja immer schon ein großer Optimist.«