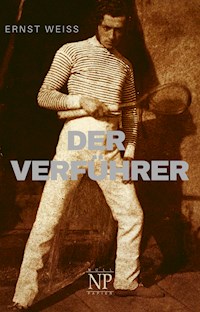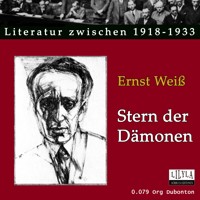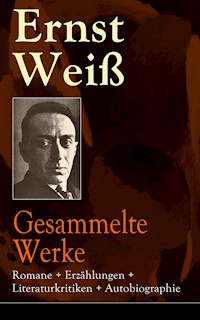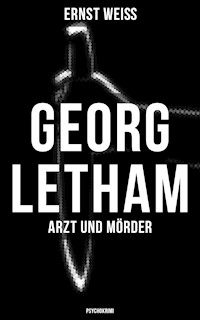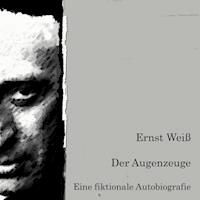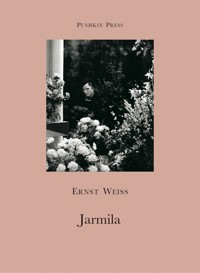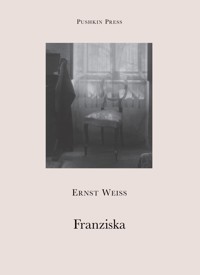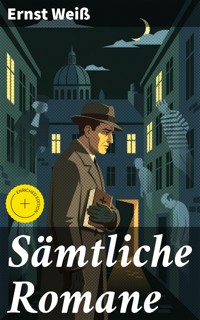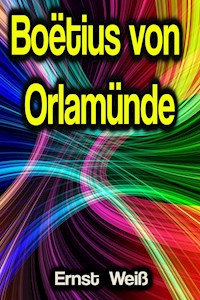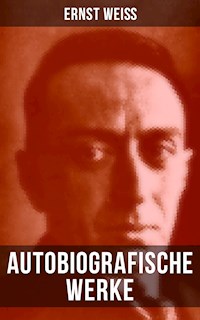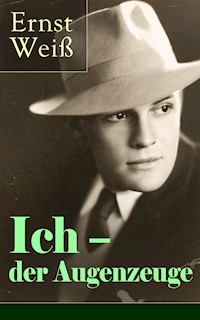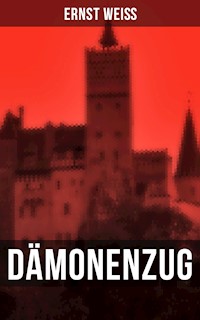
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Musaicum Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In 'DÄMONENZUG' von Ernst Weiß, einem einflussreichen Autor der deutschen Literatur des 20. Jahrhunderts, tauchen wir ein in eine düstere und faszinierende Welt. Das Buch ist ein Meisterwerk des modernen symbolistischen Schreibens, das eine einzigartige Mischung aus Realität und Fantasie bietet. Weiß nutzt eine überwältigende Sprache, um die psychologischen Abgründe seiner Figuren zu erkunden und den Leser in eine unheimliche Atmosphäre zu versetzen. 'DÄMONENZUG' stellt eine kritische Auseinandersetzung mit der menschlichen Natur dar, die sowohl verstörend als auch befreiend wirkt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DÄMONENZUG
Books
Inhaltsverzeichnis
Stern der Dämonen
Erster Teil
1
Cyrill D. entstammte einer Familie von armen Bauern, die an der ungarischen Grenze des Landes Mähren zusammenwohnten. Da der kümmerliche Boden nicht alle erhalten konnte, wanderten viele nach Amerika aus, kamen aber in späterem Alter zurück und bebauten den Boden weiter. Es gab in der Familie viel fanatisch fromme Katholiken, Väter, die sich für ihre Kinder, Brüder, die sich für ihre Schwestern aufopferten, aber auch viel Habsucht, Geiz, Jähzorn und andere Leidenschaften, die sich oft erst in höherem Alter zeigten. So hatte Cyrills Vater mit sechzig Jahren seine dritte Frau geheiratet. Diese Frau, obwohl selbst kinderlos, machte den Kindern aus früheren Ehen das Leben so schwer, daß der älteste Bruder Cyrills, Johann, der künftige Erbe des Hauses und der Felder, sich als Ackerknecht verdingte. Cyrill ging in die Stadt, um als Lehrling bei einem Tapezierermeister, einem entfernten Verwandten der zweiten Frau einzutreten, Mathias, der jüngste, wurde vom Pfarrer des Ortes wegen seiner besonderen Begabung und seines Fleißes zum geistlichen Stande bestimmt. Die zwei jüngeren Brüder kamen gleichzeitig in die Stadt. Der älteste Bruder, schwächlich von Gesundheit und durch den Kummer gebrochen, starb bald darauf. Als der Vater Cyrills im Alter von weit über siebzig Jahren die Augen schloß, fiel der ganze Besitz der Witwe zu, welche die Kinder aus den andern Ehen durch List und Niedertracht sogar um ihren Pflichtanteil gebracht hatte. Aber sowohl Cyrill als Mathias waren damals schon viele Jahre von Hause fort und konnten sich nicht wehren.
Cyrill hatte, damals schon Gehilfe und künftiger Nachfolger des Tapezierermeisters, ein Mädchen aus einem Nachbarorte kennengelernt, Fanny, das als Dienstmädchen in derselben Stadt diente, in der er lebte. Auch sie war sehr fromm und verbrachte ihre freie Zeit gern in der Kirchs. Ihre einzige Liebe war Cyrill. Aber ihre Ehe war nicht glücklich.
Sie war um zwei Köpfe größer als er, sie erdrückte ihn beinahe mit ihrer animalischen Schönheit, mit ihren dunkel glänzenden Augen, mit ihren dicken, schweren Haaren, und doch hatte sie vor ihm, dem kleinen blonden Mann, tiefe Angst. Sie vergaß nicht, sie dachte immer daran, obwohl sie nie davon sprach: nur aus Zwang, im letzten Augenblick hatte er sie zur Frau genommen, von Sorgen, gemeiner Not getrieben, wie sie selbst durch den ordinären Zwang des schweren Lebens zum Dienstboten getrieben war. Sie hatte an die Ehe wie an etwas Göttliches geglaubt, an die Trauung in der Kirche, die leere, einsame Kirche, die beiden goldenen Ringe, die hohe goldene Zeit.
Cyrills jüngerer Bruder hatte lange an der Universität studiert in der Hoffnung, es dann um so schneller zu hohen Würden zu bringen. Er hatte viel Geld gebraucht, für Bücher, für Wäsche, Kleidung, er trug einen Zylinderhut, während Cyrill, klein und abgeschabt, mit einer niedrigen, staubigen Sportmütze neben ihm einherlief. Beide waren schwächlich, aber der jüngere machte sich schwächer, als er war. Alle sollten ihm helfen. Er arbeitete viel, seine Studie über den Erzvater Moses im Evangelium Lukas erregte Aufsehen, doch davon konnte er nicht leben. Oft war er kränklich, Cyrill wollte ihm nicht zumuten, im Alumnat mit den anderen jungen Geistlichen zu wohnen, die Luft sollte dort erstickend sein, ohnehin hatte der arme Bruder Atembeschwerden und ebenso wie er selbst oft grauenhafte Träume.
Cyrill verdiente schon damals als Tapeziergehilfe etwas Geld, aber es war nicht genug. Die Eltern lebten nicht mehr. Cyrill lernte Fanny kennen; gequält von seinen Sorgen, erzählte er ihr von seinem Bruder. Fanny, das Dienstmädchen, hatte ein kleines Vermögen, sie war eine Waise, aber keine »ganz abgerissene Waise«, wie sie sagte; und da sie ihm das Geld immer wieder anbot, nahm er es schließlich mit abgewandten Augen. Daheim staunte er, es war viel. Der Bruder kam jetzt vorwärts, er bat, Cyrill solle nur nicht drängen. Bald feierte er das Primiziat. Er wurde einem Pfarrer zugeteilt. Bis zum Bischof, ja auch nur bis zum Vikar war es weit. Die Brüder sahen einander oft, alles Leid klagten sie einander. Cyrill hatte viel Mitleid. Wozu waren alle Mühen auf der Universität gut gewesen? Beide lächelten, aber Cyrill fühlte mit Freude das eine, daß der Bruder sich nicht überhebe, daß er nicht viel mehr sei als er selbst. Cyrill kehrte zurück. Er schämte sich, Fanny die Wahrheit zu gestehen: statt ihr das Geld heimzubringen, hatte er dem armen Bruder auch noch den letzten Wochenlohn gegeben. Er war Sonntags dort gewesen, nun hatte er nichts für die ganze Woche. Fanny sagte, er solle sich das nicht so zu Herzen nehmen, das Geld sei einmal dahin und verloren, es sei schon gut, ihre goldenen Pfennige hätte der liebe Gott zu sich genommen. Die selige Tante, von der sie geerbt waren, hätte sie ohnedies der Kirche weihen wollen. Sie selbst brauchte ja nichts, wozu denn auch? Sie pries lange ihre Herrschaft, das ruhige Leben, die viele gute Kost. Sie lachte jetzt über sich selbst, über ihre gar zu große Figur, vor der die Herrschaften erschraken, weil sie dachten, die Riesin würde zu viel essen, oder, wenn man sie allzusehr plagte, jemand mit der Hand erdrücken. Sie erzählte unaufhörlich, so sehr war sie bezaubert von Cyrills zarter Figur, seinen tiefliegenden Augen und ihrem Blau. Sie konnte sich von ihm nicht trennen, sich nicht sattsehen an ihm. Lange gingen sie vor ihrem Hause hin und her. Er war müde und hungrig. Ihre Herrschaft sei nicht zu Hause, meinte sie, er solle nur schnell mitkommen, am Gasherd werde sie ihm guten Kaffee kochen. Warum nicht auf dem Ofen, fragte er auf der Treppe. Die gnädige Frau sei so genau, sagte sie, sie käme zwar an Sonntagen erst spät in der Nacht, sie sitze bei Verwandten und spiele dort Karten, bis sie müde sei zum Umfallen, aber bevor sie sich niederlege, müsse sie erst den Ofen abfühlen, ob er nicht geheizt worden sei.
Cyrill ahnte etwas von Fannys Elend. Das Geld, angeblich von der Tante der Kirche bestimmt, hatte sie selbst bitter verdient. Er ließ nicht zu, daß sie vorher etwas koche, er drängte sie in ihr kleines Mägdezimmer, in dem auch die Badewanne stand. Taghell war es; die am Vormittag gebrauchte Brause tropfte schwer, jenseits der Mauer hörte er daheimgebliebene Mägde laut singen, dröhnender Lärm stürmte plötzlich von allen Seiten, dann Totenstille auf einen Schlag.
Nach einer Stunde ging er fort, ganz ohne Freude.
Drei Monate später sagte ihm Fanny, ganz ohne Erschütterung: »Ich bin doch in der Hoffnung.« Er wollte es nicht glauben. »Noch zwei Monate bleibe ich im Dienst«, sagte sie.
Gutmachen konnte man nichts mehr, aber jetzt mußte sie ihr Geld haben. Nur so blieb ihr das Aergste erspart: daß sie ins Findelhaus gehen mußte. Wenn sie dort auch unentgeltlich verpflegt wurde, hatte doch ihre Heimatgemeinde die Kosten zu tragen. Auf immer war sie dann in ihrem Zuhause, bei ihren Geschwistern »verredet und verschändet«. Der Mann wußte, man hätte ihr ein uneheliches Kind verziehen, aber daß sie nicht einmal die zur Geburt nötigen Groschen haben sollte, das niemals. Wozu war sie Dienstmädchen, hatte »umsonst« Essen, Trinken, Kleider, Heizung? Bei dem letzten Gedanken wurde er von dummer Wut ergriffen. Er hätte nie mit ihr hinaufgehen sollen, was sollte das Gerede vom Gasherd? Sollte er das sein Leben lang büßen? Er mußte Geld haben. Der Bruder war schon lange genug im Amt. Cyrill reiste zu ihm, deutete sein seine Notlage an, der Bruder tat, als verstünde er nicht. Cyrill wurde deutlicher, der Bruder sprach vom Beistand des Allmächtigen. Cyrill schrie endlich ganz roh, überschwemmt von plötzlichem Zorn: »Geborgtes Geld war es, nicht geschenktes. Bist du ein Bruder oder nicht?« Der Bruder sagte ihm, es sei alles gut, er werde das Geld aufbringen, er habe viel zu verkaufen, die Uhr, das goldene Kreuz, aber nur still, er solle nur ja nicht schreien. Der andere sagte, er lasse sich nicht das Maul verbieten, er wolle wissen, wann. »Bald bald!« sagte der Bruder. »Was, bald?« sagte Cyrill, »bald? Ja, wo ist denn dein Lohn hin?« Er wußte nicht, wie er die Einkünfte eines Geistlichen nennen sollte. »Du selbst brauchst nichts, hast nichts für Heizung zu bezahlen, das Essen hast du hier. Du ißt ja ohnehin so wenig. Das Ornat hast du umsonst, sogar den Meßwein!« Er versuchte zu lachen, obwohl er zitterte. »Sogar den Meßwein?« sagte der Bruder mit sonderbarem Lächeln. Dieses Lächeln empörte Cyrill, schon warf er sich auf den Bruder. »Das Kleid! Vergreif dich nicht am heiligen Kleid!« sagte der Geistliche. Cyrill trat zurück und sah den Bruder an, der weiß war wie die Wand, vor der er stand. Er bat ihn um Verzeihung, halb verzweifelt kam er heim. Er ließ Fanny warten. Sie war schuld an allem. Mit Ekel erinnerte er sich ihres Zimmers, ihres harten, jungfräulichen Körpers, vor dem noch jeder andere gewichen war, ihres weißlackierten Bettes, das sich in der hohen Zinkbadewanne gespiegelt hatte. Beinahe war ihr Zimmer ein Abort gewesen. Er weinte über den armen Bruder, den bleichen Schwächling, der sich pflegen mußte und eben jetzt nicht »bluten« konnte. Sie schrieb ihm nicht. Am nächsten Tage sandte ihm der Bruder das Geld, auch er schrieb nicht ein Wort, auch er hatte es auf ihn abgesehen.
Cyrill ging seiner Arbeit nach, holte sich am Samstag seinen Lohn, am Sonntag betrank er sich schon vormittags, er wollte endlich seine Freiheit genießen. Er wollte für sich arbeiten, nicht für den Bastard, nicht für sie. Aber der Wein bekam ihm schlecht. Er schrie, man hatte ihm den Rachen verbrannt, man hätte ihm Vitriolschnaps statt Wein gegeben, vergifteten Sprit, in »doppelter Mischung«. Schon begann er Lieder zu singen, ohne daß er es wollte. Heulend entrollten seinem kleinen Munde Melodien von Kirchenliedern. Er sah alte Weiber, hoch im Staub, sie stießen diese Lieder vor sich her, und auf ihnen, wie auf wirklichen Stangen, sah er seinen Bruder vorangetragen, einen Laib ungebackenes Brot auf beiden Händen, rückwärts im Zuge verbarg sich Fanny, aus der hohlen Hand Tapezierernägel einem kleinen Kinde über den Kopf rollend; schon türmte sich der Staub zu ihrem weißen Dienstmädchenzimmer und drang ihm in die Kehle. Doch schrie er auf, als er mitten durch den Staub, wie in der Sonne feurig beleuchtet, Fanny wieder sah, wie sie mit weißem Hammer etwas niederschlug, das nur ihr Kind sein konnte, zerknittert wie ein Blatt Papier, unter der Badewanne verborgen.
Bei seinem Schrei erwachte er. Er begriff, daß er betrunken war. Zorn und Wut taten ihm wohl. Das war gut, dachte er. Nun war er nüchtern, aber noch nicht ganz.
Schmerzen fühlte er nicht, zum Spaß schlug er seinen Kopf gegen die Wand, wurde tückisch gegen die andern Gäste. Er wurde hinausgeworfen, kam sehr schwer heim, schlief sehr tief.
Abends erwachte er, zog ein weißes Hemd an und ging zu Fanny. Sie war zu Hause. Er warf sich ihr zu Füßen, statt sie zu küssen, da er fürchtete, sie könnte den Weingeruch aus seinem Munde spüren.
Sie war sehr verlegen und begann zu weinen. Er wollte sie trösten, er wollte sie in das kleine weißlackierte Zimmer hineinschleppen, dorthin, wo sich das Bett in der Badewanne spiegelte. Aber sie ließ sich nicht zerren. Er trat beleidigt fort und wollte ihr schon mit giftigen Worten drohen, da erblickte er solches Grauen um ihren Mund, daß er ganz zu sich kam.
Nach vier Monaten wurden sie getraut, im dritten Monat der Ehe kam das erste Kind zur Welt und wurde auf den Namen der Mutter getauft.
2
Nach der Hochzeit zeigten sich sonderbare Eigenschaften an Cyrill; wie seinen Bruder plagten ihn schwere Träume. Während einer ganzen Nacht schrie er, warf sich schräg über die Kissen und lachte. Starrend blieben die weißen Reihen der Zähne geöffnet im matten Schwarz der endlosen Nacht. Seine Frau sah es mit Grauen. Am nächsten Tag erwachte er ohne jede Erinnerung und ging an die Arbeit.
Die Frau dachte daran, wieder eine Stelle als Dienstmädchen anzunehmen, damit es leichter für ihn würde, damit er aufatmen könne. Wohl liebte sie ihn, jetzt aber wäre es ihr genug gewesen, ihn einmal in der Woche zu sehen, beim freien Ausgang frei mit ihm zu sein, Sonntags von drei nachmittags bis zwölf Uhr nachts. Aber sie konnte das Kind nicht allein lassen, das arme Kind mußte gewartet werden. Der Mann trank nicht mehr; wenn sie Ausflüge machten, vertauschte er sein volles Bierglas mit ihrem leeren, denn er schämte sich seiner Schwache. Viel Freude hatte er am Rauchen, selbst abends rauchte er noch im Bett. Die Frau, todmüde von der Arbeit des Tages, leergesaugt von dem ungewöhnlich starken, ewig hungrigen Kinde, wußte nicht, wie sie die Augen offen behalten sollte. Der Feuersgefahr wegen durfte sie nicht einschlafen. Endlich ließ er die Zigarre aus der Hand fallen. Sie aber, sich nochmals zusammenraffend vor dröhnender Müdigkeit, beugte sich mit schwer mütterlichem, weiß quellendem Leib aus dem Bett, raffte den Stummel auf, behielt ihn in der geballten Faust, bis sie ihn am Morgen auf einem frisch gehobelten Brett mit dem Zuckerhackmesser in kleine Stücke hackte für die Pfeife der Werkstatt. So ganz weich, so völlig willenlos gab sie ihm in allem nach, nie hörte er von ihr »ein anderes Wort«. Gerade das empörte ihn, er hätte sie zertreten mögen. Aber er konnte nichts tun als seine Wut in sich hineinschlingen, Schimpfworte gegen sie tückisch erfinden: »dreistöckiges Ludermensch, gefährliches Riesenaas«, nie aber wagte er, ihr diese Worte zu sagen. So viel Angst hatte er vor ihr, er dachte, sie, die Riesin, würde doch einmal nachts über ihn herfallen. Ihre Hände waren blutig gewesen bei der Geburt des Kindes. Mit dem Zuckermesser spielte sie gern, lauerte darauf, daß er aus Dummheit, zum Spaß seine Finger unter die Schneide bringe. In dieser Zeit wandte er sich an den jüngeren Bruder um Rat, aber der Geistliche antwortete nicht. Auch bei der Taufe des Kindes hatte er sich verleugnet, nur Geld geschickt. Alles, der heilige Bruder, der liebe heilige Herr in dem abgeschabten, schwarzen Gewand, durch das seine abgemagerten Hungerknochen im Traume deutlich zu sehen waren, das viele Geld, das sich im Traume vermehrte, dessen Scheine, wie Schienen der Länge nach aneinandergelegt, sich endlos zogen, von der Hütte des Bruders bis an Fannys Haus, alles schlang das Riesenmensch ein. In dem lustlosen, ungeheuerlich weit geöffneten roten Eingeweideschlund versank alles ohne Rettung. Der kleine Mund des Kindes war gar kein Kindermund, sondern nur ein kleines Abbild des Mutterschlundes, des unersättlichen. Ihm selbst nahm es jeden Hunger, wenn er sehen mußte, wie das Kind, ohne zu kauen, fast ohne zu atmen, mit geschlossenen Augen aus der Mutter ungeheure Massen von Lebensnahrung in sich hineingeiferte. Und während das Kind, wie gelähmt, mit lauem Atem, mit schlaff niedersinkenden Händchen wie tot zu schlafen begann, schien die Mutter statt entleert, nur noch doppelt gefüllt und von dem strotzenden Kind mit neuer Fülle und Gesundheit aufgeschwellt, so daß sie strahlte.
Durfte Cyrill nicht mit Geld knausern, durfte er, der halb vertrocknete, es nicht an Geld fehlen lassen für die zwei strotzenden Weiber, so hielt er mit Worten an sich, sparte sie sich am Munde ab, regte den Mund zu nicht mehr als achtzig Worten am Tag, und als das zu zählen zu schwer war, nur zu dreißig, die er bis zum Abend manchmal kaum erreichte. Er konnte darauf warten, daß Fanny ihm Vorwürfe mache, aber sie schwieg und fühlte nichts. Es gab Dinge, die ihm unerträglich waren, so der Geruch von Petroleum an den Händen oder Watte, die beim Zusammendrücken wie zusammengepreßte Zähne knirschte. Aerger als alles aber war ihre Stimme, die ihm das Herz abpreßte. Die Frau litt seit der Geburt des Kindes an Zahnschmerzen: er zupfte ihr die Watte schweigend aus den Ohren, drohte schweigend mit Schlägen. Aber das Kind, plötzlich erwachend, haschte mit teuflischem Lächeln aus zahnlosem Mund nach seiner Faust. Cyrill legte sich ins Bett, rauchte. Die Frau richtete die Petroleumlampe an ihrer Wand, knirschend rollte der Docht empor, denn nur im Hellen konnte sie die langen Stunden zu Ende wachen. Ihre Hände, die ihm vom Petroleum geradezu zu triefen schienen, in deren öligem Glanz sich das ganze Zimmer spiegelte, wischte sie an der Bettdecke ab. Wie die Bettdecke an dem Mann riß, erblaßte er, stierte seine Frau an mit einem Blick, nicht gut, nicht böse, aber grauenhaft, wie damals, vier Monate vor der Hochzeit. Das Zimmer war zu klein für diesen Blick. Die Frau verkroch sich unter die Bettdecke, in ein kleines Bündel ihren ungeheuren Leib zusammenpressend.
Der Mann stand auf, kleidete sich wortlos an, ging fort. Als der Mann weg war, dachte die Frau: ich bin gerettet, es ist nichts geschehen. Sofort aber fühlte sie, es war das Fürchterlichste geschehen. Gekrümmt blieb sie unter ihrer Decke, ihr Atem, zwischen den schweren Brüsten gleitend, machte die Leinwand rascheln, die sich um ihre Hüften spannte. Unbewegt blieb sie so die ganze Nacht.
Cyrill ging in einen Schnapsladen. Oft schon war er vorbeigestrichen, hatte die Männer beneidet, die sich vor dem Schanktisch drängten. Ein magerer Glatzköpfiger, fast zum Umfallen rücklings über einen Stuhl gestreckt, von zwei schweren Flaschen die beiden Hände herabgezogen, so daß sie den Fußboden streiften, schien ihm besonders herrlich, noch herrlicher aber die Flasche in der linken Hand, von einer Gasflamme obenher mit öligem Licht beträufelt, ein mattgeschliffenes, traubenartig gebauchtes Gefäß, die Glasgestalt eines dicken Mannes mit hohem Hut, dessen fetter Bauch bis oben zum kropfigen Halse mit rosarotem Schnaps gefüllt war.
Nun trat er ein. Die Verkäuferin, ein gutgenährtes Judenmädchen, wunderte sich, sehr selten wurden solche Flaschen gekauft, und jener magere Säufer hatte sie am ersten April erhalten, ein Geschenk, das man ihm spaßeshalber mit Weinessig gefüllt hatte. Es gab aber noch ein Gegenstück dieser Flasche für Cyrill. Seine Hände schienen ihm warm angehaucht von der heiser glucksenden Flasche, als er sich vor dem Schnapsladen auf eine Bank setzte. Die Bank war verrufen, denn der Besitzer des Geschäftes hatte sie für seine Kunden aufstellen lassen, damit sie sich nicht in ihrer Trunkenheit vor der Schwelle umherschmieren sollten.
Wie vor Zeiten glaubte Cyrill auch jetzt, er sei innerlich angebrannt, man hatte auch ihm, als verspäteten Scherz, Säure in seinen Rausch gefüllt. Aber dann schmeckte es so mild, eigentlich gar nicht nach Schnaps, eher nach Zuckerzeug, wenigstens jetzt hatte er die Süßigkeit auf der Zunge, wenn auch scharfe Eisen unabwendbar hinterher drohten.
Wohl rollte er seine Zunge wie eine Blechröhre rund um den guten Schnaps, der nach guten Kinderjahren schmeckte, die Bitternis kam doch, jetzt schon, viel zu früh.
Ein betrunkener Bettler tappte heran mit schweren Füßen, mit ganz platten Füßen, auf denen hätte einer stehen können, aber daran dachte der Bettler gar nicht, sondern er wollte vielmehr seine ins Ungeheure verbreiterten Füße auf Cyrills Schenkel legen, um dann durch ganz müheloses Rücken nach der Seite auch Cyrills Körper und sein armes Herz und seine müden Augen und seinen schweren Hals und seine abgearbeiteten Hände flach zu drücken, denn nichts anderes war der von Kot ganz hell lackierte, aus einem Loch triefende Schuh des Bettlers als die Badewanne, in Fannys Dienstbotenzimmer stehend, unsichtbar in der Finsternis, die sich jetzt nachts auf die Reise machte. Alle Gewalt nützte nichts, mit schrecklicher Freundlichkeit, mit einem wie Schnaps süßlichen Grinsen trat der betrunkene Bettler immer wieder von frischem an und drohte. Der Bettler versank unter die Erde, und doch schrie er zu ihm, leitete böse Drohungen durch den hohlen Laternenpfahl und schrie ohne Aufhören, wie Licht ohne Aufhören scheint.
Cyrill stand auf, tastete alles ab, die Augen vor Angst geschlossen, aber niemand war neben ihm, und plötzlich erkannte er sich selbst.
Ein Bahnhof war in der Nähe, Züge rollten ein, Dampfwolken wälzten sich gegen ihn. Nur durch die Zweige einer Platane, die neben der Bank stand, war er geschützt. War er geschätzt, so durfte er weinen. Durfte er weinen, so war er noch da. Mit Liebe streichelte er den dicken Bauch der Flasche, sie war ja so gut, sie war so gut rot, nur der Kopf war durchsichtig, der Kopf der Flasche war wie Bernstein, aber der übrige Leib war rot. Nun erkannte er es klar, das war ja der arme Bruder, nun hatte er es, es war der einzige Bruder, der den Zylinderhut des jungen Theologen trug, o so blaß, so ohne Leben, ausgedürstet, am langen Kreuz verhungert, das übrige war rot, weil er geblutet hatte, um Fanny, der heimtückischen Frau, alles Geld zu geben. Das übrige war rot, weil er sich den roten Meßwein abgespart hatte, um Fanny, das elende kleine Kind zu füttern und wider Willen groß zu machen, bis es, der Mutter gleich, mit riesenhaftem, bösem Leib die arme Welt in der Hand zerdrückte.
Er, rief die anderen zu Zeugen an, den Bruder: Bruder Matthias; die Flasche: rote Flasche auf der Erde, halb bernsteingelb, halb weiß, ganz ausgeleert; die Frau: Frau Fanny; er selbst: Cyrill, Cyrill zuerst, Cyrill allein, alle mußten her, alle mußten Zeugenschaft geben.
Er stand auf, eine fürchterliche Last klammerte sich an seine Brust, das war seine Frau, die sich über ihn wälzte. Zwar konnte er sie nicht fassen, denn in einem Knäuel gewunden, von der rauhen Bettdecke überall scheußlich umhaart, war sie nicht zu erkennen, und wenn er den Knäuel würgte, so erwürgte er nur ihr Fußgelenk oder des kleinen Kindes wütend zu Faustdicke angeschwollenen kleinen Finger, der ihn verhöhnte.
Aber plötzlich war alles vorüber: hier war der weite, winterliche Platz, die Wolken der Lokomotive, wie Milchglas ganz sein, die Schnapsbude geschlossen, der Bettler verschwunden, der Bruder gerettet. Die Pflastersteine glänzten, die ausgeflossene Schnapsflasche hatte alles überströmt, es hatte also sehr geregnet, er hatte also sehr viel geweint. Cyrill hatte ja so guten Willen. Wie hat Cyrill den Bruder gepflegt, als er krank war: »Cyrill, der einzige Bruder, mit bloßen Händen in der eiskalten Wasserleitung hat er mir stundenlang den Reis gewaschen, als ich am Magen so sehr litt. Ich werde es nie vergessen, daß Cyrill meinetwegen gehungert hat. Nicht ich, du bist der heilige Cyrill, den sie im Bette gekreuzigt haben, da du lang ausgestreckt liegst, während deine böse Frau sich quer über dich wälzt ...«
Cyrill stieg die Treppe hinauf und wieder herab, endlich hielt er vor seiner Tür, endlich sprach er im Zimmer mit der Frau zahllos viel Worte, so viel Worte, wie sonst in einem ganzen Tag, in einem halben Jahr.
Die Frau lächelte ihn sehr demütig an. Er überfiel sie mit Liebkosungen, zeigte beide Hände, er wolle sie mit Watte füllen, auch das Petroleum solle sie nur ausgießen, wie und wo sie nur könne, er brachte das Weihwasserkesselchen, auch dahinein, dielleicht auch in die Badewanne, auf einmal sei es zu viel, aber mit der Zeit? In die Kirche gehe er nie mehr. Er lebe nur für sie und das Kind. Er hätte sie ja noch für lange lieb, sie solle nur nicht weinen, wenn auch der Bruder ihretwegen zugrunde gegangen wäre, aber das hätte ja jeder voraus gewußt, er wäre so schwach gewesen, ich weiß selbst nicht wie, wir sind doch beide Menschen. Am Tags bin ich fleißig, aber nachts, ich weiß es nicht, warum bin ich ganz gestört? Aber du und ich, weil wir eins sind. Nein, nicht schlafen gehen. Es ist ein, Tag in der hohen Woche. Eine Woche ist im goldenen Jahr.
Ein verrufenes Jahr ist im ganzen Leben. »Du«, er atmete auf, sein Gesicht war verzückt, aber ganz fremd, »so war es schön, da muß es sein, wie es war, roter König vom Himmel, damals, wie es war.«
Die Frau glaubte, er würde umsinken, aber er keuchte sich nur höher auf, umschlang sie. Von Grauen gepackt, gegen ihren Willen nahm ihn die Frau in sich auf.
Am nächsten Tage erwachte er, wußte nichts von dieser Nacht. In dieser Nacht wurde Slawa gezeugt.
3
Während der Kinderjahre der zweiten Tochter, des guten Kindes, lebte der Vater auf. Mit diesem Kind zusammen zu sein tat ihm wohl. Slawas schmale Augensicheln entzückten ihn. Das Kind war so zart, wie eine Linie gezogen, wie eine dunkle Ader im hellen Holz. Die Haare wuchsen dicht auf dem Köpfchen, oft schwitzte das Kind, dann rollten sie sich zu vielen dunklen Locken, die wie aus Horn gedreht waren.
Was sie tat, erfüllte ihn mit viel Glück.
Er dankte ihr, er liebkoste sie, denn in seinen Augen war sie wie er.
Daß er nur dem jüngeren Kinde Gutes gönnte, machte die Mutter böse. War Cyrill böse, warum dann nicht gegen alle? oft trat er zutraulich zu ihr, sie stieß ihn zurück, nachts kam sie auf den Gedanken, sich die Hände absichtlich mit Petroleum einzuölen, sie tat es nicht, aber sie fühlte, daß auch sie selbst bösen Hauch von ihm annehmen könnte, und fürchtete sehr, sie müßte später Slawa hassen.
Wieder in den Dienst zu gehen, daran dachte sie lange nicht mehr; wohl wäre sie dort gut aufgehoben gewesen, selbst bei der strengsten Hausfrau hatte sie ihren Anspruch auf Bett, Speise, Abendlampe, in kurzer Nacht tiefe Ruhe. Aber auch bei ihren Kindern ließ man sie leben, ihr Mann war Meister und Besitzer des Geschäfts, sorgte für die Zukunft ihrer Kinder und wenn ihr doch noch etwas die Brust bedrückte, so konnte sie sich in die Kirche retten; oft lag sie da, den großen Kopf über den Steinfußboden der Kirche geneigt, die getürmte Last des Körpers lastend auf dumpfschmerzenden Knien, atemlos, mit geballten Gedanken, wie in schwerster Arbeit stumm, stumm wie einst, da sie Nachmittage auf den Knien verbrachte, eine große Wohnung mit dichter Bürste zu reinigen. Wie als junges Mädchen weinte sie oft, die Kinder fragten neugierig: »Mutter, was singst du?« Ihr Weinen klang zwitschernd, ihre Stimme beim Sprechen war tief und gurgelte heiser.
Selig war oft der Vater mit Slawa zusammen. Wie gern nahm er sie zu seiner Tapeziererarbeit mit, in neue Räume; abendlich glosten in den Winkeln vergitterte Koksöfen mattrot, hier war er mehr zu Hause als zu Hause; auf seiner Leiter stehend, war er ins Riesenhafte vergrößert, und wenn ihm Slawa in weißem Kleidchen mit dünnen Armen wie vom Ende von Zweigen Zeitungen entgegenreichte zu seiner Arbeit, entschwand er ihr in die Höhe. In seinem Munde fühlte er wie etwas Festes, wie eine verhärtete Knospe den Geschmack vieler Küsse, lautlos kam er herab, und mit dem rechten Arm unter ihren Kniekehlen hob er sie, eine weißwehende Hülle um etwas Unsagbares, Herzklopfendes, Atembestürzendes über sich, damit sie auf der Leiter reiten konnte, er schloß die Augen vor der Wölbung ihrer Knie, die, rot angeleuchtet von dem Koksofen, schimmerten im nächtlichen Haus.
Ohne Worte lebten Slawa und Cyrill nebeneinander viele Jahre. Jedes Jahr, glaubte er, würde er jünger, würde er ähnlicher einem Cyrill, der die ganze Zeit hindurch gewandert war, jenseits von Fanny groß und Fanny klein, nahe jedoch dem Bruder, dem heiligen, dem armen, dem schwebenden außerhalb der Stadt. Das böse Knirschen gab es nicht mehr. Denn mit Freude hatte er es gesehen, wie Slawas, der geliebten, winzige Kinderschuhe knirschend in gefrorene Wasserlachen traten, in Verzückung hatte er sich vor sie gekniet, um in seinen Händen die von Kälte beschlagenen Füßchen zu wärmen. Jedes Jahr freute er sich darauf, den ganzen Herbst. Einmal hatte ihn ihr Fuß aus Versehen getreten; als er ihn aber nochmals ergriff und mit seinen Augen ganz an ihren Augen hing, den sichelförmigen, da stieß sie ihn, nun nicht mehr aus Versehen, mit ganzer Gewalt auf die Brust, ihr Fuß entschlüpfte schlangengleich aus seiner Hand, etwas entschwebte, das nie wiederkam. Er strafte sie, seitdem wich sie ihm aus, er bot ihr Spielzeug, brachte ihr Blumen, sprach sie an und bat. Sie nahm nichts aus seiner Hand, er mußte alles auf einen Stuhl legen, von dort holte sie es sich lautlos spät nachts, wenn er im Einschlafen war.
Noch schwebte sie in der Mitte, noch schien sie ihm erreichbar, eine nahe Wiederkehr des wandernden Cyrill, ein glückliches Anstreifen des »zweiten« Cyrill des Bruders Kirchengeruch, den er immer noch wußte.
Am Morgen nach den im Schlafe fortgewehten Blumen aber fühlte er, der Bruder war vorbei, er selbst war vorbei für den Bruder, der Heilige hatte ihn ausgeschüttet wie ein Waschbecken mit gebrauchtem Wasser, mit grauem schmutzigen Wasser, und seine eigenen Schläfen waren grau wie Sand.
4
Die Frau war immer noch schön, sie war wie ein Haus, ganz aus unzerstörbarem Stein, aber sie fühlte sich jetzt schwer, oft nahm sie den Mann, mit zwei Händen umspannte sie ganz den weichen Raum zwischen seiner verengten Brust und den mageren Hüften, die ihr ganz verdorrt schienen. Sie nahm ihn an sich, da Beklemmungen, drohende Ahnungen in ihr waren. Als aber der Mann sich von ihr löste, löste sich nichts in ihr. Den Nachbarsfrauen klagte sie über Schmerzen in der »Herzbrust«, der linken, aber niemand verstand sie recht, sie glaubte, man lache heimlich hinter ihrem breiten Rücken.
Das ältere Kind Fanny war ihr Einziges, der Liebling, das warme Herz. Während Slawa oft in einem dunklen Winkel um sich selbst kreisend tanzte, und hohes Lachen mühelos aus ihr brach, ein Lachen im Triller ohne Ende, drückte sich die Mutter mit dem älteren Kinde zusammen in den Rahmen des geöffneten Fensters. Damit niemand es höre, weinte sie das Kind an in dem engen Raum, dem erhitzten Fensterraum hinter den herabgelassenen Rolläden. In den langen Locken der Tochter ihre Hände zu verstecken, ihr Gesicht zu baden, das war ihr nie erfüllter Traum, da während einer schweren Erkrankung der böse Arzt und der bösere Vater dem Kind die Hände gehalten hatten, während sie selbst, die böseste Mutter, das reiche Haar dem wehrlosen Kinde fortgeschnitten hatte.
Jetzt war des armen Kindes sehr großer Kopf nur knollig bewachsen mit Büscheln fahlen Haares, aber noch konnte sich alles wenden, alles glücklich gerettet werden. Sie selbst war ja schon gerettet, da es ihr gegeben war von Gott, das geliebte Kind auf die Welt zu bringen; empfangen war es in einer heiligen Minute, an einem herrlichen Sonntag. Der böse Mann war damals nur durch besondere Gnade, durch auserlesenen Befehl zu ihr getreten, sonst aber kam er aus seiner Verfluchung nicht heraus. Es war nur Schein, daß er fleißig sich mit Arbeit abrackerte von früh bis abends, nur Schein, daß er, dem früher schon der kleinste, unschuldigste Tropfen das Böse herausgelockt