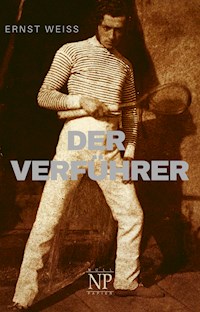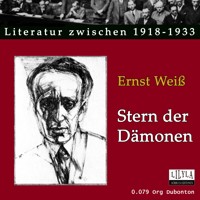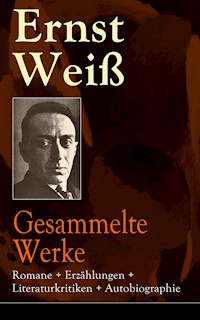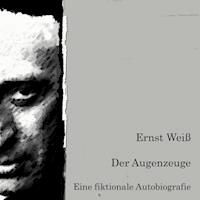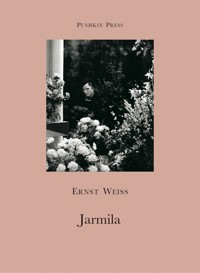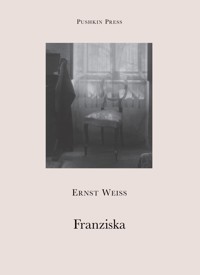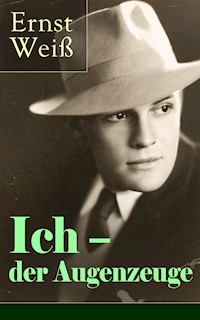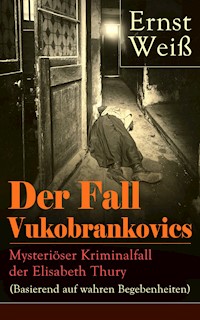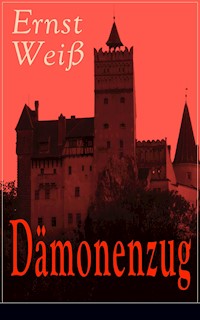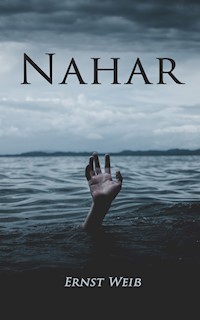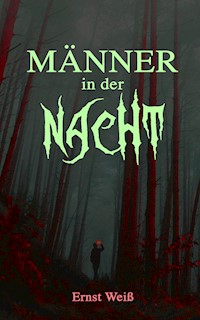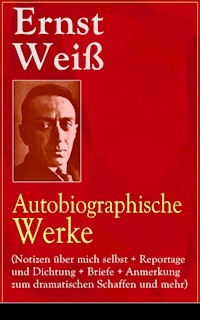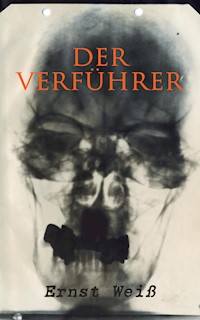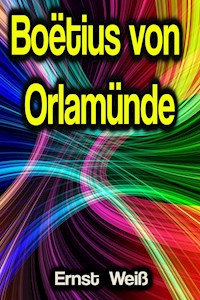
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Phoemixx Classics Ebooks
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Boëtius von Orlamünde Ernst Weiß - Boëtius von Orlamünde ist ein Internats- und Entwicklungsroman von Ernst Weiß, der, Mitte der zwanziger Jahre geschrieben, bei S. Fischer 1928 in Berlin erschien. Ab 1930 erschien der Roman meist unter dem Titel Der Aristokrat. Nach dem Kriege geht der junge Fürstensohn Boëtius von Orlamünde seinen Weg vom Aristokraten zum Proletarier.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 263
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HINWEISE DES HERAUSGEBERS:
Nehmen Sie unser kostenloses
Schnelles Quiz und herausfinden, welches
Best Side Hustle ist ✓das Beste für Sie.
✓ BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE:
→ LYFREEDOM.COM ← ← HIER KLICKEN ←
Teil 1
Kapitel
1
Ich heiße Boëtius Maria Dagobert von Orlamünde, oder besser gesagt, ich nenne mich Orlamünde. Das historische Geschlecht derer von Orlamünde ist im sechzehnten Jahrhundert ausgestorben. Orlamünde ist also hier bloß ein Name. Ich entstamme einem anderen uradeligen Geschlecht, das ich nicht nennen will. Trotz meines hochklingenden Namens bin ich nicht viel. Auch meine Eltern lebten in den erbärmlichsten Verhältnissen. Wußten sie es? Täuschten sie sich? Sie besaßen noch Reste früheren Glanzes, aber sie hungerten, und unser alter Diener David mit ihnen. Statt nun den Adel abzulegen und einen bürgerlichen Beruf zu ergreifen und auf diese Weise die einfachste Folgerung aus dem Niedergang der einst mächtigen Herren von Orlamünde zu ziehen, bedachten sie mich, ihr einziges Kind, außer mit den Geschenken der Armut und Genügsamkeit noch mit dem wahrhaft unsinnigen Rufnamen Boëtius. Nicht genug daran. Sie glaubten in ihrer Verblendung, mir eine »fürstliche« Erziehung geben zu müssen. Man erzieht mich erst durch einen alten Abbé daheim, später bringt mich mein geliebter Vater in ein adeliges Knabenstift, wenn ich es so nennen kann, in eine groß angelegte Anstalt, in welcher die Sprossen der reinblütigen Häuser, die man aus irgendeinem Grunde zu Hause nicht erziehen will oder kann, eine standesgemäße Erziehung erhalten. Dieses adelige Knabenstift heißt Onderkuhle und liegt im östlichen Belgien, nicht weit von der Grenze.
Unter diesen großen Herren verschwinde ich in dem ersten Jahre als der kleinste, der ärmste, der schüchternste und rothaarigste zugleich. Rothaarig – so klar das Wort und so scharf es einen Menschen äußerlich kennzeichnet – ist nicht ganz das rechte Wort. Zwar habe ich die lichtblauen, wie ausgewässerten Augen der meisten Rothaarigen. Wohl habe ich ihre buttercremefarbene, mit rotbraunen Sommersprossen gemusterte Haut, die feinen, langen Hände, die gestreckte, aber innerlich irgendwie verbogene Figur und knochenlose Körpergestalt, wie sie viele sehr blonde oder rothaarige Jünglinge haben, und diese Körperanlage ist es, die mich zum eleganten Tanze, zu jeder netten Verbeugung, zu jeder »adeligen Geste« unfähig macht. Man muß mich nur sehen, wie unbeschreiblich ungeschickt, geziert und unbehilflich ich, zum Staunen des Zeremonienmeisters, an meinem Ehrentage das letzte Jahrgangszeugnis aus der etwas zitternden, roten und weich aufgequollenen Hand des alten Direktors von Onderkuhle entgegennehme, der dabei, um mich nicht zu beschämen, mit seinen ebenfalls zitternden und leicht verglasten Augen wegsieht, während doch gerade sein fest auf mich gerichteter Blick die Kraft gehabt hätte, mir mein Selbstbewußtsein, meine gesunde männliche Haltung, mein Vertrauen auf mich und auf die bei aller Fürchterlichkeit doch wohlwollende Welt wiederzugeben. Nein, er sieht fort, in den Winkel, wo die alten blauen Schulfahnen hängen. Wozu eine Schule Fahnen besitzt, ist mir nie klargeworden. Zieht sie doch ebensowenig in Schlachten, als sie Veteranen, Verwundete und T. in ihren Reihen zählt. Aber die Fahnen sind da und aller Stolz. Der Haushofmeister, Zeremonienmeister und Lehrer der Etikette in einer Person (sein Name ist Garnier), er, der von einem russischen Leibeigenen und einer französischen Kammerzofe abstammen soll und der hier bei uns trotz seiner scheinbar ganz untergeordneten Rangstellung das ganze Heer der Ordonnanzen, Knechte und Verwaltungsorgane befehligt, dieser Mann reinigt sie jeden Morgen, bevor er seinen Inspektionsgang durch die Anstalt und durch unser Gut antritt. Und zwar tut er das in der Weise, daß er die schwarzen Fahnenstöcke mit einem weißen seidenen Lappen abreibt, dann mit der Daumenfläche wischend über die vergoldeten sechseckigen alten Schilder fährt, die an den Stöcken mit goldenen Nägeln befestigt sind. Nur die Fahnentücher reinigt er nicht, weil sie möglichst alt und ehrwürdig aussehen sollen. Er darf keine Bürste gebrauchen, er legt bloß die Falten in eine bessere Ordnung und läßt die blauen Fransen durch seine alten, »fürstlich« schönen, elfenbeinfarbenen, ringgeschmückten Finger rieseln.
Was sollen diese Fahnen der adeligen Schule? Was soll der unsichere Blick des trunksüchtigen Direktors, des alten Herrn in seiner hochgeschlossenen Uniform, die der eines Kavallerieobersten ähnlich sieht, aber noch mehr Gold angestickt trägt als eine solche? Was soll ich, der auf einem Podium, nein, vor diesem, auf dem spiegelglatt parkettierten Fußboden steht? Ich hebe mein rechtes Bein schon auf den Katheder und nehme in der lächerlichsten Stellung von der Welt mein Zeugnis aus der Hand des störrisch wegblickenden Schulobermeisters entgegen. Wie entbehrt dies alles der Vernunft! Freilich ist es schön und regt bei manchen edlere Gefühle an. Auch findet diese Szene nicht in Deutschland, Österreich oder Schweden statt, den drei vernünftigsten Ländern Europas, sondern im katholischen Belgien, wo man auch dem Schein sein Recht läßt. Und Schein ist auch alles. Ich, der uradelige Aristokrat und Bettler, meine Zeugnisse, die nichts eines Zeugnisses Wertes bekunden (denn Reiten, Fechten, Schwimmen, Turnen beweist man nicht durch gestempelte Zeugnisse), der Direktor in seiner Oberstenuniform, der Pulver nie gerochen hat, die Fahnen, die man nicht abstauben darf, der Haushofmeister, der der eigentliche Meister der Schule ist, denn er beherrscht, wie so viele Dienende in der Welt, die andern, welche die Macht zu besitzen glauben, denen aber der Mut fehlt, sie anzuwenden.
Ich lernte in der Schule von Onderkuhle (sie ist bei uns so weit berühmt, daß man nur zu sagen braucht, ich bin in Onderkuhle erzogen … ) bei meinen teuren Lehrern herrlich reiten. Es waren zwei Reitlehrer da, Absolvent des Kavalleriekursus in Brüssel war der eine, der andere ein ehemals preisgekrönter Herrenreiter; sie waren recht mit mir zufrieden. Dabei wird mir wahrscheinlich meine beim Reiten und Fechten ziemlich ungezwungene Haltung (schlaksig nennen sie manchmal die Leute) sehr von Nutzen gewesen sein. Diese Haltung sieht bloß ungeschickt aus, sie ist es aber keineswegs, besonders nicht auf dem Rücken eines Pferdes. Beim Reiten darf man nicht vergessen, daß sich ein lebender Körper mit einem anderen in einer gewissen Harmonie bewegt. Je leichter die Gewichtsverschiebung vor sich geht und je mehr sich der Reiter dem Pferde anpaßt, sowohl im muskelbeherrschten Sitz im Sattel als auch in der Gewichtsverteilung, wobei man oft das Gefühl wie bei einer Goldarbeiterwaage spielen lassen muß, desto harmonischer kommen die in ihren Grundelementen feststehenden Tritte des Pferdes heraus. Darf ich es ganz ungeschickt ausdrücken: Wenn ein passabler Reiter auf einem guten Pferde sitzt, beherrscht der Reiter das Pferd nicht mehr als das Pferd ihn. Beide sind eine unlösbare Einheit, ein Fleisch und, auf die Dauer der Reitstunde wenigstens, auch eine Seele.
Nun kann ich nicht erwarten, daß der Leser sich bis jetzt aus meinem verworrenen Darstellungsversuch schon ein Bild gemacht hat, wie ich lebe und meine Kindheit vom zehnten Jahre an verbringe. Ergebnis: Ich kann reiten und fahren, schwimmen, fechten, mit Pistolen schießen, kenne die Grundzüge des Exerzierreglements praktisch in ihrem Gebrauch, die Grundtatsachen der Geographie und der Geschichte sind mir nicht fremd. Kein Sport macht mir Mühe, jeder macht mir Freude, aber ich kann nicht richtig rechnen; nicht ganz fehlerfrei schreiben.
Nicht ohne Grund nahm unser Zeremonienmeister – den ich vorhin als Abkömmling eines freiwillig Leibeigenen und einer französischen Zofe bezeichnet habe – neben dem geistlichen Hirten den ersten Platz ein. Das Exerzieren unter dem Kommando eines Präfekten dauert nur eine halbe Stunde am Tage. Der Abbé, eine sehr wichtige Person in unserem kleinen Staate, überwacht zwar unser Gewissen, schreibt die üblichen, für einen gläubigen Katholiken leichten Übungen und Gebete vor und legt großen Wert auf regelmäßige Beichte und auf unseren Fleiß im schulplanmäßigen Religionsunterrichte. Den ganzen Tag aber, vom frühen Morgen bis zum späten Abend, stehen wir unter den Augen des Meisters, der uns »die Formen« lehren soll. Vor allem den Gruß. Er läßt alle vor seiner Person defilieren. Wir sind barhäuptig. Er hat auf seinem kohlschwarzen, aber an den Schläfen bereits leicht melierten Kopfhaar eine Mütze. Drei Schritte vor ihm müssen wir haltmachen. »Zurück, zurück!« ruft er uns zu, als hätte er Angst, wir wollten ihm an den Hals. Nun blickt er uns mit seinen slawischen Augen an, damit wir uns tief verbeugen. Nie tief genug. Keine königliche Hoheit hat so viel Verbeugungen von hohen Aristokraten entgegengenommen wie er. Er spielt so lange den Herrscher, bis wir den Herrscher in ihm sehen. Antworten, Schweigen, den Vortritt lassen, den Vortritt nehmen, Benehmen bei Tisch, Begrüßung und Abschied von Höherstehenden, Gleichgestellten, Domestiken, alle Feinheiten des aristokratischen Verkehrs, Körperhaltung, seelische Haltung, Selbstbeherrschung, Takt, Selbstverständlichkeit im Befehlen und vor allem stets Distanz wahren und sich seiner Stellung bewußt bleiben, sei sie hoch oder niedrig – das sind die Fächer, die er lehrt. Stunde für Stunde, bei den Mahlzeiten, selbst dann, wenn wir schlafen. Er hat seine steingrauen, etwas auseinanderweichenden Augen überall. In seinen Fächern werden wir nie Meister. Er tut, als wäre er darin aufgewachsen, und doch ist es bekannt, daß er nur ein Jahr bei dem Grafen F. in St. Petersburg zugebracht hat. Allerdings war dieser der vollendetste Hofmann seiner Zeit.
Gut Florett fechten zu können (eine Kunst, bei der mir mein scheinbar knochenloser Körper die besten Dienste leistet) sei wichtiger, meint er, als Ansammlung toten Wissens und das Rechnen mit Dezimalzahlen. Für die Religion hätte der junge Aristokrat den Beichtvater, für die Politik seinen König, für die Vermögensverwaltung seinen Rendanten. Dezimalzahlen gäbe es im Grunde gar nicht, und wenn es sie auch gäbe, zieme es einem Mann von Familie nicht, seinen Leuten solche Bagatellen nachzurechnen.
Das ist der Zug unserer Erziehung. Der Direktor ist ein goldgestickter Schatten, der Abbé ist immer im Jenseits, der Meister aber herrscht hier. – Mein Vater lebt in der Ferne.
Ich könnte mich zum Rennreiter, zum Fechtmeister ausbilden lassen, so groß sind meine Vorkenntnisse. Mein Handgelenk und meine Wirbelsäule (die letztere ist von größter Wichtigkeit) verlieren ihre Geschmeidigkeit nie. Aber Fechtlehrer! Welch phantastischer Beruf in einer Zeit, die das Duell, den entscheidenden Zweikampf, das Gottesurteil an der Spitze des Rapiers nicht mehr kennt. Und Rennreiter? Nein. Anderswo ist jetzt der eigentliche, der blutige Fechtboden der Zeit.
So lebe ich bis an mein achtzehntes Lebensjahr in dem exklusiven Stifte; als guter Reiter und Fechter bei allen, selbst bei dem griesgrämigen russischen Zeremonienmeister hoch angesehen. Wenn ich kein Geld habe (Geld braucht man allerorts, selbst hier), so wird darüber keine Silbe verloren, vorausgesetzt, daß ich nur sonst meinem Namen Ehre mache – und ich mache ihm wenigstens keine Unehre.
Eine glückliche Kindheit? Ich darf nicht klagen.
Kapitel
2
Noch erinnere ich mich eines Tages, einer Spazierfahrt im Walde. Zum Schulstift gehörte auch ein kleines Gestüt. Wir hatten freie Pferde genug, nicht alle konnten als Wirtschafts- und Schulpferde benutzt werden. Das Mustergut, das mit der Schule in Onderkuhle verknüpft war, brauchte die Zugtiere noch nicht alle, es war vor der Ernte, Anfang Juli vielleicht. Ich vertrat einen der Reitlehrer, der verreist war (verreist nannte man es, wenn ein Lehrer erkrankt war), und dieses Ehrenamt brachte mir viele Vorteile. Ich war zu dieser Zeit über das Alter der meisten anderen Zöglinge hinaus, war keiner Klasse (es waren deren fünf) zugeteilt und erwartete jeden Tag, daß man mir nahelegen würde, einen Berufsweg einzuschlagen und Onderkuhle zu verlassen.
Um so schöner dieser Tag. Die Stalldiener zogen unser honigfarbenes Gig aus dem Verschlag, es war ein zweiräderiger, hoher, weichfedernder Karren. Wir, mein Freund Titurel und ich, spannten ein junges, noch nicht dreijähriges Pferdchen vor, das mit seinem zarten, leicht zusammenpreßbaren Körper die Riemen und Schleifen nicht vollständig ausfüllte, sondern sich in ihnen wie ein Mensch in einem zu weiten Anzüge bewegte; so ähnlich schrumpfte daheim unser alter Diener David in seiner violettintenfarbigen Livree von Jahr zu Jahr ein, sein Rock hing ihm bis an die Knie und später noch tiefer. Bei ihm war es Alter und Ende, bei unserem Pferdchen Anfang und Jugend. Nun setzte sich das Pferdchen in Gang, sich fortwährend unaufmerksam nach uns, die wir Rücken an Rücken im Wagen sitzen, umwendend und das blanke Maul zum Wiehern öffnend. Da es durch den Zügelriemen und das Stangengebiß belästigt ist, wälzt das Tier seine breiten schwarzen, innen hellroten Lefzen nach außen, wodurch der trotz allen Bürstens struppige Kopf ein komisches, knabenhaft lustiges Aussehen erhält. Es trabt nun das Pferd mit uns durch den Park zu einem nahen See, der nicht mehr zu unserem Gute gehört. Sage ich nicht unser Gut, als wäre das alles, Ställe, Wirtschaftsgebäude, Rechnungsstuben, Gesindewohnungen, Brunnen und Tränken, Spritzenhaus, Kornkammern, Scheunen, Schweinekoben, Taubenschläge und der eingezäunte Raum mit Perlhühnern, Pfauen, Truthähnen, der Schuppen mit den Pflügen, mit der Dreschlokomobile und den mechanischen Heuwendeapparaten mein persönliches Eigentum? Und doch gehört mir nichts. Nicht einmal die Peitsche, die ich ruhig in der Hand halte, ohne auch nur mit der Spitze die feine, zitternde Haut des isabellfarbenen Tieres zu berühren.
In schlankem Trabe geht es neben den Düngergruben über einen kleinen Steg in die Obstgärten, wo schon alles abgeblüht ist. Es sind aber doch noch Reste von weißem Blütengefieder am Boden rings um die schwarzen, in der Sonne stark glänzenden, wie gefirnißten Apfelbaumstämme zurückgeblieben. Die Zeit ist wolkenlos. Kein Wind. Nachts nur ein wenig Tau unter dem herrlich prangenden Mond; man trägt keine Uniformmütze (wir waren alle in einer Art Uniform, ich sagte es schon von dem Direktor und Schulmeisterdiener). Bloß ich lege die Mütze nicht gern ab, was seine Gründe hat; nun aber halte ich sie zwischen den Knien. Sie knirscht, wenn der Wagen schwankt und schaukelt. Handschuhe zieht man wohl an, da es Vorschrift ist und der Meister seine Augen überall hat. Nun aber, da wir die Gemarkung des Hofes verlassen, streife ich die Handschuhe ab, und während das gebrechliche Gefährt bei meiner Bewegung sich von vorn nach rückwärts wiegt, stecke ich die Handschuhe, einen in den andern gefaltet, mit der Innenseite nach außen, meinem Freunde in die Brusttasche.
Durch die Büsche erblickt man bei der Wegbiegung hinter sich das Schulgebäude, aus roten Ziegeln schloßartig erbaut; je weiter man kommt, desto größer und gewaltiger scheint es zu werden, und desto höher scheint es von der ganz unbedeutenden Höhe in die klare, flimmernde Sommernachmittagsluft emporzusteigen. Nun liegt es bei einer scharfen Wendung des Weges hinter uns, wir fahren unter jungen Linden dahin, dann dreht sich der Weg in eine Pappelallee (man nennt sie die italienische), an die sich von beiden Seiten ein Tannenforst anschließt, es ist still, bloß ein Kuckuck ruft, ziemlich weit entfernt. Der Wagen geht so schnell und leicht, das Pferd hebt sich so regelmäßig und taktfest in seinem etwas zu weiten Geschirr, daß wir unter den hohen, malachitgrünen Tannen wie auf Schienen dahingleiten. Zu dem Duft der Bäume kommt der Geruch nach Wagenschmiere, die so reichlich aus den Radnaben tropft, daß die sehr eng an den Wagen heranstreifenden Laubsträucher, Ebereschen, Sauerampfer, Farn, Ginster und die hohen, im feuchten Grunde riesig aufschießenden graugrünen Kletten davon beschmutzt werden. Ich blicke mich um und sehe meinen Freund damit beschäftigt, meinen Handschuh, den ich ihm zur Aufbewahrung gegeben, aus der Tasche herauszuziehen, umzuwenden und an seinen bloßen, kurzgeschorenen Kopf zu heben, an seine sommersprossigen Wangen zu schmiegen, vielleicht um die Weichheit des Leders zu prüfen. Damit ist es aber nicht weit her; denn da die Eltern der Zöglinge Handschuhe und Mützen, als das einzige übrigens, zu liefern haben, sind bei mir Handschuhe ein sehr kostbarer, sehr geschonter Artikel. Ich weiß, daß mein Vater mir im Jahr nicht mehr als zwei bis drei Paare schicken kann.
Noch habe ich kein Wort von ihm, meinem Herrn, meinem alten Herrn, erzählt, an den doch mein Herz gerade jetzt denkt. Ich will bloß den erdigen, schokoladefarbenen, rein nach Tannen und Ginster duftenden Waldboden vor mir sehen, wie er sich unter den blank geputzten, spiegelnd schwarzen Hufen des Pferdchens aufrollt. Es geht bergauf, dem kleinen See entgegen. Hier stehen Buchen, Eichen. Mitten unter dem hellen, weich umflaumten Laube keimt das ernste erzähnliche Grün der Nadelbäume, unter dem wie Früchte die weißgrünen neuen Sprossen der Zweige hervorleuchten in fast stechendem Glanz. Ein Himmel voll edler Bläue steigt über den zart ineinanderwehenden Kronen der im Sommerabendwind erbebendenBäume empor. Dann öffnet sich der Weg, der Abfluß des tiefblauen Sees rauscht in gedämpftem Wirbelschlag über ein ganz glatt gescheuertes Wehr aus den weißen Stämmen, an denen sich flatternde, haardünne Algen und schwarzbraunes, fleischiges Moos streifenweise angesetzt haben. So strömt das völlig klare Wasser in doppelter Färbung, in wechselnden Streifen herab. Es gibt noch einen Gegenstand auf Erden, der ähnlich, wenn auch nicht in so schönen Farben, gestreift oder gescheckt ist – ich sage es endlich, es ist mein Haupthaar, das durch ein sonderbares Spiel der Natur zwei Farben zugleich bekommen hat, die eine mehr gelblich (an den Schläfen), die andere mehr rötlich (auf dem Scheitel). Jeder merkt es nicht, vielleicht nur der, der es weiß. Vielleicht sehe nur ich selbst mich so. Solange ich es verbergen kann, wie jetzt unter der hechtfarbenen Uniformmütze, die ich aufgesetzt habe, als friere es mich in dem kühleren Wasserhauche, solange ist mir wohl. Aber wie soll es werden, wenn ich einmal die hellgraue Mütze abgeben, die ebenfalls hechtfarbene Uniform an den russischen Leibeigenen, den Meister des Hauses, zurückstellen muß und ich dann in meiner ganzen rothaarigen Häßlichkeit, ohne Kenntnisse und verwertbare Fähigkeiten in das Leben hinaustreten soll, von dessen Grausamkeit mein armer Vater mir viel erzählt hat, wenn er mich hier besucht?
Man nennt ihn den Fürsten, und fürstlich ist er auch geboren, seine Haltung ist ohne Makel, sein Wesen edel, seine Worte sind gewählt, seine Kleidung von der ruhigsten Eleganz, er gibt beim Abschied den Dienern die größten Trinkgelder, verehrt der Ordonnanz, die sein Zimmer aufgeräumt und seine glänzenden Lackschuhe abgestaubt hat, eine goldene Nadel mit einem Hufeisen. Er gibt mit vollen Händen, er schenkt fast gedankenlos, gedankenlos vor Freude, mit seinem Sohn hier zu wohnen. So tritt er mit seinem kavaliermäßigen Gang, eine ruhige Herrschergewalt in seinen schieferfarbenen Augen, im alten Glanze auf, wie ein reicher Mann, wie der Besitzer eines großen Feudalgutes, oder wie ein Prinz, der als inspizierender Kavalleriegeneral nur im Extrazuge und nie ohne seine Adjutanten und zwei Kammerdiener reist. Aber wenn mein Vater einen Augenblick gefunden hat, mit mir allein zu sein, wie viele traurige Dinge muß ich hören, wie ängstlich wird mir zumute, wie demütig lausche ich seinen exklusiven Lehren, die doch, wie er auch selbst im Grunde weiß, nicht befolgt werden dürfen. Wir gehen an der Anstaltskapelle vorbei und sehen dem Geflügel zu, das sich auf der Treppe umhertreibt. Die Worte »Entbehrungen« und »standesgemäß« kommen am häufigsten vor. Unaufhörlich wird, ohne daß wir den Umkreis des kleinen Gotteshauses verlassen, von der Zukunft gesprochen. Aber was »Zukunft« für mich bedeutet, wird nie ganz klar. Eine Lebensrente, die aber nicht zum Leben, sondern nur zum Entbehren reicht, steht meinen Eltern von seiten sehr reicher Verwandter in Irland, die niemand von Angesicht gesehen hat, zu. Eine Perlenkette, aus rötlichen und schwarzen Perlen gemischt, der letzte Rest eines unbezahlbaren Familienschmuckes, ist verpfändet oder soll es werden – doch ist dies nicht leicht insgeheim ins Werk zu setzen, und die Welt, die Öffentlichkeit darf nur wissen, daß wir leben, aber nicht, wie. Hier wird seine Miene sehr ernst, er faßt mit seinen langen behandschuhten Händen erst nach meinem Arm, dann nach meinem Kopf, nimmt mir die Mütze herunter und betrachtet sie. Auch er hat, vor zwanzig und mehr Jahren, eine ähnliche getragen, froh, feudal und sorgenfrei – und da er mir die frohe, sorgenfreie Jugend nicht verdüstern will, verstummt er plötzlich und gibt mir die Mütze zurück. Wüßte er, wie sehr mich in diesem Augenblick T. beschäftigt – er spräche anders. Aber er tut, als wäre ihm alles leicht, als könne er über alles lächeln. Er schlägt seine schieferfarbenen Augen auf, in denen sich die helle Treppe der kleinen Kapelle mit den noch kleineren Hühnern winzig spiegelt, und jetzt feuchtet er mit der Zunge seine breiten, etwas hängenden Lippen an. Weiß er nichts? Kennt er mich nicht? Nicht sich? Oder ist es Verlegenheit und Scham?
Kapitel
3
Jetzt sind es sechs Monate, daß mein alter Vater zum letzten Male hier war, ich weiß es noch genau, denn es war sein letzter Besuch. Aber nicht vom »Letzten«, nicht von T., so tief auch beide zusammenhängen, will ich jetzt sprechen, nicht von alt, auch wenn er, mein liebster Vater, damals so alt war, wie ich, dank einem schönen T., nie zu werden hoffe.
Die Brücke über den Abfluß des Sees, über die jetzt unser Wägelchen schaukelt, ist auch nicht die jüngste. Das Holz ist weich und verfault, es duftet nach Pilzen, die in nicht geringer Menge an der Unterseite der kleinen Brücke gedeihen und dort das morsche Holzwerk unterminieren. Ich fahre langsamer, nicht aus Angst, die Brücke könnte unter unserm Gewicht einbrechen, sondern damit mein junges Pferdchen seine schmalen Hufe nicht zwischen den Holzschwellen verhakt und stolpert.
Fremde Menschen kommen vorbei, die Frauen tragen große grünlichweiße Hauben bis über die Augen, deren Glanz trotzdem durch die Löcher der Stickerei flimmert. Die Männer marschieren in hohen Stiefeln, um den Mund haben sie große Bärte. Erinnert man sich jetzt der Schulstunden in der Mitte der geschwätzigen, meist gutmütigen, oft aber auch boshaften Kameraden in Onderkuhle und sieht man jetzt die Brücke, den See vor sich statt der vertrauten Institutswände, dann erblickt man in diesem Augenblick ein langes und vielfältiges, nie auszuschöpfendes Leben vor sich. Alles ist voller Hoffnung.
Mein Freund Titurel, der von seiner letzten Krankheit sich noch nicht ganz erholt hat (stets wird er so schwer mit allem fertig, auch mit seinen Aufgaben), verdankt eben seiner Schwäche und Erholungsbedürftigkeit den Urlaub von heute nachmittag und die Erlaubnis zur Wagenfahrt. Sein Rücken preßt sich, als wir nun den See hinter uns lassen und in schnellerer Fahrt auf der Hauptstraße nach der Stadt zwischen Kartoffeläckern und wohlbewässerten Wiesen und Rübenplantagen dahineilen, fester an mich. Der Wagen wirft sich. Irgend etwas hat verdächtig in dem Federwerk geknackt. Ich bremse, bringe das Pferd, und zwar nicht durch Reißen an den Zügeln, sondern eher durch Nachlassen, zum Halten. Außerdem beginne ich ganz fein zu pfeifen, ein Appell, welchen mein Pferdchen sofort versteht und befolgt. Ich habe es seinerzeit erzogen, habe ihm mit weicher, bittender Hand die ersten kunstgerechten Gänge an der Longe beigebracht und habe es an das ganz fremde, ihm anfangs unbegreifliche Gebiß gewöhnt.
Der Freund gleitet nun mit großer Schnelligkeit von seinem Sitz herab, ohne zu bedenken, daß er die Deichselspitze dadurch in die Höhe reißt und dem im Maule noch sehr weichen Tiere nicht eben wohltut, nun steht er vor mir und will mir von meinem Sitz herunterhelfen. Ich blicke mich um, ob auf der Chaussee nicht ein anderer Wagen oder ein Automobil kommt. Plötzlich fühle ich den Knöchel meines linken Fußes von Titurels Hand umklammert. Er breitet mir etwas Weiches unter meinen Fuß, mit dem ich eben, möglichst sanft, abspringen will, um das gebrechliche Gig nicht zu sehr zu erschüttern. Jetzt stehe ich auf dem Erdboden, vor mir den Freund, der seine linke Hand mit meinen Handschuhen mir als Fußstütze dargeboten hat. Wollte er mir damit einen besonders ritterlichen Dienst erweisen, worauf ein krankhaftes Lächeln seiner geschlossenen Lippen hindeutet? Seine Zähne sind schlecht, aus Scham öffnet er seinen Mund so wenig wie möglich. Deshalb wirkt er oft schüchtern, ist es aber nicht, eher ironisch. Aber ich habe die Handschuhe ihm zur Aufbewahrung gegeben, nicht zu Ritterdiensten. Ich sehe jetzt vor mir meinen alten Vater, an den ich das Gedenken bis jetzt gewaltsam unterdrückt habe. Ich weiß, wie schwer er das Geld für ein neues Paar erschwingen wird. Trägt er doch die seinen nur zur »Parade«, das heißt bei Besuchen in Onderkuhle oder bei wichtigen Ausgängen und Staatsvisiten, bei denen man auf ihn, das heißt auf seinen Namen, rechnet. Der Freund schweigt. Er erwartet wohl ein gutes Wort von mir. Ich kann aber meinen Zorn nicht beherrschen. Ohne zu reden, nehme ich die feuchten, beschmutzten Handschuhe ihm aus der Hand und werfe sie, als wären sie nun ganz wertlos geworden, über meine Schultern nach rückwärts in die Rübenfelder. Sodann bücke ich mich unter den Wagen und finde eine Stellschraube der rechten Federlasche gelockert, die ich mit der Handhabe eines meiner Schlüssel fassen und anziehen kann.
Dann sitzen wir auf und kehren den gleichen Weg zurück. Doch es ist nicht mehr das gleiche. Auf der Waldstraße hören wir hinter uns einen Wagen heranrollen. Unsere Rücken haben sich schon lange voneinander gelöst. Wir sitzen steif und voll Haltung da, niemand, auch nicht der Zeremonienmeister, könnte etwas auszusetzen haben. Er kennt nur Haltung, nie Herz, nie Gefühl. Kennt er auch den T. nicht? Kennt er ihn? Ich treibe mein Pferd, ich schone die Peitsche nicht. Trotzdem überholt uns der andere Wagen. In ihm sitzt der Zeremonienmeister, der uns nicht zu erkennen scheint. Weder erwartet er einen Gruß, noch denkt er daran, den unsern zu erwidern. Vielleicht denkt er in diesem außerdienstlichen Augenblick nicht an uns, die Schüler, sondern an sich und seine »privaten« Reichtümer, die er hier gesammelt haben soll und die ihm bald auch eine Herrschaft außerhalb von Onderkuhle ermöglichen werden. Wen wird er in Brüssel beherrschen? Herrlich und einsam lehnt er mit gesenkten schweren Augen in seinem Wagen. Die Pferde wiehern einander zu, auch die seinen sind nicht alt, reines Blut und noch nicht lange im Zuge. Auf ihren schlanken Lenden, auf den glatten, wie reife Kastanien glänzenden Flächen der breiten Kruppen und auf den scharf gekanteten Seiten des Halses unter der ganz kurz gehaltenen Mähne spielt hin und wieder der Schatten der Bäume. Ein leichter Wind hat sich erhoben. Das Licht der sinkenden Sonne wird ab und zu verdeckt. Regen liegt in der Luft wie Abendrot. Den Kuckuck hört man nicht mehr. Die Brücke ist sehr dunkel und riecht jetzt mehr nach Fäulnis und Moder. Die Pferde des Leibeigenen wenden sich nach uns um. In den großen sumpfbraunen Augen des einen sehe ich den See gespiegelt oder das Laub, halb blau, halb grün, nur ein Schein, nur ein Augenblick, ein Schimmern. Mein Pferd beginnt zu schwitzen, und es färbt sich die Haut zuerst an den Rändern des Geschirrs dunkler, dann wachsen die Härchen zusammen, stehen in Reihen, als hätte man sie mit einem breitsträhnigen Kamme gestriegelt. Jetzt riecht es, aromatisch und schwer, nach Schweiß, nach Tannen, Regen und Staub.
Es war früh am Abend, die Schüler der »Fünften« waren auf dem Tennisplatz, wo durch die Dämmerung die Bälle flogen, sehr hell gegen die dunklen Drahtnetze geschnitten. Dann kommt das Aufschlagen der Bälle an den stark gespannten Saiten der Raketts und das gleichmütige Zählen der Partie, wobei ich die etwas fette Stimme des jungen Prinzen X. (Piggy) erkenne, der gern dieses Amt übernimmt, sich aber ungern in einen Kampf einläßt. Handelt es sich aber darum, einem Schüler nachts im Schlafe mit einer Gartengießkanne einen »Rückenguß« zu geben, ist er als erster dabei. Auch das »Flohpulver« kennt er und die »russische Lektion«. Er selbst ist aber immer »neutral«.
Die kleineren Kameraden spielen Kricket auf einem andern Platze. Ihr Kreischen und Lachen ist sehr laut, oft übertönt es die Schläge mit den Holzhämmern. Ab und zu schreit auch einer auf, den ein Kamerad, sei es aus Ungeschicklichkeit (wie er sagt) oder aus Bosheit (wie es meist ist) oder »um den Mann auf die Probe zu stellen«, mit dem Holzhammer in die Achillesferse oder auf die Kniescheibe geschlagen hat. Auch ich kenne diesen Schmerz. Keine von diesen sehr unbarmherzigen und doch zur Erlangung des Ranges als »Mann« notwendigen Proben hat man mir in den ersten Jahren hier erspart. Mich hat daheim niemand gestraft. Ich wußte nicht, was körperlicher Schmerz ist. Ich empfand ihn auch hier nicht als Strafe, niemals habe ich, wie Prinz X., mich bei den Lehrern oder bei dem Zeremonienmeister über einen älteren und stärkeren Kameraden beschwert, obwohl ich oft nachts vor Schmerzen nicht einschlafen konnte. Denn es gab viele Proben.
Nun lagern die Lehrer in ihren weißen, leichten Interimsröcken auf den mit rotweißgestreifter Leinwand überzogenen Gartenstühlen, die Wolken aus ihren Zigarren sammeln sich zu einem blauen Diadem über ihnen unter den hohen Sommerbäumen. Der Russe geht bereits zwischen ihnen und den Spielplätzen umher, scheinbar, um nach den Wünschen der Lehrer zu fragen, in Wirklichkeit, um alle, Lehrer und Schüler, zu überwachen.
Jetzt sind wir im Hofe bei den Ställen. Seine Pferde sind schon ausgeschirrt. Ein Stallpage (Fredy) reibt sie am Rücken und am Bauche mit trockenem Stroh ab. Sonst verschmähen sie im allgemeinen Stroh, jetzt aber schnappen sie nach demselben mit ihren langen, wie Erdbeereis blaßroten Zungen und fletschen ihre dunkel elfenbeinfarbenen, matt blinkenden Raffzähne, wobei sie den Ärmel des ängstlich lachenden Stalljungen mit erfassen. Mein Pferd öffnet wieder das Maul zum Wiehern, wobei es den schönen dreieckigen Kopf etwas hebt und seitwärts nach dem Stalleingang wendet. Nun steht es wieder still auf meinen Blick, tänzelt bloß ein wenig auf den Vorderbeinen. Die Zügel sind in festem Knoten um die Kurbel der Bremse geschlungen. Ich will meinem Freunde Titurel vom Sitze herabhelfen. Er ist so still, stiller als sonst. Jetzt fällt er mir wie eine leblose Masse in den Arm, er blickt mich stumm mit seinen überaus glänzenden, messingfarbenen Augen an, will lachen, aber die Bewegung geht nur in wilden Wellen über sein blasses, sommersprossiges, etwas derbes Gesicht. Er klagt nicht. Er zeigt seine Zähne nicht. Er zittert, wohl infolge eines Fieberfrostes, und so nehme ich ihn denn, obwohl ich kleiner bin als er, ohne besondere Mühe auf meine Arme und trage ihn über den Hof, wo er vom aufsichthaltenden Unterpräfekten empfangen und sofort mit einer strengen Bemerkung in das Krankengebäude hinübergeschafft wird. Als ich mich umsehe, steht der Wagen nicht mehr vor der Freitreppe, aber mein kleines Pferd ist dem Hütejungen ausgekommen, es trabt, schelmisch mit dem allzu langen Schwanze schlagend, zwischen den im Abendschimmer leuchtenden Gebäuden umher, wiehert ohne Aufhören, die Stimme willkürlich hebend und senkend, als spräche es zu sich selbst. Jetzt ist es an die geschorene Hecke gekommen, welche die Spielplätze von den Wirtschaftsgebäuden trennt, und tobt sich in lustigem Schreien und hohen Sprüngen über das dunkelgrüne Buschwerk aus.
Wer wollte nicht mit ihm tauschen? Nicht mehr Boëtius von Orlamünde sein, sondern ein dreijähriges, starkes, vollkommen gesundes und schönes Tier, das nichts vom T. weiß, das ganz im Leben aufgeht.
Ich liebe Tiere sehr, aber etwas von dieser Liebe ist Neid.
Kapitel
4
Ich habe in der folgenden Nacht nicht sehr gut geschlafen, da ich außerordentlich stark an meinen Vater, den Schöpfer meines Lebens, und an Titurel, meinen einzigen Freund, denken mußte, und so kommt es, daß ich morgens noch schlaftrunken beim Gehen über die Schwelle stolpere. Ich wohne in diesem Jahre nicht mehr gemeinsam mit den anderen Schülern in einem der großen Schlafsäle. Es gibt ihrer sieben, einige standen schon lange leer. Das Haus konnte mehr Schüler fassen, als jetzt da waren. Von den vielen Anmeldungen wurden vom Direktor, dem Abbé und dem Meister nur die »reinsten Namen« ausgewählt – oft nur ein Bruder, wenn drei eingereicht hatten. Angeblich wurden aber viel mehr Schüler in den Rechnungen geführt – alles zum Vorteil des Meisters. Sicheres habe ich nie erfahren können. Es betrifft mich auch nicht.