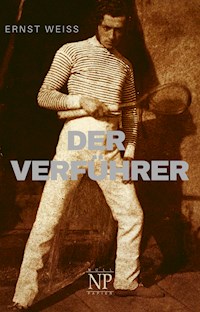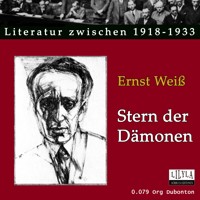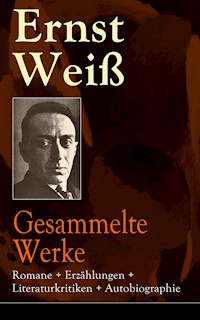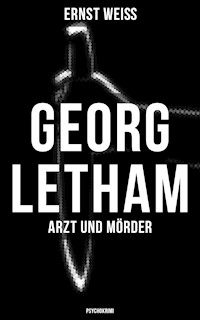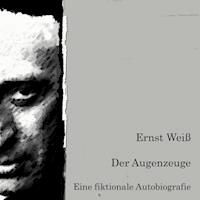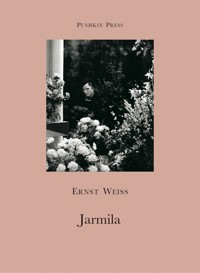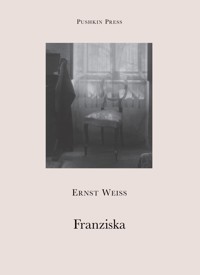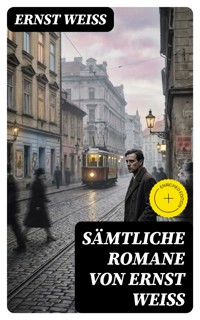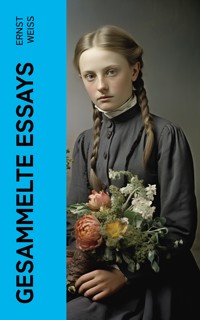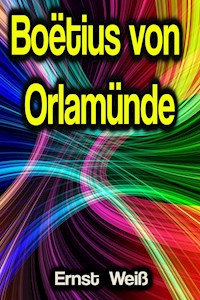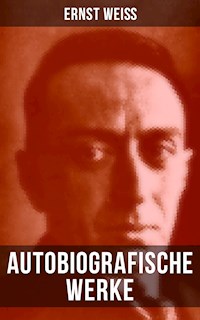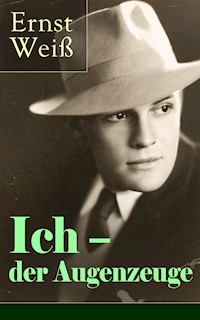
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: e-artnow
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dieses eBook: "Ich - der Augenzeuge" ist mit einem detaillierten und dynamischen Inhaltsverzeichnis versehen und wurde sorgfältig korrekturgelesen. Ich, der Augenzeuge ist der letzte Roman von Ernst Weiß. Der anonym bleibende Ich-Erzähler, ein katholischer bayerischer Arzt, verheiratet mit der Jüdin Viktoria, erzählt seine Lebensgeschichte bis zum Jahr 1936. Zum Inhalt: Der Ich-Erzähler wird als Schuljunge von einem Pferd getreten, als er dem Tier Brot reichen will. Der behandelnde Arzt Dr. Kaiser, wegen seiner Konfession der Judenkaiser genannt, verschafft dem Kranken Linderung durch eine schmerzhafte Rippenfellpunktion. Der Erzähler lernt Viktoria, die Tochter des Arztes, ein bildschönes, hönigblondes junges Mädchen kennen und lieben. Die Zuneigung Viktorias zur Familie des Erzählers schlägt in Hass um, nachdem die strenggläubige katholische Mutter des Erzählers das arglose junge Mädchen mit einer antisemitischen Äußerung brüskiert. Eigentlicher Verursacher dieser Äußerung war der Vater des Erzählers. Nachdem dieser mit der Magd Vroni Zwillinge in die Welt gesetzt hatte, schob er dafür dem Judenkaiser die Schuld in die Schuhe. Die Mutter, froh, einen Sündenbock gefunden zu haben, nahm in ihrem Judenhass diese irrwitzige Behauptung des Vaters für bare Münze. Ernst Weiß (1882 - 1940) war ein österreichischer Arzt und Schriftsteller. 1928 wurde Weiß vom Land Oberösterreich mit dem Adalbert-Stifter-Preis ausgezeichnet. Weiß debütierte mit seinem Roman Die Galeere.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich - der Augenzeuge
Die Lebensgeschichte des katholischen bayerischen Arztes (Der letzte Roman des österreichischen Autors)
Inhaltsverzeichnis
Erster Teil
Das Schicksal hat mich dazu bestimmt, im Leben eines der seltenen Menschen, welche nach dem Weltkrieg gewaltige Veränderungen und unermeßliche Leiden in Europa hervorrufen sollten, eine gewisse Rolle zu spielen. Oft habe ich mich nachher gefragt, was mich damals im Herbst 1918 zu jenem Eingriff bewogen hat, ob es Wißbegierde, die Haupteigenschaft eines in der ärztlichen Wissenschaft tätigen Forschers, war oder eine Art Gottähnlichkeit, der Wunsch, auch einmal das Schicksal zu spielen.
Einerlei, ich will mein Leben vorerst bis zu jenem Tage Ende Oktober oder Anfang November 1918 in kurzen Zügen darstellen. Nüchtern und klar, schmucklos und möglichst wahrheitsgetreu.
Ich bin in Süddeutschland geboren als der einzige eheliche Sohn eines ziemlich angesehen Hoch- und Tiefbauingenieurs. Die Anlage von Bergwerken und dergleichen hat meinen Vater wenig gereizt. Sein eigentliches Gebiet waren Brücken, und ich entsinne mich, daß wir, meine sehr geliebte zarte Mutter, er und ich, eines Herbsttages mit der Eisenbahn von M. nach I. reisten und daß mich, als ich eingeschlummert war, mein Vater plötzlich weckte, als wir über eine Eisenbahnbrücke fuhren, die er im letzten Sommer zu Ende gebaut hatte. Ich merkte nichts Besonderes an der Brücke, es schien mir eine Eisenbahnbrücke wie alle anderen zu sein, sie führte über einen mit Weiden und Erlen eingefaßten Wildbach, aus dessen Bett ein paar bemooste Steine hervorragten, die Böschung, noch ohne Grasnarbe, war nicht besonders steil, aber meine Mutter tat, als sei sie außer sich vor Begeisterung, und sie hustete, wie immer, wenn sie sich erregte. Mein Vater lächelte bescheiden unter seinem dicken blonden Schnurrbart. Gelegentlich vertraute er mir an, es gäbe etwas noch Schöneres zu bauen als Brücken, nämlich Schlösser, Warenhauspaläste, Bahnhöfe, aber diese Aufgabe behielte er sich für später vor.
Man nannte ihn immer den Herrn Oberingenieur. Man bückte sich ziemlich tief vor ihm, aber wenn jemand seine Verdienste rühmte, wandte er sich kopfschüttelnd vor Staunen ab und begann meist von seiner schweren Jugend oder von seinem Onkel zu sprechen, eigentlich dem Onkel meiner Mutter, der ungeheuer reich sein und dessen Macht und Einfluß alles übersteigen sollte.
Ich war für mein Alter sehr groß, immer der Stärkste in der Klasse der ›Au-Schule‹. Ich habe mich schon damals nach einem Freund gesehnt, habe aber nie jemanden dazu finden können. Wahrscheinlich war ich es selbst, der die Annäherung der Klassenkameraden nicht richtig aufnahm, und zwar aus einer sicherlich bei manchen Kindern, die keine Geschwister haben, häufigen Ursache: ich fürchtete mich vor den Fremden. Sie fürchteten sich aber noch viel mehr vor mir, vor meiner Körperstärke, vor meinem schweigsamen Wesen. Hätten sie gewußt, daß ich in besonderem Maße schmerzempfindlich war, daß mich ein hartes Wort ebenso verwundete wie ein kleiner Riß in meiner Haut, was alles sie gar nicht spürten, so hätten sie sich mir vielleicht leichter genähert. Ich konnte niemanden leiden sehen, nicht Mensch, nicht Tier, aber ich habe selten geweint.
Die Schule befand sich am Ende einer ziemlich breiten Straße, am Au-Park. Die eine Front ging auf den Park hinaus, oder vielmehr auf die hohe Mauer, die ihn umgab. Von der Straße konnte man im Winter bei Schulbeginn vom Park nichts anderes sehen als die Gipfel der Bäume, Eichen, Platanen, Ahorne, Buchen. Wenn ich aber zum Beispiel im ersten Winter von meiner grasgrünen Schulbank aus dem von Gasflammen erleuchteten Schulsaal heimlich hinaussah, zeichneten sich die schwarzen schweren Zweige unter ihrer handhohen Schicht von Schnee gegen den Dämmerdunst zuerst nur undeutlich ab. Die Gasflammen summten behaglich, der weiße Kachelofen strömte Wärme aus, und die Tannenzapfen, unter das Holz und die Kohle gemischt, krachten lustig. Die Flächen der Landkarten und Tierabbildungen leuchteten hell. Gegen neun oder zehn Uhr wurde das Gaslicht verlöscht, die Landkarten hörten auf zu spiegeln, um zehn Uhr lüftete man, frische Luft drang ein. Die Sonne war kupferrot aufgegangen. Der Dunst im Park hob sich, durch die klar gewordenen Scheiben sah ich, am Fenster stehend, den Rockkragen aufgeschlagen, die Hände in den Taschen, die mit Rauhreif besetzten Gebüsche an den Wegen, den zinkfarbenen, mit schütterem Schnee bedeckten Eislaufplatz, die große Wiese, die Au in der Mitte des Parkes, die Tennisplätze, von hohen Netzen umgeben, ganz verlassen. Bald öffnete sich die Tür, und der lustige Tumult der Schule verstummte, bevor der Lehrer die Tür hinter sich geschlossen hatte.
Unweit dieses Parkes befand sich die Kaserne des dritten schweren Reiterregimentes. Wenn wir nun mit krummem Rücken dahockten, den Kopf über unser Heft gebeugt, schläfrig vor Hitze und Langeweile, und still unsere Arbeiten niederschrieben, tönte plötzlich in verschiedenartig schnellendem Takt rhythmisch und klar der Klang der trabenden oder galoppierenden Pferde zu uns herüber. Wie oft war es meine (verbotene) Lust nach der Schule, an eine dicke hölzerne, aufgerauhte Barriere gelehnt, dem Reitdienst der Rekruten zuzusehen und die Peitsche des Sergeanten knallen zu hören. Bisweilen kam ein Soldat auf mich zu, in einer gelblichweißen Zwilchjacke trotz der Kälte, auf dem kahlgeschorenen Kopf eine tellerartige schirmlose Mütze, unter dem Arm ein dickes, hell eingestäubtes knusperiges Kommißbrot, das er gegen Tabak umtauschen oder sehr billig verkaufen wollte. Aber ich hatte leider weder Geld noch Tabak. Mit Bedauern sah ich, wie der Kürassier es mit seinen schweren Händen auseinanderbrach und die Stücke eines nach dem anderen den Pferden geschickt und ohne die geringste Angst verfütterte, welche es gnädig entgegennahmen. Ich weiß eigentlich nicht, warum dieses Brot solche Gier in mir erweckte. Ich bekam ja daheim alles, was sich ein vernünftiges Kind wünschen kann. Eines Tages mußte ein Soldat in meinen Augen diesen brennenden Wunsch nach dem Brot bemerkt haben, er trat sporenklirrend zu mir und hielt mir ein ziemlich großes Stück als Geschenk entgegen. Noch viel später erinnerte ich mich des merkwürdig beizenden Geruches nach Leder und Gerberlohe, den er um sich hatte.
Ich nahm es, aber ich aß es nicht. Eben hatte ich mir etwas Bestimmtes vorgenommen, und dies mußte ich durchführen. Ich nahm meinen Mut zusammen, ging ein kleines Stück an der Barriere, dann an der Umfassungsmauer der Kaserne entlang und kam zu den Schildwachen, von denen nur die eine, die auf der rechten Seite, mich wahrgenommen hatte. Auf ihren Zuruf antwortete ich, ich müsse einen kranken Unteroffizierssohn, der in der Kaserne wohne, besuchen. Ich schlüpfte in den Eingang der Kaserne, kam in den Hof. Schon sah ich ein paar Gäule, drei glaube ich, die, mit den Zügeln einer an den anderen angebunden dastanden, und auf die harte staubige Erde klopften und mit den langen Schweifen um sich schlugen. Ich gab, eisig vor Angst, aber brennend vor Entzücken und Glück, meinen Willen durchgesetzt, meinen Mut bewiesen zu haben, dem mir zunächst stehenden Pferde ein Stück des Brotes. Sei es, daß meine Hand trotz alledem zu sehr zitterte, sei es, daß das Pferd diese Kruste nicht richtig aufnahm, sondern vielmehr fortstieß, das Brot fiel herab. Ich, jetzt einer gewissen Gefahr gruselnd bewußt, bückte mich trotz allem danach. Das Blut war mir aber so stark zu Kopf gestiegen, daß ich das Brot unter den vielen unruhigen Hufen nicht sah. Die Pferde, die vor der Mittagsfütterung standen und schon deshalb unruhig waren und welche die Stallordonnanz auf einen Augenblick allein gelassen hatte, waren militärfromm. Sie stutzten, sie lauschten auf ein Trompetensignal hin. Sie rissen eines am anderen, ich hörte, wie die Zügel knirschten. Ich konnte nicht auf, ich wand mich, immer noch am Boden, zwischen den zwölf Pferdebeinen hindurch, fand das Brot und war schon gerettet und hatte mich deshalb aufgerichtet, als ein Pferd – ich glaube, es war dasselbe, dem ich den Leckerbissen zuerst zugedacht hatte –, dem Trompetensignal nur zu gehorsam, mich mit dem Huf trat. Es war der erste wahrhaft ungeheure Schmerz meines Lebens. Ich hörte mich aufstöhnen und versank in Ohnmacht, aber nicht in Schmerzlosigkeit, ich war meiner Sinne nicht mehr mächtig und doch ganz wach in grauenhafter Pein. Zum Glück war der Huf an meinem Schultornister, ein dickes Lineal zersplitternd, abgeglitten. Ich fand mich wieder in einer Mannschaftsstube, bis zur Atemlosigkeit heulend vor Schmerz, den Tornister unter dem Kopf, unter den Füßen eine Pferdedecke. Der Schmerz brannte im Rücken, ich konnte nicht atmen und mußte doch schreien. Sonst hätte ich sterben müssen, fühlte ich. Die Soldaten standen herum, die meisten sahen nachdenklich und mißmutig auf mich hin. Einer beugte sich über mich und fragte mich. Sprechen konnte ich nicht. In meinen Büchern stand meine Adresse, ich wies mit der Hand auf den Schulranzen, verlegen nahm ihn ein Kürassier mir unter dem Kopf fort, blätterte ein Buch auf und las silbenweise wie ein Schulkind meinen Namen und meine Adresse vor. Plötzlich standen sie alle stramm, der Arzt trat ein und ließ sie rühren. Die Gesichter der Soldaten, die wie in der Kirche feierlich erstarrt waren, lösten sich. Sie hoben mich jetzt auf. Ich stöhnte, es wurde mir schwarz vor den Augen. Aber ich wurde nicht wieder ohnmächtig, wie ich es erhofft hatte.
Der Militärarzt muß meine Verletzung als nicht lebensgefährlich betrachtet haben, sonst hätte er mich bei sich in seinem kleinen Lazarett behalten, statt mich in einem kleinen Regimentswagen unter Obhut eines schnauzbärtigen Unteroffiziers heimbringen zu lassen.
Während er mich befühlt und abgehorcht hatte, hatte mich plötzlich eine Art Vernichtungsgefühl befallen. Als ein ganz junger Mensch begriff ich den Tod sowenig, daß ich an alles eher dachte, als daß es meine letzte Minute sein könnte. Vielleicht war dazu der Schmerz zu beklemmend, zu zerreißend, zu erstickend. Bei jedem Atemzuge brach er wie ein Blitz meine rechte Seite durch. Versuchte ich den Atem anzuhalten, wurde es gelinder, aber wenn ich, um dem Ersticken zu entgehen, die Lungen weit mit Luft füllen mußte, war der frische, gleichsam selbstverschuldete Schmerz noch unerträglicher. Auch das Stöhnen und Keuchen verschärfte ihn, so zwang ich mich zu einem verbissenen Schweigen und erntete den achtungsvollen Blick des Arztes, der mir etwas von einem ›jungen Spartaner‹ zumurmelte.
Vielleicht wäre die Qual während der Heimfahrt in seiner Gesellschaft leichter zu ertragen gewesen, da er doch als Arzt Anteil an mir genommen und als Mann mich durch seine Achtung für die Selbstbeherrschung belohnt hatte. Dem Unteroffizier lag nur daran, mich möglichst schnell daheim abzuliefern. Ich faßte, als der Wagen gar zu schnell über die Kopfsteine unseres Straßenpflasters rollte, nach seiner Hand, aber er muß mich wohl mißverstanden haben, denn er eiferte den peitschenknallenden Kürassier auf dem Bocke zu noch größerer Eile an, vielleicht auch aus Angst, ich könne im Wagen sterben, und das Regiment könne Unannehmlichkeiten durch diesen Unglücksfall bekommen.
In mir stieg eine furchtbare Wut auf. Ich dachte daran, wie ich durch Gutmütigkeit in diese furchtbare Lage gekommen war, ich schäumte vor Zorn – im wahren Sinne des Wortes – bei dem Gedanken an das ›undankbare Roß‹, das meine Freundlichkeit mit einem plumpen Tritt belohnt hatte. Ich lag auf der linken Seite, weil mir so das Atmen leichter wurde, gerade auf dieser Seite stak aber mein Taschentuch im Rock, und als ich mich etwas aufrichtete, um es hervorzuholen und den Speichel vom Mund abzuwischen, kam von neuem das Vernichtungsgefühl, ein würgender schauerlicher Ekel, über mich, und ich versank wieder ins Dunkel.
Als es klarer wurde (ich dachte plötzlich an die Bäume der ›Au‹, die mit der aufgehenden Sonne klarer geworden waren), sah ich, daß der Wagen zwar in unserer Straße war, daß er aber über unser Haus hinausgefahren war. Mit welcher Mühe überzeugte ich den stupiden Soldaten, daß er sich in der Hausnummer geirrt habe und daß ich besser wissen müsse, wo ich wohnte. Jedes Wort war ein Stich, und ich brauchte viele. Endlich hielten wir vor dem Hause. Er nahm mich auf den Arm, murrte über mein Gewicht und schleppte mich so ungeschickt die Treppen hinauf, daß meine Füße nachschleiften. Erst als wir vor dem Eingang standen, kam mir in den Sinn, wie sehr meine Mutter erschrecken würde.
Ich hatte also meinen klaren Sinn nicht verloren, ich überlegte scharf, wie ich vorhin, in dem Untersuchungszimmer, alles scharf gesehen und belauscht hatte.
Nun war meine Mutter sehr zart. Ich hoffte, nicht sie, sondern die Magd oder mein Vater würde öffnen. Aber sie war es. Als sie mich erblickte, schrie sie leise auf und sank zusammen, mit dem Kopf voran, mitten durch die Tür, so daß ihr Haupt mit den schönen, dichten, schwarzen Haaren auf den Fußabstreifer mit der Aufschrift Willkommen niederfiel. Der blöde Kürassier mit mir auf dem Arm hätte sich nicht zu helfen gewußt. Zum Glück war mein Vater da. Er begriff sofort die Lage. Er half meiner Mutter auf, führte sie in ihr Zimmer und sagte ihr, ich sei nicht in Gefahr. Sie antwortete ihm nicht. Mich ließ er in mein Zimmer tragen. Er war es, der mich vorsichtig auf mein Lager ausstreckte. Im Vorübergehen hatte er der Magd gesagt, sie solle bei meiner Mutter bleiben und sie nicht aus ihrem Zimmer lassen. Aber nach zwei oder drei Minuten kam meine Mutter dennoch, schwankend am Arm der Magd, zu uns und setzte sich auf mein Bett. Sie zog mir zuerst die Schuhe aus, dann die Kleider. Sie tat es so zart, daß sie meine Schmerzen nicht erhöhte. Ich hatte keinen Verband, blutete nicht. Da sie mein Hemd nicht wechselte, sah sie die zerquetschte Seite nicht. Sie schüttelte den Kopf: ich sollte nicht reden. Sie hüstelte und hielt mir meine beiden Hände fest, als wolle ich entfliehen. Mein Vater war fortgeeilt, um unserem Hausarzt zu telefonieren. Er kam in Kürze zurück, der Arzt war daheim gewesen und mußte sehr bald hier sein. Dann zog er den Unteroffizier ins Nebenzimmer, und beide fingen an zu rauchen, während der Schnauzbärtige meinem Vater eine ungenaue Darstellung des Unfalls gab. Er war kein Augenzeuge gewesen. Meine Mutter weinte nun stärker, und mein Bett bebte. Ich tat ihr sehr leid, sie überschüttete mich mit Koseworten, wie sie sie in meiner zartesten Kindheit angewandt hatte, sie streichelte mich, wollte mich bequemer lagern, bot mir alles mögliche an. Sie glaubte mir damit den Schmerz zu erleichtern, aber das Gegenteil trat ein: ich begann, mich selbst zu bemitleiden, und das Herz krampfte sich mir noch mehr in der wunden Brust zusammen, wenn ich daran dachte, was für ein armes, unglückliches Kind ich sei. Es tat mir wohl, als der nüchterne, nach Medizin riechende, in einen speckigen Gehrock gekleidete jüdische Arzt erschien, der mich im Augenblick nur flüchtig untersuchte und mir einige Fragen stellte, zuerst die, ob ich schon Wasser gelassen hätte, und zweitens, ob ich Blut gespuckt hätte. Ich schüttelte den Kopf. Er bestand darauf, daß ich meine Notdurft verrichtete. Meine Mutter bat er zu gehen, und er war mir behilflich. Er riet mir zu Geduld und ging in das Nebenzimmer, wo er ihnen allen Bericht erstattete. Bald darauf traten alle wieder bei mir ein, sprachen durcheinander, beengten den schmalen Raum, nahmen mir die Luft. Alle waren irgendwie mit meinem Unglück abgefunden und freuten sich, daß es nicht ärger gekommen war. Mein Vater und der Unteroffizier rauchten. Ich konnte nicht verstehen, daß niemand daran dachte (meine Mutter ausgenommen, die mir nutzlose Umschläge auf die Stirn machte), daß ich einen solchen Schmerz nicht auf die Dauer ertragen konnte. Aber sie dachten eben doch nicht daran.
Ich beschreibe diesen Nachmittag, diesen Abend, diese Nacht nicht. Nachzufühlen ist eine solche Lage nur von dem, der etwas Ähnliches erlebt hat. Tröstende Worte empören nur und helfen nichts. Meine Mutter muß es begriffen haben. Nie hat eine Hand leichter auf einer wehen Brust geruht als die ihre, als sie gegen Morgengrauen einschlief. Bloß wenn sie im Schlummer hustete, drückte sie fester. Aber ich ertrug es noch, ebenso wie alles bisherige, so verzweifelt ich auch war. Und sowenig ich mir vorher einen solchen Schmerz hätte vorstellen können, so wenig konnte ich mir jetzt vorstellen, er könnte jemals ein Ende haben. Dabei schien er immer noch nicht seine letzte Furchtbarkeit erreicht zu haben, und manchmal stach mich ein Kitzel von der Art, wie man ihn hat, bevor man niest.
Solange ich wach war, hatte ich genügend Kraft, um diesem schauerlichen Kitzel zu widerstehen. Der Arzt hatte mich gewarnt, ich solle möglichst wenig husten oder laut sprechen und mich ja nicht im Bett herumwerfen. Damals – es waren noch keine fünfzehn Stunden seither vergangen, und doch schien es mir ein anderes Leben zu sein, das nie mehr wiederkam, so schön! – hatte ich diese Warnung noch nicht recht verstanden. Warum sollte ich husten? Warum sollte ich mich im Bett unnötig bewegen? Aber in der Morgendämmerung, als meine Mutter, in dem alten Ohrenstuhl zusammengesunken, sich immer tiefer in friedlichen Schlaf hineinatmete, beide Hände, die zarten mit den blauen Adern, im Schoße, da trieb es mich mit aller Gewalt, der Versuchung nachzugeben.
Besonders reizte es mich, meine Lage zu verändern. Ich lag auf der rechten Seite, also auf den fünf gebrochenen Rippen, auf den gequetschten Muskeln. Wenn ich mich ganz allmählich unter Anwendung von tausenderlei Listen umdrehte und mich auf die gesunde Seite legte, bekam ich sofort weniger Luft. Nun probierte ich es auf dem Rücken. Aber dann machte die kranke Seite, die frei mitatmete und sich bewegte, solche Schmerzen, daß ich ins Kissen biß. Also zurück auf die rechte Seite. Nach dieser großen Anstrengung brach mir der Schweiß aus, es überkam mich eine große Müdigkeit, es war mir, als würde ich zu einem ganz kleinen Kind. Ich gab mir nach, ich schlummerte ein. Ich weiß nicht, wovon ich träumte. Plötzlich brach durch den wohltuenden, langsam sich abspielenden alten Traum ein neuer von furchtbarer Grauenhaftigkeit ein. Ich spürte, wie mich jemand mit einem scharfen, spitzigen Messer kitzelte, es durchzuckte mich wie ein brennendes Feuer, ich warf mich lachend vor unbegreiflichem Entsetzen empor, und das Messer ging mir durch und durch. Ich sehe es noch vor mir, es war wie ein Messer, das man zum Schinkenschneiden nimmt, doppelseitig geschliffen, dünn und sehr glatt und lang. Ich erwachte. Ich saß aufrecht, die Kissen lagen verstreut auf dem Teppich. An den Fenstern war es schon dämmerig, der Rest des Zimmers war dunkel. Meine Mutter war fort, ich schrie laut um Hilfe, und während ich noch schrie, merkte ich, wie mir etwas Bittersalziges die Kehle hochstieg. Ich klammerte mich an die Messingstäbe des Bettes und rüttelte daran. Meine Mutter stürzte mit einem brennenden Licht herein, halbentkleidet, bloßfüßig, die Haare aufgelöst, in langen Locken um die bloße Schulter. Sie umarmte mich mit ihren noch vom Waschen nassen Armen und zog das Nachthemd an ihren Hals in die Höhe. Meine Augenlider lagen an ihrem lauwarmen glatten Hals, und ich fühlte bei ihr die Adern pochen. Plötzlich drang das Bittere, Salzige durch die Lippen, und ich konnte nicht widerstehen, und an den gestickten Säumen ihres Nachthemdes blieb das Entsetzliche haften, schaumiges hellrotes Blut. Seltsamerweise war mir auch jetzt der Gedanke an den Tod fern. Ihr nicht. Sie machte sich, sobald sie die Blutflecken wahrgenommen hatte, sanft, aber energisch, von mir los, lief zu meinem Vater und hieß ihn, sofort den Geistlichen mit den Sakramenten und nachher den Arzt holen. Ich hörte, wie er aus dem krachenden Bette aufstand, wie er mit den Kleidern raschelte, mit den Schuhen knarrte. Das Blut kam mir alle Augenblicke in den Mund. Meine Mutter war wieder bei mir. Als gläubiger Katholikin war ihr mein ewiges Seelenheil wichtiger als mein Leben. Was konnte sie Besseres für mich tun, als mich in ihren Armen halten, beten und Gelübde tun? Sie verlangte nicht von mir, daß ich in der Stunde des Todes hörbar mitbete. Im Gegenteil, sie sagte, ich solle ruhig bleiben, sie drückte mich mit sanfter Gewalt in eine liegende Stellung zurück, baute die Kissen in meinem Rücken auf, ohne ihr Gebet zu unterbrechen, holte einige ihrer kleinen nach Vanille duftenden Taschentücher, tupfte mir den Schweiß von der Stirn, das Blut vom Mund, die Tränen von den Augen. Sie tat mit leiser Stimme das Gelübde, zur Hl. Mutter Gottes von Altötting zu pilgern, wenn es aufhören wolle, zu bluten und mich zu peinigen.
Es wäre mir wohler gewesen, wäre sie ruhig gewesen und hätte sie mich wieder aufsetzen und mich fest an den Stäben des Bettes anhalten lassen. Denn jetzt kam etwas Neues über mich: vielleicht nenne ich es am besten das Zermalmende. Es hatte eigentlich mit dem früheren Schmerz nichts zu tun, es ähnelte am ehesten dem Augenblick, als der Huf des Pferdes, von dem Schulranzen niedergleitend, das Schullineal unter Krachen zerbrechend, mir die rechte Seite zerschlagen hatte, also dem ersten Augenblick.
Vielleicht hat dies eine viertel oder halbe Stunde gedauert, ich konnte es nicht ermessen. Ohne daß ich bemerkt hatte, daß ich fortgewesen, war ich wieder bei mir, als der Arzt eintrat. Mein Vater führte mit meiner Mutter ein hastiges Gespräch. Er, der viel weniger fromm und katholisch war als meine Mutter, war noch nicht beim Geistlichen gewesen, er wollte zuerst den Bescheid und die Hilfeleistung des Arztes abwarten. Dieser hörte sich mein Stöhnen nicht lange an. Er legte mir seinen Zeigefinger, der nach Mandelseife roch, quer über meine Lippen, wie um mich zum Schweigen zu mahnen, jetzt holte er aus den Schößen seines speckigen Salonrockes ein mit violettem Samt gefüttertes Futteral mit einer kleinen Nickelspritze und einem Fläschchen mit Äther, dessen Geruch mich zu neuem furchtbarem Husten reizte, und aus einer anderen Tasche ein anderes Fläschchen, auf dem das Wort Morphium und ein Totenkopf mit zwei gekreuzten Schienbeinen sich befanden. Mich überkam es aber angesichts dieser Todesinsignien eher wie ein Trost. Mir war alles gleich, wenn es nur hinter mir lag. Ich fühlte mich in seiner Gegenwart leichter als vorhin, und wenn man in solcher Lage von Frohsein sprechen kann, war ich froh, daß er und nicht der geistliche Herr als erster mir zur Hilfe kam. Der Arzt hatte mir den Ärmel des Nachthemdes hochgestreift, die Haut mit Äther gereinigt, das Morphium aufgezogen und einen Strahl der Flüssigkeit aus der kleinen Nickelspritze emporsteigen lassen, dann stach er mich geschickt in den Arm und zog die Nadel eine Sekunde nachher wieder zurück. Jetzt setzte er sich zu mir, sah zum Fenster hinaus, mit angespannten Zügen, schweigend, übernächtigt. Er gähnte hinter seiner mageren feinen Hand.
Mich überkam ein sonderbares Gefühl der Milderung. Nicht daß die Schmerzen mit einem Schlag verschwunden wären. Im Gegenteil, sie dauerten weiter und sollten, wenn auch vermindert, noch sehr lange bleiben, aber über dem Schmerz lag wie ein Verband mit guter Salbe diese Beruhigung, dieser Schleier, diese Milde, dieses Schweigen, dieses Gähnen, das Hellerwerden im Zimmer. Meine Mutter trat ein, im Gesicht hochrote Flecken, in einem dunklen Kleid. Sie staunte sehr über die schnelle Verwandlung, die sie mir sofort ansah. Sie konnte nicht begreifen, daß der kleine, unscheinbare Arzt soviel vermocht hatte. Der Arzt zog die Uhr, hielt sie an sein Ohr, um zu sehen, ob sie noch ging, er zählte mir den Puls. Das Zimmer war nun sehr hell, war aber mir ganz fremd, ich sah alles klar, aber wie von weitem. Ich war hier und fuhr gleichzeitig über eine Brücke. Ich merkte, wie sie zusammen sprachen, verstand sie aber nicht mehr. Jemand wischte mir die Feuchtigkeit vom Mund. Das Tuch blieb weiß, also mußte es Winter sein.
Diese ›Wunderkur‹ ist mir unvergeßbar geworden, vielleicht hat sie mich bestimmt, den Beruf eines Arztes zu ergreifen. Die Brücken meines Vaters hatten mich kalt gelassen. Das Militärswesen, das mich früher sehr gelockt hatte, war mir verhaßt. Die Wunderkur leuchtete mir ein.
An der Person des Arztes, des braven Doktor Kaiser, lag es nicht, eher im Gegenteil. Meine Eltern ließen ihn zwar immer sofort kommen, wenn er notwendig war, aber sie nannten ihn ein notwendiges Übel. Manchmal waren sie in ihrer Geringschätzung sogar so weit gegangen, nach seinem Fortgehen die Fenster aufzumachen und den Raum zu lüften. Nicht etwa, weil der Arzt einen unangenehmen Geruch verbreitete, sondern weil er Jude war. Meiner Mutter war jeder Jude ›zuwider‹, obwohl sie nur wenige kannte und von keinem etwas wirklich Tadelnswertes wußte. Es war vielleicht ihre katholische Erziehung, denn sie ›mochte‹ die Lutheraner ebensowenig, die sie für ganz ›abgefeimt‹ hielt.
Es gab in unserer Stadt aber noch einen zweiten Doktor Kaiser, einen sehr mageren, hochgewachsenen, stolzen, reichen Mann, der sich hier ein großes, abgeschlossenes Nerven- und Irrensanatorium und außerdem in S., einem kleinen Ort an einem schönen langgestreckten See, wo wir ein Holzhäuschen mit kleinem Obstgarten besaßen, eine prachtvolle, aus Marmor gebaute Villa mit Spiegelscheiben und einer Terrasse aufs Wasser hinaus gebaut hatte. Man sah ihn in der Stadt fast nie zu Fuß, er fuhr meist in einem mit zwei Apfelschimmeln bespannten Wagen, mit einem seiner Kinder auf dem Rücksitz, neben sich aber eine schöne junge Frau. Später gehörte er zu den ersten Besitzern eines Automobils.
Während man unseren Hausarzt den Judenkaiser nannte, zog man vor dem anderen, dem Hofrat und Irrenarzt, zwar ehrerbietig den Hut, gab ihm aber spöttisch den Spitznamen Narrenkaiser.
In den kommenden Tagen, während derer ich noch oft fieberte und sehr abmagerte, konnte ich viel über die ›Übermacht‹ eines Arztes nachdenken. Wenn schon dem unscheinbaren dicklichen Judenkaiser eine solche Gewalt zustand, wie unermeßlich mochte dann erst die Macht des Narrenkaisers sein.
Es blieb nämlich nicht bei jener plötzlichen Zauberwirkung der Medizin aus der Totenkopfflasche. Wenn ich nachher noch so sehr von Schmerzen und Atemnot geplagt war, der Judenkaiser brauchte nichts zu tun, er brauchte nur mein Zimmer zu betreten – und ich atmete auf, im wahrsten Sinne des Wortes, und die Lungenstiche waren wie fortgeblasen.
Schmerzempfindlichkeit war stets mein wundester Punkt. Meine Schulkameraden hätten es nie geglaubt. Ich aber wußte es nur zu gut. Es gibt ein sehr naheliegendes Mittel, sich Schmerzen zu entziehen, zum Beispiel bei den Kämpfen der Jugend unter sich, die sehr grausam geführt werden und wo jede Träne, jedes Greinen als große Schande gilt. Dieses Mittel besteht in Feigheit. Ich war etwas feig, das war der Grund, weshalb ich mich, sooft es nur ging, von den Spielen ausgeschlossen habe. Spielen und sich bekriegen ist bei Knaben fast das gleiche. Meine Kameraden sahen nur, daß ich sehr groß war für mein Alter, daß ich harte Muskeln und wenig Fett und starke knochige Hände, ›Pratzen‹, hatte. Sie konnten sich nicht vorstellen, daß in einem so kraftvollen Körper eine so schmerzempfindliche Natur hauste. Und nicht allein meine eigenen Schmerzen, auch das, was anderen weh tat, was ich zum Unterschied von den Schmerzen Leiden nannte – mir war es nicht gegeben, es ruhig anzusehen, es ging mir nahe, die Tränen kamen mir ›grausam‹ hoch, und ich schämte mich.
Vielleicht wäre alles anders gewesen, hätte ich Geschwister gehabt. Wir würden uns gegenseitig abgehärtet haben und wären lustig gewesen. Meine Mutter, so zart sie war, sprach zwar oft, unter Husten lachend und unter Lachen hustend, davon, daß sie mir nicht ein Geschwisterchen, sondern mit einem Schlag deren zwei oder drei, Zwillinge oder Drillinge, ›bescheren‹ würde, mein Vater mochte es nicht hören und fand es ›unbescheiden‹, daß sie klüger sein wollte als der liebe Gott, der es zum Glück für ihre zarte Gesundheit bei einem einzigen Kind belassen hatte. Nun war wieder meine Mutter böse, errötete mit zirkelförmigen Flecken auf den Wangen und hieß den Vater schweigen, da sich solche Reden nicht für meine Ohren eigneten. Als ich nun so lange ans Bett genagelt war, brach eine Regung in mir durch, die mir neu war und die mir eine Art Genugtuung oder einen Ersatz für die verlorenen Knabenfreuden gewährte, nämlich der Wille, über die Großen zu herrschen, meinen Willen bei den Übermächtigen durchzusetzen. Ich begann beim Arzt. Er tat mir wohl. Solange er neben mir saß, hob sich meine Brust leichter, meine Schmerzen waren geschwunden. Er untersuchte mich oft und eingehend, denn das Fieber, das zwar nicht hoch war, aber nicht weichen wollte, machte ihn besorgt. Er fand aber nichts Bedrohliches, und nach fünf oder zehn Minuten wollte er wieder gehen. Es gibt keine List, die ich nicht anwandte, um ihm entgegenzuarbeiten und ihn immer noch eine Minute länger zurückzuhalten. Ich brachte, als er meine ungeschickten Manöver durchschaute, zuerst meine Mutter, dann meinen Vater dazu, den Arzt zu längerem Bleiben zu bewegen. Man verdoppelte das Honorar, brachte das Gespräch auf irgend etwas Interessantes, und manchmal gelang es ihnen wirklich, den Judenkaiser dazu zu bringen, seinen in allen Farben schillernden schwarzen Filzhut noch einmal auf den messingenen Fenstergriff zu hängen, die Rockschöße seines speckigen Gehrockes auseinanderzubreiten und sich zu mir an das Bett zu setzen. Es mag sein, daß er dann wichtige andere Patienten warten ließ. Möglicherweise verursachte mir auch dies eine Genugtuung.
Nachts schlief ich unruhig, oft schwitzte ich, und mein Vater, der mehr Vertrauen zum Arzt hatte als meine Mutter, die alles gern der Mutter Gottes überließ, die ihr immer bei ihrer ›schwachen Brust‹ geholfen hatte, drängte den Arzt zu energischeren Maßregeln.
Dies kam dem Judenkaiser sehr gelegen. Eines Tages brachte er allerhand Geräte in einem abgeschabten Handköfferchen mit. Er entnahm ihm eine Spritze, die aber bedeutend größer war und bedrohlicher aussah als jene, mit welcher er die Wunderkur getan hatte. »Bist du auch ein tapferer kleiner Kerl?« fragte er mich, mir wie damals den Finger auf den Mund legend. Ich ahnte nichts Gutes. Ich dachte an den tapferen kleinen Spartaner des Arztes in der Kaserne.
Übrigens ging von meinem Abenteuer eine ganz falsche Berichterstattung um. Ich hatte in der Tat den Pferden Brot geben wollen. Keineswegs hatte ich sie etwa durch Schläge mit dem dicken Lineal gereizt, wie der falsche Augenzeuge, jener Unteroffizier, es meinen Eltern berichtet hatte. Ich hatte es nicht aus Güte, nicht aus Mitleid mit den vollgefressenen, prallen, schwergliedrigen Pferden getan. Ich hatte nur meine Feigheit besiegen, meinen Mut auf die Probe stellen wollen, denn ich hatte, wie viele Stadtkinder, Angst vor Pferden – und besonders vor den Hufen und Zähnen dieser Tiere. Ich hatte die Probe bestanden, aber teuer bezahlt. Sollte es damit nicht genug gewesen sein?
Jetzt bereute ich, daß ich den Arzt so oft aufgehalten hatte, daß ich, der kleine, hilflose, bettlägerige Junge, ihn zu beherrschen versucht hatte. Aber was half es? Ich biß die Zähne zusammen. Ich hielt den Atem an. Dieses Atemanhalten ist für mich immer ein schmerzverhütendes oder schmerzlinderndes Mittel gewesen. Hätte der Arzt nur sofort mutig zugestochen! Er suchte aber lange die beste Einstichstelle, tastete vorsichtig hin und her, klopfte und horchte und kitzelte mich grausam. Es war dann höchste Zeit, daß er mit der dicken Hohlnadel mir zwischen die Rippen fuhr. Kein Schmerzenslaut kam mir über die Lippen. In der folgenden Nacht schlief ich nicht. Ich hielt mich für einen seltenen, für einen ungewöhnlichen Menschen, über den der Schmerz nichts vermag.
Ich habe vergessen zu berichten, daß mir der Judenkaiser vorgeschlagen hatte, mir einen kleinen Ätherrausch zu geben, wenn ich glaubte, den Eingriff nicht aushalten zu können, aber das unverständliche Wort Ätherrausch hatte mich mehr erschreckt als der Gedanke an Schmerzen. Ich hatte mich stark gemacht und war stark gewesen.
Mit diesem kleinen schmerzhaften Eingriff, den der Arzt am nächsten Tage als ›prächtig gelungene Rippenfellpunktion‹ bezeichnete, war mir sehr geholfen. Das Fieber sank mit einem Schlage wie fortgezaubert, zum Entzücken meiner Mutter, die dem Arzt als Extrahonorar an diesem Tage aus ihrem Wirtschaftsgelde ein goldenes Zwanzigmarkstück verehrte, das dieser schwitzend und errötend – es war an jenem Tage sehr heiß – einsteckte. Er kam nicht mehr so oft zu mir. Zwei Tage danach durfte ich zum erstenmal aufstehen, und bald kam ich auf die Straße und in die Schule und wurde sehr bewundert.
Ich war stolz auf meine Heilung. Ich sah zwar bei näherer Überlegung ein, die Punktion, die aus der Entfernung von etwas trüber, gelblichroter Flüssigkeit aus dem Brustraum bestanden hatte, wäre auch dann gelungen, wenn ich mich weniger tapfer gehalten hätte. Aber ich hatte mich gehalten. Ich hatte nicht gemuckst. Ich hatte also doppelten Mut bewiesen, zum ersten, als ich mich in die Gefahr begeben hatte, von einem Rudel wilder Pferde (so sah ich es jetzt) zerstampft zu werden, und dann, indem ich die Schmerzen, die ungewöhnlich groß waren, mit ungewöhnlicher Seelenruhe und Selbstbeherrschung auf mich nahm. Ich sagte mir immer wieder vor: Ich kann, wenn ich will. Ich strahlte in meinem Innern vor Freude und Stolz. In der Tat war jetzt auch mein Schülerehrgeiz erwacht. Ich, der bis dahin ein träger, bequemer Schüler gewesen war, stürzte mich über die Bücher, und ohne daß mich jemand mahnen mußte (mein Vater staunte sehr), holte ich das in diesen Monaten Versäumte bis zur letzten Lektion nach. Auch das ein Grund des Stolzes.
Der Arzt hatte mich liebgewonnen. Jetzt brauchte ich ihn aber nicht mehr. Er kam ab und zu, setzte sich zu mir an den Tisch und unterhielt sich mit mir. Ich erfuhr, daß er seine Frau verloren hatte und daß er mit seiner Tochter Viktoria lebe. Ich stellte mir dieses Geschöpf als ein ältliches vertrocknetes Mädchen vor. Eines Tages, kurz vor Beginn der Sommerferien, kam ich am Mädchenlyzeum vorbei. Vor dem Tore wartete der Judenkaiser, seine abgeschabte Instrumententasche unter dem Arm, statt in den alten Gehrock in ein etwas verwaschenes hellblaues Lüsterjackett gekleidet. Als die Schulglocke ausgeläutet hatte, eilte ein bildschönes, schlankes, honigblondes junges Mädchen in weißem, fußfreiem Strickereikleide auf ihn zu. Er nahm ihr ein Blatt aus der Hand und strahlte dabei vor Stolz und Freude. Es war seine Tochter, die an diesem Tage die Schlußprüfung im Lyzeum mit glänzenden Noten bestanden hatte.
Meiner Mutter hatte ich mich während meiner Krankheit Herz an Herz angeschlossen. Ich hatte sie immer geliebt. Jetzt wußte ich es mit klarer Überlegung. Ich hatte mich während der Krankheit sehr verändert, sie aber auch. Nicht, daß sie jetzt von Zärtlichkeiten und Koseworten übergeströmt wäre, aber sie tat etwas, was sie bis jetzt immer vermieden hatte: sie begann sich für mich zu schmücken. Sie kaufte das Schönste, was sie bekommen konnte, ihr Sinn stand auf einmal nach kostbarem Schmuck, und sie stellte sich manchmal, leise hüstelnd, vor das Schaufenster eines Juweliers, und ihre überaus glänzenden schwarzkirschfarbigen Augen wanderten von den ausgestellten Broschen und Armbändern zu einer zweireihigen Perlenkette und zurück. Ihr Arm, der sich in meinen schlang, als suche sie Schutz, begann leicht zu zittern, nur mit Widerstreben ging sie fort. Ich liebte sie nicht wie etwas Fremdes, wie eine zweite Person, sondern ich liebte sie, wie ich mich selbst liebte. Ich und sie gingen ohne Unterbrechung ineinander über. Ich sah sie und fühlte sie bei mir, selbst wenn ich allein war. Das machte mich aber nicht träumerisch und weich, im Gegenteil, es machte mich kühn, meiner selbst sicher. Der während meiner ›Leiden und Schmerzen‹ erwachte Trieb zum Herrschen war nach meiner Heilung nicht schwächer geworden, aber ich versuchte diesen Trieb nicht an ihr, so wie ich es manchmal (bisweilen mit Erfolg, bisweilen auch nicht) mit meinem Vater tat. Wir waren zu sehr eins, sie und ich.
Die Ferienzeit stand nahe bevor, mein Vater dachte natürlich daran, daß wir nach S. gehen würden. Mir wäre dies am angenehmsten gewesen, und auch der Arzt war dafür. Meine Mutter aber hatte andere Pläne. Sie hatte, während ich in Gefahr war, ein Gelübde getan, nämlich nach Altötting zu pilgern, und dieses Gelübde wollte sie erfüllen. Ich sollte sie begleiten. Es wurden alljährlich, meist im Herbst, nach der Ernte, große Prozessionen zu dem wundertätigen Muttergottesbild unternommen, wobei besonders Bauernfrauen, die schwarzseidenen Röcke hochgeschürzt, in pechschwarzen Strohhüten mit herabwallenden schmalen Bändern über den knochigen, sonnengebräunten Gesichtern, alt und jung, reich und arm nebeneinander, in Reih und Glied durch den Straßenstaub wateten, dem voranschreitenden Geistlichen seine Litaneien im Chor nachsingend und ihre Rosenkränze fromm abrollend. Unmittelbar hinter dem Geistlichen zog manchmal auch eine kleine Zahl von Stadtfrauen und ehrbar gekleideten, meist älteren Herren einher. Zu ihnen hätte sich meine Mutter gesellen können. Sie würde sich diese Anstrengung wohl zugetraut haben, aber nicht mir. In Wahrheit aber war sie jetzt schon viel schwächer und anfälliger als ich. Sie kam auf den Gedanken, einen Wagen zu mieten und jeden Tag nur eine gewisse Strecke zu Fuß zu pilgern. Wenn ich dann nicht mehr weiterkonnte, sollte die Kutsche uns weiterbefördern. Meinem Vater verschwieg sie diesen Plan. Wir besprachen uns heimlich, während er schon schlief.
Da es aber dann fast ununterbrochen geregnet hat, sind wir nur wenig zu Fuß gegangen. Trotzdem kam meine Mutter gänzlich erschöpft und zähneklappernd vor Fieber im Wallfahrtsorte an. Die meisten Gasthöfe waren besetzt, endlich fanden wir ein kleines Kämmerchen. Diesmal war ich es, der an ihrem Bette wachte. Ich konnte meinen Blick nicht von ihr abwenden. So schön war sie. Manchmal sah sie in ihrem Fieberglanz jünger und bezaubernder aus als die honigblonde Viktoria.
Ich betete nie für mich. Für sie tat ich es. Nach zwei Tagen Fieberfrost und -hitze stand sie plötzlich vergnügt auf, machte sich ohne Mühsal auf die letzte Partie des Wallfahrtsweges, einen steil ansteigenden Weg, an welchem die Leidensstationen des Heilandes in bunten Holzbildern angezeigt waren. Abends fasteten wir, am nächsten Tag empfingen wir die Sakramente, liefen dann aus Angst, den Zug zu verpassen, zum Bahnhof und fuhren nach S., wo uns der Vater, diesmal ganz unbescheiden lachend, bereits erwartete, Blumen in der Hand. Meine Mutter blieb aber etwas ernst. Es begann leise zu regnen, und das Dach unseres Häuschens, mit dicken Steinen oben belastet, glänzte.
Während der ersten Tage gab es fast ununterbrochen Regen. Ich schlief jetzt viel und aß für drei. Das Schwimmen war mir untersagt worden, ich litt also nicht so unter dem schlechten Wetter, als wenn ich ins Wasser gedurft hätte. Meine Mutter war still, sie sorgte sich um mich. Ich strahlte jetzt vor Gesundheit und Freude am Leben. Ich hätte Bäume ausreißen, in einem Rennen, ohne anzuhalten, um den ganzen See herumlaufen, mich von einer Bergwiese, den Kopf zwischen den Schultern, die Arme um die Knie, zu einem Knäuel zusammengerollt, herabkugeln lassen mögen. Meine Mutter hatte Geduld mit mir. Viel Geduld, ja.
Aber war es der Aufenthalt in dem kleinen Orte am Ende des Sees, den sie niemals sehr geliebt hat, war es die Langeweile, das Fehlen ihrer gewohnten Beschäftigung im Haus oder der Umstand, daß sie jetzt nicht mehr gar so viel für mich tun konnte, sie war nicht mehr die alte. In ihren glänzenden, neuen, glatten Kleidern saß sie mißmutig am Fenster, hustete und sah fröstelnd hinaus. Ich bin niemals sehr gesprächig gewesen. Jetzt, wo ich es versuchte, erzielte ich nichts. Meine Mutter strich mir mit zerstreutem Gesichtsausdruck zart über mein Haar und entschloß sich dann zu einem gedrückten Lächeln. Oft besah sie sich im Spiegel. Es kam mir beinahe vor, als hätte sie begonnen, sich Mühe zu geben, weniger zu lachen, weniger zu husten, weniger zu sprechen. Wenn ich sie in meiner kindlichen Art, sicherlich ohne das rechte Geschick dazu, aufheitern wollte, verzerrten sich sogar ihre sonst so sanften Züge. Oft schien es mir, als reize es sie unten in der Brust oder oben in der Kehle zum Husten, sie griff sich dann an den Mund, als wollte sie sich Stillesein gebieten.
Mein Vater machte trotz des ungünstigen Wetters kleine Bergtouren und kehrte abends in seinen von Nässe geradezu dampfenden Lodenkleidern, aber in bester Laune zurück, den Tirolerhut mit einer seltenen Blume geschmückt, wie sie dort in den Höhen zu finden ist. Meine Mutter nahm seine Küsse geduldig entgegen. Nachher aber sah ich, wie sie sich den Mund mit einem ihrer kleinen Batiststücher abtrocknete, wobei sie einen besonders starken Hustenreiz nur mit großer Anstrengung überwand. Ich dachte, sie wische sich die Lippen ab, weil der Mund, der Bart meines Vaters vom Regen so feucht gewesen War. Erst später verstand ich es. Übrigens wiederholte sich dies nicht mehr oft. Am nächsten Tage brach nach einem nebligen Morgen die Sonne durch, bald senkten sich die Nebel, wie immer, wenn sich das Wetter bessert, die See schlug kräftige blaugraue Wellen, hier und dort silbrig aufblitzend, der Wind zog herb und stark, und nachmittags war es bereits so trocken, daß wir den Kaffee im Freien trinken konnten unter einem der verwilderten Apfelbäume, die schon voller winziger, steinharter, giftgrüner Früchte steckten, die niemals reif und süß werden sollten; das heißt, reif wurden sie auf ihre Art, genießbar aber nie, und selbst die Hausfrauenkünste meiner Mutter, die aus ihnen unter Zugabe von Unmassen Zucker eine Art Mus bereiten wollte, sind daran gescheitert. Ich blieb diesen schönen Tag bei ihr, obwohl es mich natürlich sehr lockte, in den Ort, an den See, in den Wald oder zum Moor zu laufen. Es war eigentlich einerlei, wohin ich rannte. Es pochte mir in allen Adern vor Lebensfreude und Übermut. Ich war monatelang ans Bett gefesselt gewesen, jetzt war ich ganz gesund, bloß eine dicke, aber schmerzlose harte Anschwellung auf der rechten Seite des Rückens zeigte die Stelle an, wo mich das Pferd getreten hatte. Auch den nächsten Tag verbrachte ich bei meiner Mutter, von ihrer Blässe und Müdigkeit beunruhigt. Wir spannten gemeinsam eine alte, schon etwas löchrige Hängematte an knarrenden Hanfseilen zwischen einem der besagten Apfelbäume und einem uralten Birnbaum aus, der überhaupt nichts mehr trug.
Wir gaben uns Mühe, die Mahnungen meines Vaters zu befolgen und die Rinden durch die Seile nicht zu schädigen. Meine Mutter bettete sich, so gut sie konnte. Da aber die eine Seite der Hängematte etwas herabglitt und ihr Kopf recht tief lag, holte ich, während sie in unruhigem Schlummer lag, aus ihrem Schlafzimmer ein Kissen. Als ich die Bettdecke abgehoben und die Kissen aufgenommen hatte, fiel mir ein zerknäultes Batisttüchelchen in die Hände. Es zeigte rostrote Blutspuren. Ich hatte sofort erfaßt, was es war, und das Zermalmende kam wieder über mich.
Ich wollte meiner Mutter nicht zeigen, daß ich wußte, warum sie so verändert war. Ich machte Ordnung in ihren schneeweißen glatten Kissen und Decken, so gut, daß sie am Abend nicht merkte, daß jemand sich mit dem Bett zu schaffen gemacht hatte. Ich kehrte ohne Kissen zu ihr zurück. Sie war bereits wieder wach und schien mir ungeduldig. Ich versuchte nun nicht mehr, etwas aus ihr herauszulocken, was sie, doch sicher nur aus Liebe zu mir, so beharrlich mir verschwieg. Sie hatte Angst um ihr Leben. Sie war immer schon schwach auf der Lunge gewesen, und die Aufregung um mich hatte ihr geschadet. Ich ging sogar weiter. Als sie mich bedrängte, ich solle die schöne Zeit ausnützen und schwimmen gehen (sie hatte im Augenblick vergessen, daß es mir verboten war), gab ich ihr nach und tat, als könne ich mich vor Freude nicht lassen. Das war es, was sie gewollt hatte. Sie wollte allein sein, vielleicht hielt sie vollständige Ruhe und frommes Beten für die beste Hilfe.
Mein Vater machte sich damals den Spaß, rudern zu lernen. Natürlich konnte er von jeher einen gewöhnlichen Kahn mit oder ohne Rollsitz rudern. Was ihn reizte, war, einen der plumpen, viele Meter langen flachen Holzkähne der Fischer zu rudern, was vom Heck aus mit einem flachen Holzscheit geschieht, das man in eine drehende Bewegung versetzt, wobei sich der Ruderknecht mit dem ganzen Gewicht seines Körpers hineinlegen muß. Anfangs kam mein Vater, sehr zum gutmütigen Spott der Fischer und der jungen Mädchen am Ufer, nicht von der Stelle, ja, der Kahn, den man dort die ›Plätte‹ nennt, kam zurück. Da er aber sehr kräftig und geschickt war, erfaßte er bald die Kunst und brachte eines Abends meine Mutter dazu (es war ihr Namenstag), sich in die mit einem an Drähten hängenden Lampion geschmückte Fischerplätte zu setzen und sich, mit mir zu ihren Füßen, bis nach der kleinen Stadt T. rudern zu lassen. Ich hatte Angst, die feuchte Luft des Sees könne ihr schaden, aber merkwürdigerweise schien sie sich schon besser zu fühlen, sie hüstelte fast gar nicht mehr. Der ernste, verschlossene Ausdruck ihres bisher so kindlichen Gesichtes war nicht geschwunden, er paßte nicht gut zu dem sehr schönen neuen Seidenkleide und der schmalen goldenen Brosche, die meine Mutter zur Feier des Tages trug. Mein Vater sang auf der Heimfahrt, ich und sie blieben still. Bald nachher tat sie die neuen Kleider in die Truhe und trug sie nicht mehr.
Am nächsten Tage lockte es mich in das Moor. Das Ende des Sees bestand aus immer flacher werdenden Kieselgründen, die mit Schilf bewachsen waren und um die das dicke Dampfschiff in weitem Bogen herumfuhr. Landeinwärts, jenseits der um den See führenden breiten Fahrstraße, begann eine ganz andere Landschaft, nicht festes Land, aber auch nicht Wasser, eines ging ins andere über. Einige kleine fischreiche, aber grundlose, gefährliche Seen, die Osterseen genannt, glänzten in fahlem, mattem Grün. Es führten schmale Fußwege durch das Gelände, in dem sich weit und breit keine Hütte befand. Erst am Rande, dort, wo es wieder bergan ging, standen ein paar elende Baracken der Torfstecher. Alles war hier anders als am Seeufer, die Pflanzen üppiger, die Vögel schreckhafter, mit bunterem Gefieder und von unbekannten Arten, die Schmetterlinge größer, aber, wie mir schien, weniger scheu. Auch die Luft zitterte hier in der Sommerhitze anders als über den Wiesen, den Feldern, dem freien Wasser. Ich versuchte, einen Falter mit saphirfarbenen Flügeln, der sehr träge schien, zu fangen. Ich zog ihm nach, oft über weiche Stellen oder kleine Rinnsale springend. Eine alte Holzstange mit einem vermodernden Heubündel zeigte hier und da, eigentlich selten genug, Gefahr an. Mich lockte der unter meinen Füßen federnde Grund. Ich bekam endlich mit Geduld und List den Schmetterling unter meinen Hut. Dann aber dachte ich daran, daß ich ihn rauh anpacken müßte, wenn ich ihn behalten wollte, und fand ihn zu schade. Er flatterte unbeirrt davon, die edelsteinfarbenen Flügel lautlos entfaltend. Als ich zum Weg zurückwollte, war plötzlich rings um mich alles Moor. Vom Ort her hörte man in der großen Einsamkeit und Stille die mir wohlbekannten Töne der