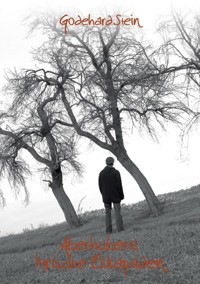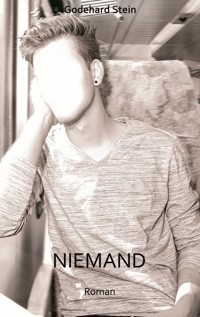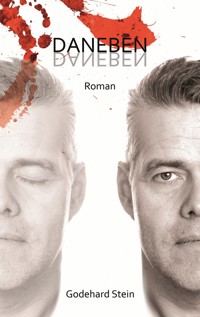
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Es gibt Tage, die einfach nur daneben sind. Für Paul ist heute so ein Tag, der einige unangenehme Überraschungen bereit hält - und jede Menge Leichen! Und schließlich stellt er fest, dass am Ende noch lange nicht alles vorbei ist. Pauls Geschichte ist todernst - allerdings wohl nur für ihn selbst. Jeder andere bekommt ein Schmunzeln zurück, mit Grinsen und Grinsesgrinsen!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Out of our heads
Out of our minds
Out of this world
We’re out of this time
Bush
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
1
Mein Name ist Paul Martini – und glauben Sie mir, dass ich den Witz schon kenne. Ich kenne sie alle, die flapsigen Bemerkungen über „geschüttelt“ und „gerührt“, die Sprüche über die Olive und so weiter. Und kommen Sie mir bloß nicht mit James Bond! Lustig finde ich diese Zoten schon lange nicht mehr. Genaugenommen ist mir seit einiger Zeit das Lachen gänzlich vergangen. Was ich Ihnen hier erzähle, ist eine unglaubliche Geschichte, so seltsam, so absurd, so wahnwitzig, dass ich sie mir selbst nicht abnehmen würde, wenn ich nicht zufällig hautnah dabei gewesen wäre. Präzise ausgedrückt saß ich nicht nur in der Loge, nicht nur in der ersten Reihe, sondern noch ein Stückchen weiter vorn: In der Hauptrolle! Und ehrlich gesagt wohl auch in der Scheiße – pardon, aber manche Dinge müssen eben in aller Deutlichkeit ausgesprochen werden.
Ich möchte mir die größte Mühe geben, alles haargenau so zu berichten, wie es sich zugetragen hat. Tatsächlich stelle ich fest, dass diese unglaubliche Geschichte nur dadurch überhaupt ansatzweise begreifbar wird. Machen Sie sich also besser nichts daraus, wenn manches ein wenig verworren klingt. Das liegt, so hoffe ich inständig, nicht an meinem Geisteszustand.
Einige der Ereignisse sind nun schon eine ganze Weile her, aber an die meisten Dinge erinnere ich mich, als wären sie gerade gestern passiert (und auf manche davon trifft das sogar zu!). Genaugenommen ist es sogar so: Wann immer ich – freiwillig oder nicht – darüber nachdenke, muss ich einsehen, dass die Zeit letztendlich überhaupt keine Rolle spielt. Ein einzelner Gedanke löst eine Kaskade von Erinnerungen aus und jeder verdammte Tag läuft vor mir ab wie ein überlanger Kinofilm – und glauben Sie mir, davon habe ich genügend gesehen! Um diese Flut einzudämmen, erscheint es mir am Sinnvollsten, die Ereignisse von Anfang bis Ende aufzuschreiben; Sie werden das ganz gewiss nachvollziehen können.
Damit ich richtig verstanden werde: Es geht mir nicht um Mitleid! Damit kann ich wirklich nichts anfangen, es bringt mich schließlich keinen Deut weiter. Auch erwarte ich keinesfalls Verständnis für meine Handlungen, die ich nur ehrlich und möglichst präzise wiedergeben möchte. Ich bin, wie ich bin – nehmen Sie das ruhig schon mal hin!
Worum es mit geht ist etwas gänzlich anderes, das werden Sie schon bald nachvollziehen können. Bitte verschaffen Sie sich doch einfach einen eigenen Eindruck der Geschehnisse. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild von dem, was mir widerfahren ist – auch wenn die Farbpalette eher düster ausgewählt werden muss. An mancher Stelle, so nehme ich an, wird es Ihnen ähnlich gehen wie mir: Sie erleben Überraschung, Verzweiflung, Angst, Abscheu und vieles mehr so, als wären Sie dabei gewesen.
Ich nehme Sie gerne mit auf eine Pauschalreise in meinen Kopf, bei der Sie durch meine Augen sehen werden, mit meinen Händen fühlen und mit meinem Verstand begreifen – auch wenn ich letzteren bereits verloren glaubte. Es wird eine phantastische Reise mit allem, was dazu gehört – all inclusive, würde ich sagen.
Der Fairness halber möchte ich Sie warnen: Wenn Sie diese wahnwitzige Achterbahnfahrt mit mir antreten, könnte es sein, dass sich Ihr Leben grundlegend, um nicht zu sagen radikal bis ultimativ, verändern wird. Es wäre denkbar, dass nichts mehr ist, wie es einmal war. Es ist sogar gut möglich, dass Ihr ganzes Sein, genau wie das meine, nicht nur auf den Kopf gestellt, sondern noch ordentlich durcheinander gewirbelt wurde. Und wenn Sie so richtiges Pech haben, wenn gerade Ihr Wagen aus den Gleisen springt, wenn Sie im freien Fall beschleunigt mit aller Wucht auf den harten Asphalt prallen, dann stehen Sie wohlmöglich am Ende genau dort, wo ich mich gerade befinde.
Ich wünsche Ihnen, dass es nicht so kommen wird, auch wenn gerade ich letztendlich keinen Anlass zur Hoffnung habe. Es grenzt allein schon an ein Wunder, dass Sie diese Zeilen überhaupt in Händen halten können – wenn es denn wirklich ihre Hände sind! Sie sollten sich sicherheitshalber fragen, ob Sie die Grenzen des Seins nicht vielleicht doch schon überschritten haben. Sollte es aber aus irgendeinem Grund anders sein, sollten Sie nicht genauso daneben sein wie ich, dann erzählen Sie bitte allen, die Sie kennen, von mir. Vielleicht hilft es irgendjemandem. Und, wer weiß, vielleicht hilft es am Ende auch mir.
Aber nun lassen Sie mich ganz von vorn beginnen…
2
Es gibt Tage, an denen man am liebsten nicht aufwachen würde.
Damit sind deutlich mehr gemeint als nur diejenigen, die einer schlimmen Nacht mit triefenden Nasen und bellendem Husten, mit Fieber und Schüttelfrost, mit Darmkrämpfen und endlosen Stunden in der „Keramikabteilung“ folgen. In der Rangliste ganz weit vorne stehen Tage, deren grau-trübe herein blinzelndes Licht Kälte, Nässe und andere meteorologische Unannehmlichkeiten verheißt. Auch gern genannt werden solche, an denen ein unausweichlicher Abschied, eine wirklich menschenunwürdige Prüfung oder das scheinbar doch unvermeidliche Gespräch mit dem cholerischen Chef wegen der vielen Raucherpausen bevorsteht – besonders wenn man Nichtraucher ist.
Aber es gibt auch Tage, die all dies bei weitem übertreffen. Leider wird das den meisten Menschen erst retrospektiv klar – und dann ist es längst zu spät.
Als ein einzelner, verirrter Sonnenstrahl meine Nase traf und sie seiner Materielosigkeit zum Trotz kitzelte, überkamen mich in genau dieser Reihenfolge die nachstehenden Eindrücke: Da war zunächst ein heftiger Kopfschmerz, wie von glühenden Nägeln, die nicht schnell und heftig, sondern durch langsame, kraftlose Schläge nur millimeterweise in meinen Schädel getrieben wurden. Ihm folgte eine Übelkeit, die mit allen bekannten Formen der See-, Luft- oder andersartiger Reisekrankheit gewiss konkurrieren konnte, und zwar mit allen gleichzeitig. Der beißende Geruch von Erbrochenem sorgte dafür, dass die beiden ersten Eindrücke sich verbündeten, um mir den Rest zu geben.
Mühsam öffnete ich die tonnenschweren Lider meiner gequälten Augen, geblendet von der höhnischen Sonne, die mich auf diese Reise durch die Torturen geschickt hatte. Meine Arme fühlten sich an wie aus Gummi, aber ich überwand die Kraftlosigkeit, als ich bemerkte, dass mein Gesicht in einer dunklen Lache aus dem lag, was vielleicht einmal das gestrige Abendessen gewesen sein mochte. Irgendwie stützte ich meine Hände auf und wollte mich gerade hochstemmen, als eine gewaltige Explosion zwischen meinen Schulterblättern mich niederstreckte und in gnädige Dunkelheit sinken ließ.
Ich weiß nicht, wie lange ich dort tatsächlich gelegen habe, aber dem Licht des nächsten Augenblicks nach zu urteilen müssen es einige Stunden gewesen sein. Die Sonne, die mich so frech geweckt hatte, schien längst nicht mehr durch das Fenster des Schlafzimmers, als hätte sie das Interesse an ihrem Opfer verloren, gerade so wie ein vollgefressener Kojote. Der Wecker neben dem Bett entzog sich meinem Blick. Ich bemühte mich, vorsichtig ein wenig höher zu rücken, aber dieses hinterhältige Gerät schien sich immer weiter hinter dem Kopfkissengebirge zu verstecken.
Jede Bewegung erzeugte neue Schmerzattacken in meinem Rücken – längst nicht so schlimm wie beim ersten Anlauf, aber doch stark genug um eindringlich vor abrupten Manövern zu warnen. Irgendwie gelang es mir, mich halb rollend, halb gleitend, neben das Bett zu setzen, auf dem ich scheinbar in voller Bekleidung genächtigt hatte. Mein Mund fühlte sich an wie ein nasser Rauhaardackel und schmeckte auch so. Unter einem dumpf dröhnenden Schädelfirmament schifften meine Gedanken durch die zähe Masse der Erinnerungslosigkeit und stießen dabei immer wieder gegen die schwankenden Eisberge des Brechreizes. Mit unendlicher Mühe und einigen Schmerzlauten, die bestimmt die halbe Nachbarschaft auf den Plan rufen würden, schaffte ich es auf meine wackligen Beine und irgendwie ins Badezimmer, wo mir kaltes Wasser in Gesicht und Magen ein wenig zu Bewusstsein verhalf.
Der Spiegel verheißt normalerweise ein wohltuend vertrautes Gesicht in allen erdenklichen Lebenslagen. In dieser Situation jedoch war es der dümmste Gedanke, sich am Waschtisch abzustützen, um einen Blick zu erhaschen, denn der Schmerz zwischen meinen Schulterblättern schaltete umgehend das Licht aus, was eine nähere Betrachtung meiner selbst verhinderte, und spielte erneut den Übelkeitstrumpf aus. Das Wasser, welches eben noch erlösende Erfrischung gebracht hatte, fand den Weg zurück und ergoss sich mit den kläglichen Resten des Mageninhalts auf den Waschtisch. Bitterer Gallengeschmack füllte Mund und Rachen.
Wahrscheinlich gingen wieder eher Stunden als Minuten ins Land, bis ich halbwegs zur Besinnung kam. Das war der Zeitpunkt für eine erste vorsichtige Bestandsaufnahme meiner Situation, die sich folgendermaßen darstellte: Ich war ein absolutes Wrack, das mit höllischen Schmerzen in seiner eigenen Kotze aufgewacht war und nicht die leiseste Erinnerung hatte, was vor diesem Morgen oder dem Zeitpunkt des ersten Erwachens geschehen war. Ob ich von einem Bus angefahren wurde oder im falschen Fanblock Witze über den Star der falschen Mannschaft gemacht hatte, konnte ich nicht sagen. Rein gefühlsmäßig waren beide Situationen denkbar – da mochte man sich kaum entscheiden.
Soweit ich das mit möglichst wenigen Bewegungen feststellen konnte, war meine Kleidung zwar verknittert, aber im Großen und Ganzen nicht von der unangenehmen Schlafunterlage in Mitleidenschaft gezogen worden. Auf Hemd und Sakko konnte ich keinerlei Flecken entdecken – zumindest nicht von der Brust bis zum Hosenbund. Lediglich meine Schuhe – ich hatte auch sie scheinbar die ganze Nacht über getragen – wirkten sehnsüchtig nach einem Putzlappen, der sie von einer Schicht grauen Staubs befreien sollte, aber in meiner Situation war das gewiss das geringste Übel.
Nach mehreren vergeblichen Versuchen gelangte ich erneut auf die zittrigen Beine und schlurfte mit Ächzen und gebeugtem Rücken vom Badezimmer durch den kleinen Flur in Richtung der Wohnungstür. Sie stand einen Spalt breit offen, aber das konnte mich genauso wenig überraschen wie die blasse Fratze, die mich aus dem Garderobenspiegel anstarrte. Inzwischen war ich versucht zu glauben, dass der Vorabend in einem Übermaß alkoholisch gewesen sein müsste. Und was hilft da besser, als frische Luft? Nun ja, vermutlich ziemlich viele Dinge, die einem Mediziner oder einem zumindest klar denkenden Menschen eingefallen wären, aber da ich mich zu dem Zeitpunkt zu keiner der beiden Gruppen rechnen konnte (zur ersten im Übrigen überhaupt nicht), schien mir ein langsamer Gang nach unten und vor die Haustür eine großartige Idee zu sein.
Ich schätze ich habe die vierzig Treppenstufen über die zwei Etagen hinab bis ins Erdgeschoss mit der durchschnittlichen Geschwindigkeit eines Gletschers überwunden. Bei jedem Schritt pochten meine Schläfen und anfangs zuckte jedes Mal ein Schmerzfeuerwerk durch meinen Rücken, wenn ich mich zu sehr auf dem Handlauf abstützte. Aber auch in diesem Zustand ist ein Mensch scheinbar lernfähig, denn irgendwann konnte ich diesen heimtückischen Attacken tatsächlich aus dem Weg gehen. Und während ich gefühlte Äonen später die letzten Stufen herab kraxelte, konnte ich sogar schon Verwunderung dafür aufbringen, dass ich noch keine Kommentare aus einer der anderen Wohnungstüren vernommen hatte. Manchmal muss man eben auch Glück haben, dachte ich.
Glück ist relativ. Das spürte ich bei dem Versuch, die plötzlich unwahrscheinlich schwere Haustür aufzuziehen. Mit einem Paukenschlag meldeten sich meine Schulterblätter zurück und verkündeten, dass sie diese Missachtung ihrer zuvor eindringlich dargelegten Beschwerden nicht einfach so tolerieren konnten. Schmerzkaskaden durchzuckten mich. Wieder wurde mir übel, schwarz vor Augen – doch dann umgab mich endlich eine frische Brise und ich sog die Luft ein, als wäre sie pure Energie. Die Tür schwang mit einem Mal spielend leicht und völlig lautlos auf. Ich trat hinaus auf die Straße. Ein kleiner Schritt für die Menschheit, aber ein verdammt großer für mich, in Anbetracht meines desolaten Zustands.
Die Sonne hatte bereits beschlossen, sich hinter einer hohen Häuserreihe zu verkriechen, was mir nur recht war, denn meine Augen hatten schon genug Probleme mit dem vorhandenen Restlicht. Der Blick auf die Uhr an meinem Handgelenk war wenig aussagekräftig, weil die Ziffern und Zeiger zu einer verschwommenen Masse zerflossen. Ich schlurfte ein paar zaghafte Schritte an der Hauswand entlang und fühlte endlich neue Kraft in mir. Genug, um den Kopf zu heben und mich endlich einmal wieder richtig zu wundern: Die Straße war völlig menschenleer wie eine Kirche an einem gewöhnlichen Montagmorgen. Und nicht nur das! Es herrschte absolute Stille, abgesehen von dem irrsinnigen Rauschen meines Blutes in den Ohren. Kein Fahrzeuglärm, kein Vogelgezwitscher, kein Klappern, Brummen, Klingeln, Summen.
Ich bin taub, überkam es mich mit erschreckend klarer Einsicht. Vor Verblüffung musste ich schlucken, was wiederum dazu führte, dass mich ein Hustenreiz übermannte und ich keuchend an die Hauswand gelehnt nach Luft rang. Bellende Laute drangen aus meinem Mund – die eindeutig hörbar waren, vermutlich sogar meilenweit. Auf der Gedankenliste der größten Sorgen des Tages konnte ich zumindest die Taubheit streichen, musste aber umgehend einige Einträge hinzufügen: Warum ist es so still? Wieso ist um diese Uhrzeit kein Mensch auf der Straße? Und woher bekomme ich einen starken Kaffee oder einen Drink oder vorzugsweise beides?
Der leichte Wind rauschte sanft durch die Blätter der einsamen Straßenbäume. Es blieb das einzige, kleine Geräusch in diesem grandiosen Stillleben und ich beschloss, meine Sorgenliste von hinten aufzurollen. Das behutsame Abtasten meines Jacketts verriet mir, dass ich meine Geldbörse (und meine Schlüssel, an die ich zuvor überhaupt nicht gedacht hatte) bei mir trug. Nur zwei Straßen entfernt war mein Stammlokal, wo man mir sicher ein paar Muntermacher und mit etwas Glück auch einige Informationen zu meinem gestrigen Absturz geben konnte. Vielleicht hatte mein alter Freund Mark, der den Laden schon unmittelbar nach unserer gemeinsamen Schulzeit übernommen hatte, sogar ein Aspirin für mich. Oder am besten eine ganze Packung.
Gedankenverloren schleppte ich mich weiter. Meine Füße betrachtend in der Hoffnung, so keinen falschen Schritt zu machen, näherte ich mich langsam meinem Ziel. Dabei dachte ich darüber nach, was mich zu meinem jetzigen Dasein gebracht hatte. Es ist immer schön, wenn man im größten Elend ein Ventil für Wut und Frust besitzt, und dankenswerterweise erfüllte meine Ex-Frau diese Funktion mit einer Perfektion, die ihres gleichen sucht.
3
„Soll ich die Zwiebeln schneiden?“, fragte Johannes in seiner unnachahmlichen Art, dem Unsinn ein Wortgewand zu verleihen. Kaum eine überflüssige Frage, die er nicht treffsicher fand.
„Nein“, antwortete ich mit einem Schmunzeln, „ich denke wir werfen sie heute einfach mal so in den Topf, das ist haute cuisine!“
Fast rechnete ich damit, dass dieser unglaublich flache Sketch noch fortgesetzt würde. Leider (oder glücklicherweise) unterbrach das Klingeln des Handys die Situationskomik. Das Display zeigte, dass SIE schon wieder anrief (womit sich die Frage des Glücks erledigt hatte). Wie unterhaltsam muss die lang ersehnte Shopping Tour zweier Freundinnen sein, wenn man alle paar Minuten zuhause anrufen wollte? Mir ging diese ständige Kontrolle auf die Nerven, zumal wir uns schon seit Monaten kaum mehr etwas zu sagen hatten.
„Was gibt’s?“, entfuhr es mir sofort verächtlich und unter Vermeidung jeglicher Begrüßungsfloskeln.
„Habt ihr wenigstens schon angefangen mit dem Kochen?“ schnatterte es harsch aus dem Gerät. „Wir haben gleich alle Geschäfte durch und kommen zurück. Dann gibt’s hoffentlich was.“
Es war unglaublich! Nicht nur, dass der Abend eigentlich als ‚gemeinsames Kochen mit Freunden‘ geplant war und wie immer darauf hinaus lief, dass einer der Freunde mit mir kochte, während SIE sich vermeintlich vergnügte (was nebenbei bemerkt auch besser so war, denn ihre Kochkünste beschränkten sich auf Trennkost: Schon ihre angebrannten Fischstäbchen waren eindeutig ein Scheidungsgrund!) – SIE konnte jegliche Vorfreude mit wenigen Worten im Keim ersticken. Am liebsten hätte ich ihr gewünscht, ein Forschungsprojekt zur Trägheit der Masse am Beispiel eines heranrasenden LKW durchzuführen. Seit fast zehn Jahren ertrug ich nun ihre seltsame Art, die von Herzlichkeit und Liebenswürdigkeit ungefähr so weit entfernt war wie ein Kohlebergwerk von strahlendem Sonnenschein. Hätte ich mir nicht ein Schutzschild von stählernem Stoismus zugelegt, wäre ich vermutlich geplatzt. Vielleicht hätte ein früherer Ausbruch auch alles vereinfacht, aber manchmal ist man erst hinterher wirklich schlauer.
„Alles klar“, entgegnete ich ruhig und legte auf. Was nutzte es, sich im Sturm nassregnen zu lassen, wenn man genauso gut im Haus bleiben konnte?
In der Küche klapperte es und eine männliche Stimme brummte einen gebetsmühlenartigen Singsang mit dem Thema ‚Wo ist das Olivenöl?‘.
„T minus 40 Minuten“, rief ich, warf das Telefon auf den Esstisch und machte mich widerwillig an die weitere Arbeit. Es war längst kein Spaß mehr, diese private Kochshow zu veranstalten, wenn im Grunde genommen nur ein Kandidat dabei war. Und üblicherweise hatte SIE schon vor dem Dessert so viel unsachliche Kritik hervorgebracht, dass der Pudding giftgrüne Blasen warf.
Ich ging kurz in den Garten, um einige frische Kräuter zu schneiden. Die Luft tat gut und löschte einige der glühenden Gedanken. Durch das Fenster konnte ich einen Blick in die Küche erhaschen. Johannes war zwischenzeitlich über die Zwiebelphase hinaus zum Bratvorgang gelangt und stand an der brutzelnden Pfanne. Alles im Zeitplan, dachte ich und hoffte auf weitere Konfliktvermeidung. Aber wie so oft irrte ich mich.
Als eine knappe dreiviertel Stunde später das Auto vorfuhr, stand der erste Gang eines köstlichen Menüs mexikanisch inspirierter Speisen auf dem Tisch. Britta, die damalige Partnerin von Johannes und beste Freundin des Hausdrachens, stieß einige Jauchzer freudiger Erwartung aus. SIE dagegen zeigte schon beim ersten Blick auf die gedeckte Tafel eine Miene, als habe sie auf etwas unglaublich Bitteres gebissen. Vielleicht war ihr Einkaufsbummel suboptimal verlaufen, was bedeuten konnte, dass sie nicht die hundertste Sweat-Jacke gefunden hatte oder die internationalen Mode-Label weiterhin an der Verschwörung gegen ihre Figur arbeiteten. Möglich war auch, dass die ungefähr 30 Kilometer auf der Autobahn zu viel für ihr zartes Gemüt waren – auch wenn Britta (wie immer) fahren musste, weil SIE schon beim Ausparken des Wagens einen halben Herzinfarkt bekam. Denkbar war auch, dass ihre Galle explodiert war und ihren Körper nun mit Verdauungssäften überspülte, obwohl sie das eher grün und wahrscheinlich viel süßer als gewöhnlich gemacht hätte.
„Wassndasschonwiederwersolldasessenistbestimmtwie dermalvielzuscharfaberaufmichnimmtjakeinerrücksicht“
Eines musste man ihr lassen: Im Apnoe-Sprechen würde SIE gewiss weltmeisterliche Leistungen bringen. Natürlich vorausgesetzt, dass irgendjemand dies verfolgen konnte, ohne dabei zu einer rasenden Bestie zu mutieren.
Natürlich hätte ich diese Reaktion vorhersagen können, und das ganz ohne Kristallkugel oder Karten – obwohl ich auch solchen Hokuspokus bereits zur Genüge erlebt hatte. Das Einzige, was mir noch mehr auf den Wecker ging als IHR Gezeter über das Essen war IHR übertriebener Hang zu Aberglauben und Übernatürlichem. Und damit ist nicht etwa IHRE Neigung für stereotype Fernsehserien à la Akte X gemeint, in denen eine Bande übergeschnappter Drehbuchautoren gesammelte Alpträume und Verschwörungstheorien hundertfach auszupressen versuchten wie Saft aus ausgelutschten Früchten. Viel schlimmer noch: Ständig sprach SIE davon, was IHR eine Wahrsagerin prophezeit hätte und dass SIE überhaupt schon immer alles vorher wusste. Beispiele dafür konnte ich zu Hauf benennen. Ob es IHR Geburtstag war, an dem SIE schon vorher wusste, dass die große Überraschung ein gewaltiger Flop sein würde, ob es das Weihnachtsessen der Familie war, bei dem SIE natürlich im Vorfeld schon erahnen konnte, dass es wieder Streit geben würde, insbesondere, wenn SIE der Auslöser war. Und mit höchster Wahrscheinlichkeit war IHR den ganzen Tag bereits klar gewesen, dass das Abendessen eine Katastrophe werden würde.
Eben jenes Essen wartete auf uns, aber SIE stapfte erbost die Treppe hinauf und knallte demonstrativ mit der Schlafzimmertür. Britta und Johannes starrten mich an, während ich mich setzte und in meine Fajita biss, ungefähr so beinundruckt wie Peter Jackson über den 17. Oscar für seinen „Herrn der Ringe“. In Sachen Wutausbruch war ich längst kein Neuling mehr und hätte für meine schauspielerische Leistung in diesem Low-Budget-Katastrophenfilm mindestens einen Grammy verdient gehabt. Der moralische Druck im Raum stieg auf geschätzte zwanzig Atmosphären. Immerhin war ansatzweise Verständnis und Mitleid in den Blicken meiner Gegenüber zu erkennen, aber schließlich ließ ich den Maisfladen fallen und schlich ebenfalls nach oben.
„Komm bitte zum Essen“, bat ich SIE und zuckte präventiv zusammen, als ihre Reaktion in Form weiterer Tiraden und bedrohlicher Gesten losbrach. Nicht, dass ich ansatzweise wiedergeben könnte, was sie gesagt hat – mit den Jahren hatte mein Gehör einen interessanten Filter entwickelt. Dies war nicht nur reine Konfliktvermeidung, sondern fast schon ein Überlebenstrieb. Ein Therapeut hätte vermutlich geraten, dass man viel früher über die zwischenmenschlichen Probleme hätte reden sollen, es ist aber durchaus begründet anzunehmen, dass ein psychologisch geschulter Fachmann, der ja professionell ruhig bleibt, nach einem fünfminütigen „Gespräch“ mit ihr unweigerlich suizide Tendenzen entwickelt hätte.
Es fehlten leider Zeugen, die berichten könnten, was genau der Auslöser für das Folgende war, aber irgendwann in diesem recht einseitigen Disput versagten meine Schutzmechanismen. Alle aufgestaute Wut, die gesammelte Frustration der vergangenen Jahre, vielleicht auch der geballte Zorn gegen mich selbst, entlud sich in einem einzigen, nur fünf Worte umfassenden Satz.
„Ich liebe dich nicht mehr“, sagte ich ruhig und stellte im selben Augenblick in Frage, ob ich das jemals getan hatte.
4
Dieses Etablissement ein „Café“ zu nennen war ungefähr so treffend, wie Gallensaft zur Delikatesse zu erklären. Alle schönen, angenehmen, verlockenden, romantischen, gustatorischen, olfaktorischen oder auch einfach nur naheliegenden Gedanken, die man mit dieser Bezeichnung verbinden konnte, verkrochen sich beim bloßen äußeren Anblick des Gebäudes in einer möglichst weit abgelegenen Gehirnwindung, um dort einsam an Verzweiflung zu sterben. Trotzdem hatte Mark über der wenig einladenden Eingangstür in großen, unpassend grellen Leuchtbuchstaben den Namen „Café Central“ anbringen lassen. Vielleicht steckte darin irgendeine seltsame Form von Humor, die aber wohl für alle Zeiten kryptisch bleiben würde.
Nicht nur, weil ich mich bereits an dieses Gesamtkunstwerk gastronomischer Fehlkombinationen gewöhnt hatte, sondern vermutlich auch, weil es mir einfach beschissen ging, freute ich mich, als ich endlich die Tür erreicht hatte. Durch etwas, das vor langer Zeit einmal das Glas der Fenster gewesen sein mochte, konnte ich Licht erahnen, welches mein Gemüt gleich noch ein wenig mehr erhellte. Das vertraute „g öff t“ flackerte in einem Epilepsie auslösenden Rhythmus. Mit dem Schwung eines 90Jährigen drückte ich gegen das fleckige Holz der Tür, die mit dem gleichen Elan nachgab.
Um diese Tageszeit (die ich zwar nur schätzen konnte, aber eigentlich war das zu jeder Tageszeit so) saßen für gewöhnlich drei oder vier heruntergekommene Typen an der Bar, rauchten und tranken ihre Hoffnungslosigkeit oder ihr Unvermögen, etwas dagegen zu tun, ins emotionale Abseits und seufzten herzerweichend, wenn jemand nur annähernd in Mitleidsreichweite kam. Meist stand Mark am Ende des Tresens und hantierte mit irgendetwas geheimnisvoll herum, als sei der Beruf des Kneipenwirts eine alte Handwerkstradition. Umrahmt würde dieses Stillleben dann von derselben alten Rockmusik, die hier immer und immer wieder herunter geleiert wurde. Das war auch heute so – zumindest was die Musik betraf, denn es war keine Menschenseele in diesem Raum des Lokals zu sehen. Die Luft wirkte abgestanden und dick. Drei Gläser, eines davon halb leer, die anderen schon deutlich weiter, waren auf der Theke verteilt. Und irgendetwas stimmte wohl mit den Lautsprechern nicht, denn der Song, der gerade lief – etwas Altes von Pearl Jam war es wohl – klang seltsam dumpf.
Nun, das konnte immer noch an meinem Zustand liegen. Darum ging ich zielstrebig auf den Kaffeeautomaten zu, der in Marks Hoheitsgebiet stand (tatsächlich hing am schmalen Durchgang, der hinter die Theke führte, ein entsprechendes Hinweisschild, das unbefugten Eindringlingen mit drakonischen Maßnahmen drohte). Ich fühlte mich dort allerdings wie zuhause, was nicht zuletzt daran lag, dass ich seit Monaten mehr Zeit im „Central“ als daheim verbracht hatte. Der Zorn des Wirts würde mich nicht erschlagen, wenn ich mich einfach selbst bedienen würde, insofern gehörte kein Todesmut dazu.
Ich dachte kurz an Mark, der eigentlich schon immer einer meiner treuesten Freunde gewesen war, auch wenn er, wie ich ihm nur immer wieder bestätigen konnte, von allen Schulkameraden der offensichtlichste Verlierer war. „Wer nichts wird, wird Wirt“, hatte mein Vater ohne Unterlass gesagt, nichtsahnend, dass es auf den sonst so netten und wortgewandten jungen Mann zutreffen könnte, den ich des Öfteren bei uns zu Besuch hatte. Marks große Leidenschaft war schon früher die Schreiberei gewesen, aber keiner aus unserer Klasse hielt sich mit Hohn und Spott darüber zurück. Schließlich konnte man mit so etwas keinen Blumentopf, geschweige denn ein Vermögen gewinnen. Als ich mich dann nach dem Abschluss in Richtung der krisensicheren und lukrativen Versicherungswirtschaft orientierte, übernahm Mark diese schäbige Spelunke – quod erat demonstrandum, wie wir zu sagen pflegten. Vermutlich gab es keinen einzigen Besuch meinerseits in seiner Kneipe (und die waren immerhin fast täglich), bei dem ich meinem Freund nicht brüderlich auf die Schulter klopfte und ihn liebevoll auf sein Scheitern hinwies. Bewundernswert war allein die Gelassenheit, mit der er das ertrug – eine Eigenschaft, die ich mir nur zu gern aneignete.
Der Kaffeeautomat brummte seltsam dumpf. Das tiefschwarze Gebräu, das aus der Öffnung troff, verhieß entweder ersehnte Linderung oder qualvolle Magengeschwüre. Um die Chancen etwas zu meinen Gunsten zu beeinflussen, griff ich die Milchtüte aus dem Kühlschrank und gab ein paar Tropfen in den Zaubertrank, bis er die Farbe von dunklem Karamell angenommen hatte. Die erhoffte Wirkung blieb nicht aus, auch wenn der erste Schluck unaussprechlich und der zweite nach kochendheißer Blumenerde schmeckte. Allmählich verzog sich der wabernde Nebel in meinem Kopf und sogar die höllischen Schmerzen im Rücken verringerten sich auf ein beinahe erträgliches Maß, obwohl sie es sich dann doch nicht nehmen ließen, ihre fortgesetzte Anwesenheit immer wieder aufs diabolischste unter Beweis zu stellen.
Mittlerweile mochte bestimmt eine halbe Stunde vergangen sein, aber noch immer war niemand im Lokal aufgetaucht. Ich sah mich um nach der Schwingtür zu dem kleinen, fetttriefenden Kämmerchen, dass Mark immer als seine Küche anpries. Einige Schritte weiter konnte ich auch den Eingang zum Toilettenbereich sehen. Praktischerweise überkam mich spontaner Harndrang, so dass ich im zielstrebigen Vorbeigehen die Küchentür aufstoßen und mich von der Menschenleere dahinter überzeugen konnte. Auf der Herrentoilette pinkelte ich ausgiebig und völlig ungestört In der aufkommenden Überzeugung, dass mich absolut nichts mehr überraschen könnte, betrat ich schließlich auch den Bereich für die Damen. Zugegeben, was sollte mich dort auch schon erwarten? Eine Dame oder eine andere Person weiblichen Geschlechts, die nur annähernd diese Bezeichnung verdient hätte, war hier vermutlich schon seit sehr langer Zeit nicht mehr hier gewesen. Höchstwahrscheinlich hatte ein derartiges Wesen keinen einzigen Bereich von Marks mitleiderregendem Leben je berührt. Und tatsächlich hatte sich auch an diesem denkwürdigen Tag keines dorthin verirrt.
Irgendwie dämmerte mir allmählich, dass etwas hier so ganz und gar nicht stimmte. Nicht nur hier: Mit einem Mal wurde mir bewusst, dass ich seit meinem unangenehmen Erwachen noch keiner Menschenseele begegnet war. Nicht im Hausflur, nicht auf der Straße und schließlich auch nicht im „Café Central“. Die Erkenntnis traf mich wie ein Blitzschlag, durchzuckte mich und erinnerte meinen Rücken daran, wieder einmal zu schmerzen. Und dann strömten die Fragen in meinen Kopf: Was ging hier vor? War ich wohlmöglich der einzige, der irgendetwas nicht mitbekommen hat? Lief hier ein verdammt seltsamer Streifen ab und völlig an meiner Wenigkeit vorbei? Nun ja, das hatte vielleicht, nein, ganz gewiss mit den Ereignissen des Vorabends zu tun, an die ich mich beim besten Willen nicht im Geringsten erinnern konnte.
Mit zittrigen Händen, teils von der Benommenheit, teils von diesem grauenhaften Kaffee, tastete ich die Taschen meines Jacketts ab und fand schließlich mein Smartphone. Das Display verschwamm ein wenig vor meinen Augen, ich kniff die Lider zu einem engen Schlitz zusammen, um überhaupt etwas erkennen zu können. Die Antivirensoftware zeigte wieder einmal die Meldung „Ihr Gerät ist vollständig geschützt“. So etwas wünschen sich manche Männer für ihre Unterhose, kam mir seltsamerweise in den Sinn. Mit einem Schütteln versuchte ich diesen Gedanken loszuwerden und mich auf mein eigentliches Problem zu konzentrieren. Ich wählte einige Nummern aus meiner Kontaktliste – Arbeitskollegen, Freunde, mein absolut überbezahlter Steuerberater –, hörte aber jedes Mal nur eine Art statisches Rauschen. Mein sonst so brillanter Verstand reagierte nur äußerst zögerlich, so dass ich erst nach einer ganzen Reihe von Anläufen allmählich begriff, dass ich überhaupt keinen Empfang zu haben schien. Seltsam, dachte ich, dass mein sonst so zuverlässiger Mobilfunkanbieter – so viel zum Thema „Das beste Netz“ – ausgerechnet an diesem Tag einen Totalausfall hatte. Schließlich war ich sonst immer und überall erreichbar, was in meiner Position nicht unwichtig war.
Die Rätsel des Tages waren einfach zu viel für mein geschundenes Gehirn. Ich konnte einfach nicht begreifen, dass niemand zu sehen oder zu erreichen war, noch nicht einmal Mark. Was steckte dahinter? Irgendein geheimnisvoller, möglicherweise perfider Plan? Was hatte ich überhaupt damit zu tun? Und warum sollte irgendjemand, wer auch immer dafür verantwortlich war, ausgerechnet einen weniger als mäßig erfolgreichen Eckkneipenwirt mit hineinziehen?
Ich beschloss, mich einfach heimlich wohin auch immer zu schleichen, dorthin, wo alle anderen scheinbar waren. Allerhand seltsame Gedankenkonstrukte spannen sich in meinem Kopf. Vielleicht hatte ich eine wichtige Volksversammlung verpasst – nicht, dass mich so etwas wirklich interessiert hätte. Oder sollte es gar eine Überraschungsparty geben? Da ich noch fehlte, war ich vermutlich, nein, ganz eindeutig der Ehrengast! Ein spürbar dümmliches Grinsen huschte über mein Gesicht und ich schämte mich augenblicklich ein kleines Bisschen dafür, wenn ich auch nicht wusste, vor wem, außer vielleicht vor mir selbst. Nein, da musste etwas anderes im Gange sein. Immerhin war ich mir auch fast hundertprozentig sicher, dass ich nicht zufällig Geburtstag hatte, und alle meine Freunde, allen voran Mark, wussten: Wenn es etwas gab, was ich mindestens genau so sehr hasste wie Überraschungen, dann waren das Volksaufläufe.
Gepeinigt und genervt von diesen hirnverbrannten Überlegungen verließ ich schließlich das „Central“ und lief beinahe blindlings durch die Gegend, ohne auch nur irgendeinen Anhaltspunkt zu entdecken. Ein endlich klarer Blick auf die Uhr bestätigte, dass inzwischen der frühe Abend anbrach. Der Himmel verfärbte sich allmählich dunkelblau und über den Dächern war schon ganz zart die blasse Sichel des Mondes zu sehen. Sie trug ein hämisches Grinsen in ihrem kratervernarbten Gesicht. Erstaunlicherweise – oder genaugenommen eigentlich auch nicht – dachte ich dabei mit einem Mal an meinen alten, cholerischen Chef, den ich so oft genau eben dort hin auf diesen elenden, verstaubten Trabanten gewünscht hatte. Ob Wünsche doch manchmal wahr werden konnten?
5
„AFFENARSCH!“ Um eine Führungsposition gleich welcher Art bekleiden zu können muss man gewiss bestimmte Kompetenzen besitzen: Eine gesunde Menschenkenntnis beispielsweise und wohl auch Entscheidungsfähigkeit sollen sehr hilfreich sein. Oder wie im Fall meines früheren Chefs Lautstärke und ein prall gefülltes Vokabelheft persönlicher Beleidigungen. Auf diesem Gebiet war er eine echte Autorität. Ich zog mir seinen Groll dermaßen oft zu, dass ich die einzelnen Vorfälle kaum mehr in eine sinnvolle Reihenfolge bringen kann. Nichtigkeiten waren es allesamt, die der alte Choleriker zum Anlass nahm, seine Fähigkeiten voll auszuleben. Daran mochte der nicht gerade Aufsehen erregende Alltag in einem Großraumbüro auf einer unbedeutenden Etage eines gigantischen Hochhauses der „Aeterna Versicherungen AG“ eine gewisse Mitschuld haben. Hier war jede Gelegenheit willkommen, ordentlich Dampf abzulassen. Einmal gab es zum Beispiel Ärger, weil ich in meiner Büronische ein Poster unserer Werbeabteilung aufgehängt und den Slogan „Sicherheit ein Leben lang“ geringfügig dem öden Schreibtischdasein angepasst hatte: „Mit Sicherheit lebenslänglich!“
Egal, ob ich einmal ganz knapp eine willkürlich gesetzte Frist versäumt hatte oder der neuen, jungen und erfolgreich von der namhaften Konkurrenz abgeworbenen Kollegin etwas zu nahe getreten war, nur weil ich sie scherzhaft „Janine, die Jungfrau von der Allianz“ nannte, ich konnte jedes Mal eine Eruption über mich ergehen lassen, gegen die der Krakatau-Ausbruch von 1883 wie ein Lagerfeuer ausgesehen haben mochte.
Möglicherweise fühlte sich mein Chef, der in der Branche ja ganz offensichtlich besser zurechtkam als ich, manchmal einfach gelangweilt oder unterfordert. Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass er im Zuge seiner Beförderungen bereits seine Kompetenzgrenze erreicht hat, die besagt, dass er für den nächsten Schritt auf der Karriereleiter einfach nicht geeignet war. Es war natürlich ohnehin schwer, sich in diesem Büro Lorbeeren zu verdienen, denn dort wurden keine Abschlüsse getätigt oder große Geschäfte gemacht. Alles drehte sich um die Verwaltung und natürlich die Verwaltung der Verwaltung (nicht umsonst hatten die horrenden Versicherungsprämien ihre Berechtigung). Die einzige, winzig kleine und fast aussichtslose Möglichkeit, sich für die nächst höhere Etage verdient zu machen, bestand darin, Abläufe zu optimieren und vielleicht sogar noch etwas einsparen zu können (zu diesem Thema fielen mir immer spontan einige Kollegen ein und natürlich mein Chef). Alles, was es in dieser Richtung zu tun gab, wurde von unserem Vorgesetzten (oder Sklaventreiber, wie wir ihn nannten) mit Gebrüll und Geschrei angeordnet. Und all das, was nicht rund lief, erzeugte noch eine vielfache Steigerung dessen. Der letzte Vorfall jedoch, der mit dem oben genannten, lauthals geschmetterten Wort noch nicht einmal richtig in Fahrt gekommen war, übertraf sie alle. Der Grund war einfach wie einleuchtend: Ich habe mich nach allen Anfeindungen der Vorgeschichte irgendwann entschieden, den Anweisungen meines Vorgesetzten wortwörtlich Folge zu leisten. Warum widersprechen, wenn es nur Ärger gibt? Warum auf offensichtliche Unzulänglichkeiten hinweisen, wenn man dafür angebrüllt wird? Und warum Fehler eigenständig ausmerzen, wenn sie einem später trotzdem angekreidet werden? Zu dumm nur, dass sich diesmal die gravierende Fehlkalkulation unmittelbar auf die Führungsebene zurück verfolgen ließ. Tragischerweise hatte auch mein Chef einen Vorgesetzten, der wiederum selbst Untergebener von irgendwem war und so weiter. Irgendwo in dieser Hierarchie oder Hackordnung gab es schließlich jemanden, erstaunlicherweise ein Mensch mit Verstand, der sich als Hauptverantwortlichen (oder Sündenbock) für ein unglaublich teures Schlamassel nicht das letzte