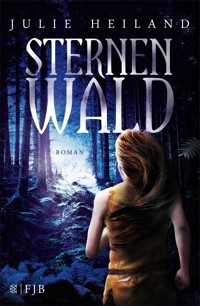0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Zeilenfluss
- Serie: Dark Falling
- Sprache: Deutsch
Mit jeder Sekunde verliert er mehr und mehr von seiner Seele. Kann ihre Liebe ihn retten?
Um den zwanzigjährigen Gideon Zeus ranken sich düstere Geschichten, und in seiner Burg auf der schottischen Insel St. Eilean geht es nicht mit rechten Dingen zu. Trotz dieser Gerüchte bleibt Geal nichts anderes übrig, als dort einen Job anzunehmen. Was sie nicht ahnt: Gideon ist nur noch einen Schritt von der Verdammnis entfernt. Sein Gewissen belastet nichts weniger als der Tod seiner Eltern und um die Erinnerungen an seine schreckliche Vergangenheit und seine eigene Grausamkeit zu vergessen, hat er dem Teufel seine Seele versprochen. Doch als diese fast vollständig an die Unterwelt verloren scheint, entfachen Geals Wärme und Sanftmut zarte Gefühle in dem verschlossenen Mann, die allein ihn aus seinem Bann befreien können. Doch der Gegner ist mächtig und setzt alles daran, die Liebe der beiden zu verhindern …
"Dark Falling - Schatten der Vergangenheit" ist der Auftakt der mystischen Liebesroman-Dilogie"Dark Falling".
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Schatten der Vergangenheit
Dark Falling – Band 1
Julie Heiland
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literaturagentur Kai Gathemann GBR.
1
Gideon Zeus hatte seine Eltern getötet.
Heute war der Mord exakt drei Jahre her. Ein Jahrestag sozusagen.
Gideon leerte sein Glas Champagner in wenigen Zügen und sah vom ersten Stock aus auf seine Partygäste hinab. Keiner von ihnen ahnte auch nur, dass sie auf der Party eines Mörders waren. Der Großteil der anwesenden Mädchen himmelte ihn an, weil er mit seinen blonden Locken und den im Licht golden schimmernden Augen aussah wie ein Engel. Und weil er in einer wildromantischen Burg lebte. Und in Geld schwamm. All die Schönen und Reichen dort unten hatten keine Ahnung, dass er zwei Leben auf dem Gewissen hatte.
Gideon lehnte an einer Steinsäule und fuhr mit dem Zeigefinger über den Rand seines Champagnerglases. Die Standuhr schlug Mitternacht. Niemand außer Gideon nahm das Schlagen wahr, dafür war die Musik zu laut. Kirschrote Bowle sprudelte aus einem Tischbrunnen. Kaviar, Wachteleier, Austern – alles war im Überfluss vorhanden. Der Steinboden unter seinen Füßen vibrierte, die Ritterrüstung neben ihm zitterte im Bass der Musik.
Wie hingegossen lag Liliana di Mauro, die aktuell erfolgreichste Polospielerin Europas, auf dem schwarzen Ledersofa. Gideon hatte ihr Gesicht letzte Woche in der Zeitung gesehen und sich gewünscht, sie würde auf seine Party kommen. Er hätte sich auch wünschen können, dass sämtliche Victoria’s-Secret-Models erscheinen würden. Denn jeder seiner Wünsche ging in Erfüllung. Jeder. Allerdings waren Models ehrfahrungsgemäß anstrengend.
Hinter Liliana bewegte Alesia Iwanowa, eine russische Balletttänzerin, ihre schmalen Hüften im Takt des Hip-Hop-Songs, der aus den Boxen dröhnte. Auch sie wäre unter normalen Umständen wohl nicht zu Gideons Party erschienen. Eine Party auf einer winzigen schottischen Insel, auf der es mehr Schafe als Einwohner gab. Aber die Umstände waren eben nicht normal, und Gideon war es gewohnt, zu bekommen, was er sich wünschte.
Der Rest der Anwesenden waren ›Styroporgäste‹, wie Gideon sie insgeheim bezeichnete. Er nannte sie deshalb so, da der Großteil der Typen und Mädchen hier denselben Zweck wie Styroporchips in Paketen hatte: Sie füllten den Leerraum aus, weil Gideon sich eine große Party mit vielen Gästen gewünscht hatte. Meist waren es Studenten aus London, junge Rucksacktouristen oder reiche Söhne und Töchter, die es sich leisten konnten, mal eben am Wochenende zu einer Party in ein anderes Land zu fliegen. Gideon kannte sie alle nicht, hatte sie noch nie zuvor gesehen. Es zählte ohnehin nur, dass sie jetzt hier waren und seine Samstage zum Highlight jeder Woche machten. Am nächsten Morgen würden sie alle wieder verschwunden sein.
Gideon setzte sich in Bewegung und schlenderte zur schmalen Steintreppe, die ihn in den zweiten Stock führte.
»Gideon, warte!«
Tom Rinley, ein Mann um die vierzig, das Gesicht wie gestrafftes Leder. Tom war Dauergast auf Gideons Partys und der Einzige unter all diesen Menschen, den Gideon tatsächlich kannte. Gemeinsam mit Mason, Gideons Vater, hatte er Zeus Petroleum aufgebaut und leitete die Öl- und Gasfirma seit drei Jahren allein. Tom war der Grund, weshalb Gideon in Geld schwamm, selbst aber keinen Finger dafür krümmen musste. Zudem hatte sich Tom darum gekümmert, dass Gideon nach dem Tod seiner Eltern bis zu seinem achtzehnten Lebensjahr in der Burg von einem Privatlehrer unterrichtet worden war und sich anschließend zu einem BWL-Fernstudium eingeschrieben hatte, das Gideon jedoch nicht sonderlich ernst nahm.
»Wo ist das noch mal, wo es diesen …« Tom schnippte mit den Fingern und suchte in seinem Kopf augenscheinlich nach dem richtigen Wort. »Na, du weißt schon. Wo es diesen Lavafluss gibt. Das war doch Japan, nicht wahr?«
»Hawaii«, antwortete Gideon kurz angebunden.
Noch jemand rief seinen Namen. Mara.Vor zwei Wochen war sie als Styropormädchen auf seiner Party erschienen. Gideon hatte sie gefragt, ob sie sich vorstellen könne, eine Weile als Gast auf der Burg zu bleiben. Mara hatte ihr Glück kaum glauben können. Gideon war für sie die Erfüllung ihrer Träume, das hatte sie ihm mehrmals nachts ins Ohr geflüstert. Für ihn war Mara nur ein Glied einer langen Kette von Mädchen. Sie war hübsch, aber nicht mehr als ein Zeitvertreib. Er ignorierte sie und ging weiter.
»Ist der Typ dort oben Gideon Zeus?«, hörte er zwei Mädchen miteinander flüstern. »Er ist noch schöner als auf den Fotos in den Zeitschriften …«
»Aber die Burg ist schon unheimlich, findest du nicht? So dunkel … Bestimmt gibt es hier Geister.«
Es zog Gideon zur Wehrplatte der Burg, wo ihm der kalte Wind des Atlantischen Ozeans die blonden Locken ins Gesicht wehte.
»Hier stecken Sie, Mister O’Connery«, sagte er. »Ich dachte mir schon, dass es Ihnen drinnen zu laut ist.«
Mister O’Connery schwieg.
Gemeinsam schauten sie auf das nachtschwarze Meer, auf dem in weiter Ferne das Licht eines Kreuzfahrtschiffes leuchtete. Von der anderen Seite der Wehrplatte aus hatte man einen guten Blick auf das Dorf, das um diese Uhrzeit in absoluter Dunkelheit lag. Das war das Beeindruckende an dieser Gegend: Nachts war es stockfinster. Abgesehen vom funkelnden Sternenhimmel, dem Blinken des Leuchtturms und dem goldenen Lichtkreis, der die Burg umgab.
»Verspüren Sie eigentlich niemals den Drang, einfach davonzufliegen?«, fragte Gideon.
Mister O’Connery schwieg noch immer. Meist legte er nur den Kopf schief und betrachtete Gideon aufmerksam.
»Verstehe«, sagte Gideon. »Warum sollten Sie auch von hier fortwollen, wo Sie doch alles haben, was Ihr Herz begehrt?«
Seit drei Jahren hatte Gideon die Burg so gut wie nie verlassen. Tagtäglich atmete er die salzige, raue Inselluft ein. Hörte den eisigen Wind heulen. Sah die weitläufige Landschaft St. Eileans, in der es nichts gab außer ein paar Cottages und einer einzigen Straße, die um die Insel herumführte.
Mister O’Connery begann zu singen – oder eher zu krächzen. »Moon, moon, shiny and silver. Moon, sun, shiny and gold.”
Mister O’Connery war Gideons Papagei und einer seiner wenigen Freunde. Seiner wahren Freunde. Er war ein vollkommen freier Vogel, hielt sich jedoch meistens in Gideons Zimmer oder auf den Türmen auf. Vielleicht spürte er, dass Gideon ihm einst das Leben gerettet hatte, und flog deshalb nicht fort. Vor sieben Jahren hatte einer von Masons Geschäftspartnern, der echte Mister O’Connery, den Papagei für seine Frau gekauft und schon bald das Gekrächze nicht mehr ausgehalten. Er wollte ihm einfach den Hals umdrehen, aber Gideon hatte gefleht, ihn stattdessen als Haustier geschenkt zu bekommen. So war der Papagei in Gideons Zimmer eingezogen, damals noch in der Villa in der Provence. Da Gideon sich selbst nach stundenlangem Überlegen nicht für einen Namen für das Tier hatte entscheiden können, hatte er ihn einfach Mister O’Connery genannt.
»Moon, moon, shiny and silver …«
Früher hatte Gideons Mutter Angelique für ihn dieses Schlaflied gesungen. Aber dann hatte er sie nur noch zwei-, vielleicht dreimal im Jahr gesehen. Sein Vater hatte ihn in ein Klosterinternat gesteckt und fast vollständig aus Angeliques Leben gestrichen. »Deiner Mutter geht’s nicht so gut, Giddy, mein Kleiner. Ein bisschen Abstand zu dir hilft ihr sicher. Das verstehst du doch, oder?«
Daraufhin hatte Gideon sich selbst in den Schlaf singen müssen, wenn er nachts kein Auge zugetan hatte. Irgendwann hatte Mister O’Connery das Schlaflied gelernt. Das war vor etwa drei Jahren gewesen – bevor Gideon seine Eltern umgebracht hatte.
Gideon hatte seine Eltern an einem Tag getötet, der wie jeder andere gewesen war. Mason, Angelique und Gideon hatten eine Woche in diesem schottischen Nest verbracht: St. Eilean, einer winzigen Insel, auf der es das ganze Jahr über stürmte, sodass Bäume und Sträucher keine Chance hatten, zu wachsen. Stürme, die so schlimm waren, dass die nördliche Nachbarinsel im Jahr neunzehnhundertfünfzig evakuiert worden war, da die letzten dreißig Inselbewohner ihr Leben dort nicht mehr ertrugen. Die Bewohner St. Eileans harrten hingegen aus. Stoisch wie Felsen trotzten sie der Kälte, den Winden und dem ständigen Wechsel von Sonne und Regen.
Da Zeus Petroleum auf St. Eilean einen seiner vielen Firmensitze hatte, war die Familie Zeus einmal im Jahr auf die Insel geflogen, damit Mason die Geschäfte kontrollieren konnte. Abgesehen von der Zeit auf St. Eilean hatten seine Eltern ihn zwischendurch auch noch anstandshalber für ein paar Tage Urlaub aus dem Internat geholt, damit niemand sagen konnte, sie würden sich nicht um ihr Kind kümmern. Diese Zeit hatte Gideon meist mit Kopfhörern in den Ohren und Handy in der Hand am Pool verbracht. An Weihnachten hatten seine Eltern und er sich nur für ein paar Stunden gesehen. Das war’s.
An dem Tag, als seine Eltern starben, war die ganze Familie mit dem privaten Hubschrauber seines Vaters die Küste entlanggeflogen. Es war ein erstaunlich schöner und warmer Tag gewesen. Gideon sah noch immer alles ganz deutlich vor sich: Die Sonne glänzte auf der Frontscheibe und heizte den Innenraum auf. Unter ihnen ragten spitz zulaufende Felsen aus dem Meer heraus. Mason lenkte die Maschine mit nur einer Hand, in der anderen hielt er sein Handy, durch das er ununterbrochen irgendeinen armen Kerl anbrüllte.
»Scheiße!« Sein Vater fluchte und knallte sein nagelneues iPhone auf das Cockpit des Hubschraubers. »Als ob ich nicht schon genug Ärger am Hals hätte!«
Angelique, die neben ihm saß, hatte die Augen geschlossen und die Arme dicht an ihrem Körper in den Sitz des Hubschraubers gestemmt.
In Momenten wie diesen, in denen von Masons typischem ›Läuft-doch-alles-wie-geschmiert‹-Grinsen nichts mehr übrig war, konnte Gideon einfach nicht nachvollziehen, was Angelique an ihm fand. Abgesehen von seinem Vermögen. Gideon konnte auch nicht verstehen, dass er tatsächlich Masons Gene in sich tragen sollte. Ursprünglich aus Texas stammend, hatte Mason diese amerikanische Art, mit jedem sofort ›best buddy‹ zu sein. Doch keiner seiner einflussreichen Freunde hatte je den Mut gehabt, ihm zu sagen, dass es in seinem Alter lächerlich war, sich die Haare platinblond zu färben.
»Weißt du, wer das gerade war?«, fuhr Mason Gideon an. »Dein Schuldirektor! Du glaubst also, dass du uns nur Ärger machen kannst, oder was? Verdammt! Ich blättere nicht jeden Monat tausende Euros hin, damit mich dieser Idiot anruft und sagt, dass er deine Visage nicht mehr sehen will!«
»Ich habe nichts gemacht! Ich weiß nicht, warum der sich so aufregt!«
»Nichts gemacht?« Mason schlug mit der flachen Hand auf das Cockpit. »Du bist das dritte Mal in Folge einfach aus dem Internat abgehauen! Ein ganzer Polizeitrupp musste dich suchen!«
Angelique drehte sich um und streckte Gideon ihre Hand entgegen, der sie widerstrebend nahm. Mason regte sich weiter auf.
»Ich will mich nicht mit so einem Mist herumschlagen. Ich habe genug um die Ohren! Du kommst jetzt in die Schweiz in ein Jungeninternat. Die arbeiten dort mit Psychologen zusammen. Die werden dich hoffentlich endlich in den Griff kriegen. Punkt! Aus! Ende! Deine Mutter braucht Ruhe.«
Gideon wusste, dass er der einzige Mensch in Angeliques Leben war, dem sie sich nahe fühlte. Ihretwegen hatte er sich überhaupt erst aus dem Internat geschlichen. Weil er gewusst hatte, dass sie ohne ihn den ganzen Tag nicht aus dem Bett kommen und zu essen vergessen würde.
»Gott hat dich mir geschenkt, Gideon. Du bist mein Ein und Alles«, flüsterte sie oft nachts.
Mit dem goldblonden Haar und den blaugrauen Augen sah Angelique wie ein Engel aus. Ein tieftrauriger Engel.
»Wie geht es deiner Hand?«, fragte sie ihn und sah dabei aufrichtig besorgt aus, obwohl sie es doch gewesen war, die ihm die Wunde zugefügt hatte.
»Besser.« Den Verband um sein Handgelenk hatte Gideon in der Früh selbst gewechselt.
In diesem Moment hasste Gideon seine Eltern so sehr. Mason, weil ihm seine Familie gleichgültig war. Und Angelique … Er wusste nicht, ob er sie hasste oder liebte oder auf verquere Weise beides auf einmal.
»Du hast die Kontrolle, Gideon«, flüsterte eine tiefe Männerstimme in seinem Kopf. »Du musst nicht auf diese Weise weiterleben, wenn du nicht willst. Du hast es in der Hand.«
Es war die Stimme des Mannes, der zwei Nächte zuvor aus dem Nichts an Gideons Bett aufgetaucht war. Des Mannes, der Gideons Leben komplett auf den Kopf gestellt hatte. Es war die Stimme des Teufels.
»Ach ja?«, fragte Gideon.
»Was sagst du?« Angelique glaubte, Gideon würde mit ihr sprechen. Er ging nicht auf sie ein.
»Ja!«, entgegnete die Stimme. »Du könntest dir zum Beispiel wünschen, dass deine Eltern verunglücken. Dann wärst du all deine Probleme los. Was hältst du davon?«
Gideon malte sich vor seinem inneren Auge aus, wie ein Leben ohne seine Eltern aussehen würde. Eine Vorstellung, die ihm Angst machte. Oder nein, es machte ihm Angst, wie befreiend sich diese Vorstellung anfühlte.
Was danach passiert war, wusste Gideon nur noch lückenhaft. Er wusste nicht mehr, was er gesagt, getan oder gedacht hatte, um dem Mord an seinen Eltern zuzustimmen. Er wusste nur noch, dass plötzlich ein rotes Licht hinter dem Steuerrad zu blinken angefangen hatte. Mason war zu sehr mit seiner Wut beschäftigt gewesen, um es zu bemerken. Und Angelique hatte es nicht gesehen, weil sie damit beschäftigt gewesen war, Gideon anzuhimmeln.
»Mein Bruder hatte recht, als er sagte: ›Mason, schaff dir bloß keine Familie an! Die kostet nur und macht einen Haufen Ärger!‹ Das habe ich jetzt davon, dass ich geheiratet habe. Ärger. Nichts als Ärger!«, hatte Mason gezetert.
Auf einmal erklang ein hohes Piepen. Der Motor setzte aus. Es folgte ein lauter Knall. Rauch stieg aus dem Cockpit.
Panik.
Schreie.
Feuer.
Sie rasten auf die Klippen zu. Es dauerte nur wenige Sekunden. Einen Atemzug nur. Dann knallte der Hubschrauber auf Stein. Explodierte.
Stille.
Lange Zeit war da dieses Nichts gewesen. Gideon konnte sich kaum noch daran erinnern, aber es hatte sich seltsam angefühlt … Als wäre er von einem Strudel mitgerissen worden.
Nach und nach waren Geräusche zu ihm durchgedrungen. Knistern. Die Sirene eines Notarztwagens. Stimmen.
Er hatte sich aufgerichtet. Seine Klamotten waren an einigen Stellen zerfetzt oder verbrannt gewesen. Eine Hälfte des Hubschraubers hatte auf den Klippen gelegen, die andere war fünfzig Meter unter ihm auf den Felsen zerschellt. Ein Arm hatte unter dem hervorgeragt, was mal eine Tür gewesen war. Gideon hatte gezittert. Es war ein zarter Arm gewesen. Ein Engelsarm. Angelique.
Die Ärzte hatten gesagt: »Es ist ein unvorstellbares Wunder, dass der Junge den Absturz überlebt hat! Mit nicht mehr als ein paar Kratzern.«
Aber es war kein Wunder gewesen. Es war auch kein schrecklicher Unfall gewesen, der seine Eltern getötet hatte. Gideon wusste: Es war der Ring an seinem Finger gewesen. Der Teufelsring.
Gideon strich Mister O’Connery über den gefiederten Kopf. Dabei fiel sein Blick auf das Schmuckstück an seiner rechten Hand. Es war ein schlichter silberner Ring. Unauffällig, aber doch so machtvoll.
Er bot Mister O’Connery den Arm an, und der Papagei wanderte auf Gideons Schulter. Gemeinsam zogen sie sich ins Innere der Burg zurück. Mister O’Connery in seinen Käfig, Gideon auf die Party.
Nach und nach wurden die Gäste weniger, bis nur noch der harte Kern übrig war, der es sich im Salon auf dem Ledersofa gemütlich machte. Und auf einmal gab es nur noch Gideon und Mara, die zwar hübsch war, aber unbedeutend. Ihr rundes Gesicht hatte er schon hundertmal gesehen, in Zeitschriften, Modekatalogen oder im Fernsehen, weil es wie so viele andere Frauengesichter aussah.
Als Gideon am nächsten Morgen in seinem Bett aufwachte, lag Mara in seinen Armen. Ihre Wimperntusche war leicht verschmiert von der Nacht.
»Guten Morgen«, sagte sie und lächelte glückselig.
»Morgen …«
Mara träumte mit offenen Augen, das sah Gideon ihr an. Sie träumte davon, wie sie jeden Morgen neben ihm aufwachen würde. Wie sie gemeinsam im Bett frühstücken würden. All das, was Mädchen nun mal so träumten.
Das Licht der Nachttischlampe fiel auf ihr langes blondes Haar. Die ganze Nacht hatte die Lampe gebrannt. Wie immer. Gideon konnte nicht im Dunkeln schlafen. Er überlegte, welche Farben er benutzen würde, um die Schatten in der Kuhle von Maras Schlüsselbein zu malen. Er kam nicht drauf. Was vermutlich daran lag, dass sie kein Motiv war, das ihn reizte.
Gideon verschränkte die Arme hinter dem Kopf und betrachtete die zwei Schwerter, die sich an der Wand über dem Kamin kreuzten. In so ziemlich jedem Raum der Burg hingen Waffen, und die Möbel waren massiv und dunkel lackiert. Mason hatte darauf bestanden, den rustikalen Charme der Burg beizubehalten.
»In eine Burg gehört so ein Kram«, hatte Mason immer gesagt und dann gelacht, sodass das Kaugummi zwischen seinen gebleichten Zähnen zu sehen gewesen war.
Mason hatte hier ja auch nie leben müssen, er hatte höchstens ein paar Tage am Stück auf St. Eilean verbracht. Aber Gideon war in dieser Steinfestung gefangen. Nach dem Tod seiner Eltern hatte er zwar ein paar moderne Lampen und helle Sofas gekauft, aber man hätte schon ganze Wände herausreißen müssen, um die Räumlichkeiten aufzuhellen.
»Sag etwas«, bettelte Mara. »Irgendetwas. Ich bin verrückt nach deinem französischen Akzent.«
Gideon schwang seine Beine aus dem Bett und sagte: »Um zwölf muss ich los.« Was natürlich gelogen war. »Bevor du gehst, kannst du gern noch in Ruhe duschen und frühstücken.«
Maras Lächeln bröckelte. »Bevor ich gehe?«
»Ja, ich bin die nächsten Tage viel unterwegs, und du musst doch sicher nach Hause, oder?«
»Ach so … ja, klar … Frühstücken wir denn noch gemeinsam?«
»Ich habe dir schon mal gesagt, dass du dir keine Hoffnungen machen sollst«, erwiderte Gideon so sanft wie möglich.
Das Meer bäumte sich auf und warf sich gegen die Klippen, als Gideon die Vorhänge aufzog. Während sich um die Burg Regenwolken stauten, war der Himmel über dem Dorf aufgebrochen. Wie Scheinwerferlicht fielen Sonnenstrahlen auf die Dächer der kleinen Häuser und ließen die weitläufige Landschaft in mystischen Farben aufleuchten, die so faszinierend waren, dass kein Maler der Welt jemals fähig sein würde, sie auf Leinwand zu bannen.
2
Mit drei kräftigen Schlägen hämmerte Geal den Nagel ins Holz. Sie saß auf dem Dach der Scheune, wo sie dem Wind ungeschützt ausgeliefert war. Der Sturm der letzten Nacht hatte ein paar der alten Schindeln abgedeckt und einen Balken gelockert, weshalb es nun in die Scheune regnete. Der Geruch von Essen wehte vom Haus herüber. Erbsensuppe, wie Geals Nase sofort erkannte. Aber Ian hatte nur in seiner Mittagspause Zeit, ihr dabei zu helfen, das Dach zu reparieren. Deshalb knurrten ihre Mägen im Wechsel.
Der nächste Schlag war so kräftig, dass sich ein Grinsen auf Ians Lippen ausbreitete. »Es ist doch immer wieder erstaunlich, wie eine so kleine Person so viel Kraft haben kann.«
»Ich bin nicht klein«, protestierte Geal.
»Stimmt. Du bist winzig«, neckte er sie.
»Pass lieber auf!« Drohend hob sie den Hammer, woraufhin Ian lachte.
Dabei war sie nicht mal sonderlich klein. Ein Meter dreiundsechzig war akzeptabel.
Die einst graue Steinfassade ihres Zuhauses war inzwischen an einigen Stellen von der Witterung schwarz verfärbt, auch wenn Geal den dunklen Belag immer wieder mit einer Wurzelbürste abschrubbte. Es war ein einfaches Haus, das mit fünf Leuten aus allen Nähten zu platzen drohte. Es stand am Rande von Buidseach, einem Fünfzig-Seelen-Dorf auf der Insel St. Eilean, die im Nordwesten Schottlands lag. Clyde, Geals Ersatzvater, war Leuchtturmwärter gewesen, weshalb die Familie in der Nähe des weiß-rot gestreiften Turms lebte.
Wie Schafe scharten sich die wenigen Häuser in Buidseach ohne jegliches System zusammen. An Zäune, die die Grundstücke eingrenzten, war hier nicht zu denken. Keiner der Dorfbewohner sperrte jemals seine Haustür ab. Wenn sich Touristen in diesen abgelegenen Teil Schottlands verirrten, glich das einer Sensation. Meist blieben sie aber nur für einen oder höchstens zwei Tage, denn außer Wandern, Radfahren und dem Beobachten seltener Vogelarten gab es für sie hier nichts zu erleben.
Auf einmal rutschte Geal auf den vom morgendlichen Regen noch nassen Schindeln aus. Ian packte sie gerade noch rechtzeitig. »Vorsicht!«
»Danke …«
»Typisch Geal.« Ian lachte, nachdem der erste Schreck verflogen war. »Ein Wunder, dass du dir nicht schon längst Hals und Beine gebrochen hast!«
»Weil du immer so gut auf mich aufpasst.«
Äußerlich glich Ian einem Fels in der Brandung. Nahezu mühelos schleppte er seiner Mutter Mehlsäcke ins Haus. Oder trug Geal den ganzen Hügel hinab zum puderzuckerweißen Sandstrand, ohne auch nur außer Atem zu sein. Niemand, der diesen kräftigen jungen Mann das erste Mal sah, würde ahnen, wie liebevoll Ian doch war. Ian, der es nicht übers Herz brachte, eine Fliege zu erschlagen, mit den Hühnern sprach und sonntags im Garten die Vögel fütterte.
»Mein Gott, bin ich müde …« Geal seufzte. »Und ich habe einen Mordskohldampf!«
Ian ließ den Dachziegel, den er gerade angehoben hatte, wieder sinken. Seine warmen braunen Augen sahen sie sorgenvoll an. »Du arbeitest zu viel. Wo steckt denn meine Schwester? Warum hilft sie nicht? Dann könntest du eine Pause machen.«
»Beatrice hat doch Höhenangst.«
Die Klippen versanken im Nebel, der sich über die violetten Heidekrautwiesen gelegt hatte. Wie bei einem Aquarell, dessen Farben mit zu viel Wasser gemischt worden waren, zeichnete sich dahinter blass die Burg ab. Sie lag auf einem Teil der Insel, der vor Jahrhunderten vom Rest abgebrochen war und ein kleines, separates Eiland bildete, das über eine Steinbrücke mit St. Eilean verbunden war. Obwohl es Tag war, brannte in fast jedem Zimmer Licht. Trotzdem wirkte die Burg dunkel und angsteinflößend. Nur einmal war Geal mit Fionna, ihrer Stute, in die Nähe der Burg geritten. Damals hatte sie sich eingebildet, eine finstere Gestalt stünde auf dem Turm.
»Ich spreche mit meiner Mutter«, riss Ian sie aus ihren Gedanken und schloss die Lücke im Dach mit dem letzten Ziegel. »Beatrice muss mehr mithelfen.«
In diesem Moment schoss ein Auto über die einzige, schmale Straße, die die Küste entlangführte. Ein glänzend neues Cabrio mit offenem Dach, obwohl es recht kalt war. Das Mädchen auf der Beifahrerseite riss lachend eine Hand in die Luft, mit der anderen hielt sie ihren großen Hut fest. Ihr Seidenschal flatterte im Wind.
»Bestimmt ein Nachzügler von der Party gestern«, meinte Ian und grinste.
»Wer sollte denn auch sonst mit einem so schicken Flitzer wie diesem auf St. Eilean fahren?«
»Da hast du recht. Ich hätte Lust, mal auf eine dieser Partys in der Burg zu gehen«, erwiderte Ian. »Schon allein um zu sehen, wie viel Kohle dieser Gideon Zeus wirklich hat.«
»Offenbar viel zu viel. Ich frage mich, warum er jedes Wochenende eine Party veranstalten muss. Noch dazu hier, auf dieser winzigen Insel, auf der es nichts gibt!«
»Eben deswegen. St. Eilean ist etwas Besonderes.«
»Aber man könnte das Geld für Sinnvolleres verwenden«, meinte Geal. »Dieser Zeus führt sein dekadentes Leben in der Nähe eines Dorfs, in dem die Bäckerin die nicht verkauften Brötchen vom Vortag aufbackt, weil sie sparen muss. Jamie Donnan hat letzte Woche sein Motorrad verkauft, weil die Ernte dieses Jahr so schlecht war und er seiner Freundin nicht mal einen Verlobungsring schenken konnte! Und die Brücke zwischen den beiden Dorfhälften müsste dringend repariert werden, aber dafür fehlt seit Jahren das Geld. Nicht mehr lange und jemand stürzt in den Bach!« Geal hatte sich in Rage geredet. »Aber anstatt zu helfen, schmeißt dieser Zeus Partys!«
Ian strich ihr eine Haarsträhne hinter das Ohr und lächelte sanft. »Ich mag deinen Sinn für Gerechtigkeit. Erinnerst du dich noch daran, als Matt behauptet hat, Zeus habe sein Pferd gestohlen? Es gibt ja tatsächlich ein paar im Dorf, die den Hengst auf dem Burggrundstück gesehen haben wollen. Vielleicht hat er sich auch Luzifer geschnappt!«
Geal lachte. »Wohl kaum! Luzifer war ein schlecht gelaunter Kater, dem ein halbes Ohr gefehlt hat und der aussah, als wäre er heimatlos.«
»Das stimmt doch gar nicht.« Ians Widerstand war halbherzig. Jeder in der Familie hatte den Kater insgeheim nicht ausstehen können. Ian selbst war es gewesen, der ihm den Namen Luzifer gegeben hatte. »Baxter ist jedenfalls felsenfest davon überzeugt, dass Gideon Zeus letztes Jahr seine geliebte Sophie entführt hat.«
»Na ja, ein paar Leute wollen wirklich hin und wieder Mädchen auf dem Burggrundstück gesehen haben, die dann auf einmal verschwunden waren …«
»Das glaubst du doch nicht wirklich, Geal, oder? Sophie ist einfach abgehauen, weil sie die Schnauze voll hatte von Buidseach und Baxters Sauferei.«
»Ja, vermutlich hast du recht. Auf jeden Fall ist mir die Burg unheimlich und dieser Zeus selbst noch viel unheimlicher!« Geal klopfte den Dreck von ihrer Jeans-Latzhose und sammelte die restlichen Nägel ein. »Sieht aus, als wären wir fertig.«
Sie folgte Ian die Leiter hinab und warf erneut einen Blick zur Burg. »Findest du es nicht seltsam, dass bis jetzt niemand Zeus auch nur einmal zu Gesicht bekommen hat? Obwohl er schon seit drei Jahren auf der Insel lebt, wie man sich erzählt.«
»Er gibt sich halt nicht mit unsereinem ab. Vermutlich ist es eh besser, wenn er sich von Buidseach fernhält. Beatrice hat mal in einer Zeitschrift ein Foto von ihm gesehen. Er soll ziemlich attraktiv sein. Am Ende würde er dich mir wegschnappen!« Ian zwinkerte ihr zu.
Geal kuschelte sich an ihn. Nichts und niemand würde sie von Ian trennen können, dessen war sie sich sicher. Zumal jemand wie Gideon Zeus sich gewiss nicht für ein Mädchen wie sie interessierte.
Ihr Name war wie für sie gemacht. ›Geal‹ war gälisch und bedeutete ›weiß‹. Weiß wie Schnee war ihre Haut. Im Kontrast dazu erinnerte ihre Haarfarbe an das Schwarzbraun der Lochs, wenn es mal wieder geregnet hatte und ihr sumpfiger Boden aufgewühlt war. ›Loch‹ war ein schottisches Wort für ›See‹. Schwarzbraun waren auch ihre Augen, die sie von ihrer Mutter geerbt hatte. Lediglich ihre markanten Augenbrauen erinnerten an ihren Vater.
Geal erinnerte sich nur zu gut an die Kreidezeichnung, die sie eines Morgens in der Schule an der Tafel gesehen hatte. Eine Kreidezeichnung, die eine Bohnenstange mit wirr abstehenden Haaren und Schlabberkleidung gezeigt hatte. Darüber hatte ihr Name gestanden. Seitdem bändigte Geal ihre Haare jeden Tag, indem sie sie zu einem Zopf flocht.
An der Schlabberkleidung ließ sich nichts ändern. Da ihre Familie jeden Penny zweimal umdrehen musste, war für Geal an Shoppen nicht zu denken. Zwar bot Margaret hin und wieder an, ihr in Dùn, der einzigen Stadt der Insel, ein hübsches Kleid zu kaufen. Aber Geal interessierte sich nicht für Mode. Die Dorfbewohner und Hühner scherten sich nicht darum, wie sie aussah, und Ian liebte sie so, wie sie war. Warum also Geld verschwenden? Deshalb trug sie die Shirts und Hosen, die Beatrice aus ihrem Schrank aussortierte. Im Gegensatz zu Geal war Beatrice jedoch mit atemberaubend langen Beinen gesegnet. Trotz ihrer schlanken Figur hatte sie weibliche Kurven. Das konnte Geal nicht von sich behaupten.
Aber das brauchte sie auch gar nicht, sagte sie sich und verdrängte die unliebsamen Gedanken wieder.
»Manchmal tut er mir sogar leid, dieser Gideon Zeus«, murmelte Geal in Ians sandfarbenes Baumwollhemd hinein. An der Schulter hatte er sich heute Morgen auf dem Fischerboot ein Loch gerissen. Den Fischgeruch schleppte er den ganzen Tag mit sich herum. Erst am Abend, wenn er sich in der Badewanne den gesamten Körper mit Meersalzseife geschrubbt hatte, roch er wieder nach Ian. Ein Duft, den Geal gern einatmete.
»Er tut dir leid? Wieso das denn?«
»Na wegen damals. Weil doch seine Eltern umgekommen sind.«
»Ach, der Helikopterabsturz … Da brodelt noch immer die Gerüchteküche.« Ian senkte die Stimme, als würde er Geal eine Gruselgeschichte erzählen. »Man sagt, dass er unsterblich sei, weil er als Einziger überlebt hat. Nahezu unversehrt!«
Geal erinnerte sich noch genau an den Tag, als der Helikopter abgestürzt war. Es hatte einen furchtbaren Knall gegeben, dann war eine Rauchwolke von den Klippen in den Himmel aufgestiegen.
»Andere munkeln«, fuhr Ian fort, »dass er den Helikopter bewusst zum Absturz gebracht habe, um seine Eltern zu töten. Und er selbst habe sich mit einem Fallschirm gerettet.«
Geal wusste, wie es war, beide Eltern auf einen Schlag zu verlieren. Deshalb verstand sie nicht, wie Ian Witze darüber reißen konnte.
»Erinnerst du dich noch an diese seltsame Geschichte mit Willy?«, wechselte sie das Thema.
Willy war Milchmann auf der Insel gewesen. Jeden Morgen war er pünktlich wie ein Schweizer Uhrwerk mit seinem Lieferwagen die Küstenstraße entlanggetuckert und hatte den Ort mit Milch versorgt. Eines Morgens hatten die Bewohner vergeblich darauf gewartet, dass der Wagen um die Kurve bog. Sie hatten gedacht, Willy sei vielleicht krank oder habe einen Unfall gehabt. Noch am selben Morgen war der Notarzt zur Burg gedüst. Dort hatte Willy auf den Stufen gelegen, die zur mächtigen Holztür hinaufführten. Tot.
Über die Todesursache war viel spekuliert worden. Manche hatten behauptet, Willys Herz sei einfach stehen geblieben. Andere hatten das nicht glauben wollen, denn Willy war gerade mal fünfundvierzig Jahre alt gewesen. Hinter vorgehaltener Hand hatte man getuschelt, Gideon Zeus habe den gutmütigen Milchmann vergiftet.
»Zeus ist dir wirklich unheimlich, oder? Das sind doch alles nur Dorfgerüchte!« Ian strubbelte ihr durchs Haar. »Sowohl das mit den Mädchen als auch das mit Willy. Mal ehrlich, warum sollte Zeus unseren Milchmann umbringen?«
Auf einmal hörten sie einen Schrei.
Margaret. Ians Mutter. Geals Ziehmutter.
Ian und Geal sahen sich an. Dann rannten sie los, so schnell ihre Füße sie trugen.
Geal rechnete damit, dass Penny gestorben war. In den letzten Wochen war es ihr gesundheitlich immer schlechter gegangen. Vorgestern war sie in den frühen Morgenstunden neben ihrem Bett zusammengeklappt. Immerhin war Penny schon einundachtzig Jahre alt. Äußerlich war sie zwar topfit, aber seit ein paar Jahren war sie dement. Seit Neuestem machte ihr Herz Schwierigkeiten.
Penny McKinsey war Geals Ersatzoma. So wie Margaret McKinsey ihre Ersatzmutter war, Beatrice McKinsey ihre Ersatzschwester und Ian … Tja, Ian war für sie schon immer etwas Besonderes gewesen.
Bis vor zwei Jahren hatte Geal auch noch einen Ersatzvater gehabt. Clyde McKinsey. Nachdem der Arzt bei ihm Schilddrüsenkrebs diagnostiziert hatte, hatte er nur noch vier Monate gelebt. Clyde war der beste Freund von Geals Vater gewesen. Drei Tage nach dem Unfall ihrer Eltern und zwei Wochen vor Weihnachten war Geal vierzehn Jahre alt geworden. An diesem Tag hatte Clyde zu Geal gesagt, sie solle ihre Sachen packen, sie werde zu den McKinseys ziehen.
Ian stieß die Küchentür just in dem Moment auf, als Margaret die Whiskeyflasche auf den Tisch stellte.
»Gott … Oh Gott …«, murmelte sie.
»Was ist denn los?«, fragte Ian besorgt.
»Ian! Junge!« Mit zittrigen Fingern löste Margaret den Knoten ihrer Schürze und hängte sie über die Stuhllehne. Das Haarband, das ihre kurzen Ringellocken aus der Stirn hielt, war verrutscht, doch das schien sie nicht zu bemerken. Sie sank auf die Eckbank und klopfte auf den freien Stuhl neben sich. »Setz dich. Komm, setz dich!«
Geals Herz sackte zentnerschwer in ihren Magen. Dann hörte sie Beatrices zufriedenes Summen.
»Was ist denn los?«, fragte Ian noch einmal. »Mann, wir dachten, es wäre sonst was passiert!« Richtig böse konnte er nie sein. »Gibt’s denn etwas zu feiern?«
Beatrice tänzelte leichtfüßig durch die Küche, drehte sich einmal um die eigene Achse, schwebte dann zu ihrem Bruder hinüber und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. »Sie haben es sich überlegt! Sie nehmen mich!«
»Was? Wer nimmt dich?«
Die Kuckucksuhr schlug Viertel nach eins. Das bedeutete, dass Ian seine Mittagspause überzogen hatte. Die Zeit würde er heute Abend nachholen müssen, indem er die Kisten schrubbte, in denen der gefangene Fisch gekühlt wurde. Wenn er dann nach Hause kam, war er meistens so müde, dass er sich nur noch ins Bett legte und keinen Atemzug später zu schnarchen anfing.
»Na, die Modelagentur! Gerade hat der Postbote den Brief gebracht! Eine Zusage!«
Margaret schenkte Ian und sich Whiskey in die Gläser ein. Weder Beatrice noch Geal durften Alkohol trinken, dafür waren sie laut Margaret noch zu jung. Mit glänzenden Augen nippte sie an der bernsteinfarbenen Flüssigkeit. Geal ahnte, dass Beatrice Margarets ganze Hoffnung war, der Insel irgendwann zu entkommen. Abends betete sie vermutlich dafür, dass ihre schöne Tochter als Model durchstartete, Geld im Überfluss verdiente und die ganze Familie in die Sonne zog.
»Das ist ja großartig!« Ian drückte seine kleine Schwester an sich.
Auch Geal umarmte Beatrice. Sie freute sich aufrichtig für sie. Schon in der Schule hatte sich Beatrice mit ihrem Sinn für Mode von den anderen Kindern abgehoben. Ihr hellblondes Haar erinnerte an sonnenbeschienene Weizenfelder. Wenn sie lächelte, kräuselte sich ihre sommersprossenbetupfte Nase, was die meisten Jungs dümmlich grinsen ließ, wenn sie ihr gegenüberstanden.
»Haben wir euch erzählt, wie Beatrice sich dieser Agentur vorgestellt hat?«, fragte Margaret.
Ian und Geal grinsten sich an. Sie hatten die Geschichte schon hundertmal gehört.
Während Geal zwei tiefe Teller aus dem Schrank holte, um Ian und sich etwas Suppe aufzutun, erzählte Beatrice.
»Voilà«, begann sie. Sie liebte es, französische Wörter einfließen zu lassen. »Mindestens zwanzig Modelagenturen habe ich aufgesucht. Alle haben mich gleich an der Rezeption abgewimmelt. Bei der letzten Agentur war ich so wütend, dass ich hineingerauscht bin und der Sekretärin gegenüber behauptet habe, ich hätte einen Termin. Als ich dann vor dem Inhaber stand, habe ich gesagt: ›Sie. Wollen. Mich!‹ Und anscheinend hat ihn das beeindruckt …«
Margaret klatschte Beifall.
Ein paar Monate zuvor hatte sich Beatrice einer Modelagentur in Edinburgh vorgestellt. Dort hatte man ihr gesagt, dass ihr Gesicht nichts Besonderes sei, und sie wieder nach Hause geschickt. Alle hatten es gedacht, aber niemand hatte es ausgesprochen: Geal, das Unglückskind, war dabei gewesen. Nur deshalb war die schöne Beatrice damals gescheitert.
Laut einer der Sagen der Insel war Geal als Unglückskind geboren worden. Tatsächlich brachte sie, seit sie auf der Welt war, nur Unglück über die Menschen, die sie liebte.
Ihre Eltern waren gestorben.
Clyde, ihr Ersatzvater, war gestorben.
»Sehr gut, Beatrice. Ich bin stolz auf dich«, lobte Ian seine Schwester.
Er ignorierte den Löffel, den Geal ihm reichte, und trank die Erbsensuppe aus dem Teller. Ohne dass jemand Notiz von ihr nahm, setzte sich Geal auf die andere Seite des Tischs und löffelte still und leise ihre Portion.
»Vielleicht ist das meine Eintrittskarte in die Modewelt! Vielleicht darf ich schon bald nach Paris, Mailand oder Madrid, um dort über den Laufsteg zu schreiten und wunderschöne Kleider zu präsentieren …«
Ian lächelte stolz und erhob sich von seinem Stuhl. »Wenn das jemand schafft, dann du. Ich muss jetzt los. Bin eh schon spät dran.«
Er legte Geal eine Hand auf die Schulter, was ungewöhnlich war, denn normalerweise berührte Ian sie vor seiner Familie nicht gern. Es war ihm wohl unangenehm, und Geal akzeptierte das. Offiziell hatten die beiden nie verkündet, dass sie ein Paar waren. Ihre Beziehung war ans Licht gekommen, als Beatrice die beiden in der Scheune beim Küssen erwischt und es natürlich sofort brühwarm Margaret erzählt hatte. Die hatte Geal den Rest des Tages fast ununterbrochen an ihre voluminöse Brust gedrückt und betont, dass sie es schon länger geahnt habe.
Vor Peinlichkeit am liebsten im Erdboden versunken wäre Geal, als Margaret vor Kurzem mit ihr ein ›Frauengespräch‹ in der Wohnstube geführt hatte. Aber so weit waren Ian und sie noch nicht. Oder nein, eigentlich war es folgendermaßen: Immer wenn Geal bei Ian auf dem Dachboden schlief, sie sich lange küssten und Geal es wagte, ihre Hand unter sein Shirt wandern zu lassen, bremste er sie, knipste das Licht aus und schlief ein. Was für Geal jedes Mal einer Ohrfeige glich. Ian liebte sie, daran zweifelte sie keine Sekunde. Aber begehrenswert fand er sie offenbar nicht.
In Ian verliebt hatte sich Geal bereits am Tag ihres Umzugs. Sie hatte draußen im Hof neben ihren zwei Koffern gestanden, während Clyde mit Margaret diskutiert hatte, wo man Geal unterbringen könne. Das Haus sei nicht besonders groß, man habe keinen Platz für ein zusätzliches Kind und vor allem nicht das Geld …
Ian hatte ihre Koffer genommen und gesagt: »Geal bekommt mein Zimmer.«
»Und wo wirst du schlafen?«, hatte Margaret entgegnet.
»Auf dem Dachboden. Da lege ich mir eine Matratze hin. Außerdem kann ich nach der Schule irgendwo aushelfen und ein bisschen Geld verdienen. Komm, Geal, ich zeig dir dein neues Zimmer.«
Ja, an diesem Tag hatte Geal ihr Herz an Ian verloren. Er war der gütigste Mensch, der ihr jemals begegnet war.
»Wie geht es denn jetzt weiter?«, fragte Geal ihre Schwester.
Beatrice warf ihr langes Haar zurück. »Jetzt werde ich erst mal ein ausgiebiges Bad nehmen.«
»Aber du hattest versprochen, Geal beim Stallausmisten zu helfen«, erinnerte Margaret ihre Tochter und stemmte sich mithilfe des Tischs vom Stuhl hoch, um die Whiskeyflasche in den Schrank zurückzustellen. Ihr rechtes Bein zog sie leicht nach, weil ihre Hüfte schmerzte. Aber sie weigerte sich partout, zum Arzt zu gehen.
»Das kann ich ja jetzt wohl kaum noch!«, protestierte Beatrice. »Was, wenn ich mir einen Hexenschuss hole und ganz krumm laufe?«
»Aye, auch wahr.« Aus Leibeskräften, sodass Geal zusammenzuckte, brüllte Margaret: »Joanne! Komm her! Joanne!«
Keine Minute später eilte das Mädchen in die Küche. Vor ein paar Wochen hatte Joanne sich ihre kastanienbraunen Haare zu einem kurzen Bob schneiden lassen, dessen Spitzen bis knapp über ihre Ohren reichten. Geal hätte niemals den Mut, sich die Haare so rigoros abschneiden zu lassen, aber Joanne hatte ein schmales, hübsches Gesicht, das für diese Frisur wie gemacht war. Sie war fleißig und konnte anpacken. Das Geld, das sie sich hin und wieder bei den McKinseys verdiente, sparte sie, um sich nach diesem Sommer einen Ausbildungsplatz in einer Bootswerft in Edinburgh zu finanzieren.
»Aye?«, sagte Joanne. »Ich habe gerade die Schafe gefüttert.«
»Hättest du noch Zeit, Geal beim Stallausmisten zu helfen?«
»Klar. Ich bin eh bis abends hier. Ich wollte mit Ian überlegen, wo wir am besten das Hochbeet bauen, das du dir wünschst, Margaret.«
»Danke, Herzchen. Wie lieb von dir.«
Joanne lächelte Geal an, als wollte sie auf diese Weise sichergehen, dass auch sie, Ians Freundin, damit einverstanden war. Geal lächelte zurück. Es störte sie nicht, dass Ian und Joanne so viel Zeit miteinander verbrachten. Die beiden verstanden sich nun mal gut.
»Ich finde, wir sollten uns nach einer anderen Hilfskraft umsehen«, sagte Beatrice zu Margaret, nachdem Joanne wieder nach draußen verschwunden war. »Joanne und Ian verbringen zu viel Zeit miteinander.«
Margaret zog nur verständnislos die Mundwinkel nach unten. Geal schüttelte energisch den Kopf. »Joanne ist eine großartige Hilfe.«
»Aber sie schmeißt sich an meinen Bruder ran. Konkurrenz muss beseitigt werden. Und zwar rigoros. Hast du denn gar keinen Stolz?«
Nein, offenbar hatte Geal keinen Stolz.
»Wie du meinst.« Beatrice seufzte. »Aber sag Bescheid, wenn du Hilfe brauchst. Wenn nötig, drehe ich Joanne den Hals um und schaufle zusammen mit dir nachts heimlich ein Grab für sie.« Sie lachte über ihren Witz, seufzte dann noch einmal und blickte verträumt aus dem Fenster zur nebelumwobenen Burg. »Ich werde mir jedenfalls jetzt von Penny eine ihrer berühmten Kräutermasken anrühren lassen. Ich muss hübsch aussehen. Denn ich habe das Gefühl, ab heute ist alles möglich.«
Den Abend verbrachte Geal damit, einen Artikel über den Erfolg ihrer Schwester zu schreiben, während Beatrice mit einer schlammbraunen Maske im Gesicht neben ihr saß, sich die Nägel feilte und streng darüber wachte, dass nur das Beste von ihr erwähnt wurde.
Geal arbeitete in ihrer Freizeit für das Lokalblatt der Insel. Sie schrieb hin und wieder kleinere Berichte, um etwas zur Haushaltskasse beizutragen. Die Berichte fassten das Wenige zusammen, das auf der Insel passierte: Ein Schaf war angefahren worden. Der Gesangsverein von Buidseach lud zum Frühlingskonzert ein. In Dùn wurde ein chinesisches Restaurant eröffnet.
Zeitverzögert tauchten die Buchstaben auf dem Bildschirm des Computer-Urgesteins auf. Vor zwei Jahren hatte sich Geal den Rechner von ihrem Ersparten geleistet. Gebraucht natürlich.
»Schreib, dass ich im Schultheater immer die Hauptrolle gespielt habe«, dränge Beatrice.
»Es soll doch nur ein kleiner Artikel werden! Ich weiß doch nicht mal sicher, ob die Zeitung mir den Bericht abkauft.«
»Natürlich wird sie das! Dass es jemand aus diesem Loch geschafft hat, in einer Londoner Modelagentur aufgenommen zu werden, ist ja wohl wesentlich interessanter als der ganze Kram, der sonst berichtet wird.«
Nach Mitternacht war der Artikel fertig, und er wurde tatsächlich im Lokalblatt gedruckt.
***
Nur wenige Stunden später las Gideon Zeus den Lobgesang auf das hübsche und erfolgreiche Wundermädchen aus Buidseach und wurde so auf Beatrice McKinsey aufmerksam.