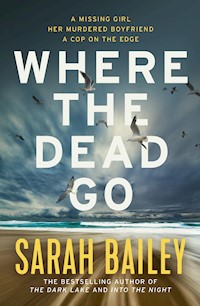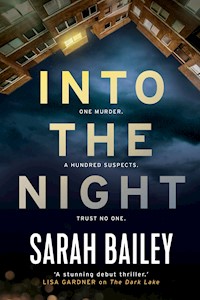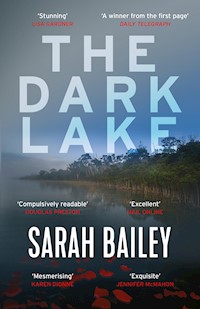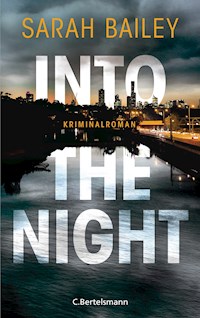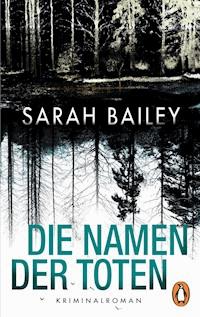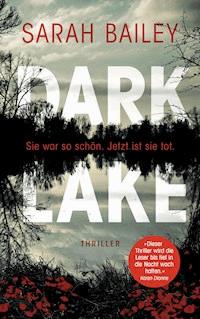
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Detective Gemma Woodstock ermittelt in Australien
- Sprache: Deutsch
Sie war so schön. Jetzt ist sie tot.
In einem Badesee bei einer australischen Kleinstadt wird die Leiche einer wunderschönen Frau gefunden. Der Tatort ist mit Rosenblättern geschmückt. Für Detective Gemma Woodstock und ihren Partner Felix McKinnon ein komplexer Fall. Denn die Tote, Rosalind Ryan, war Gemmas Klassenkameradin und immer von Geheimnissen umgeben. Alle behaupten, Rosalind geliebt und bewundert zu haben: der Direktor der Schule, an der sie unterrichtete; die Schüler, denen sie den Kopf verdrehte; ihr wohlhabender Vater und ihre drei Brüder.
Stück für Stück entfaltet Sarah Bailey in ihrem packenden Thriller die Abgründe ihrer Figuren, jede auf ihre Weise gefangen in einem Netz aus Lügen und verdrängter Schuld.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Buch
Kurz vor Weihnachten wird in einer australischen Kleinstadt die junge Highschool-Lehrerin Rosalind Ryan ermordet. Detective Gemma Woodstock hat es dabei nicht nur mit einem äußerst komplizierten Fall zu tun, sondern findet sich plötzlich mit den Schatten ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Um den Mörder ihrer ehemaligen Klassenkameradin aufzuspüren, geht die Polizistin bis an die äußersten Schmerzgrenzen und setzt alles aufs Spiel, was sie liebt.
»Ich habe DARK LAKE in einem Atemzug gelesen. Ein Thriller, der einen von der ersten Seite an packt. Sehr zu empfehlen.« Douglas Preston
Autorin
Sarah Bailey lebt mit ihren zwei Kindern in Melbourne und leitet dort eine Agentur für Kommunikation. »Dark Lake« ist ihr erstes Buch.
SARAH BAILEY
DARKLAKE
THRILLER
Aus dem australischen Englischvon Astrid Arz
C. Bertelsmann
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel The Dark Lake im Verlag Allen & Unwin, Sydney.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2017 by Sarah Bailey
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2018
beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-23241-2 V002
www.cbertelsmann.de
Für meine Söhne Oxford und Linus, die es tatsächlich geschafft haben, dass sich meine Welt größer und kleiner anfühlt, und zwar beides zugleich.
So wilde Freude nimmt ein wildes EndeUnd stirbt im höchsten Sieg, wie Feur und PulverIm Kusse sich verzehrt.
William Shakespeare: Romeo und Julia, 2. Aufzug, 6. Szene
jetzt
Wenn ich an jenen Sommer zurückdenke, macht sich etwas in meinem Kopf selbständig. So als würde eine Murmel da drin herumkullern oder als wäre mein Hirn ein Flipperautomat. Ich versuche es nicht zu lange herumrollen zu lassen. Sonst wird mir ganz komisch hinter den Augen und im Hals, und ich kriege so normale Dinge wie Kaffee bestellen oder Ben die Schnürsenkel binden nicht mehr auf die Reihe. Ich weiß, ich sollte versuchen, es zu vergessen. Nach vorn zu schauen. Den Rat würde ich jedem anderen in meiner Situation geben. Wahrscheinlich sollte ich wegziehen, weg von Smithson, aber Neuanfänge waren noch nie meine Stärke. Ich kann schlecht loslassen.
Tagsüber ist es gar nicht mal so schlimm. Wenn ich gerade mit etwas beschäftigt bin, meine Gedanken plötzlich zu ihr abschweifen, sodass mir die kleine Kugel durch den Schädel flitzt und ich mitten im Satz abbreche oder vergesse Gas zu geben, wenn die Ampel auf Grün umspringt – dann kann ich es meist abschütteln und weitermachen, als wäre nichts gewesen, ohne dass es auffällt.
Schon erstaunlich, was man alles von sich wegschieben kann, wenn man nur will.
Nur manchmal, spätabends, erlaube ich mir, an die Ereignisse von damals zu denken. Richtig dran zu denken. Dann erinnere ich mich an die mörderische Hitze. An den Irrsinn in meinem Schädel und die Angst, die in meiner Brust pochte. Und ich erinnere mich an Rosalind, natürlich. Immer wieder Rosalind. Ich liege flach auf dem Rücken, und sie erscheint an der Schlafzimmerdecke, zieht vorüber wie eine lichtlose Diashow. Ich klicke mich durch die Bilder: sie in der ersten Klasse mit hochgezogenen Söckchen; wie sie die Ayres Road zur Bushaltestelle langgeht, mit hüpfendem Ranzen; wie sie am Rand des Cricketfeldes auf dem Schulgelände eine Zigarette raucht; sie, angetrunken auf Cathy Ropers Party, die Augen mit dunklem Eyeliner umrandet.
Da ist sie auf unserem Debütantinnenball, ganz in Weiß.
Da küsst sie ihn.
Hier liegt sie mit geöffnetem Körper auf dem Obduktionstisch.
Ich könnte nicht einmal sagen, ob die Bilder aus meiner Erinnerung oder der Arbeit an dem Fall stammen. Irgendwann verschwimmt alles vor meinen Augen. Ein paarmal ist mir schon alles durcheinandergeraten, und am Ende hing Ben an der Schlafzimmerdecke, aufgesägt auf dem Obduktionstisch. Wenn es so weit kommt, stehe ich auf, mache das Flurlicht an und gehe in sein Zimmer, um nach ihm zu sehen.
Als alles vorüber war, habe ich mir gelobt, einen Neuanfang zu machen. Mich nicht mehr von der Vergangenheit erdrücken zu lassen. Aber das war ganz schön schwer. Schwerer, als ich gedacht hätte. In dem Sommer ist so viel passiert. Es lebt irgendwie in mir weiter, dreht und windet sich wie ein ungebärdiges Tier.
Komisch, aber es kommt mir fast so vor, als ob sie mir fehlen würde.
Da ist sie nicht die Einzige.
Eine Erinnerung, an deren Echtheit ich nicht zweifle, stammt aus unserem letzten Jahr Englischunterricht an der Highschool. Es war warm, und die Fenster zu beiden Seiten des Klassenzimmers standen offen. Ich spüre noch den Luftzug, der über uns hinwegstrich, während Mrs. Frisk durchs Klassenzimmer tigerte und uns mit Fragen bombardierte. Wir nahmen Shakespeare durch, Romeo und Julia. Dieser Kurs war anders als die Englischkurse in früheren Klassen. Wenn man es so weit gebracht hatte, war man ernsthaft bei der Sache. Selbst die Jungs passten normalerweise auf. Niemand kicherte bei den Liebesszenen, wie in den Jahren zuvor.
Rose saß immer vorne, ihr Rücken, über den sich das wallende goldblonde Haar ergoss, kerzengerade nach Jahren des Ballettunterrichts. Ich saß immer in Türnähe auf der anderen Seite des Raums. Von dort konnte ich sie ansehen. Ihre perfekten Bewegungen beobachten.
»Was meinen Sie, worauf Shakespeare mit der Zeile hinauswill: ›So wilde Freude nimmt ein wildes Ende‹?« Auf Mrs. Frisks Stirn standen Schweißperlen, während sie den Seitengang abschritt und dabei immer mal wieder durch Sonnenflecken trat.
»Na ja, es ist eine Vorausdeutung, oder?«, schlug Kevin Whitby vor. »Man weiß, dass sie von Anfang an dem Untergang geweiht sind. Shakespeare will, dass man es weiß. Er hat gern solche Warnungen eingesetzt, um die richtige Stimmung zu schaffen. Heutzutage würde er saugeile Anti-Drogen-Werbekampagnen schreiben.«
Verhaltenes Gelächter blubberte in der Klasse auf.
»Sicher, es ist eine Vorwarnung, aber ich finde nicht, dass er meint, sie sollten aufhören.«
Alle horchten auf, betört von Roses honigsüßer Stimme. Selbst Mrs. Frisk blieb stehen.
Rose beugte sich über ihr Notizheft. »Ich meine, Shakespeare schreibt weiter: ›Und stirbt im höchsten Sieg, wie Feur und Pulver/Im Kusse sich verzehrt.‹ Womit er eigentlich sagt, dass nichts folgenlos bleibt. Und nicht unbedingt, dass es das nicht wert ist. Ich glaube, er deutet an, dass es sich manchmal trotzdem lohnt, etwas Bestimmtes zu tun.«
Mrs. Frisk nickte begeistert. »Da hat Rose ein wichtiges Argument beigesteuert. Shakespeare hatte es sehr mit den Folgen von Handlungen. In all seinen Stücken geht es um Figuren, die das Für und Wider abwägen und sich für eine bestimmte Handlungsweise entscheiden, je nach Einschätzung der Lage.«
»Meistens waren das keine so tollen Entscheidungen«, sagte Kevin. »Die hatten alle kein besonderes Urteilsvermögen.«
»Das sehe ich anders.« Rose sah Kevin mit einem Blick an, der sich weder als freundlich noch als genervt einordnen ließ. »Romeo und Julia sind von Anfang an mit ganzem Herzen dabei, obwohl sie wissen, dass es wohl kaum ein gutes Ende nehmen wird.« Sie lächelte Mrs. Frisk zu. »Diese Überzeugung finde ich bewundernswert. Außerdem kann es gut sein, dass das Glück, das sie in ihrer kurzen gemeinsamen Zeit genießen, alles andere Glück überwiegt, das sie eventuell empfunden hätten, wenn sie eine volle Lebensspanne getrennt voneinander verbracht hätten.« Sie zuckte anmutig mit den Schultern. »Aber wer weiß. Vielleicht sehe nur ich das so.«
Ich denke oft an diesen Tag zurück. Die frische, balsamische Luft, die zu den Fenstern hereinströmte, während wir über die Geschichte zweier Liebender diskutierten. Rose von der Sonne angestrahlt, ihr schönes Gesicht, das nichts preisgibt. Ihre feingliedrigen Hände, die emsig mitschreiben, ihre makellose Handschrift, verglichen mit meinem plumpen Gekrakel. Schon damals war sie mir ein Rätsel, das ich lösen wollte.
Es gab ein paar Minuten, in denen ich im Obduktionsraum mit ihr allein war. Das war ein aufwühlendes Gefühl. Wie nicht ganz da. Ehe ich mich bremsen konnte, beugte ich mich nah zu ihr vor und sagte ihr alles. Die Worte strömten unaufhaltsam aus mir heraus, und sie lag einfach nur da. Die langen feuchten Haare hingen über den Stahltisch hinab, die glasigen Augen starrten blind zur Decke. Sie war immer noch so schön, selbst im Tod.
An jenem Morgen wirbelten unsere Geheimnisse ungezügelt durch das hell ausgeleuchtete weiße Zimmer. Während ich auf den Hacken wippend neben ihr stand, wusste ich, wie weitgehend ich da wieder drinsteckte, wie umfassend ihr Tod mir schaden konnte. Ich warf einen letzten langen Blick auf Rosalind Ryan, bevor ich einmal tief Luft holte, mich wappnete – und mich dann doch wieder von ihr in ihre Welt ziehen ließ, in der ich immer tiefer versank, bis ich vollständig, komplett untergegangen war.
Erstes Kapitel
Samstag, 12. Dezember, 7.18 Uhr
Connor Marsh joggt entspannt am Ostufer des Sonny Lake entlang. Rasch ein Blick auf die Uhr: Er legt ein tolles Tempo vor, und es fühlt sich gut an, draußen an der frischen Luft zu sein. Die Kinder waren heute früh völlig außer Rand und Band; waren um sechs aufgewacht und tobten immer noch wie aufgezogen durchs Haus, als er eine Stunde später rausging. Das Haus ist viel zu klein für zwei kleine Kinder, erst recht Jungs, denkt er. Und Mia war so was von mies drauf. Unfassbar, dass sie ihn wegen des Angelausflugs am nächsten Wochenende angeraunzt hat. Er war schon ewig nicht mehr von zu Hause weg, bringt die Jungs jetzt seit über zwei Jahren jeden Samstagmorgen zum Australian Football oder Fußball. Connor verzieht das Gesicht, ärgert sich, wie irrational sie sein kann.
Seine Füße stampfen in gleichmäßigem Rhythmus über den unbefestigten Weg. Eins, zwei, eins, zwei. Connor ertappt sich oft selbst beim Zählen, wenn er versucht, nicht zu viel ans Laufen zu denken. Die Beinmuskeln brennen mehr als früher, und sein einer Knöchel ist auch nicht mehr der alte, seit er vor ein paar Jahren bei der Arbeit von der Leiter gefallen ist. Aber jedenfalls ist er immer noch fitter als die meisten in seinem Alter. Und er hat noch keinen Haarausfall. Grund genug, dankbar zu sein.
So allmählich wacht der Tag richtig auf. Durch die dichten Wipfel der Eukalyptusbäume sieht Connor schon die Sonne funkeln. Das wird wieder ein heißer Tag. Die Vögel trällern auf ihren Logenplätzen, und über dem See klart es langsam auf, der Nachtdunst verzieht sich. Connor seufzt. Heute bringt er die Jungs um zehn zur Feier eines fünften Geburtstags, dicht gefolgt von der Geburtstagsparty eines Siebenjährigen am Nachmittag. Tja, Wochenenden sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Was würde er nicht dafür geben, wenn er sich einfach nur ein Bier aufmachen und in Ruhe Cricket schauen könnte.
Connor tritt schwer auf einen Zweig, der hochschnellt und ihm das Schienbein aufkratzt.
»Mist.« Er stolpert, fängt sich wieder. Die Wunde, ein feiner roter Riss, schmerzt. Keuchend verlangsamt er das Tempo. Eine zweite Runde um den See schenkt er sich jetzt; er muss sowieso wieder nach Hause und helfen, die beiden für ihren Party-Marathon fertig zu machen. Die Hände in die Hüften gestemmt und stoßweise durch den Mund atmend, geht er weiter, während sich sein Herzschlag beruhigt.
Eine Ente segelt mit weit ausgebreiteten Flügeln tief über der Wasseroberfläche. Das Seeufer ist mit Müll gesprenkelt. Chipstüten und Colaflaschen kleben an den Steinen und Ästen im Wasser. Durch die Hitze hat sich der See von seinem Ufer zurückgezogen. Baumwurzeln liegen bloß wie Stromkabel. Connor lässt den Blick übers Wasser schweifen. Er sollte wirklich öfter hier joggen, es sich wieder regelmäßig angewöhnen. Er weiß noch, wie er vor Jahren hier für Leichtathletik trainiert, vor der Schule seine Runden gedreht hat, wie die Oberschenkel brannten. Er sieht das gähnende Loch des Regenwasserabflusses, stockfinster gegen das blendende Licht, wie es in der Lehmwand des Sees verschwindet. Ein Stückchen weiter weg fällt Connor etwas auf, das am Wasserrand hängen geblieben ist; es scheint aus einer Art Stoff zu sein. Er kneift die Augen zusammen und merkt, dass er Haar sieht, das sich am Rand eines Schilfgürtels entlang auffächert. Er stemmt die Füße in den Boden. Es sieht aus wie Menschenhaar, blondes Frauenhaar. Sein Herz schlägt wieder schneller. Arme und Beine fühlen sich hohl an. Zwei Schritte weiter, und er findet bestätigt, dass wirklich eine Frau bäuchlings im See liegt. Mit jedem Wellenplätschern kommen die bloßen weißen Arme zum Vorschein, und langstielige rote Rosen schwimmen zuoberst auf ihrem nassen Grab.
Unter der alten Holzbrücke schauen ein paar Schwäne zu Connor her. Einer von ihnen stößt einen leisen, gespenstischen Schrei aus.
Connor geht in die Knie und fürchtet kurz, sich übergeben zu müssen. Sein Atem wird erst langsamer, dann wieder schneller. Nach einem weiteren Blick auf die Leiche wendet er sich abrupt ab. Ohne lange nachzudenken, wählt er dreimal die Null und drückt sich das Handy ans Ohr.
Zweites Kapitel
Samstag, 12. Dezember, 7.51 Uhr
Ich stehe in der Dusche, die Stirn gegen die Wand gepresst, während das Blut aus mir rinnt. Ohne es genau zu wissen, hatte ich angenommen, dass ich etwa in der sechsten Woche war. Ich frage mich, ob meine ablehnende Haltung dazu geführt hat; dass ich es absolut nicht wahrhaben wollte. Sondern nur verzweifelt gehofft habe, dass es nicht so sei. Das Blut mischt sich mit dem Wasser, ehe es den Abfluss hinabrinnt, und ich kneife die Augen zusammen und wünsche, ich wäre wieder ein kleines Mädchen, gut zugedeckt im Bett, während meine Mutter mir mit ihren weichen Lippen einen Kuss auf die Stirn drückt.
Herrje, wie sie mir fehlt.
Scott ist heute Morgen früh aus dem Haus gegangen, um den Stoßverkehr zu meiden. Er hat ein paar Wochen Betonierarbeiten auf einer Großbaustelle am Nordrand von Paxton an Land gezogen, einer Stadt etwa dreißig Kilometer östlich von Smithson. Ben ist bei meinem Vater; er hat dort übernachtet, weil wir heute beide so früh los müssen. Im Moment wird Dad vermutlich als Trampolin herhalten müssen. Ben ist morgens immer so verschmust.
Ich höre mein Handy läuten, rühre mich aber nicht. Die kühlen Fliesen fühlen sich fest und beruhigend an meiner Haut an, wenn ich die Handflächen zu beiden Seiten des Kopfes daranlege. Versuche, mich zu sammeln. Mich normal zu fühlen. Nach ein paar Minuten hebe ich den Kopf. Es dauert etwas, bis sich meine Augen ans Licht gewöhnen. Mein Unterleib schmerzt, ein tief sitzender Schmerz.
Ich bin erschöpft. Fühle mich losgelöst von meinem Körper. Von meinem Geist.
Ich weiß, ich sollte wahrscheinlich ins Krankenhaus, aber ich weiß auch, dass ich es wahrscheinlich lassen werde.
Im Bad ist es diesig vom Wasserdampf. Die Blutung scheint nachzulassen. Ich wasche mich vorsichtig und drehe den Hahn ab. Die Rohre zittern in den Wänden. Ich trete aus der Dusche und wickele mich in ein dunkelgraues Handtuch. Ein Blick in den Spiegel zeigt mir nur einen verschwommenen Umriss im Wasserdampf. Im Schlafzimmer werfe ich die Decken quer übers Bett und kicke einen Pantoffel drunter, halte kurz inne, um nach Luft zu schnappen und mich zu krümmen, während mich wieder der stechende Schmerz durchzuckt. Ich ziehe mich hastig an, stecke eine Binde in den Slip, bevor ich meine schwarze Jeans, ein einfaches graues T-Shirt und schwarze Boots überziehe. Es wird immer heißer, und die Resthitze von gestern hängt noch unangenehm zwischen den Wänden. Ich schenke mir ein Glas Wasser ein und schlucke ein paar Schmerztabletten. Dann starre ich die Wand an und denke an all die unerledigten Dinge, die dieser Tag bringen wird: Papierkram, ein paar Berichte schreiben, ein alter ungelöster Fall, den ich für Jonesy überprüfen soll. Ich denke an meinen kleinen Schreibtisch mitten im Hauptdienstzimmer des Reviers und wünschte, ich hätte ein eigenes Büro. Mein Handy klingelt wieder, als ich mein Haar mit dem Handtuch rubbele: Es ist Felix, und ich sehe seinen Namen auf dem Display und denke an so einiges.
»Jawoll, hey.« Ich bemühe mich, unbeschwert zu klingen. »Bin schon unterwegs. Geh gleich aus der Tür.«
»Fahr direkt zum See, Gem«, sagt er; wie ich es liebe, wenn sich sein Akzent um meinen Namen legt.
Ich versuche den Sinn seiner Worte zu verstehen. »Warum? Was ist passiert?«
»Sie haben eine Leiche gefunden. Es ist eine Lehrerin aus Smithson, eine Rosalind Ryan.«
Das Zimmer kippt zur Seite weg. Ich lasse mich schwer aufs Bett fallen, greife mir an die Kehle und zwinge mich, weiterzuatmen. Felix redet weiter, ihm ist nichts aufgefallen. »Offenbar ist sie auch hier zur Schule gegangen. In deinem Alter. Wahrscheinlich hast du sie gekannt.«
*
Eingebettet zwischen steil aufragenden Höhenzügen, ist Smithson eine kleine grüne Oase inmitten endloser fahler Flächen australischen Farmlands. Es ist dafür bekannt, dass es den »Regen fängt«, der von den Bergen kommt; eigentlich absurd, weil die Farmen drum herum den viel dringender bräuchten. Im letzten Jahrzehnt hat es sich grundlegend verändert. Carling Enterprises, eine größere Konservenfirma, hat in den späten neunziger Jahren, gerade als ich mit der Schule fertig wurde, am Stadtrand eine Fabrik errichtet. Das massige silberfarbene Gebäude sieht zwar schon jetzt ziemlich veraltet aus, aber dort herrscht reger Betrieb. Es saugt die Felder und Plantagen der Umgebung aus, zieht das Obst von den Bäumen und das Gemüse aus dem Boden und spuckt dafür über zehn Millionen Dosen mit konservierten oder eingemachten Feldfrüchten aus. Dank dieser Produktivität hat Smithson langsam, aber sicher seine ursprünglich bescheidene Einwohnerzahl von knapp fünfzehntausend auf fast dreißigtausend verdoppelt. Fabrikarbeiter, Lkw-Fahrer, Ingenieure, Lebensmitteltechniker, Werbefritzen: überall neue Gesichter. Plötzlich vermehrte sich so einiges in Smithson, dieser Arche-Noah-Stadt, die sich immer gerühmt hatte, von allem zwei zu besitzen. Jetzt gibt es fünf Bäckereien, und das allein in der Innenstadt. Jemand hat mir gesagt, dass die Firma Carling es auf der ganzen Welt so macht: lässt sich in ländlichen Regionen nieder, wo das Bauland billig ist und man leicht an Genehmigungen kommt, nistet ihren Betrieb in einer Gemeinde ein und krempelt Landschaft und Gemeinwesen komplett um. Ehrlich gesagt hatte Smithson wohl schon einen kleinen Tritt in den Hintern nötig, aber es kann einen auch beunruhigen, die Riesenlaster, unter deren Gewicht die Straßen ächzen, in unsere kleine Welt einbrechen zu sehen, jeder mit seiner Abgasfahne hinter sich.
Östlich der Stadtmitte liegen ein großer See, umgeben von dichtem Buschland, und ein beliebter Stadtpark. Sonny Lake heißt zwar eigentlich Smithson Lake, wird aber von keinem so genannt. Warum, weiß ich nicht, aber so lange ich zurückdenken kann, ist es der Sonny Lake. Selbst auf den Hinweisschildern steht Zum Sonny Lake. Meine Eltern haben dort in den siebziger Jahren mit einer sehr hippiemäßig angehauchten Feier geheiratet. Auf meinem Nachttisch steht ein Foto von Mum als Braut, unmittelbar nach ihrer Trauung aufgenommen. Sie hat Gänseblümchen im Haar und ein Glas Bowle in der Hand und sieht aus wie zwölf.
Der See grenzt an die Rückseite der städtischen Highschool. Als Grundschülerin bin ich mit Mum hergekommen, um die Enten zu füttern und im Gras nach vierblättrigen Kleeblättern zu suchen. Als ich dann auf der Highschool war, gingen wir an den See, um Zigaretten zu rauchen, geklauten Alkohol zu trinken und mit Jungs zu knutschen. Der alte Pavillon am Ende einer Brücke lieferte das perfekte Setting für eine Geisterstunde, und der alte Holzturm auf der Lichtung nebenan gab einen einwandfreien Beobachtungsposten ab, um Schmiere zu stehen. Am oberen Ende der knarzenden gewundenen Treppe erreichte man einen Ausguck, von dem aus man den gesamten See und den Haupt-Highway sehen konnte, ganz bis zur Highschool. Es war auch ein Superversteck. Vor seinem Tod verbrachten Jacob und ich viele Stunden hier oben mit Reden, Küssen und mehr. Ich schließe kurz die Augen und sehe sein junges Gesicht vor mir. Er kommt mir jetzt so weit weg vor.
Normalerweise bin ich darauf bedacht, diesen Ort zu meiden.
*
Am Sonny Lake wimmelt es schon von Polizisten, die gerade mit einem Absperrband neugierige Passanten verbannen. Im Sommer ist der See ein beliebter Treffpunkt, und vor etwa zwei Jahren ließ der Gemeinderat einen dieser modernen Spielplätze mit abgerundeten Kanten am Nordende des Parks zusätzlich zum altersschwachen im Westen bauen, aber ich habe mir noch nie einfallen lassen, mit Ben herzukommen; hier lauern viel zu viele Erinnerungen für einen Sonntagnachmittagsausflug zum Spielplatz.
Leute in Joggingklamotten stehen in der Nähe beieinander und unterhalten sich leise, als ich vorbeigehe. Dann entdecke ich ihn. Detective Sergeant Felix McKinnon, mein Partner. Alles in mir blubbert weich, und wie immer kann ich nur staunen, was für eine Wirkung er auf mich hat. Mit gerunzelter Stirn bückt er sich zu einem Mann von der Spurensicherung, der direkt neben dem Weg auf dem Boden herumpinselt. Etwas weiter weg, beim Schilf, sehe ich eine weiße Plane. Casey, unser Fotograf, steht links davon und knipst wie wild drauflos.
Dass Rosalind Ryan tot ist, lasse ich langsam in mein Bewusstsein einsickern. Mit jähem Schrecken fällt mir auf, dass ich endgültig erwachsen bin. Ich weiß noch, wie sich ihr Sommerschulkleid an ihre kurvenreiche Figur schmiegte. Und wie mir meine eigene Uniform bis unter die Knie hing, wie ich versuchte, sie an Taille und Saum abzustecken, damit sie mehr wie ihre aussah. Ich atme tief ein und langsam aus. Auf dem Weg zum See hinunter setze ich eine neutrale Miene auf und versuche die altbekannten Bilder von Rosalind wegzuschieben, die sich in mein Gesichtsfeld drängen wollen. Ich versuche alles auszublenden. Die Sonne bricht durch die letzten Wolken und sengt wie Feuer. Die Luft ist geladen. Trocken. Wir werden uns beeilen müssen. Sie rasch von hier wegbringen.
»Hallo«, sage ich.
»Hey.« Felix schaut lächelnd zu mir hoch und blinzelt in die Sonne. »Alles okay?«
Weiße Flecken tanzen mir vor den Augen. »Jap.« Ich schüttele seine Frage mit einem Schulterzucken ab und zeige auf die weiße Plane. »Was meinst du?«
»Schwer zu sagen. Wir haben sie durch ein Portemonnaie in ihrer Jacke identifiziert, in dem ein Schulbüchereiausweis war. Sonst hatte sie nichts bei sich, bis auf ihre Schlüssel, ebenfalls in der Jacke. Handy oder Tasche konnten wir noch nicht finden.« Er wischt sich die Stirn, auf der schon der Schweiß steht. »Scheiße, ist das heiß.« Felix versucht immer noch, sich an die brutale Hitze zu gewöhnen, die Smithson jedes Jahr um Weihnachten herum heimsucht. »Sie war im Wasser, als der Mann sie gefunden hat, aber Anna glaubt nicht, dass sie ertrunken ist. Sondern dass sie erdrosselt wurde. Sie hat allerdings auch eine üble Kopfwunde. Keine sichtbaren Stichverletzungen oder Schusswunden. Natürlich kriegen wir mehr heraus, wenn wir sie von hier wegbringen.« Er rappelt sich auf. Ein paar graue Haare glitzern an seinen Schläfen. Als er mir in die Augen sieht, zeigen sich Krähenfüße. Ich wende den Blick ab, solange es noch geht.
»Und hast du sie gekannt? Aus der Schule?«, fragt er.
Ich nicke und schaue auf die Wasserfläche hinaus. Zwei Enten dümpeln nebeneinander her, die Köpfe schön gezeichnet, wie Theatermasken.
»Sie ist nicht der Typ, den man vergisst.«
»Ja, das hab ich mir gedacht. Aber wart ihr befreundet?«
»Das war auf der Highschool! Wir waren alle mal befreundet, mal zerstritten. Du weißt schon, wie das in dem Alter so ist.«
Er runzelt die Stirn und scheint etwas anderes sagen zu wollen, also schneide ich ihm rechtzeitig das Wort ab. »Felix, ist das unser Fall?«
Er sieht mich immer noch neugierig an, sagt aber: »Ich glaub schon. Ich war da, als der Anruf kam, und Jonesy hat mich gebeten, dich anzurufen. Matthews könnte vielleicht rummotzen, aber ja, der gehört schon uns, denke ich.«
Ich werde von einem wohlbekannten Sog ergriffen. Ein neuer Fall. Die Räder in meinem Kopf beginnen zu schnurren, während ich damit anfange, mir Optionen zurechtzulegen. Aber da liegt doch Rosalind Ryan tot im Wasser, denke ich. Sie ist es. Meine sonst so funktionstüchtigen Hirnwindungen kommen nicht vom Bild ihres Gesichts los, das wie bei einer Fehlschaltung auf einem defekten Computerbildschirm flackert. Hinter uns klickt Caseys Kamera in einem festen Rhythmus, der sich mir in die Gehörgänge bohrt. Bewusst hole ich ein paarmal tief Luft und sage dann: »Gut. Ich will den Fall wirklich gerne übernehmen. Weißt du –«, und damit drehe ich endlich den Kopf, um Felix in die Augen zu sehen, »– ich hab sie ein bisschen aus der Schule gekannt, aber das ist kein Thema. Echt nicht.« Ich versuche den pochenden Schmerz in meinem Unterleib zu ignorieren. »Also, wer hat sie gefunden?«
»Der Typ da drüben neben Jimmy. Er war auch auf der Smithson High, ist aber wohl etwas älter als du. Er ist ziemlich durch den Wind. Seine Frau holt ihn bald ab. Er heißt Marsh.«
Ich sehe den gut gebauten Mann in Joggingkleidung an, der neben Jimmy, einem unserer Streifenpolizisten, auf einer Parkbank sitzt. Das muss der ältere Bruder von Philip Marsh sein. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen.
»Ich geh und rede mit ihm.«
»Okay. Mach nicht zu lange – wir müssen sie uns ansehen, bevor wir hier abhauen.«
Ich gehe zu unserem Zeugen rüber und versuche mich an seinen Namen zu erinnern. Spencer? Cooper? Irgendwas in dem Dreh. »Guten Tag.«
Jimmy und der Mann sehen zu mir hoch.
»Ich bin Detective Sergeant Gemma Woodstock.«
Jimmy lächelt mir kurz zu. »Das ist Connor Marsh. Er hat heute Morgen die Leiche gefunden. Als er seine Runden um den See lief.«
»Guten Tag, Mr. Marsh«, sage ich.
»Um ehrlich zu sein, ich bin nur eine gejoggt. Eine Runde. Bin nicht mehr so fit wie in meiner Jugend.« Dabei sieht er mich nicht an, sondern hält den Blick auf einen Stock zu seinen Füßen gesenkt, den er mit den Schuhen hin und her schiebt.
»Erzählen Sie mir, wie es war, als Sie die Leiche entdeckt haben«, sage ich.
Er tritt wieder gegen den Stock. »Ach Gott, das war so unheimlich. Sie wissen schon.« Er sieht wieder zu mir hoch, und etwas wie Wiedererkennen blitzt in seinem Blick auf. Mit ziemlicher Sicherheit habe ich ihn beim Gewichtheben im Fitnessstudio hinter der Bücherei gesehen, als ich mit der Schule fertig war und anfing, dorthin zu gehen. Er kneift die Augen zusammen und wendet den Blick Richtung See. »Ich bin gejoggt. Gleich da unten, um die Kurve.« Er zeigt auf eine Wegbiegung unten, etwa zwanzig Meter von Rosalinds Leichnam entfernt. »Ich hab an nichts gedacht. Also an nichts Bestimmtes, Sie wissen schon. Bin bloß so gelaufen. Gerade hatte ich mir überlegt, dass ich nicht noch eine Runde drehen wollte, und bin langsamer geworden, da hab ich sie im Wasser gesehen.« Er atmet geräuschvoll aus. »Erst hab ich nicht gewusst, was es war. Hab mir gedacht, vielleicht Müll oder so. Und dann ist mir plötzlich irgendwie in einer grusligen Eingebung aufgegangen, was ich da gesehen hab. Ich bin total ausgeflippt.« Connor streicht sich die Haare aus der Stirn und fährt fort: »Ich hab gehört, wie ein Polizist gesagt hat, dass sie Lehrerin an der Schule ist.«
Ich erwidere seinen Blick, sage aber nichts und setze eine unbewegte Miene auf.
»Die kenne ich. Sie war dort auch Schülerin, genau wie wir. Und was für eine hübsche.« Connor sieht mich an. »Wahrscheinlich Ihre Stufe, oder?«
Jimmys Kopf ruckt in meine Richtung. Ich beachte ihn nicht.
»Connor, ist Ihnen heute Morgen sonst jemand aufgefallen? Irgendwer, der sich hier aufhielt? Jede noch so kleine Einzelheit, an die Sie sich erinnern, kann hilfreich sein.«
Er blickt wieder zu Boden. Ich bemerke die Spitze eines Tattoos, die sich aus seiner Sportsocke schlängelt. Sieht aus wie das Emblem des Smithson Saints Football Clubs. »Ich glaub nicht, dass ich irgendwen gesehen hab. Vielleicht war da eine junge Frau in ihrem Auto, als ich auf dem Parkplatz ankam. Die telefoniert hat. Daran kann ich mich wohl schon erinnern.«
»Sonst noch was?«, setze ich nach.
»Eigentlich nicht. Nicht richtig. Irgendwann muss ich an einem vorbeigelaufen sein, der seinen Hund ausgeführt hat. Jedenfalls glaub ich, dass es ein Mann war. Vielleicht älter. Sorry, es war ziemlich früh, und ich hab nicht drauf geachtet.«
»Schon gut. Wenn Ihnen noch irgendwas einfällt, melden Sie sich einfach.«
»Haben die Blumen irgendwas zu bedeuten?«
»Die Blumen?«
Connor nickt. »Ja, um sie rum schwammen Blumen im Wasser. Sahen aus wie Rosen.«
Jimmy und ich werfen uns einen Blick zu. Er zuckt unmerklich mit den Schultern. »Das können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen. Natürlich werden wir alles genau untersuchen.« Ich höre mich aalglatt an, auch wenn ich innerlich koche.
»Kann ich bald gehen? Meine Frau kommt mich holen, aber mit den Kindern, also warte ich besser am Parkplatz auf sie.« Er wirft noch einen Blick auf den Tatort und fröstelt trotz der Hitze. »Nicht hier.«
»Kein Problem, Kumpel, ich begleite Sie.«
Jimmys Gelassenheit hat immer etwas Beruhigendes. Er wäre ein toller Sprecher für Werbefilme, zum Beispiel, wenn es um den Verkauf von Lebensversicherungen geht.
»He, Connor, nur eins noch«, sage ich, als sie aufstehen. »Sie haben den Leichnam nicht angefasst, oder?«
»Ach was. Ich bin nicht mal besonders nah rangegangen. Ehrlich gesagt, kann ich mit so was nicht gut umgehen.«
»Völlig in Ordnung, Kumpel, völlig in Ordnung«, sagt Jimmy und bringt Connor weg.
Ich wippe auf den Fußballen und sehe mir den Fundort noch einmal genau an. Ein paar junge Mädchen mit neonfarbenen Laufschuhen und schwarzer Lycrakleidung halten einander mit aschfahlen Gesichtern umklammert. Wahrscheinlich gehen sie auf die Highschool von Smithson, denke ich und verziehe das Gesicht. Ein paar Mütter schubsen vorsichtig ihre Kinder auf den Schaukeln an und helfen ihnen lustlos die Rutsche rauf und runter, während sie den Blick fest auf die Vorgänge am Seeufer gerichtet halten. Ich höre das Brummen eines näher kommenden Hubschraubers. Das Journalistenpack. Wir müssen uns ranhalten.
Als Felix mich kommen sieht, löst er sich von der Spurensicherung und zieht fragend die Augenbrauen hoch.
»Der Typ ist sauber«, sage ich ihm. »Hat nichts gesehen, weiß nichts. Wir holen ihn heute später am Tag oder morgen rein, um alles aufzunehmen, und klären das Alibi mit seiner Frau ab, aber der wird uns kaum weiterbringen.«
»Hätte ich auch nicht erwartet«, sagt Felix. »Na, dann komm, reden wir mit Anna und bringen es hinter uns, damit wir loslegen können.«
»Genau mein Gedanke.«
Wir lächeln uns kurz zu, während wir an den Steinen entlang zu der Stelle gehen, wo der Schilfgürtel beginnt. Ich sehe die dunkle Öffnung der Abflussröhre und werde das Gefühl nicht los, dass uns jemand von dort beobachten könnte.
»He«, sage ich zu Felix und schüttele die Paranoia ab. »Was soll das mit den Blumen? Connor Marsh hat gesagt, dass ihr ganzer Körper davon bedeckt war.«
»Genau«, sagt er und wendet mir den Kopf zu, damit ich ihn besser hören kann. »Langstielige rote Rosen schwammen überall um sie rum auf der Wasseroberfläche. Scheißgruselig.«
Ich male es mir aus, denke kurz, wie umwerfend sie von Rosen bedeckt unter anderen Umständen ausgesehen hätte, und gehe weiter hinter Felix her. Plötzlich werde ich von einem so heftigen Gefühlsschub überrollt, dass ich schon fürchte, gleich ins Wasser zu fallen. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Ich konzentriere mich auf meinen aufrechten Gang, halte den Blick fest auf Felix’ Hinterkopf gerichtet und atme tief durch.
Graues Wasser schwappt leicht an die braune Erde unter meinen Boots, und dann sehe ich es: ein Fuß, blass und wie nicht von dieser Welt, der unter der Plane hervortreibt. Mir fällt ein, wie ich Rose an einem Tag des Schwimmsports auf dem Sockel am Ende unseres städtischen Schwimmbads beobachtet habe, die zierlichen Füße nebeneinander aufgepflanzt, während sie sich tief bückte und die Schwimmbrille aufsetzte, bereit machte zum Sprung ins Wasser.
»Hey, Gem!« Annas Kopf taucht auf der anderen Seite der Plane auf.
»Hallo, Anna«, sage ich, schirme das Gesicht mit einer Hand vor der Sonne ab, mache einen großen Schritt über eine dreckige Plastiktüte und schlage mich seitwärts am Wasserrand entlang bis zu ihr durch.
Anna steht in ihrer wasserdichten Arbeitskleidung knietief im See und sieht wie eine Astronautin aus. Dass sie schwitzt, ist nicht zu übersehen; ihr Gesicht ist gerötet, und der Pony klebt ihr strähnig an der Stirn.
»Na dann«, sagt sie, als wir nahe genug gekommen sind. »So, ihr beide wisst ja, wie’s läuft. Wir haben den Leichnam einer Achtundzwanzigjährigen. Laut ihrem Personaldokument, einem Bibliotheksausweis für Lehrer des Smithson Secondary College, hätte sie am ersten Weihnachtstag Geburtstag gehabt. Sie ist seit mindestens fünf Stunden tot, aber es könnten auch bis zu zehn sein, schwer zu sagen durch das Wasser. Ich kann den Todeszeitpunkt erst später näher eingrenzen. Wie ich schon vorhin zu McKinnon gesagt habe, glaube ich, dass sie tot war, bevor sie im Wasser landete. Sie hat eine große Schläfenwunde. Ich schätze, dass sie ihr mit einem großen Stein oder einem scharfkantigen Gegenstand zugefügt wurde, doch das wird sich bei der Obduktion klären lassen. Es könnte Erd- oder Kiespartikel geben, die auf die Waffe hinweisen. Aufgrund der Flecken am Hals würde ich sagen, dass sie außerdem gewürgt wurde, und selbstredend will ich auch eine toxikologische Untersuchung. Ich würde auf eine Beziehungstat tippen. Oder einen Raubüberfall, besonders, wenn ihre Brieftasche fehlt.« Anna schiebt sich das feuchte Haar aus den Augen. »So oder so, schön ist das nicht. Es sieht ganz danach aus, dass es auch zu einem sexuellen Übergriff kam: Ihre Unterwäsche fehlt, und sie hat einige Prellungen an Oberschenkeln und Oberarmen. Aber Selbstmord und Unfalltod kann ich zweifelsfrei ausschließen. Wir haben es hier mit einem Tötungsdelikt zu tun.«
Ich sehe Felix an. Er blickt auf Rosalind hinab, wie es aussieht, tief in Gedanken versunken.
Anna macht den Kriminaltechnikern Zeichen, damit sie Rosalinds Leichnam abtransportieren. Die Journalisten sind da und schleichen wie hungrige Löwen am Absperrband entlang. Ich sehe den schwarzen Puschel eines Mikrofons über den Köpfen der kleinen Menge entlangwandern. Eine Kameralinse funkelt auf. Geglättete, telegene Haare werden über Schultern zurückgeworfen.
Na toll, das Letzte, was ich heute brauchen kann, ist ein Zusammenstoß mit der rasenden Kleinstadtreporterin Candy Fyfe.
Anna stemmt die Hände in die Hüften. »Also, Leute, ich bin hier fertig. Wir haben alle Aufnahmen gemacht und alles eingetütet. Auch wenn ich keine großen Hoffnungen hege. Schließlich liegt überall verdammter Müll rum. Und Wasser ist immer ein Problem.«
»Sicher, besser wär’s, wenn jeder an einem ruhigen Tag mitten auf einem großen Sportplatz ermordet würde«, lässt Roger fröhlich verlauten. Er ist unser dienstältester Techniker, gehört seit fast vierzig Jahren der Polizei von Smithson an und hat ein unerschütterlich sonniges Gemüt, wie die Lage auch sein mag. Ich stelle mir oft vor, wie er zu Hause seiner Frau vergnügt von seinen Fällen berichtet: »Ja, die tote junge Frau wurde erwürgt, kaltblütig ermordet, so wie’s aussieht. Reichst du mir bitte das Salz, Liebling?«
Roger und Fred, unser anderer Techniker, ziehen die Plane weg und schieben Rose die Trage vorsichtig von links unter. Über uns schwebt der Bauch eines tieffliegenden Hubschraubers, und ich trete an ihre rechte Seite, um die Leiche vor Blicken abzuschirmen. Rose wird auf die weiße Liegefläche gezogen. Ihr Gesicht sieht genauso aus wie in meiner Erinnerung, mit der Schönheit einer Disney-Prinzessin, deren ebene Züge geduldig auf den Kuss eines Prinzen warten. Als ich vor ein paar Jahren hörte, dass sie nach Smithson zurückgekehrt sei und als Lehrerin an der Schule arbeite, war ich enttäuscht. Ich hatte mir etwas Besseres für sie ausgemalt. Ihr Haar hängt an der Seite herab, und Fred hebt es an und legt es neben ihr Gesicht, sodass es auf ihrer Schulter und an ihrem Arm ruht. Er sieht sie an, als wäre sie ein schlafendes Kind. Mir fällt ein, dass Freds Frau vor ein paar Monaten ihr erstes Kind bekommen hat, und ich frage mich, was ihm wohl durch den Kopf geht.
Rosalinds Zehennägel sind knallblau lackiert; an den Fingern trägt sie Silberringe. Ihre Brauen und Wimpern zeichnen sich dunkel auf der blassen Haut ab. Ich weiß noch, wie ich in meinem Zimmer versucht habe, diese Augenbrauen nachzuformen. Obwohl ich ein viel dunklerer Typ bin als sie, sah es bei mir immer verkehrt aus.
Fred und Roger ziehen den Reißverschluss des Leichensacks zu. Die Flecken an ihrem Hals sind fast schwarz. Ihre dunklen, schokoladebraunen Augen blicken starr in die sengende Sonne. Das harsche Surren des Reißverschlusses, und weg ist sie.
»Gut, na dann, wir sehen uns sicher bald.« Anna blickt schon auf ihr Handy, während sie Richtung Parkplatz davongeht.
Wir geben dem Team vom Erkennungsdienst Anweisungen für die Spurensuche.
»Fangt mit der Gegend um den See an«, sage ich zu Charlie, unserem leitenden Techniker. »Von da weiter zum Spielplatz und ins Buschland. Und werdet all diese Leute los. Das ist ja der reinste Albtraum.«
Mehrere Uniformierte weisen die Leute hinter dem Absperrband an, weiterzugehen. Ich sehe, wie ein Jugendlicher mal eben sein Handy zückt und ein Foto von Rosalinds Leichensack schießt, der in den Rettungswagen geschoben wird, ehe er Richtung Zentrum davonsprintet.
Wir sind schon hinter der Zeit, wenn wir diese Angelegenheit in den Griff bekommen wollen.
Ich wende mich zum See um. Das Wasser gibt nichts preis.
Nachdem wir alles angestoßen haben, machen wir uns in meinem Auto auf den Weg zum Revier. Felix hört seine Voicemails ab. Er langt zu mir hinüber und drückt langsam meine Hand. Zutiefst im Innersten durchläuft mich ein Zittern. Ich ziehe meine Hand weg und stelle das Radio an, um den Summton in meinen Ohren zu übertönen. Der Schmerz hat sich fest hinter meinem Schambein eingenistet, wo der Gürtel drückt, und ich verlagere das Gewicht, versuche ihn zu beschwichtigen. Ich habe keine Ahnung, wie stark die Blutung noch ist, und will nur noch zur Personaltoilette. Ich will allein sein.
Ich bremse abrupt, habe die rote Ampel gerade noch rechtzeitig gesehen. Felix wirft mir einen Blick zu, doch ich halte die Augen auf die Straße gerichtet. Rosalind Ryan ist tot. Rosalind Ryan ist tot, denke ich mantraartig. Und: Irgendwie habe ich immer geahnt, dass so etwas passieren würde.
Drittes Kapitel
Samstag, 12. Dezember, 11.36 Uhr
»Sind Sie ganz sicher, dass Sie mit dem Fall klarkommen werden, Woodstock?«, fragt Jonesy. Auf seinem Schnurrbart hat er Kaffeespritzer. Sein Bauch wölbt sich über der Hose, und er reibt ihn sich geistesabwesend. »McKinnon hat mir gesagt, dass Sie die Tote gekannt haben.«
Wir stehen in einem der kleinen Büros, die vom Hauptraum der Dienststelle abgehen. Ken Jones, unser Chief Superintendent, hat offenbar beschlossen, dass Rosalinds Ermordung nach seiner Anwesenheit verlangt. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich ihn das letzte Mal an einem Wochenende hier gesehen habe.
In Erinnerungsblitzen sehe ich Rosalinds Gesicht auf dem Schulhof vor mir. Ihre sahneweiße Haut im Umkleideraum der Schule, ihre großen Augen, die meinen Blick wissend und eindringlich erwidern. Jahre später bremste ich mein Auto ab, um ihr zuzusehen, wie sie vor mir herging, schwere Einkaufstaschen in beiden Händen, und ihr langer Rock um ihre Füße schwang. Ihr grobkörniges Gesicht in meinem Highschool-Jahrbuch, verblasst unter meinen darüber reibenden Fingern.
Wie sie in der Klasse meinem Blick standhielt, im Wettstreit, wer zuerst wegsah.
Ich kenne jeden Zentimeter ihres Gesichts.
Ich räuspere mich. »Ja, Sir. Ich hab sie flüchtig gekannt, aber das ist kein Problem. Ehrlich. Wir waren nicht befreundet, und ich hab sie seit der Schulzeit nicht mehr gesehen. Also seit einer Ewigkeit.«
Mein Herz rast in der Brust; ich will Jonesy nicht anlügen, aber wie sonst soll ich es ausdrücken? Es ist unmöglich, ihm Rosalind irgendwie anders zu erklären.
»Na gut. Weil ich hier nämlich vollen Einsatz von Ihnen verlange. Von Ihnen und McKinnon. Legen Sie sich ins Zeug! Das wird eine große Sache.« Er schlürft geräuschvoll an seinem Kaffee zum Mitnehmen. »Tun Sie, was heute getan werden muss, nehmen Sie sich ihre Familie vor, und dann hauen Sie sich aufs Ohr, damit Sie morgen in die Vollen gehen können.«
»Ja, Sir, natürlich.«
»Sie fühlen sich dem gewachsen, nach letzter Woche?«
»Ja, Sir.«
»Gut. Das war ja richtig schlimm.«
Ich richte meine Tasche; der Riemen gräbt sich zu tief in meine Schulter. Ich denke an den vorigen Sonntagabend zurück, wie ich die Badezimmertür öffnete, von der die Farbe abblätterte, und die verzweifelte, misshandelte junge Frau vorfand, die beschlossen hatte, lieber ihr kleines Söhnchen in der Badewanne zu ertränken und sich dann mit dem toten Baby im Arm die Pulsadern aufzuschlitzen, als noch eine Nacht in Angst vor ihrem gewalttätigen Exfreund zu ertragen. »Ist heutzutage nicht alles ziemlich schlimm?«
»Kann einem wirklich manchmal so vorkommen. Na, jedenfalls wollen wir diese Sache jetzt anleiern.« Gerade als Jonesy mir fest auf den Rücken klopft, klingelt sein Handy. »Ah, der verdammte Handwerker. Die Klimaanlage im Hauptraum ist mal wieder abgekackt«, sagt er und geht, in der Hosentasche nach seinem klingelnden Handy wühlend. Die Rosarote-Panther-Melodie wird jäh unterbrochen, als er barsch seine Anweisungen durchgibt.
Ich starre auf das große Bild, das neben dem Wasserspender an der Wand hängt: ein weichgezeichneter blaugrauer Himmel über grünen Bergen. Ich denke an Rosalind, tot im Leichensack. Innerlich bin ich zum Zerreißen gespannt; meine inneren Organe sind auf einmal zu groß für meinen Körper. Ich tippe mit der Schuhspitze auf den Boden und wünschte, Felix würde sich beeilen. Ich will jetzt nicht mit meinen Gedanken allein sein.
Er kommt mit zwei Kaffeebechern in der Hand um die Ecke. Als er mich sieht, lächelt er. »Hier. Den kannst du sicher brauchen.«
»Danke.« Ich nehme ihm den Kaffee ab, obwohl sich mir der Magen umdreht bei der Vorstellung, ihn zu trinken.
»Ich hab gerade mit Charlie gesprochen. Sie haben ihr Auto auf dem obersten Parkplatz gefunden. Dem zwischen Schule und See.«
»Charlie hat dich angerufen?«, frage ich.
»Genau. Grade eben.«
»Ich hab gedacht, du sprichst mit deiner Frau.«
Felix wirft mir einen vernichtenden Blick zu. »Hab ich auch, Gem. Und dann hat Charlie mich angerufen. Willst du mein Anrufprotokoll sehen?« Sein Akzent schmiegt sich so süß an das Wort »Protokoll«, dass ich ihn küssen möchte.
»Sei nicht albern.«
»Offenbar ist ihr Auto nicht der eigentliche Tatort. Anna ist hingegangen, um es kurz zu überprüfen, aber es ist abgeschlossen und sieht in Ordnung aus. Wenn wir wollen, können wir es uns anschauen, bevor sie es abtransportieren.«
»Okay. Gut.«
»Da das Auto also auf dem obersten Parkplatz am See stand, hatte sie gestern Abend vielleicht vor, später zum See zu gehen«, sagt er.
Ich denke drüber nach. »Soweit ich mich erinnere, ist der Schulparkplatz viel zu klein. Die Lehrer haben immer diesen Parkplatz am See benutzt, weil es nur fünf Minuten zu Fuß ist. Sie könnte also einfach so dort geparkt haben.«
»Vielleicht hat sich das seit deiner Zeit geändert«, meint Felix.
»Glaub ich nicht. Ich fahr da manchmal vorbei, und es sieht ziemlich unverändert aus.« Ich weiß, dass ich zu schnell rede, und lege eine Pause zum Luftholen ein.
Felix knufft mich freundschaftlich gegen die Schulter, sieht mir dann aber in die Augen. Ein Flattern durchfährt mich. »Ist wirklich alles okay mit dir, Gem? Es muss grausig sein, erst mit ihr zur Schule zu gehen und sie dann so zu sehen.«
»Ernsthaft, alles okay. Ich bin halt nur etwas geschockt.«
»Also dann.« Jonesy hat fertig telefoniert. »Los geht’s. Holen Sie Matthews und Kingston dazu. Ich will die beiden einbeziehen, nur für alle Fälle.«
Ich verdrehe die Augen, doch Felix zieht los, um sich die anderen zu schnappen. Gerry Matthews und Mac Kingston, beide Ende vierzig, sind auch Detective Sergeants, tragen ihre Überlegenheit aber offen zur Schau. Für mich haben sie keine Zeit, und das beruht auf Gegenseitigkeit.
Als wir uns zu fünft in Jonesys unaufgeräumtes Büro gequetscht haben, gehen wir durch, was uns vorliegt.
»Verstorbene Achtundzwanzigjährige, Rosalind Elizabeth Ryan. Englischlehrerin am Smithson Secondary College. Hat offenbar allein in einem Häuschen am Highway gewohnt. Ihre Leiche wurde heute Morgen am Sonny Lake gefunden, kurz vor halb acht. Sie hatte eine Kopfverletzung und Würgemale, außerdem besteht der Verdacht auf sexuellen Missbrauch.« Felix rattert diese Informationen runter wie den Text einer Kleinanzeige, und ich könnte fast so tun, als würde ich die Tote nicht kennen. Als sähe ich nicht ihren leblosen Körper im Wasser schwimmen.
»Und wer hat sie gefunden?«, fragt Jonesy. »Ein Jogger, haben Sie gesagt, Woodstock? Haben wir den überprüft?«
»Ja, Sir, ich halte ihn für sauber. Er hat sie ganz entfernt gekannt, aber da wird er bestimmt nicht der Einzige sein, schließlich ist sie von hier und war Lehrerin am Smithson.« Meine Stimme hört sich komisch an, so als redete ich aus dem Nebenzimmer.
»Okay, nehmen Sie seine Aussage zu Protokoll und schließen Sie das ab. Was noch? Todeszeitpunkt?«
»Anna meint, gestern Nacht oder heute am frühen Morgen«, berichte ich.
»Irgendwelche Vermutungen, was sie unten am See wollte?«
Matthews räuspert sich. »In der Schule war gestern eine große Aufführung. Ein Theaterstück, soweit ich weiß. Meine Frau ist hingegangen. Ich hab gerade mit ihr gesprochen. Sie hat gesagt, am Ende war unsere Tote auf der Bühne, bekam Blumen und hielt eine Dankesrede. Das Stück soll sehr gut gewesen sein.«
Ich erinnere mich an Rose in unserem letzten Schuljahr auf der Bühne, absolut fesselnd als Medea. Ihre wilden Augen wie Dolche, als sie den Zuschauern ihr Elend klagte.
»Sie hatte es schon immer mit dem Schauspielern«, sage ich.
»Woodstock kannte sie aus der Schule«, erklärt Jonesy den anderen.
Ich weiche ihren Blicken aus.
»Gut«, fährt Jonesy fort, »also, die Schule muss als Nebentatort behandelt werden, und zwar pronto. Allem Anschein nach ist sie nie zu Hause angekommen. Absperren und versiegeln, macht euch an die Arbeit. Und untersucht auch ihr Haus.«
»Das hab ich schon von einem Team versiegeln lassen«, sage ich, ohne den Blick weiter zu beachten, den Kingston Matthews zuwirft.
»Gut«, sagt Jonesy. »Sie und McKinnon sehen sich das an, sobald die Kriminaltechnik durch ist. Befragen Sie alle Beteiligten. Wer übernimmt die Familie?
»Das kann ich gern …«
»Nein.« Jonesy winkt Matthews ab. »Ich will, dass McKinnon und Woodstock die Familie übernehmen.« Er sieht mich an. »Der Vater ist ein großes Tier in der Wirtschaft, da ist also Vorsicht geboten. Offenbar ist er ein Herz und eine Seele mit Bürgermeister Cordon. Ich will die offizielle Identifizierung so rasch wie möglich abgeschlossen haben. Es gibt Gerede, also müssen wir die Identität noch heute bestätigt bekommen. Obduktion morgen; Anna weiß schon Bescheid. Wenn das alles klar ist, sollten Sie untersuchen, was gestern in der Schule los war. Wer, was, wo, das Übliche. Die Journalisten belagern schon unsere Telefonleitungen. Kaum zu glauben, dass Ihre Freundin Candy Cane mich noch nicht angerufen hat, Woodstock, aber das ist nur eine Frage der Zeit.«
»Sie ist nicht meine Freundin, Sir.«
»Sie ist eine verdammte Nervensäge, wenn Sie mich fragen, aber sie und der Rest der Bande werden sich drauf stürzen wie die Hyänen. Was für eine tolle Story, und genau rechtzeitig vor Weihnachten. Verfluchter Scheißalbtraum.« Er fährt sich durchs schüttere Haar und reibt sich die Augen, wirkt überrascht, uns alle noch vorzufinden, als er aufschaut. Nach einer kurzen Pause dröhnt er: »Dann nichts wie los – an die Arbeit!«
Wir trollen uns.
*
Ich bekam wieder festen Boden unter die Füße, als ich Polizistin wurde. Nachdem ich jahrelang schwankend am Rand gestanden hatte, gefährlich nahe am Abgrund, gab mir die Truppe Sicherheit. Ich lernte wieder aufrecht zu gehen. Dad sagte, meine Uniform verleihe mir Stärke. Ich glaube, ich hab einfach aufgehört, mit gesenktem Blick herumzulaufen, wenn ich sie anhatte. Anfangs waren meine Aufgaben nicht besonders anspruchsvoll: Verkehrsunfälle, Kleindiebstähle, Fundsachen, eingeschlagene Fensterscheiben. Mit der Zeit wurde es spannender: überführte Straftäter aufspüren, Muster erkennen, mich in sie hineindenken, versuchen, ihnen zuvorzukommen und den nächsten Zug zu vereiteln. Wir hatten eine Menge Absolventen aus der Stadt, die bei uns ihr Berufspraktikum geschoben haben. Wieder mal typisch: Junge Polizisten müssen eine gewisse Zeitspanne in ländlichen Gebieten absolvieren, was umgekehrt nicht der Fall ist. Seit meiner Ausbildung habe ich höchstens ein paar Wochen in der Großstadt gearbeitet. Ich bin nie so richtig über Smithson und Umgebung hinausgekommen.
In gut vier Autostunden Entfernung von Sydney ist es hier heiß im Sommer und eiskalt im Winter, aber ich habe rasch festgestellt, dass Verbrechen nicht saisonal passieren. Zur gesunden Landluft gesellen sich hier reichlich Alkohol, reichlich Langeweile und erst recht reichlich Gewalttätigkeit. Felix, noch frisch aus den Straßen von London, hat mir versichert, dass wir hier mit genau den gleichen polizeilichen Methoden vorgehen, nur in anderem Maßstab. Das glaube ich zwar nicht – er wollte mir sicher nur das Gefühl geben, dass ich nichts versäume –, aber wie auch immer, wohl jeder würde zustimmen, dass ich gut in meinem Beruf bin. Er liegt mir.
Von Anfang an mochte ich die Spurensuche. Das langwierige Rätsellösen. Dass man sich voll und ganz auf eine Sache konzentrieren und alles sonst vergessen kann. Dieser Beruf hat was für ichbezogene Menschen. Ich fand es nach Jahren voll Lärm und Geplärr entspannend, mit gutem Recht auf meinem Tunnelblick bestehen, mich vollständig in eine Sache vertiefen zu können, eine Entschuldigung zu haben, um nicht mit Leuten reden zu müssen, meine Verschlossenheit rechtfertigen zu können.
Das Polizistinnendasein in Smithson war nicht ohne gewisse Herausforderungen zu haben, doch auch in denen konnte ich irgendwie aufgehen. Sie lieferten mir etwas Festes, Handgreifliches, gegen das ich aufbegehren konnte. Ein lebendes, atmendes Hindernis zum Bezwingen – welch ein krasser Gegensatz zu dem trüben Nichts, das der tiefe Quell meiner Trauer war. Der Soundtrack aus anzüglichem Grinsen und dummen Kleinmach-Sprüchen, der mir täglich folgte, bestärkte mich nur in meiner Entschlossenheit und Konzentration.
Jonesy hatte von Anfang an eine Schwäche für mich. Seine anfängliche Verwunderung, wie eine Frau es nur schaffte, sich in der testosterongeschwängerten Umkleide zurechtzufinden, wich nach und nach einer gewissen Bewunderung, wie ruhig und kompetent ich mich jedem neuen scheußlichen Verkehrsunfall, unschönen Selbstmord oder Gewaltausbruch stellte. Ich muss ihm zugutehalten, dass er fest entschlossen wirkte, mich nicht nach Geschlechtsstereotypen zu beurteilen, und oft absichtlich die anderen losschickte, um Angehörigen schlimme Nachrichten zu überbringen, statt davon auszugehen, dass meine weibliche Intuition gefragt wäre. Nach ein paar Monaten im Dienst hörte ich, wie er zu jemandem am Telefon sagte, ich sei »’ne ganz schön Taffe«. Es war nicht so, dass mir eine Vaterfigur fehlte, und er überschritt nie die Grenze, die ich akribisch um mich gezogen hatte, aber mit Jonesy hatte ich unverhofft einen extra Onkel gewonnen, wogegen nichts einzuwenden war. Meine Kollegen waren brutal, und seine Rückendeckung war nicht so auffällig, dass sie meine Situation verschlimmert hätte; stattdessen wurde er eher insgeheim mein mächtiger – wenn auch tollpatschiger – Verbündeter, und ich wollte unbedingt erreichen, dass er stolz auf mich war.
Es war lange her, dass Stolz für mich zuletzt eine Rolle gespielt hatte; die Trauer, die meinen Vater und mich umgab, ließ keine normale Eltern-Kind-Beziehung zu. Wir waren fast nur aufs Überleben eingestellt. Dad war so gut wie nie entspannt genug, um seine Vaterrolle zu genießen. Es gab zwar Augenblicke nervöser Freude, doch meist war er zu sehr damit beschäftigt, nach lauernden Gefahren Ausschau zu halten. Da ich seit meinem dreizehnten Lebensjahr nur mit ihm zusammengewohnt hatte, kam mir die Nähe so vieler Leute, erst recht so vieler Männer, anfangs erdrückend vor. Überall in der Dienststelle hing ihr Geruch in der Luft; ihr ständiger Hunger irritierte mich. Ihre Witze waren primitiv und fies. Ich biss die Zähne zusammen und schluckte meinen Ärger und, gelegentlich, meine Angst runter. Ich hatte nicht allzu viel in die Waagschale zu werfen: Ich war nicht nur eine Frau, sondern auch jung, eifrig und nicht auf den Kopf gefallen – eine gefährliche Mischung.
Gegen Ende meines ersten Monats wurde ich mit Keith Blight, einem abgekämpften alten Knaben, für den Frauen in der Polizeitruppe ein rotes Tuch waren, zu einem Raubüberfall in einer örtlichen Autowerkstatt gerufen. Er meinte wohl, ich wäre besser beraten, wenn ich mit meinen Gefühlen und meiner Handtasche auf direktem Wege zum nächsten Kosmetiksalon abzischen würde. Dem Automechaniker war es gelungen, den Dieb festzuhalten, einen dürren Backpacker mit Aknenarben im Gesicht, der so etwa im Minutentakt auf den Boden spuckte. Als wir ankamen und ich meine Handschellen hervorholte, grinste mich der frettchenhafte Kleinkriminelle nur höhnisch an und wechselte einen wissenden Blick mit Blight, der genauso amüsiert wirkte. Beide hielten mich für eine Witzfigur. Noch nicht trocken hinter den Ohren, im Polizeidienst, noch dazu weiblich! Ich sagte nichts, weil ich wusste, dass jeder Protest, überhaupt jede Reaktion sofort als zu gefühlsbetont abgetan werden und somit genau ihrer Erwartungshaltung entsprechen würde. Mit brennenden Wangen drückte ich den fettigen Kopf des Bürschchens nach unten und schob ihn ins Polizeiauto. Es hätte nicht viel gefehlt, und der rasende Zorn in meinem Inneren hätte sich in einem lauten Schrei entladen.
Und dann kam wenige Monate später der Fall Robbie, der alles änderte.
Viertes Kapitel
Samstag, 12. Dezember, 13.46 Uhr
Smithson ist an sich schon recht grün, und George Ryans Haus steht zweifelsohne im grünsten Teil der Stadt. In Smithson gab es schon immer diese vornehme Wohngegend der Reichen, damit wir anderen dort bleiben, wo wir hingehören. Nur dass vor dem Bau der Carling-Fabrik Ladenbetreiber, eine Handvoll Banker und die ehemaligen Besitzer erfolgreicher Familienfarmen am Fuß der sanft geschwungenen Hügel am Stadtrand wohnten, auf der anderen Seite des Sonny Lake. Jetzt muss man eher damit rechnen, dass die Topmanager von Carling sowohl daheim als auch in der Firma Nachbarn sind.
»Nette Bude.« Felix beugt sich vor, um Rosalinds Elternhaus durch die Windschutzscheibe in voller Länge betrachten zu können.
»Ja, wirklich.«
»Hier stiegen früher sicher ’ne Menge Partys?«
»Leider nein. Rosalind war eine Einzelgängerin. Jedenfalls weitgehend.« Ich versuche es ihm zu erklären. »Sie war beliebt, hielt sich aber sehr für sich. Ich weiß nicht, ob irgendwer sie je wirklich besucht hat.«
»Warum nicht?«
»Weiß auch nicht. Sie war ungewöhnlich.«
»Na, hoffentlich ist sie inzwischen etwas leichter zu durchschauen.«
»Ja«, stimme ich ihm wieder zu, auch wenn ich das bezweifle.
Ich blicke auch zum Haus hoch. Ich weiß, dass ihr Schlafzimmer früher links im ersten Stock lag: Manchmal sah ich von der anderen Straßenseite aus dort ihren Umriss am Fenster.
Mit einem Ruck kehre ich in die Gegenwart zurück und stelle mein Handy stumm.
»Okay«, sagt Felix. »Also dann, wollen wir?«
Wir steigen aus und knallen die Autotüren zu. Ich habe nichts dagegen, dass George Ryan uns kommen hört, obwohl ihn natürlich nichts auf den Schock vorbereiten kann, der ihm bevorsteht. Falls er es nicht schon weiß, denke ich düster.
Angehörigen und Freunden die Nachricht von der Ermordung eines Nahestehenden zu überbringen, ist immer schwer. Bei Eltern ist es normalerweise am schlimmsten, ihre Trauer ist so unverfälscht und roh. Einen toten erwachsenen Sprössling sehen sie meist unmittelbar so vor sich, wie er als Kind war. Gebrochene Mütter durchleben dann erneut den Moment, da sie ihr Neugeborenes im Arm hielten, und formen ihre Arme zu einer leeren Wiege, selbst wenn die Geburt sechzig Jahre zurückliegt. Andererseits sind Kinder frisch Verstorbener oft von stoischer Tapferkeit; sie erkennen ihre neue Verantwortung, sind sie doch ans obere Ende der Nahrungskette aufgerückt. Außerdem werden sie von tausenderlei Erwachsenenaufgaben abgelenkt: Behördengänge, die Beerdigung ausrichten, die Verwandtschaft benachrichtigen. Geschwister sind natürlich bestürzt, werden aber auch oft von einer seltsamen tief verwurzelten Rivalität dazu gebracht, sich in vertauschten Rollen vorzustellen. Sie sehen sich selbst als das tote Kind und vergleichen die zu erwartenden Trauerreaktionen. Selbst im Angesicht des Todes kann immer noch das Gefühl siegen, sich gegen seine Geschwister behaupten zu müssen.
Die Familienangehörigen eines Mordopfers zu benachrichtigen, ist auch deshalb besonders schwer, weil unsere größte Aussicht auf Aufklärung darin besteht, uns jede Option offenzuhalten. Wir müssen hinter die Fassade eines gebrochenen Blicks schauen können. Sehen, was hinter einem bleichen, leidenden Gesicht und gerungenen Händen vorgeht. Auch Mörder sind Menschen, und häufig ist die Trauer, die sie um ein Opfer an den Tag legen, echt, selbst wenn sie die Schuldigen sind.
George Ryan wird als Rosalinds nächster Verwandter aufgeführt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch noch drei ältere Brüder hat.
»Ich kann mich nur an einen von ihnen erinnern«, erzähle ich Felix, als wir zur Tür gehen. Der Zufahrtsweg ist von Wolken aus Kängurudorn gesäumt, deren Blütengold die sengende Sonne erstrahlen lässt. »Der kam mir irgendwie überheblich vor. Ich glaub, die anderen waren ein bisschen älter als wir.«
»Keine Mutter?«, fragt Felix.
»Ich weiß nicht«, erwidere ich. »Kann mich an keine erinnern.«
Die Haustür fliegt auf, gerade als ich auf die Klingel drücken will.
»Guten Tag?« Vor uns steht ein kleiner, gut rasierter Mann mit penibel gescheiteltem Haar und einem Teint, der kaum Sonne abbekommen hat. Hinter ihm wirbelt ein Stoß Klimaanlagenluft hervor. Seine kleinen Augen wandern pfeilschnell zwischen uns hin und her.
»Guten Tag. Bitte entschuldigen Sie die Störung, aber wir müssen mit George Ryan reden.«
Der Mann ruckt mit dem Kopf auf und ab. »Ach. Der ist eben erst aufgestanden. Er fühlt sich nicht so gut.«
»Leider müssen wir ihn trotzdem sprechen. Ich bin Detective Sergeant Woodstock. Das ist Detective Sergeant McKinnon.«
Ein Schleier des Begreifens senkt sich auf den Blick des Mannes. »Dann kommen Sie besser rein. Ich bin Marcus. Sohn von George.« Er tritt zur Seite, bittet uns mit einer Geste herein. Zur Linken liegt eine polierte Holztreppe. Rechts hängt ein wuchtiges Ölgemälde in einer Diele mit hoher Decke.
»Geht es Mr. Ryan gesundheitlich nicht gut?«, fragt Felix, während wir hinter Marcus her in den hinteren Teil des Hauses gehen.
»Er wurde gestern operiert«, erklärt uns Marcus. »Aber er ist auf dem Wege der Besserung.«
Felix und ich sehen uns an. Wahrscheinlich werden wir seiner Besserung einen schrecklichen Dämpfer verpassen.
»Bitte hier entlang«, sagt Marcus. »Alle sind hier drin. Meine Brüder sind auch da.«
Er führt uns in ein großes weitläufiges Zimmer hinten im Haus.
Drei Männer sitzen auf einem riesigen cremefarbenen Sofa an der rechten Zimmerwand. Ihre Blicke hängen an dem Cricketspiel, das ohne Ton, aber in umso höherer Auflösung auf einem der größten Fernseher läuft, den ich je gesehen habe. Die spitzgiebelige Decke hat direkt über ihnen ihren höchsten Punkt, und seitlich wurden Fenster eingebaut, die Lichtflächen auf den Boden zu ihren Füßen werfen. Der Kaminsims steht voller Fotos. An einem Ende ist in einem großen Rahmen eine Frau mit rabenschwarzem Haar und glänzenden blauen Augen zu bewundern. Aus der Küche höre ich ein Radio, in dem das Cricketspiel kommentiert wird, das im Fernsehen läuft.
Draußen glitzert ein Swimmingpool im strahlenden Sonnenschein.
»Guten Tag«, sage ich. »Ich bin Detective Sergeant Woodstock, und das ist Detective Sergeant McKinnon.«
Drei Augenpaare sehen mich verständnislos an.
»Bitte nehmen Sie Platz«, drängt uns Marcus, der hinter mir vorkommt und uns Sessel zuweist. »Das ist mein Vater George Ryan. Und meine Brüder, Bryce und Timothy.«
Falls Bryce und Timothy mich wiedererkennen, lassen sie es sich nicht anmerken. Dampfkringel steigen von der Tasse in George Ryans Hand auf. Er ist der Größte von allen: breitschultrig und massig, aber so, dass es zu seinem Körperbau passt. Er ist sehr blass. Mit zitternden Händen hält er die Tasse auf dem Schoß. Seine jüngeren Söhne sitzen rechts und links von ihm. Während Marcus aussieht wie direkt dem frühen zwanzigsten Jahrhundert entstiegen, sind Timothy und Bryce die typischen modernen Aussies: beide tiefbraun und in legeren T-Shirts und Surfer-Markenshorts. Drahtiges Haar windet sich wie Efeu die muskulösen Beine hoch. Gerade weiße Zähne unter jeansblauen Augen runden das Bild ab.
Ich sehe sie mir einen nach dem anderen an, ehe ich das Wort an George Ryan richte. »Leider bringen wir sehr schlechte Nachrichten.« Ich hole tief Luft und schließe kurz die Augen, ehe ich fortfahre: »Ihre Tochter Rosalind wurde heute Morgen tot aufgefunden. Wir gehen davon aus, dass sie ermordet wurde.«
Im Radio trifft ein Ball auf einen Schläger, was sich wie ein Gewehrschuss anhört. Die Menge bricht in Oooh- und Aaah-Rufe aus, und ich beobachte genau, wie der Schock die Ryans mit Wucht ins Gesicht trifft.
Marcus sieht ratlos erst seinen Vater und seine Brüder, dann mich an. »Wie bitte?«
George Ryan richtet sich sichtlich unter Schmerzen im Sitzen auf. »Rosalind ist tot?«
Timothy und Bryce starren wie vom Donner gerührt zu Boden.
»Ja. Es tut mir sehr leid.«
Marcus eilt in die Küche und stellt das Radio aus. Die Stille dröhnt durchs ganze Haus, und ich habe plötzlich das dringende Bedürfnis, etwas zu sagen. »Wir vermuten, dass Rosalind gestern Nacht oder heute in den sehr frühen Morgenstunden gestorben ist. Nach der Schultheateraufführung.«
»Was ist passiert?« George Ryans volltönende Stimme ist prachtvoll. Flüssig wie Sirup und rau zugleich, dringt sie aus tiefer Kehle.
Felix beugt sich vor. »Wir wissen es noch nicht, Mr. Ryan, aber wir behandeln es als ein Tötungsdelikt. Ihre Tochter wurde überfallen. Es tut uns unendlich leid, aber können wir Ihnen allen bitte ein paar Fragen stellen? Wir müssen wirklich so viel wie möglich in Erfahrung bringen, um den Täter überführen zu können.«