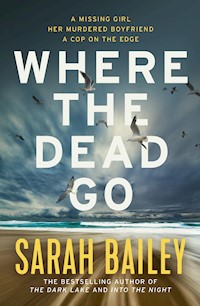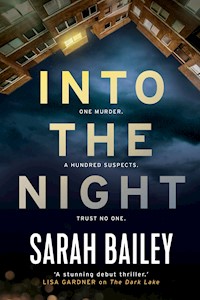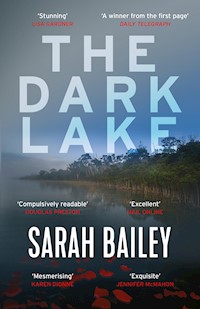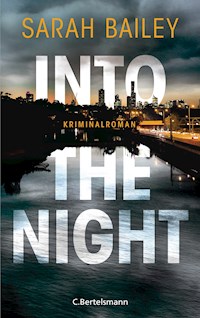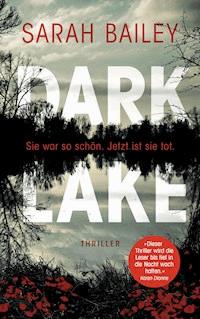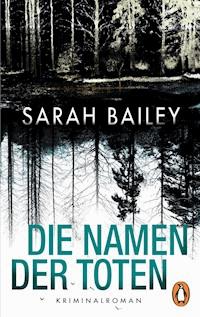
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Detective Richard Vega fühlt sich wie in einem schlechten Traum, als nahe der südenglischen Kleinstadt Tunbridge Wells die Leiche eines 15-Jährigen gefunden wird. Denn vor sechs Jahren stand er an derselben Stelle schon einmal über die Leiche eines Teenagers gebeugt, der auf dieselbe Weise getötet wurde. Hat Vega damals den Falschen verhaftet? Hat er erneut Schuld auf sich geladen? Denn dies wäre nicht der einzige Tod, der auf seinem Gewissen lastet …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
SARAH BAILEY hat Kriminologie und Angewandte Psychologie studiert. Sie ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Tunbridge Wells, einer Kleinstadt im Südosten Englands, wo auch ihre Krimireihe um Detective Richard Vega spielt. Die Namen der Toten ist ihr erster Roman.
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.deund Facebook.
Sarah Bailey
Die Namen der Toten
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Stefan Lux
1 Samstagnachmittag
Deanos Haare waren immer noch feucht vom Pool. Um die Kälte zu vertreiben, rieb er sich mit der Hand über den Kopf. Zum fünften Mal tippte er die Nummer seines Bruders in sein Handy.
»Komm schon, Reese … Nimm ab. Bitte.«
Einmal mehr wurde er zur Mailbox weitergeleitet. Während Deano seine Nachricht aufsprach, hörte er das Echo seiner eigenen Stimme im Headset mit einer halben Sekunde Verzögerung. Sie klang höher, als er sie normalerweise wahrnahm. Jünger. Er bemühte sich, möglichst cool zu klingen, ohne Erfolg.
»Hör mal, Mann, es tut mir leid, was ich gemacht hab, klar? Vor allem wenn ich dich dadurch in Schwierigkeiten gebracht hab. Ich wollte dich nicht in irgendeine Scheiße reinreiten. Ich hab mir einfach Sorgen um dich gemacht. Es war gut gemeint. Das weißt du doch, oder?« Deano schickte einen Tritt ins Leere, zog die Schultern hoch und wartete auf eine Antwort, die nicht kam. »Na ja, egal. Rufst du mich zurück? Hab dich lieb.«
Er legte auf und schämte sich bereits für die letzten drei Worte, die ihm einfach herausgerutscht waren.
Seine Augen brannten immer noch vom Chlor. Er rieb sie sich mit den Handknöcheln, zwinkerte energisch und entdeckte sein Spiegelbild in der glänzenden Fassade des Sportcenters.
Er sah immer noch ganz normal aus. Einfach ein Teenager in einer Puffa-Jacke mit eingesteckten Ohrhörern und dem unvermeidlichen finsteren Blick im Gesicht. Trotzdem würden die Leute es merken. Es war, als hätte sich in seinen Körperzellen etwas verändert. Als wäre er am Verfaulen und man könnte es riechen.
Die Leute verstanden ihn grundsätzlich falsch. Die einzige Ausnahme war immer sein älterer Bruder gewesen, bis jetzt jedenfalls, bis jetzt, da es darauf ankam.
Deano warf sich seinen in Signalfarben gehaltenen Rucksack über die Schulter und schloss sein Fahrrad auf. Zehn Minuten später raste er die schmale Straße entlang, die ihn nach Hause bringen würde. Zu beiden Seiten ragten Hecken auf. Eine Amsel ließ ihren schrillen Warnruf hören. Er trieb sich an. Schneller, immer schneller, bis er die Geschwindigkeit und den Gegenwind für seine Tränen verantwortlich machen konnte.
Man spricht nicht mit der Polizei. Dad hatte es ihnen beiden immer und immer wieder eingetrichtert, seit sie laufen konnten. Man verrät ihnen nie etwas. Sie drehen einem die Worte im Mund herum. Und dann lochen sie einen ein.
Aber jetzt war Dad weg. Dad war weg, Mum war zu nichts zu gebrauchen, und Reese ging vor die Hunde. Was sollte er dagegen unternehmen? Etwa gar nichts?
Quatsch. Er liebte diesen schlaksigen Trottel viel zu sehr, um nichts zu unternehmen.
Deano hörte hinter sich das lauter werdende Geräusch eines Dieselmotors und wich an den Straßenrand aus, um das Fahrzeug vorbeizulassen. Er widmete dem Lieferwagen keinen weiteren Gedanken, bis das Hinterrad seines Fahrrads von der Stoßstange erfasst und er auf die Windschutzscheibe geschleudert wurde.
Ein Knirschen von Glas und das Kreischen von Metall. Mit einem harten Aufprall landete Deano auf dem löchrigen Asphalt und rollte weiter, bis er auf dem zerfurchten Gras am Straßenrand liegen blieb. Er starrte in den Wolkenwirbel am langsam dunkler werdenden Himmel und versuchte zu begreifen, was zum Teufel gerade geschehen war.
Durch die Wellen des ausgestoßenen Adrenalins hindurch nahm er den Schmerz wahr. Er bewegte sich vorsichtig und versuchte abzuschätzen, wie schwer seine Verletzungen waren. Gebrochen fühlte sich nichts an. Der Rucksack, in dem sein feuchtes Handtuch lag, hatte ihn offenbar geschützt, aber sein Helm lag zu Hause, am Fußende seines Bettes.
Mum würde ihn umbringen.
Mühsam richtete Deano sich auf und hielt sich die Rippen. Mit der Zunge fuhr er an den Zähnen entlang: der Geschmack von Kupfer und den Chemikalien aus dem Schwimmbad. In die Haut an seiner Wange hatten sich Kieselsteine gegraben. Er starrte den inzwischen stehen gebliebenen Lieferwagen an, an dessen Stoßstange sich sein BMX-Rad verfangen hatte.
Als er sich humpelnd dem Transit näherte, den linken Fuß hinter sich herziehend, trat Wut an die Stelle des Schocks. Der Fahrer stieg aus und marschierte mit schweren Stiefelschritten auf ihn zu.
»Sie haben es zu Schrott gefahren!« Deano starrte auf die Überreste seines Rades. »Sie haben Glück, dass ich verletzt bin, sonst würde ich Sie jetzt plattmachen!«
Deano war fünfzehn und der kleinste Junge in seiner Klasse. Der Fahrer neigte den Kopf zur Seite und lächelte ihn an, als hätte er eine witzige Bemerkung gemacht. Der Mann war fett und blond und hatte schwere Augenlider. Er ging zurück zum Lieferwagen und öffnete die Türen zum Ladebereich.
»He! Sie Vollidiot! Ich rede mit Ihnen! Schauen Sie mich an! Schauen Sie mich an! Sie müssen es ersetzen, ich brauche mein Fahrrad!«
Der zweite Mann, der Beifahrer, stieg aus. Er war älter als der erste, wirkte aber fitter. Er hatte die Statur und die Haltung eines Mannes, der an harte Arbeit gewöhnt war. Und an handgreifliche Auseinandersetzungen. Deano richtete seine Konzentration jetzt auf ihn. Und dann erkannte er ihn.
Er hatte nicht erwartet, dass sie ihm so schnell auf die Spur kommen würden.
Er hatte sich für schlau gehalten.
Deano drehte sich um und rannte los, oder versuchte es jedenfalls. Der Schmerz lähmte sein linkes Bein, und sein Schädel schien zu brennen. Vor seinen Augen explodierten Lichter, grelle farbige Blitze, die ihm die Orientierung raubten. Doch er humpelte weiter, so schnell er konnte. Der Mann hinter ihm packte ihn bei den Haaren, zerrte ihn zu Boden und zog ihn dann auf den Lieferwagen zu. Deano trat wild um sich. Mit aller Macht versuchte er, wieder auf die Beine zu kommen und seine Haare aus dem Griff des Mannes zu befreien.
»Du verdammter Irrer, lass mich los!« Er zerrte an den Fingern des Mannes, bis sich ein kräftiger Arm im Würgegriff um seinen Hals legte. Deanos Augen fühlten sich an, als würden sie gleich herausspringen, und seine Zunge kam ihm mit einem Mal riesig vor. Seine Fersen wurden über den Boden geschleift, ohne irgendwo Halt zu finden. Er bekam keine Luft …
Er war jetzt beinahe schon im Transit. Er konnte das Öl bereits riechen, den blanken, vernieteten Boden sehen, doch nahm er außer dem Scharren von Füßen und dem Keuchen seines Atems auch das Brummen eines anderen Autos wahr, das sich ihnen näherte.
Wenn es vorbeikäme, würde der Fahrer sehen, was hier vor sich ging. Er würde ihm helfen. Deano brauchte bloß dreißig Sekunden.
»Nichtsnutziges kleines Arschloch …!«
Deano brachte ein Lächeln zustande, das seine vom Blut geröteten Zähne zeigte. Sein ganzes Leben lang hatte man ihn immer wieder nichtsnutzig genannt. Er hatte sich nie davon beirren lassen, und damit würde er auch jetzt nicht anfangen. Wieder versuchte er, sich frei zu strampeln.
Der andere Mann hatte schon bereitgestanden, um die Türen hinter ihnen zuzuschlagen. Doch jetzt griff er ein. Er hielt eine Brechstange in der Hand. Deano sah ihn ausholen wie einen Golfer beim Abschlag.
Der erste Schlag brach ihm den Unterarm, der zweite das Schlüsselbein. Der dritte schickte ihn in die Dunkelheit, wenn auch nur kurz. Im Lieferwagen kam er wieder zu sich. Es war dunkel. Scharfe metallische Gerüche brannten in seiner Nase. Der Boden unter ihm schwankte und ließ ihn gegen ein Bündel mit Werkzeugen rollen. Er übergab sich und verlor erneut das Bewusstsein.
2 Ostermontag, abends
BISTDUHIER?? :D
Die Nachricht war die vierte, die Cherry ihm geschickt hatte. Richard Vega stand jetzt seit zwanzig Minuten draußen vor dem Musikclub, konnte sich aber nicht dazu aufraffen, hineinzugehen und ihr Gesellschaft zu leisten, noch nicht. Er würde warten, bis er sie spielen hörte, und dann erst hinaufgehen.
Der kleine Laden lag im ersten Stock eines Gebäudes mit einer georgianischen Säulenreihe. Er hatte einen unebenen Holzboden, eine schwer zugängliche Bar und kleine, dunkle Nischen, die durch zusätzliche Wände zwischen den tragenden Balken entstanden waren. Die Akustik war fragwürdig, und es war grundsätzlich gerammelt voll und heiß. Er hatte nicht wirklich Platzangst, er mochte einfach keine drängelnden Menschenmassen.
Nein, hier draußen gefiel es ihm besser. Zwischen den Bögen konnte er mehr Beobachter als Teilnehmer sein. Er zog seine Lederjacke enger um die Schultern und nahm einen Zug an seiner Selbstgedrehten.
Es war das Osterwochenende im wohlhabenden Kurort Royal Tunbridge Wells. Die Linden an der Kurpromenade The Pantiles waren mit Lichterketten geschmückt und die Pubs und Restaurants mit ihren prächtigen Fassaden hell erleuchtet. Die Gerüche und die Gespräche schwappten hinaus auf die gepflasterte Straße.
Die Temperatur lag nur knapp über dem Gefrierpunkt, aber The Pantiles war trotzdem voller junger Menschen, die das Geld ihrer Eltern unter die Leute bringen und richtig Dampf ablassen wollten. Und sei es auch nur für eine Nacht.
Vegas Blicke folgten dem Schauspiel, wobei er die Dealer aus London zu ignorieren versuchte, die sich dreist unter die Menge mischten. Er war nicht im Dienst. Er würde nicht einschreiten. Schließlich hatte er Cherry versprochen, sich ihr Konzert anzuhören, und auch wenn sie es nicht zugeben würde, war ihm klar, dass sie sich ziemlich Sorgen machte, wie es beim Publikum ankommen würde. Wenn es ihm gelang, sie ein wenig zu beruhigen, war das die überteuerten Getränke und sein Unbehagen in der jugendlichen Menge schon wert.
Aus den Fenstern oben drangen die ersten Fetzen Musik, also zog Vega ein letztes Mal an seiner Zigarette und machte sich bereit, in die erzwungene Intimität des Grey Lady einzutauchen.
Er stieg gerade die schmale Treppe hoch, als er ein vertrautes Summen in seiner Brusttasche spürte. Eigentlich hatte er heute Abend nicht darauf reagieren wollen. Doch die Macht der Gewohnheit ließ ihn einen Blick auf die Nummer des Anrufers werfen, noch bevor er überhaupt realisiert hatte, dass er sein Handy aus der Tasche gezogen hatte.
MIT – Murder Investigation Team.
Nein. Nicht heute Abend. Er ließ es klingeln, bis der Anrufer zur Mailbox durchgestellt wurde. Trotzdem machte es ihn kribblig. Er war fast dankbar, dass der Anrufer es ein zweites Mal versuchte, noch ehe er den ersten Treppenabsatz erreicht hatte. Hinter ihm bildete sich bereits eine Schlange, sodass er unter gemurmelten Entschuldigungen wieder nach draußen trat. Er nahm den Anruf am schmiedeeisernen Geländer an, von dem man den Lower Walk überblicken konnte und wo es ein bisschen ruhiger war.
»DS Vega.«
»Abend, Rich. Hier ist Phil. Sorry, Kumpel. Ich weiß, dass du heute Abend nicht dran bist …«
»Was kann ich für dich tun?«
»DI Rosen hat einen verdächtigen Todesfall, gleich an der Romford Road. Sie bittet um das Vergnügen deiner Gesellschaft. Scheinbar bin ich ihr nicht gut genug. Frechheit, was?«
»Was soll ich sagen, Phil? Die Frau hat Geschmack. Davon mal abgesehen, hast du irgendeine Idee, warum sie …« In diesem Moment wurde Vega klar, warum seine Vorgesetzte ihn wollte statt des genauso fähigen DS Phil Llewellyn, der heute Bereitschaft hatte.
Gleich an der Romford Road …
»Sprichst du von Spine Wood, Phil?«
»Zufälligerweise ja, warum?«
Spine Wood, ein ungepflegtes Wäldchen, das an brachliegendes Weideland grenzte. Ein unscheinbarer Flecken der Grafschaft Kent, jedenfalls bis vor sechs Jahren, als er grausige Berühmtheit erlangt hatte. Vega kannte ihn nur zu gut.
Er verlagerte sein Gewicht und spürte, wie seine Füße in den glatten Schuhen rutschten, bis seine langsam kälter werdenden Zehen vorne anstießen.
»Hallo?«, hörte er Phil in seinem linken Ohr. »Bist du noch da, Rich?«
»Ja. Ja, ich mache mich gleich auf den Weg«, erklärte Vega. »Phil, alter Junge, was weißt du über das Opfer? Männlich, weiblich …«
»Jung, weiß, männlich.«
Um Gottes willen. Ein Déjà-vu der schlimmeren Sorte.
»Okay«, sagte er. »Gib Rosen Bescheid, dass ich bald da bin.«
»Mach ich. Und danke.«
»Klar. Kein Problem.«
Vega schaute noch einmal zurück zu der schmalen Treppe, die zum Grey Lady führte. Die Musik war gut für Cherrys Genesung, sie gab ihr einen Fokus. Das behauptete jedenfalls ihr Therapeut in seiner Wollstrickjacke.
Er schluckte seine Schuldgefühle herunter und machte sich auf den Weg. Er hatte ganz in der Nähe geparkt, in der Hoffnung, Cherry gleich nach Hause locken zu können, fort von den Versuchungen der obligatorischen After-Show-Party.
Sie würde heute Abend für sich selbst sorgen müssen.
Und er würde es wiedergutmachen, ein anderes Mal.
Detective Inspector Daria Rosen streckte Vega die Hand entgegen, kaum dass er ausgestiegen war. Bei dem knappen Händeschütteln konnte er durch die Wollhandschuhe hindurch ihre feinen Knochen und die kalte Haut spüren.
Rosen war lebhaft und engagiert, dennoch hielt sie stets ein Lächeln bereit. Sie konnte gut mit Leuten umgehen, vor allem mit den jüngeren Detectives. In einem anderen Leben hätte Vega sie sich als Direktorin einer angesehenen Mädchenschule vorstellen können. In diesem Leben hatte sie sich für die Toten entschieden, nicht für die Kinder. Heute Abend befürchtete er aber, dass es zu einer Überschneidung kommen würde.
»Danke fürs Kommen, Richard. Ich weiß das wirklich zu schätzen.«
»Es ist schlimm, oder?«
»Überhaupt nicht. Der Tatort ist ziemlich frisch und weitgehend unbeeinträchtigt. Ich bin optimistisch.«
Das hatte er nicht gemeint, aber er machte sich nicht die Mühe, sie zu korrigieren.
Sie befanden sich an einer schmalen Straße. Keine Laternen und zu beiden Seiten Wald. Polizeiwagen mit leise pulsierenden Blaulichtern sperrten die Straße in beide Richtungen ab.
Vega steckte seine Hände unter die Achseln, um sie vor der beißenden Kälte zu schützen. Die Nachtluft brannte in seinen Lungen, schien Rosen jedoch nicht das Geringste auszumachen.
»Also, wo ist der Tatort?«
»Die Böschung runter und dann ungefähr eine halbe Meile«, sagte sie. »Man muss ein bisschen klettern. Wir nähern uns aus dieser Richtung, um auf der Route, die der Täter wahrscheinlich genommen hat, keine Spuren zu verwischen.«
Nach einem Blick auf seine Schuhe runzelte sie die Stirn. »Hast du nichts Praktischeres dabei?«
»Nein …« Erst jetzt bemerkte Vega, dass Rosen Hunter-Gummistiefel über die Beine ihrer Anzughose gezogen hatte.
»Dann gehst du besser vor«, sagte sie. »Ich will nicht, dass du auf mich fällst.«
Vega ging mit seiner Vorgesetzten unter die Bäume am Waldsaum. Ihr Abstieg wurde durch totes Unterholz und das beinahe vertikale Gefälle der Böschung erschwert, doch irgendwer hatte die Idee gehabt, ein Abschleppseil um einen jungen Baum zu binden, sodass sie die Rutschpartie einigermaßen würdevoll bewerkstelligten.
»Du sagst, der Tatort ist noch frisch«, bemerkte er, als Rosen, die ihm geschickt gefolgt war, ihn auf einem Stück flacherem Gelände einholte. »Was schätzen wir, wie lange er schon hier liegt?«
»Ich will mich nicht festlegen, bevor Dr. Fleischer ihn sich angesehen hat, aber sicher nicht lange.« Aufrecht marschierte sie an der dunklen Linie der Bäume entlang auf das weiße Zelt der Spurensicherung zu. »Es gibt noch keine sichtbaren Zeichen der Verwesung, aber bei dieser Kälte …«
Bodennebel waberte über das Gras, und Vega fluchte, als er in einen Kaninchenbau trat. Zu spät warf Rosen ihm eine Taschenlampe zu. Eine junge Mitarbeiterin der Spurensicherung begrüßte sie und reichte ihnen das unerlässliche Outfit: blaue Handschuhe, weiße Anzüge, Überzüge für die Schuhe und eine Gesichtsmaske. Rosen tauschte ein paar Höflichkeitsfloskeln mit der Frau aus, während Vega sich schweigend umzog. Per Unterschrift bestätigten sie ihre Anwesenheit am Tatort, dann hielt die junge Frau ihnen die Zeltklappe auf und ließ sie gebückt eintreten.
Vega hielt sich die Hand vor die Augen. Nach der Dunkelheit draußen blendete ihn die Helligkeit im Zelt, und es dauerte einen Moment, bis seine Augen sich angepasst hatten. Die Leiche war auf den ersten Blick nicht zu sehen, da sich mehrere Forensiker über sie beugten. Während sie die Fasern und Staubkörnchen einsammelten, die später die Basis für eine Verurteilung bilden konnten, unterhielten sie sich mit ehrfürchtig gesenkten Stimmen.
Der Polizeifotograf trat zurück, um Platz für Vega zu machen, der sich nun einen ersten Eindruck verschaffen konnte.
Der Junge lag auf einer dunklen Schicht alten Laubs. Automatisch registrierte Vega die gekräuselten Farntriebe, die sich ihren Weg durch die gefrorenen Schichten hindurch suchten.
»Hallo«, sagte er leise, als er sich neben die Leiche hockte. »Was ist dir zugestoßen?«
Der Junge war schlank und trug eine Puffa-Jacke und tief sitzende Jeans, unter denen die Gummibänder seiner Shorts hervorschauten. Sackartig, hatte Cherry diese Hosen einmal genannt, mit denen die jungen Leute wie Rapper aussehen wollten.
»Seine Turnschuhe sind ausgetreten, sie müssten aber teuer gewesen sein.«
»Da muss ich dir vertrauen«, sagte Rosen. »Ich kann keinen Manolo von einem … anderen Schuh unterscheiden.«
»Wir haben Glück, dass die Füchse sich noch nicht an ihm zu schaffen gemacht haben.« Vega beugte sich weiter vor, um das ramponierte Gesicht des Jungen besser sehen zu können. Dabei wurde sein Blick automatisch von den glasigen, milchigen Augen angezogen. »Wahrscheinlich war er ein gut aussehender Junge. Auch wenn es jetzt schwer ist, ihn sich lebendig vorzustellen, stimmt’s?«
»Das ist es immer.«
Sein Gesicht war bleich, mit Ausnahme der den Boden berührenden Wange: Dort, wo sich das Blut nach dem Tod gesammelt hatte, war sie braunrot marmoriert. Der Junge hatte zahlreiche Verletzungen. Mehrere Knochen waren eindeutig gebrochen und zeichneten sich in bizarren Winkeln unter seiner Haut ab. Doch zwischen den Abschürfungen und einer hässlichen Strieme entdeckte der Detective auch helle Sommersprossen und eine Windpockennarbe gleich unterhalb des Haaransatzes.
Merkmale des Jungen selbst, nicht dessen, was ihm angetan worden war.
»Dreizehn, vierzehn Jahre vielleicht?«, schätzte Vega.
»So ungefähr, ja.«
»Und Todesursache war die Kopfwunde?«, fragte er und schob das kastanienbraune Haar des Jungen ein Stück zur Seite. Die Wunde war gleichmäßig rund und hatte die Größe einer Zwei-Pfund-Münze. Die Schädeldecke war nach innen gesplittert und hatte Gehirnmasse freigelegt, die zäh wie Knetgummi geworden war. Der Jackenkragen des Jungen war mit altem Blut verkrustet, doch an den Blättern, auf denen er lag, befanden sich keine Blutspuren. »Es sieht nicht so aus, als wäre er hier gestorben. Glaubst du, man hat ihn hier nur abgelegt?«
»Ich schätze schon«, sagte Rosen. »Aber ehe Dr. Fleischer ihn gesehen hat …«
»Ja, ich weiß.« Vega richtete sich langsam auf und verschränkte die Finger hinter dem Kopf. Aus Solidarität schien er langsam Kopfschmerzen zu bekommen. »Der arme kleine Kerl.«
»Also …«, drängte ihn Rosen. »Stimmst du mir zu?«
»Wobei?«, fragte Vega, der vorerst lieber den Dummen spielen wollte.
»Stimmst du mir zu, dass Ähnlichkeiten zwischen diesem Jungen hier und Tom Healy bestehen? Er wurde getötet wie Healy. Hingelegt wie Healy. Vielleicht ein paar hundert Meter von der Stelle, an der Healy damals gefunden wurde … Es gibt Übereinstimmungen, meinst du nicht?«
Noch einmal betrachtete Vega den unbekannten Jungen. Die Hände, die mit Kabelbindern hinter seinem Rücken gefesselt waren, und das Loch an der Schädelbasis, das wie eine Schusswunde aussah, das aber keine war, wie er wusste.
»Ich würde sagen …«, begann er. Dann zögerte er die Antwort noch ein wenig hinaus und erkundete mit der Zungenspitze die Vertiefung in einem seiner Backenzähne. »Ich würde sagen, dass der Modus Operandi beinahe identisch ist. Aber Tom wurde nicht geschlagen. Das hier …«
Er ließ die Luft aus seinen Wangen entweichen. »Das ist eine ganz neue Dimension der Gewalt. Es ist eine viel widerlichere Art zu töten.«
DI Rosen hatte unwillkürlich den Atem angehalten und ließ ihn jetzt wieder entweichen. Vega wusste nicht, ob er ihr die Antwort gegeben hatte, die sie hatte hören wollen.
»Erzähl mir mehr von Tom. Könnte es sich um dieselbe Mordwaffe handeln?«
»Möglich«, räumte Vega ein. Nach einem weiteren Blick in die halb geöffneten Augen des Jungen spürte er Mitleid aufwallen. »Weil die Kopfwunde so klar abgegrenzt war, glaubten wir ganz am Anfang, Tom wäre mit einer Pistole erschossen worden. Eine Zeitlang wurde über einen Mord im Stil einer Exekution spekuliert, was angesichts des Opfers keinen Sinn ergab – ein elfjähriger Junge aus einer normalen Familie ohne nennenswertes Vermögen oder kriminelle Verbindungen.«
»Aber es war keine Schusswunde, oder?«
»Nicht im eigentlichen Sinn. Sie wurde von einer aufgesetzten Bolzenschusspistole verursacht.«
»Das sind die Waffen, mit denen Schweine und Rinder betäubt werden, oder?«
»In erster Linie, ja«, sagte Vega. »Normalerweise zielen die Schlachter damit auf die Stelle am Hinterkopf, von der aus die komplette Motorik koordiniert wird, wobei sie versuchen, den Hirnstamm unbeschädigt zu lassen.«
»Also stirbt das Tier nicht, jedenfalls nicht gleich.«
»Genau. Es verblutet einfach.«
Rosen schlug auf ihre Oberschenkel und stand auf. »Na denn. Lassen wir die guten Leute hier ihre Arbeit machen. Bitten Sie Fleischer, mir so schnell wie möglich ein paar Zeilen zu schreiben«, sagte sie und berührte die jüngste Mitarbeiterin der Spurensicherung leicht an der Schulter. Die junge Frau nickte eifrig und bekam ein Lächeln von Rosen als Dankeschön.
Vega hatte bemerkt, dass Rosen oft so vorging. Sie vertraute jungen Kollegen Aufgaben an, um deren Selbstvertrauen zu stärken. Und in einer Nacht wie dieser konnte ein wenig Selbstvertrauen nicht schaden. Vega folgte seiner Vorgesetzten hinaus in die Dunkelheit.
»Du weißt sicher, dass ein Junge namens Shane Johnson für den Mord an Tom verurteilt wurde?«, fragte Vega und warf Rosen einen Blick zu. Sie legten ihre Schutzkleidung ab. Er faltete den papierähnlichen weißen Anzug präzise zusammen, während sie ihren einfach an Ort und Stelle liegen ließ.
»Ja«, sagte sie. »Er war noch ziemlich jung, oder?«
»Er war gerade erst zwölf geworden und bekam sechs Jahre, was die höchste Strafe war, die wir erwarten konnten. Toms Eltern waren zufrieden damit.«
»Und Shane wurde vor vierzehn Tagen aus der Jugendstrafanstalt in Rochester entlassen?«
»Genau. So viel zum Thema Zufall.«
»Bish hat mich sofort beim zuständigen Bewährungshelfer anrufen lassen, als wir von den Einzelheiten dieses Mordes hier erfahren haben«, sagte Rosen. »Shane muss als Teil seiner Bewährungsauflagen einen Sender tragen. Sie sind sicher, dass er sich seit seiner Entlassung nie mehr als eine Meile von seinem Wohnsitz entfernt hat.«
»Hmm. Dann wünsche ich seinen neuen Nachbarn viel Glück.«
»Vielleicht ist er rehabilitiert.«
»Ja, vielleicht.«
Es war nicht der komplizierteste Fall gewesen, in dem Vega je ermittelt hatte. Sie hatten Shane Johnson innerhalb der ersten Woche nach der Tat als möglichen Verdächtigen ins Auge gefasst und ihn binnen acht Wochen der Staatsanwaltschaft übergeben. Es war ein guter, solider Fall mit genügend forensischen Beweisen gewesen, um die Geschworenen zu überzeugen. Die hatten dann auch nur wenige Stunden für ihre Beratung gebraucht, ehe sie auf schuldig erkannt hatten. Der Gerechtigkeit war in jeder Hinsicht Genüge getan.
Trotzdem hatte Vega sich mit dem Ergebnis nie wirklich wohlgefühlt. Oder vielleicht lag es gar nicht am Ergebnis, sondern an der Geschichte hinter dem Fall, die ihm nie wirklich schlüssig erschienen war.
Jeder Mord war sinnlos. Das hatte er – hatten sie alle – schon nach kurzer Zeit in diesem Beruf begriffen. Und trotzdem hatte im Healy-Fall irgendetwas nie richtig gepasst. Bis heute hatten sie ein entscheidendes Detail nicht begriffen, das jedenfalls vermutete er. Doch mit solchen Vermutungen kam man nicht weit, man konnte sie nur vor sich hin schwären lassen und hoffen, dass sie sich nicht zu etwas Schlimmerem entwickelten.
Schweigend näherten sie sich wieder der Straße. Der Boden war gefroren und ließ ihre Schritte hohl klingen. Beim Ausatmen schienen frostige kleinen Wölkchen vor ihnen zu explodieren.
»Ich konnte die Akte bisher nicht komplett durcharbeiten. Wie hat das Team Shane damals überführt?«, fragte Rosen, als sie die Böschung erreicht hatten.
»Zuerst haben wir die Höfe und Schlachthäuser abgeklappert, um die Arbeiter zu befragen«, erklärte Vega. »Wir haben deren Namen mit Jungen aus Toms Bekanntenkreis abgeglichen und sind dadurch auf Sean Johnson gestoßen, den Vater von Shane Johnson. Tom war mit Shane in der gleichen Schulklasse. Der Vater hatte die Bolzenpistole von der Arbeit mit nach Hause gebracht, um in seiner Stammkneipe damit anzugeben, also ist unser Verdacht zunächst auf ihn gefallen. Wie sich herausgestellt hat, hatte er für die Tatzeit aber ein ziemlich solides Alibi – er war mit seinen Kumpels zum Feiern irgendwo auf Lanzarote oder in Magaluf. Und so haben wir Shane eingelocht.«
»Wir sollten durchgehen, was seinerzeit in der Presse veröffentlicht wurde«, sagte Rosen. »Um zu klären, welche Details öffentlich gemacht wurden. Anlässlich von Shanes Entlassung ist kürzlich noch einmal über den Fall berichtet worden.«
»Du glaubst, der Mord könnte auf das Konto eines Nachahmungstäters gehen?«
Sie zuckte die schmalen Schultern. »Es wäre ungewöhnlich, aber so etwas ist schon vorgekommen.«
Vega nickte. Er hatte die Daumen in seine Jackentaschen gehakt. Rosen griff nach dem Abschleppseil und setzte einen Fuß auf die Böschung, bereit zum Aufstieg.
»Da ist noch etwas«, sagte Vega wider besseres Wissen. »Shane hat uns nie verraten, warum er es getan hat. Nach allem, was wir gehört haben, waren Tom und er Freunde. Natürlich haben sie sich hin und wieder mal geprügelt, aber ihre Lehrer beschrieben sie als unzertrennlich. Shanes Verteidiger versuchte damals, den Vorfall als aus dem Ruder gelaufenes Spiel hinzustellen, aber das hat mich nie überzeugt.«
»Wer war damals der Ermittlungsleiter?« Rosen ließ das Seil wieder los und wandte sich zu ihm um. »DCI Keogh, stimmt’s?«
»Ja. Er arbeitet inzwischen in Manchester.«
»War er mit der Erklärung zufrieden? Dass Johnson die Kontrolle verloren hat und Toms Tod letztlich unbeabsichtigt war?«
»Ja, er war damit zufrieden.«
»Und Bish ebenfalls?«
»Ja.«
Rosen nickte und sagte weiter nichts dazu. Vega wusste, was das bedeutete: Sie gab Keogh recht, was er ihr nicht verübeln konnte. Rosen griff erneut nach dem Seil und begann mit dem Aufstieg. Vega folgte ihr und genoss den Anblick.
»Dein Pilates macht sich langsam bezahlt, was, Dar?«
»Benimm dich.«
Schließlich erreichten sie die Straße, auf der zu beiden Seiten weiterhin die Blaulichter blinkten. Rosen setzte sich seitlich in ihren Wagen und zerrte an den Gummistiefeln. Vega nahm eine Selbstgedrehte aus seiner Tabaksdose und registrierte im Augenwinkel, wie sie den schmalen, elegant geformten Fuß in einen ihrer schwarzen Lederpumps schob. Sie trug Strümpfe und musste unweigerlich frieren, doch man merkte ihr nichts davon an.
»Der Look gefällt mir übrigens«, sagte Rosen und deutete auf das fliederfarbene Paisley-Hemd, das er unter seinem normalen Anzug und der Lederjacke trug. »Ziemlich trendig.«
»Es ist furchtbar, und das weißt du genau.«
»Ein bisschen verspielter als dein üblicher Stil.«
»Hmm. Cherry hat es für mich gekauft. Ich hätte es unhöflich gefunden, es nicht wenigstens einmal zu tragen, ehe ich es in den Second-Hand-Laden einer Wohltätigkeitsorganisation bringe.«
»Geht es ihr gut?«, fragte Rosen. »Wie ist ihr Auftritt gelaufen?«
»Ich weiß nicht.«
»Oh, verdammt, wie gedankenlos. Tut mir leid.«
»Ah, nicht nötig. Sie ist ein gutes Mädchen und weiß, wie es läuft.« Vega richtete den Blick starr geradeaus. »Sie vermisst dich.«
Rosen versuchte, sich mit den Fingern durch die Haare zu fahren, doch ihre zerzauste Frisur, mehr Krauskopf als Lockenpracht, wollte sich nicht bändigen lassen.
»Woran arbeitest du im Augenblick, Richard?«
»An einer Serie von Sexualstraftaten in der Gegend des West Kent College.«
»Irgendetwas Ernsthaftes?«
»Es sind Sexualstraftaten, Dar, das ist immer ernst.«
»Trotzdem hätte ich dich mindestens für die ersten paar Wochen gern in meinem Team«, sagte sie. »Gib deinen Fall weiter ans Priority Crime Team.«
»Ja, Ma’am«, sagte Vega und salutierte halbherzig. Sie musterte ihn mit einem Ausdruck, der ihm vertraut war: als wäre er ein herumstreunender Hund, von dem sie nicht wusste, ob er beißen würde oder nicht.
Inzwischen hätte sie wissen sollen, dass er bloß bellte.
Vega stieß langsam den Rauch aus, der nach unten sank und sich im aufsteigenden Nebel verlor. »Bis jetzt hat niemand etwas zur Identität des Jungen gesagt. Haben wir eine Vorstellung davon, wer er ist?«
Rosen kniff die Lippen zusammen. Wieder berührte sie ihr Haar.
»Du weißt, wer er ist, stimmt’s? Sag schon, Dar. Wenn ich meinen Fall abgebe, um dein Team zu verstärken, dann musst du mich auch miteinbeziehen.«
»Auf den ersten Blick ähnelt er einem Jungen, der gerade als vermisst gemeldet wurde«, räumte sie nach längerem Zögern ein. »Mehr möchte ich ungern sagen.«
»Wie heißt er?«
»Stowe. Deano Stowe.«
Vega nickte. »Gut.«
»Wir sprechen beim Briefing weiter darüber.« Sie drehte sich um und ging zu ihrem Wagen. »Wir treffen uns im Dowding House, Richard.«
»Ja. Bis bald.«
»Und zieh dir was Dezenteres an.«
»Gern«, erwiderte er lachend. Dann drückte er die Zigarette aus und warf den Stummel in den Aschenbecher seines Wagens.
Lassen Sie am Tatort nichts außer Fußabdrücken zurück und so weiter …
3 Ostermontag, später Abend
Vega fuhr nach Hause, ersetzte das Paisley-Hemd durch ein blassblaues mit Doppelmanschette und wählte dazu eine marineblaue Krawatte. Vor dem Aufbruch zum Konzert hatte er sich nicht rasiert, was er jetzt nachholte. Zum Schluss legte er ein wenig Aftershave auf.
Die Uhr an seiner Mikrowelle zeigte kurz vor Mitternacht an. Er nahm eine Dose mit einem Energydrink aus dem Kühlschrank und leerte sie in einem Zug. Dann schrieb er Cherry eine Nachricht und kehrte schnell zu seinem Wagen zurück. Auf den Asphaltstufen hinauf zum Parkplatz geriet er mit seinen glatten Sohlen ins Rutschen.
Im Großraumbüro des Major Incident Teams im Dowding House saßen die Kollegen dicht an dicht. Er suchte sich ein freies Fleckchen ganz hinten im Raum. In diesen ersten Stunden nach der Entdeckung der Leiche wirkten alle ein wenig angespannter und energiegeladener als gewöhnlich. Mit einem Projektor wurden Fotos auf eine Leinwand geworfen, und Vega spürte die Erschütterung hinter den grimmigen Mienen der Kollegen. Auf einer Katasterkarte markierte eine blutrote Stecknadel den Fundort der Leiche.
Mit einem Nicken begrüßte Vega DCS Bishop, seinen Chef, den er nur selten zu Gesicht bekam und der jetzt in gebeugter Haltung neben Rosen saß. Bishop verbrachte sein Leben praktisch ausschließlich im Büro. Vega nannte ihn für sich »Das Ewige Licht«, weil er nie ausging.
»Ich will nicht lange drum herumreden«, erklärte DI Rosen gerade. »Wir haben keine einfachen Ermittlungen vor uns. Sie werden uns eine große emotionale Distanz abverlangen, was uns allen zu diesem frühen Zeitpunkt sicherlich schwerfällt, vor allem angesichts des Alters unseres Opfers und der Gewalt, mit der er zu Tode gekommen ist.«
Vega war jetzt seit fünfzehn Jahren in dem Beruf. In dieser Zeit hatte er eine harte Schale bekommen, aber er war nicht abgestumpft. Ein abgestumpfter Bulle nützte niemandem. Bei ihm bildeten sich wie bei einer verhärteten Gummidichtung Risse, durch die das, was eigentlich zurückgehalten werden sollte, hindurchdrang: Wut oder – schlimmer noch – Apathie. Nein, er war nicht abgestumpft, aber robust.
Die Jüngeren fühlten alles unmittelbar und intensiv, was man den rangniedrigeren Teammitgliedern gleich ansah: das Bein von DC Zaid Khan zuckte, während DC Carmichaels ungleichmäßiger, an Schamhaar erinnernder Bart die plötzliche Blässe seiner Haut nicht verbergen konnte. Nur DC Ellie Finch wirkte relativ ungerührt, aber sie war auch ein wenig älter und hatte entsprechend mehr Erfahrung, darunter sieben Jahre an vorderster Front.
»Nehmen Sie sich einen Moment Zeit«, sagte Rosen leise. »Atmen Sie durch. Und dann schieben Sie Ihre Gefühle beiseite und konzentrieren sich auf das weitere Vorgehen. Arbeiten Sie akribisch. Trösten Sie sich mit der Banalität des Jobs – vertrauen Sie mir, es hilft.«
Einige Minuten lang herrschte Stille. Nur das Scharren der Sohlen auf dem grauen Teppichboden der Behörde und ein gelegentliches Räuspern waren zu hören.
»Wir haben eine Vermutung, wer dieser Junge sein könnte«, nahm Rosen den Faden wieder auf. »Ein Junge, dessen Beschreibung auf das Opfer passt, wurde gestern am späten Abend als vermisst gemeldet. Bisher ist das unsere vielversprechendste Spur, aber ehe wir mit der Mutter gesprochen und die Identität bestätigt haben – oder auch nicht –, machen wir weiter wie bisher und bleiben für alle Möglichkeiten offen.«
»Wie sind die näheren Umstände?«, fragte Vega. »Was das Verschwinden dieses Jungen angeht, meine ich.«
»Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir es mutmaßlich mit einer Entführung zu tun«, sagte Rosen. »Die Eltern sind frisch getrennt, und der Junge besuchte entsprechend den Sorgerechtsvereinbarungen den Vater. Der sollte ihn am Sonntagnachmittag nach Hause zur Mutter bringen. Als er heute am frühen Morgen noch nicht aufgetaucht war, rief uns die Mutter an.«
»Wann hat sie den Jungen beim Vater abgeliefert?«
»Gar nicht. Sie hat ihren Sohn am Samstag um 13 Uhr am Sportzentrum von Tunbridge Wells abgesetzt, wo er mit seinen Freunden schwimmen gehen wollte. Der Vater sollte ihn später dort abholen. Wir werten die Aufnahmen der Überwachungskameras aus, um das zu überprüfen.« Rosen schaute in die Gesichter ihres Teams. »Ist bis hierher alles klar? Sie alle wissen, was Sie in den nächsten Stunden zu tun haben?«
Als die Beamten begriffen, dass die Besprechung zu Ende ging, begann ein allgemeines Stühlerücken, und alle setzten sich in Bewegung. Rosen holte Vega an der Tür ein.
»Bei der Mutter sind bereits Streifenpolizisten. Ich werde jetzt mit ihr sprechen und hätte dich gern dabei, falls schlimme Nachrichten zu überbringen sind.«
»Klar«, sagte er, und sie machten sich auf den Weg zum Parkplatz. »Du hast bei der Besprechung nichts von Tom erwähnt.«
»Nein, noch nicht. Ich will die Dinge nicht komplizierter machen.«
»Das verstehe ich. Ist wahrscheinlich vernünftig.« Er folgte Rosen zu ihrem Wagen. Zwischen ihnen hing jetzt Schweigen. Ein unbehagliches Schweigen.
Miss Jodie Groves wohnte in einer Dreizimmerwohnung in Montacute Gardens, einer im Süden der Stadt gelegenen Siedlung mit viel Grün. Mit seinen großen Erkerfenstern und den auffälligen Ecksteinen schien das Haus aus der viktorianischen Zeit zu stammen, war aber – wie viele andere Häuser der Stadt – in den 1980er-Jahren in Wohnungen aufgeteilt worden. Rosen parkte in der Schottereinfahrt neben dem bereits dort abgestellten Streifenwagen. Ein einsamer Laternenmast sorgte vor dem Haus für spärliche Beleuchtung.
»Welche Wohnung war es gleich wieder?«, fragte Vega und durchbrach das unbehagliche Schweigen, das seit der Abfahrt vom Dowding House geherrscht hatte.
»Vier.«
Vega stieg aus, suchte die entsprechende Klingel und wartete. Drinnen war ein Summer zu hören, und eine Flurlampe wurde eingeschaltet. Ein uniformierter Beamter ließ sie ins Haus und ging ihnen auf der breiten, geschwungenen Treppe voraus.
Die Wohnung ganz oben lag zwischen den Dachschrägen. Sie war nicht besonders geräumig und zum größten Teil mit unausgepackten Kisten vollgestellt, an denen vielleicht ein Dutzend große Leinwände lehnten. Die Bilder unterschieden sich in Stil und Technik, waren aber allesamt ausgezeichnet. Eine sorgfältig zusammengestellte Sammlung. Vega spürte, dass seine Aufmerksamkeit spontan mehr von den Bildern als von der Frau gefangen wurde.
Jodie hockte am Rand eines breiten Chesterfield-Sofas, dessen Ecken dort, wo man es durch die schmale Wohnungstür geschoben hatte, deutlich angestoßen waren. Sämtliche Möbel waren zu groß für diese Wohnung. Sie hatten woanders hingepasst und wirkten nach ihrem Umzug fehl am Platz.
Der uniformierte Sergeant und sein Constable hielten jeweils eine Tasse Tee in den Händen, die sie beim Eintreffen der Detectives sofort auf der nächstgelegenen freien Fläche abstellten. Die Beteiligung der Kriminalpolizei hob den Fall auf eine andere Ebene, was auch Jodie zu begreifen schien.
Sie hatte auf ihren Füßen gesessen, streckte nun aber die Beine aus, erhob sich und reichte den Detectives die Hand. Sie trug kein Make-up und hatte eindeutig in ihrem T-Shirt geschlafen. Sie war groß und für die Jahreszeit ungewöhnlich braun. In den Haaren hatte sie Strähnchen. Die Begrüßungen gingen schnell über die Bühne.
Rosen ergriff die Initiative. »Wir müssen uns über Ihren Sohn unterhalten, Miss Groves.«
»Sagen Sie bitte Jodie«, erwiderte sie. Ihre Stimme überraschte Vega. Sie sah aus wie jemand, der aus einem reichen Haus stammte, was auch ihre schmale Designer-Uhr und der ansehnliche einzelne Diamant, der um ihren Hals hing, zu bestätigen schienen. Ihr Akzent jedoch wies in eine andere Richtung.
»Wollen Sie Tee? Ich hab ’ne Kanne gemacht. Was soll man sonst machen, stimmt’s?« Dabei lachte sie nervös.
»Nein, danke. Bitte, Jodie, setzen Sie sich.«
»Ich bleib lieber stehen.« Sie schlug die vermutlich im Fitnessstudio trainierten Arme um ihren Körper, als wolle sie sich selbst Trost spenden. »Also, finden Sie meinen beschissenen Ex, ja? Ich kapier nicht, warum er mir das antut. Ich würde ihm die Jungs nie wegnehmen. Das könnte ich nicht, selbst wenn ich es wollte.«
»Dann stehen die Söhne ihrem Vater also nahe?«, fragte Rosen.
Jodie nickte nachdrücklich. »Oh ja, sehr. Deano ist ein echtes Muttersöhnchen, wo er doch das Baby im Haus ist. Aber trotzdem verehrt er seinen Dad.«
»Es tut mir leid, aber einige Fragen, die wir stellen werden, sind ziemlich persönlich, Jodie. Wenn wir Ihnen helfen sollen, müssen Sie uns wahrheitsgemäß antworten. Verstehen Sie das?«
Jodie setzte sich wieder. »Dann los. Spucken Sie’s schon aus.«
Rosen setzte sich zu ihr aufs Sofa. »Ist Ihr Ex jemals übergriffig geworden? Gegenüber Ihnen oder Ihren Kindern?«
»Niemals.«
»Sie klingen sehr sicher.«
»Das bin ich auch. Sam ist ziemlich selbstzerstörerisch, verstehen Sie?« Jodie betastete ihren nackten Ringfinger, als hinge sie in Gedanken glücklicheren Zeiten nach. »Aber anderen würde er nie etwas antun.«
»Wie heißt er mit vollem Namen, Jodie?«
»Samuel James Stowe.«
»Sam Stowe? Der ist Ihr Ex?«, mischte Vega sich ein. Bisher hatten sie Jodies Mädchennamen benutzt, Groves, sodass er keine Verbindung hergestellt hatte. Rosen betrachtete ihn fragend, und Jodie rieb sich nervös die Hände. »Wie heißt Ihr ältester Sohn?«
»Reese.«
»Reese Stowe«, sagte Vega mehr zu sich selbst als zu irgendjemandem sonst.
Rosen konzentrierte sich weiter auf Jodie. »Soweit ich weiß, hatte Ihr Mann in letzter Zeit einige Schwierigkeiten, beruflich.«
Jodie stieß ein bellendes Lachen aus. »Das ist eine hübsche Formulierung dafür, dass sein Leben ins Klo gespült wurde.«
»Hat man Sie bedroht?«
Plötzlich hielt Jodie die Hände ruhig. »Was wollen Sie damit sagen?«
»Ich will gar nichts sagen, Jodie. Im Moment versuchen wir noch, uns ein Bild zu machen.«
»Die Wettbewerbsbehörde hat gegen Sam ermittelt. Sie haben ihn vor Gericht gezerrt, und er hat das Urteil mit Fassung getragen: Geldstrafe und zwei Jahre auf Bewährung. Das war’s. Er ging pleite, Ende der Geschichte«, sagte Jodie grimmig. »Wir sind nicht die verdammten Corleones.«
»Natürlich, Miss Groves.« Rosen nickte. »Das sind bloß Routinefragen.«
Vega schaute sich im Zimmer um: die unausgepackten Kisten, der kleine Küchenbereich und der mit Alufolie abgedeckte Teller hinter der Backofentür, auf dem das Abendessen wartete. Von gestern Abend, vermutete er, als Jodie noch mit der Rückkehr ihres Sohnes gerechnet hatte. Falls sie irgendwie in seinen Tod verwickelt war, musste sie über eine enorme Fähigkeit verfügen, falsche Spuren zu legen. Die Uhr am Ofen zeigte an, dass es ein Uhr vorbei war. Mittlerweile war Dienstag, und ihr Sohn konnte schon drei Tage tot sein.
»Würden Sie uns ein Foto Ihrer beiden Söhne zeigen?«, fragte er. Jodie warf den Streifenbeamten einen Blick zu.
»Ich hab denen schon eins gegeben.«
Der Sergeant reichte Rosen ein gerahmtes Foto. Vega registrierte, wie sich ihre Brauen ein winziges Stück hoben. Sie gab ihm das Bild weiter, und Vega schaute in das Gesicht des toten Jungen. Er grinste mit vorgerecktem Kinn, und die grauen Augen blinzelten in die Sonne, die seine zahlreichen Sommersprossen dunkler hatte werden lassen. »Ein echter Frechdachs, wie es aussieht«, sagte er und gab Rosen das Bild zurück. »Aber ich hatte um ein Bild von beiden gebeten. Von ihm und seinem Bruder.«
»Ich gehe eins suchen.«
Rosen wartete, bis Jodie das Zimmer verlassen hatte. Dann sagte sie mit sanfter Stimme: »Sie hat keine Ahnung von Deanos Tod. Sie glaubt wirklich, dass er bei seinem Dad ist.«
Rosen ließ sich gegen die Rückenlehne des Sofas fallen und legte den Rahmen mit der Bildseite nach unten neben sich. Sie schloss die Augen und runzelte die Stirn. Vega fragte sich, ob sie einen ihrer üblichen Migräneanfälle bekommen würde. In seiner Tasche suchte er nach dem Co-Codamol, das er genau für solche Fälle stets bei sich trug. In seinem Auto hatte er außerdem einen Vorrat ihrer sämtlichen sonstigen Medikamente versteckt. Für den Fall, dass sie etwas davon brauchte. Dass sie ihn brauchte.
»Warum drängst du sie wegen des älteren Sohnes, Richard?«
»Das sag ich dir gleich. Was Sam angeht, hast du jedenfalls deine Hausaufgaben gemacht.«
»Jeder hat doch von Sam gehört. Es ging um Preisabsprachen, oder? Weswegen er bestraft wurde?«
»Ja«, bestätigte Vega. »Er hat mit anderen Baufirmen die Preise abgesprochen und damit gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen. Die Gemeinde hat das eine Menge Geld gekostet. Aber diese Art von Kartellbildung ist reine Wirtschaftskriminalität und führt normalerweise nicht dazu, dass einem der Sohn …«
Sie verstummten, weil Jodie in diesem Moment ins Zimmer trat und Vega ein Album mit Familienfotos reichte. Er blätterte zu den älteren Aufnahmen zurück und fand, wonach er suchte.
Er stieß die Zunge in die Wölbung in seinem hinteren Backenzahn, wie er es oft tat, wenn er nachdachte.
»Wissen Sie was, Jodie? Ich denke, ich nehme doch eine Tasse Tee.« Rosen lächelte Jodie an, die unsicher nickte und sich in den Küchenbereich begab. Rosen wartete, bis das Wasser laut aufkochte, dann winkte sie Vega näher zu sich. »Was ist? Was ist los?«
»Dieser Junge«, sagte Vega und deutete auf das Gesicht eines Jungen mit langen, ungelenk wirkenden Gliedmaßen, der neben dem achtjährigen Deano stand und den Eindruck eines echten Stubenhockers machte. »Das ist Reese Stowe.«
»Ja. Und?«
»Vor sechs Jahren habe ich ihn im Zusammenhang mit dem Mord an Tom Healy vernommen.«
»Was ist passiert?« Jodie stand im Durchgang zur Küchenzeile und hielt einen Teelöffel in der Hand. Sie zitterte jetzt. »Wenn Sie was wissen, dann rücken Sie damit raus!«
Vega warf Rosen einen Blick zu und wartete auf ein Zeichen von ihr, doch Rosen starrte ins Leere und wirkte völlig erschöpft. Der Himmel wusste, seit wann sie auf den Beinen war. Vega räusperte sich und stand auf.
»Vor wenigen Stunden haben wir einen Jungen gefunden, der verstorben ist«, sagte er. »Die ersten Anzeichen deuten darauf hin, dass er ermordet wurde. Es tut mir leid, Miss Groves, aber wir glauben, dass es sich um Ihren Sohn handelt.«
Als seine Worte zu ihr durchdrangen, ließ Jodie den Löffel fallen.
»Sie glauben, dass es Sam war, oder?«, fragte sie atemlos. »Das glauben Sie, oder? Oh Gott, Sie glauben, es war Sam!«
»Wir wissen nicht, wer Deano getötet hat, aber wir werden es herausfinden.«
Jodie gab ein tiefes, urtümliches Stöhnen von sich und fiel vornüber, als wäre jegliche Kraft mit einem Mal aus ihr gewichen. Als Vega sie auffing, klammerte sie sich an ihn wie ein Kind.
»Ich begreife nicht, was Sie da sagen«, keuchte sie schließlich. »Ich begreife es nicht!«
»Ihr Verlust tut uns sehr leid«, murmelte Rosen. »Ein Team speziell ausgebildeter Beamter wird in Kürze hier sein, um Ihnen durch die nächsten Stunden zu helfen.«
»Die nächsten Stunden?« Jodies aufgerissene, feuchte Augen fixierten Rosen. »Es wird sicher nicht besser nach ein paar Stunden!«
»Natürlich nicht. Ich wollte nicht …« Rosen verstummte. Sie zog ihr Handy aus der Tasche und schien den Nachrichteneingang zu überprüfen. »Es tut mir schrecklich leid, Jodie, ich werde woanders gebraucht. Bitte verlassen Sie sich darauf, dass wir herausfinden, was genau Ihrem Sohn zugestoßen ist.«
Während Jodie ihn immer noch festhielt, sah Vega Rosen zur Tür eilen. Er schüttelte den Kopf, und die entschuldigende Miene, die sie für einen Augenblick aufsetzte, verriet ihm, dass sie nicht dringend woanders gebraucht wurde.
Sie hatte sich schlicht einen Vorwand geschaffen.
Die Gesellschaft der Trauernden war viel schwerer zu ertragen als die der Opfer.
»Die Kontaktbeamten für die Angehörigen werden bald hier sein.« Rosens Versprechen galt mehr ihm als Jodie. »Es tut mir leid.«
»Wenn du gehen musst, dann geh«, sagte Vega und half Jodie zurück aufs Sofa. Er deutete auf die beiden uniformierten Beamten, die immer noch schweigend dabeistanden. »Ich finde schon eine Mitfahrgelegenheit.«
Rosen nickte kurz und verschwand.
»Jodie, wann haben Sie zuletzt mit Sam gesprochen? Nachdem Sie Deano beim Sportzentrum abgesetzt haben, hatten Sie doch noch Kontakt mit ihm, oder?«
Jodie zitterte und hielt den Blick starr geradeaus gerichtet. »Jedes Mal, wenn wir telefoniert haben, haben wir uns gestritten. Also haben wir SMS geschrieben.«
»Ich würde sie gern lesen. Ist das für Sie in Ordnung?«
Jodie stand wieder auf und durchquerte das Zimmer wie in Trance. Sie holte ihr Handy, das sie in der Küchenzeile zum Aufladen eingesteckt hatte. Vega scrollte durch die letzte Korrespondenz des Paares.
»Dann hat Sam seine letzte Nachricht also am Samstagmorgen geschickt? Und am Sonntagabend sollte er Deano bei Ihnen absetzen?«
»Ich hab ihm immer neue SMS geschickt«, erklärte Jodie abwesend. »Ich hab immer wieder versucht anzurufen. Aber sein Telefon war ausgeschaltet. Das sieht Sam überhaupt nicht ähnlich.«
»Ich werde Ihr Handy mitnehmen müssen. Ist das in Ordnung, Jodie?«
Sie schaute ihn mit glasigen Augen an, nickte aber. Er steckte das Gerät in die Tasche. Nach einem tiefen, zögerlichen Atemzug fragte sie: »Hat mein Deano gelitten?«
»Das wissen wir noch nicht«, log Vega. »Ich bezweifle es.«
»Wo hat man ihn gefunden?«
»In einem Waldstück.«
»Er hat den Wald geliebt«, flüsterte Jodie. »Er wollte immer draußen sein. Manchmal konnte er ein ziemlich wildes Kind sein. Er hat sich irgendwo ein Lager gebaut und dort übernachtet, wenn man ihn gelassen hat.«
»Jodie, wo ist Reese?«
Kurz betrachtete sie ihn, dann ging ihr Blick wieder ins Leere. »Ich weiß es nicht.«
»Wohnt er nicht bei Ihnen?«
»Nein. Reese ist … Reese hatte Probleme.«
»Welche Art Probleme?«
»Ich bin … Ich weiß es nicht genau. Irgendwas mit seinem Dad. Sie haben zusammengehalten wie Pech und Schwefel. Zu mir haben sie keinen Mucks gesagt.« Sie beugte sich vor und fuhr sich durchs Haar. »Reese ist vor ein paar Wochen ausgezogen. Ich wollte das nicht. Ich wollte ihn überreden hierzubleiben.«
»Haben Sie eine Nummer, unter der wir ihn erreichen können?«
»Nein. Nicht mehr. Sein Handy funktioniert nicht mehr.« Sanft rieb sie sich mit den Fingerknöcheln über die Wangen, als wollte sie sich selbst trösten. »Ich muss es ihm sagen, stimmt’s? Dass sein Bruder tot ist. Sie haben sich so nahe gestanden. Sie waren wie beste Freunde, immer schon.«
»Ich könnte es Reese sagen, falls das leichter für Sie ist«, bot Vega an. »Natürlich sieht es so aus, als müssten wir ihn erst finden. Haben Sie wirklich überhaupt keine Idee, wo er sich aufhalten könnte?«
»Nein.« Wieder begann Jodie zu weinen. Vega legte den Arm um sie und blieb schweigend neben ihr sitzen, bis es an der Tür läutete und die Kontaktbeamten ihn ablösten.
Der Streifenwagen setzte Vega am Dowding House ab. Im Büro des Major Incident Teams war jeder einzelne Schreibtisch besetzt und ständig läuteten die Telefone. DI Rosen befand sich im hinteren Teil des Raums an einem Schreibtisch, der nicht der ihre war und telefonierte mit ihrem Handy. Als sie Vega auf sich zukommen sah, beendete sie das Gespräch hastig.
»Wie hat Jodie es verkraftet?«
»Sie war verstört.« Vega verlagerte sein Gewicht und spürte die Verspannungen in seinen Schultern. »Können wir reden? Ungestört?«
Rosen zögerte einen Moment, ehe sie sich erhob. Dann führte sie ihn hinaus in den Eingangsbereich mit seinem fadenscheinigen blauen Teppich und den hohen Decken, deren ursprüngliche Stuckverzierungen längst abgebröckelt waren.
»Ist das ungestört genug?«
Vega schüttelte den Kopf und schaute zu DS Phil Llewellyn hinüber, der vor einem Automaten stand und sich einen Snack aussuchte. Vega führte Rosen durch das zweite, engere Treppenhaus hinunter in den Keller.
Die Verhörräume hatten keine Fenster und rochen nach Feuchtigkeit und Ziegelstaub. Die Steinwände waren grau gestrichen und der unebene Boden nachlässig auf dem jahrhundertealten Fundament verlegt. In dem Raum, den sie betraten, hockte eine Kamera wie eine Spinne in einer Ecke und erfasste den Tisch und die vier Stühle, die dort standen.
Beide Detectives blieben stehen. Sie musterten sich gegenseitig und warteten, dass der jeweils andere das Gespräch eröffnete.
»Willst du mir sagen, was eben los war?«, fragte Vega schließlich. Seine Stimme wurde durch die Akustik des Raums verstärkt, was Absicht war. Dieser Raum ließ Menschen zusammenschrumpfen, selbst Berufsverbrecher. Ein paar Minuten hier reichten den meisten – dann begannen sie zu reden.
»Es tut mir leid, ich konnte nicht bleiben, nachdem wir die Nachricht überbracht hatten«, erklärte Rosen mit vorgerecktem Kinn und einem Blick, der allem Möglichen galt, nur nicht ihm. »Zu diesem frühen Zeitpunkt kann ich es mir nicht leisten, zu viel Zeit mit der Mutter zu verbringen.«
»Und das ist alles?«
»Was sollte sonst sein?«
»Zwing mich nicht, es laut auszusprechen«, sagte Vega sanft. »Schieb mir nicht die Rolle des Bösewichts zu.«
Es klopfte an der Tür. Rosen öffnete sie, bevor er sie davon abhalten konnte. Er verlagerte sein Gewicht, um etwas Distanz zwischen ihnen zu schaffen, und richtete umständlich seine Krawatte.
DC Khan stand vor der Tür, die Hände in den Taschen seiner engen Anzughose. »Tut mir leid, aber Dr. Fleischer hat angerufen. Sie will, dass die Leiche aus dem Wald geholt wird, bevor das Wetter umschlägt. Sie bittet Sie, Madam, dabei zu sein. Um die Sache zu beschleunigen, glaube ich.«
»Natürlich. Danke, Zaid«, sagte Rosen mit einem angedeuteten Nicken. »Sagen Sie ihr, ich bin bald da.«
»Klar.«
Khan verschwand, und Vega wartete einen Augenblick, ehe er sich wieder Rosen zuwandte. Er streckte die Hand aus, um ihren Arm zu berühren, überlegte es sich im letzten Moment aber anders. »Hör zu … Ich will einfach wissen, ob mit dir alles in Ordnung ist, Dar. Sag mir, dass es so ist, und ich lasse dich in Ruhe.«
Sie ließ sich Zeit, antwortete dann aber umso schärfer: »Mir geht’s gut.«
»Prima. Das ist alles, was ich wissen wollte.«
Sie trat aus dem Verhörzimmer und hielt ihm die Tür auf. »Kommst du?«
4 Dienstag, früher Morgen
Sie verließen die Stadt auf einer Nebenstrecke. Während der zehnminütigen Fahrt über schmale Landstraßen mussten sie nur hin und wieder einem frühen Taxi ausweichen. Schließlich trafen sie direkt nach dem Leichenwagen ein. Ein Constable spannte gerade quer über den Weg ein Absperrband, und Vega parkte den Wagen gleich neben dem schwarzen Fahrzeug, dessen grausige Funktion von Uneingeweihten leicht übersehen wurde.
Es war jetzt kurz vor drei Uhr morgens, und Vega spürte es. Die nächtliche Kälte legte sich von außen auf die Fenster und ließ die Detectives noch eine Weile in ihren Sitzen verharren, wo sie auf ihre Becher mit pulvrigem Tankstellenkaffee bliesen. Unterwegs hatte Rosen mehrmals telefoniert, doch jetzt lag eine Stille zwischen ihnen, die Vega glaubte füllen zu müssen.
»Kalt draußen«, murmelte er und merkte selbst, wie überflüssig diese Bemerkung war. Rosen schaute ihn an und dachte wahrscheinlich dasselbe, lächelte aber.
»Letzte Nacht waren es fünf Grad minus. Simon und ich benutzen immer noch die Heizdecke.«
»Angeblich kommt die Kaltluft aus Sibirien.«
»Das hab ich auch gehört. Wie auch immer, bieten wir der Kälte die Stirn!« Schwungvoll öffnete Rosen die Beifahrertür, und Vega folgte ihrem Beispiel. Er schaute zum Himmel, der bis vor Kurzem noch klar gewesen war, an dem die von den Kollegen aufgestellten Scheinwerfer inzwischen aber die Unterseiten tiefhängender gelblicher Wolken erfassten.
Er war überzeugt, dass es noch vor dem Wochenende schneien würde.
Während Rosen die beiden Assistenten des Coroners per Handschlag begrüßte, stand Vega herum wie das fünfte Rad am Wagen. Schnell und wortlos entluden die beiden Männer die Rollbahre aus dem Heck ihres Transporters. Doch das mechanische Scheppern ihrer Räder hallte auf beinahe unanständige Weise über die ansonsten totenstille Straße, die jetzt wie ein geheiligter Ort wirkte.
Vega winkte die Kollegen zu einer Lücke in der Hecke, dorthin, wo das Seil befestigt war. Das Unterholz war hier von den vielen Füßen fast plattgetrampelt. Der Abstieg die Böschung hinunter war nicht mehr so riskant wie noch vor wenigen Stunden.
Wortlos zogen sie über das einsame Stück Weideland bis zu dem leuchtend weißen Zelt. Draußen erwartete sie Dr. Evelyn Fleischer, Pathologin im Dienste des Innenministeriums. Sie trug ihr aschblondes Haar schulterlang, dazu eine Brille mit derart klobigem Rahmen, dass ihrem Gesicht, als sie die Brille absetzte, um sie an ihrem Ärmel zu putzen, geradezu etwas Wichtiges zu fehlen schien.
»Sie sind hier – großartig«, sagte sie. »Hallo, Richard.«
»Evelyn.«
Dr. Fleischer hatte die Angewohnheit, anderen zu dicht auf die Pelle zu rücken. Vega hatte den Verdacht, dass ihr in all den Jahren, in denen sie Tote seziert hatte, die Fähigkeit abhandengekommen war, in den Lebenden etwas anderes zu sehen als Nachschub für ihren grauenhaften Obduktionstisch. Auch jetzt spürte er Fleischers durch die Brille vergrößerte Augen rastlos über seinen Körper gleiten. Er malte sich aus, welche Notizen sie sich im Geist machte: zu hoher Cholesterinspiegel, Vitaminmangel, erhöhter Blutdruck … Seit er das Kochen aufgegeben hatte und sich seine Mahlzeiten über eine App auf seinem Handy bestellte, war seine früher olivfarbene Haut heller und fleckiger geworden.
Er redete sich ein, dass er aus Zeitmangel nicht mehr kochte, doch das war eine Lüge. Es lag an ihm selbst. Seit einigen Monaten hatte ihn eine Lustlosigkeit im Griff, aus deren Klauen er sich nicht befreien konnte.
Vega räusperte sich. »Also. Unser Opfer? Irgendwelche Überraschungen?«
»Überraschungen? Ja, ich denke schon. Dem Jungen wurden ein paar schreckliche Dinge angetan.« Dr. Fleischer seufzte. »Das Endresultat ist genauso tragisch, aber ich wage die Behauptung, dass sein Tod mehr in die Länge gezogen wurde als der von Healy.«
»Wir setzen die beiden nicht in Verbindung zueinander«, erwiderte Rosen. »Wir stellen nur die Ähnlichkeiten fest.«
Dr. Fleischer runzelte die Stirn. Einen Moment lang schien es, als wolle sie diesen Punkt kritisch hinterfragen, doch dann schüttelte sie entschuldigend den Kopf. »Natürlich.«
Die Mitarbeiter des Coroners betraten gerade das Zelt, und Vega erhaschte einen kurzen Blick auf den Jungen, der mit verdrehten Gliedmaßen zwischen den Blättern lag. Seine Augen waren halb geöffnet und starrten zu Vega herüber. Er spürte ein frostiges Prickeln auf der Kopfhaut, steckte die Hände unter die Arme und wandte sich ab.
»Sollen wir?«, fragte Fleischer und schob Rosen ins Zelt. Vega schaute nicht hin, als die Frauen eintraten, hörte aber, wie sie die Stimmen senkten und ihre Wortwahl der traurigen Umgebung anpassten.
Kurz darauf wurde die Bahre nach draußen gerollt. Der glänzende schwarze Sack, der obenauf lag, sah genauso leer aus wie zuvor, als sie die Böschung hinabgestiegen waren.
Rosen und Vega standen nebeneinander und sahen zu, wie die Bahre über eine Seilwinde ins blaue Licht der Scheinwerfer jenseits des schwarzen Unterholzes gehoben wurde. Sie standen so nahe beieinander, dass er Rosens Zähne klappern hörte. Zum ersten Mal seit der Ankunft in diesem erbärmlichen Waldstück hatte er das Gefühl, dass seine Anwesenheit irgendeinem unausgesprochenen Zweck diente.
»Hör zu, Richard. Ich weiß, dass diese Theorie vielen nicht gefallen wird, aber glaubst du, dass bei den Healy-Ermittlungen irgendetwas übersehen wurde?«
»Möglich ist es, aber wir waren gründlich. Es war ein ziemlich belastender Fall.«
»Das bezweifle ich nicht.«
Vega biss sich auf die Innenseite der Wange und suchte nach einer passenden Erwiderung. »Was ich sagen will, ist Folgendes: Was man diesem neuen Jungen, Deano, vor seiner Exekution angetan hat – genau das war es nämlich, eine verdammte Exekution –, kommt mir wie das Werk von zwei Tätern vor. Ich glaube nicht, dass derjenige, der ihn bearbeitet hat, auch den tödlichen Schlag ausgeführt hat.«
»Da würde ich dir zustimmen«, erklärte Rosen seufzend. »Noch eine Komplikation. Gut, ich brauche dich am Vormittag ausgeruht, Richard. Fahr nach Hause.«
»Wenn du sicher bist …«
»Das bin ich.«
Vega nahm das Abschleppseil in die Hand, um sich nach oben zur Straße zu ziehen.
»Ich glaube, Fleischer mag dich«, sagte Rosen, und dieser Kommentar kam derart unerwartet, dass Vega das Seil wieder losließ und sich zu ihr umwandte. Sie grinste.
»Sei nicht albern …«
»Nein, wirklich. Ich glaube, sie ist ein bisschen verknallt in dich.«
Vega stöhnte. »Na, besten Dank, Dar. Jetzt werde ich mich jedes Mal scheißbefangen fühlen, wenn …«
»… sich eure Blicke über einer Leiche begegnen?«
»Hör auf damit«, sagte er, konnte ein Lächeln aber nicht unterdrücken. Rosen berührte leicht sein Handgelenk, und dieser kurze Kontakt sandte eine Welle der Wärme seinen ganzen Arm hinauf. »Dann geh jetzt. Schlaf ein paar Stunden.«
»Ja, okay. Ich sehe dich dann am Vormittag.«
»Und Evelyn siehst du am Nachmittag.«
»Wirklich, hör auf damit!«
Er wohnte in einer Doppelhaushälfte mit drei Schlafzimmern, die er vor fünf Jahren gekauft hatte. Das Viertel bestand überwiegend aus Sozialbauten und Wohnungen, die ehemals im Gemeindebesitz gewesen waren. Deswegen galt es unfairerweise als Sammelpunkt für den sozialen Bodensatz der Stadt.
Die Vorbesitzer des Hauses hatten dreißig Jahre dort gelebt, was Vega als gutes Zeichen aufgefasst hatte. Der Ehemann war nach langer Krankheit gestorben, und seine Frau war ihm bald darauf gefolgt – mithilfe eines wahren Medikamentenlagers unter der Matratze ihres Ehebetts, wo sie außerdem ihren Schmuck und seine Orden aufbewahrt hatte.
Manchmal unterhielt sich Vega mit den beiden. Sie waren freundliche Geister.
Er hatte nicht viel am Haus verändert seit seinem Einzug. Nur im Flur hatte er einen Laminatfußboden verlegt, und das Gewächshaus hatte er instand gesetzt. Er liebte es, seine Tomaten selbst zu ziehen – so viele Kochrezepte seiner Mutter kamen nicht ohne sie aus.
Den grellen 80er-Jahre-Teppichboden im Wohnzimmer mochte er, also war der liegen geblieben. Allerdings hatte er das Dach neu gedeckt und sich in einem Sommer an einer Terrasse im Garten versucht, die inzwischen bereits wieder abzusinken begann.
Das kleinste Zimmer sollte als Arbeitszimmer dienen, ein anderes als Gästezimmer. Hier hatte er Cherry einquartiert, als sie erstmals hier übernachtet hatte. Als aus ein paar Nächten dann sechs Monate geworden waren, hatte sie angefangen, das Zimmer mit Postern zu schmücken.
Jetzt, vier Jahre später, waren die Fugen im Badezimmer mit Eyeliner verschmiert, und sämtliche Abflüsse waren voller Haare. Doch Vega störte es immer noch nicht. Auch wenn sie nicht gerade die sauberste Mitbewohnerin war und keine Miete zahlte, passte ihm das Arrangement.
Es kam ihm so vor, als hätte er eine in Whisky gebadete Katze im Haus, die kam und ging, wie es ihr passte. Sie brachte Leben ins Haus. Außerdem gab sie ihm das Gefühl, etwas Gutes zu tun. Und daran hinderten ihn sein Job und die verdammte Polizeistation manchmal. Ihm gefiel die Vaterrolle, die er nach und nach übernommen hatte, und indem er für Cherry sorgte, sorgte er auch für sich selbst. So hielt er den Junggesellen-Lebensstil mit seinen Fallstricken in Schach. Meistens.
Vega wusste, dass er nicht schlafen würde, also legte er eine Platte auf: Sandy Denny, eine feine Geschichtenerzählerin. Ihre Stimme half ihm immer, wenn es darum ging, Verbindungen im Kopf zu knüpfen. Trotz der offiziellen Linie, Toms Tod nicht mit dem von Deano zu verknüpfen, hielt er es weiterhin für eine gute Idee zu klären, welche Details damals an die Öffentlichkeit gelangt und welche zurückgehalten worden waren.
Er setzte sich auf sein Sofa aus blaugrünem Samt – inzwischen war es ein wenig fadenscheinig, doch er mochte die Farbe zu sehr, um es zu ersetzen –, legte den warmen Laptop auf seine Oberschenkel und suchte auf neuen Seiten und in längst beendeten Threads in Foren nach jeder noch so kleinen Erwähnung von Tom.
Der Wecker seines Handys ließ ihn hochschrecken. Die graue Morgendämmerung suchte sich langsam ihren Weg durch den Spalt zwischen den Vorhängen. Irgendwann musste er eingenickt sein, sodass er vielleicht eine Stunde Schlaf gefunden hatte. Dafür war sein Nacken jetzt steif.
Mit verschlafenem Blick stieg er die Treppe hinauf, um zu duschen. Er spülte sich die vergangene Nacht ab, stellte sich vor den Spiegel und inspizierte die Topografie seines nackten Körpers. Wenn er den Bauch anspannte, ließen sich die Muskeln dort noch erahnen, doch seine Hüften waren runder. Außerdem lag eine Rolle weichen Fleischs über dem dunklen Dreieck seines Schamhaars und dem langen, schlaffen Glied.
Er musste auf seine Ernährung achten, das war offensichtlich. Zumindest über etwas die Kontrolle zurückgewinnen.
Über irgendetwas.
5 Dienstagmorgen
Das Dowding House lag an einer Abzweigung der langen, baumbestandenen Mount Pleasant Street, die steil hinunter durchs Stadtzentrum führte. Es handelte sich um ein imposantes Gebäude im georgianischen Stil, das ursprünglich der Wohnsitz einer Familie gewesen, aber schon vor langer Zeit in Büros umgewandelt worden war.
Vor zehn Jahren hatte die Stadtverwaltung das Gebäude dem damaligen Eigentümer abgekauft und dem Criminal Investigation Department überlassen, um dadurch mehr Platz in der Polizeischule von Tonbridge zu schaffen. Das Major Incident Team und das Priority Crime Team waren getrennt voneinander im ersten und im zweiten Stock untergebracht. Im Erdgeschoss arbeiteten die zivilen Beschäftigten, und im Keller gab es zwei Verhörräume und ein paar unbeheizte Toiletten.