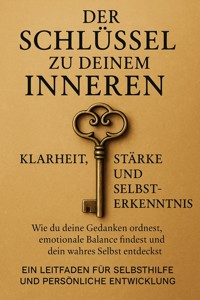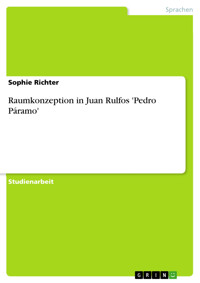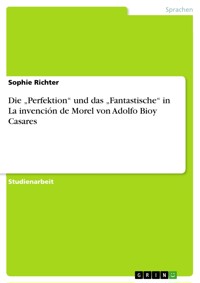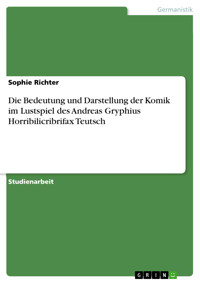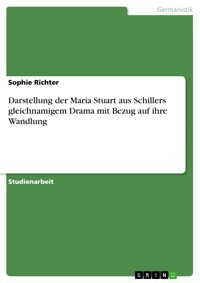
Darstellung der Maria Stuart aus Schillers gleichnamigem Drama mit Bezug auf ihre Wandlung E-Book
Sophie Richter
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Germanistik - Literaturgeschichte, Epochen, Note: 2,0, Universität Potsdam (Germanistik), Veranstaltung: Schillers klassische Dramen, Sprache: Deutsch, Abstract: Das am 14. Juni 1800 uraufgeführte und Ostern 1801 veröffentlichte Drama Maria Stuart von Friedrich Schiller, ein im Titel als historisch ausgewiesenes Stück, ist paradoxerweise laut Schiller aus einem „frei phantasierten, nicht historischen“, sondern „bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoff“ entstanden. Auch während seiner Vorstudien zu dem Drama dringt aus seinen Briefen die Lust an dem Dramaturgisch-Formalen des Themas durch, die die geschichtlichen Fakten an den Rand drängen. Auch, dass die als reizvoll empfundenen Darstellungen, dazu dienen, den Blick auf die Charaktere der zentralen Figuren zu richten, verrät ein Brief vom 11. Juni 1799 an Goethe: „Die Idee, aus diesem Stoff ein Drama zu machen, gefällt mir nicht übel. Er hat schon den wesentlichen Vortheil bei sich, daß die Handlung in einen thatvollen Moment concentriert ist und zwischen Furcht und Hoffnung rasch zum Ende eilen muß. Auch sind vortreffliche dramatische Charaktere darinn schon von der Geschichte hergegeben.“ Später formuliert er sein Ansinnen noch deutlicher und beabsichtigt, die Hauptfiguren zwar aus dem geschichtlichen Kontext zu entnehmen, sie aber dennoch ausschließlich über das Menschlich-Personenhafte darzustellen. Die Freiheit der Fantasie soll über die Geschichte gestellt werden. Trotzdem will Schiller sich an allem Brauchbarem aus der Geschichte bedienen: „Ich fange schon jetzt an, bei der Ausführung, mich von der eigentlich tragischen Qualität meines Stoffs immer mehr zu überzeugen, und darunter gehört besonders, daß man die Catastrophe gleich in den ersten Scenen sieht, und indem die Handlung des Stücks sich davon wegzubewegen scheint, ihr immer näher und näher geführt wird. An der Furcht des Aristoteles fehlt es also nicht, und das Mitleid wird sich auch schon finden. Meine Maria wird keine weiche Stimmung erregen, es ist meine Absicht nicht, ich will sie immer als ein physisches Wesen halten, und das pathetische muß mehr eine allgemeine tiefe Rührung als ein persönlich und individuelles Mitgefühl seyn. Sie empfindet und erregt keine Zärtlichkeit, ihr Schicksal ist nur, heftige Paßionen zu erfahren und zu entzünden. Bloß die Amme fühlt Zärtlichkeit für sie.“
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2013 GRIN Verlag GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Elemente politischen Handelns in der Figur Maria Stuart
3. Die Bedeutung des religiösen Motivs für Schillers Maria Stuart
4. Die „schöne Seele“ in der Figur der Maria Stuart
5. Wandlung als Erweckung statt als Entwicklung
6. Fazit
7. Bibliographie
1. Einleitung
Das am 14. Juni 1800 uraufgeführte und Ostern 1801 veröffentlichte Drama Maria Stuart von Friedrich Schiller, ein im Titel als historisch ausgewiesenes Stück, ist paradoxerweise laut Schiller aus einem „frei phantasierten, nicht historischen“, sondern „bloß leidenschaftlichen und menschlichen Stoff“ entstanden. Auch während seiner Vorstudien zu dem Drama dringt aus seinen Briefen die Lust an dem Dramaturgisch-Formalen des Themas durch, die die geschichtlichen Fakten an den Rand drängen. Auch, dass die als reizvoll empfundenen Darstellungen, dazu dienen, den Blick auf die Charaktere der zentralen Figuren zu richten, verrät ein Brief vom 11. Juni 1799 an Goethe:[1]
„Die Idee, aus diesem Stoff ein Drama zu machen, gefällt mir nicht übel. Er hat schon den wesentlichen Vortheil bei sich, daß die Handlung in einen thatvollen Moment concentriert ist und zwischen Furcht und Hoffnung rasch zum Ende eilen muß. Auch sind vortreffliche dramatische Charaktere darinn schon von der Geschichte hergegeben.“[2]
Später formuliert er sein Ansinnen noch deutlicher und beabsichtigt, die Hauptfiguren zwar aus dem geschichtlichen Kontext zu entnehmen, sie aber dennoch ausschließlich über das Menschlich-Personenhafte darzustellen. Die Freiheit der Fantasie soll über die Geschichte gestellt werden. Trotzdem will Schiller sich an allem Brauchbarem aus der Geschichte bedienen:
„Ich fange schon jetzt an, bei der Ausführung, mich von der eigentlich tragischen Qualität meines Stoffs immer mehr zu überzeugen, und darunter gehört besonders, daß man die Catastrophe gleich in den ersten Scenen sieht, und indem die Handlung des Stücks sich davon wegzubewegen scheint, ihr immer näher und näher geführt wird. An der Furcht des Aristoteles fehlt es also nicht, und das Mitleid wird sich auch schon finden.
Meine Maria wird keine weiche Stimmung erregen, es ist meine Absicht nicht, ich will sie immer als ein physisches Wesen halten, und das pathetische muß mehr eine allgemeine tiefe Rührung als ein persönlich und individuelles Mitgefühl seyn. Sie empfindet und erregt keine Zärtlichkeit, ihr Schicksal ist nur, heftige Paßionen zu erfahren und zu entzünden. Bloß die Amme fühlt Zärtlichkeit für sie.“[3]
In diesem Auszug eines weiteren Briefes an Goethe zeichnet Schiller bereits ein zartes Bild der Charakterzüge seiner Maria Stuart.
Das Trauerspiel kontrastiert von Beginn an die beiden Königinnen und ihre Lebenswelten. Obwohl Schiller in seinem Stück einen markanten Gegensatz der Königinnen entwirft, verlangen die Figuren eine differenzierte Analyse. Bereits mit Beginn des ersten Aktes zeigt sich, dass die Schicksale der beiden blutsverwandten Königinnen eng miteinander verflochten sind, beide sind in ihren Gedanken aufeinander fixiert. Ihre komplementäre Abhängigkeit bringt Burleigh in einer Aussage auf den Punkt:
„Du mußt den Streich erleiden oder führen.
Ihr Leben ist dein Tod! Ihr Tod dein Leben!“(II, 3; Vers 1293)
Diese Konstellation aus staats- und religionspolitischen Differenzen sowie persönlichen Motiven ergibt einen Machtkampf. Zusätzlich zur dynastischen Rivalität verbindet sie ein konfessioneller Konflikt. Elisabeth steht für einen sittenstrengen Protestantismus in England. Maria steht ihr mit einem sinnenfrohen Katholizismus in Schottland diametral gegenüber. Schiller beweist hier ein gewisses psychologisches Geschick, indem er ihre Schwächen auf ihre persönlichen Entwicklungen hin transparent macht und Konsequenzen aufzeigt, die sich aus einer Verflechtung von persönlichen Interessen und einer vermeintlicher Staatsräson ergeben. [4]
In der folgenden Arbeit werde ich versuchen, mich aufgrund der Fülle von Aspekten, zunächst nur der Figur der Maria in Schillers Drama detaillierter zu nähern. Es ist dabei nicht von Bedeutung, wie historische Quellen die Person der Mary Stuart darstellen, denn Schiller hat zwar selbst eine Menge an Quellwerken zu seiner Vorarbeit herangezogen, jedoch hat er die meisten Fakten frei für sich umgestaltet. So stellt Schiller seine Maria eher günstiger und Elisabeth eher ungünstiger dar, als seine Quellen es belegt haben können. Außerdem macht er sie beide jünger. Die historische Mary Stuart gab zudem ihre Beihilfe an der Ermordung Darnleys, sowie die Beteiligung an Babingtons Attentat auf Elisabeth nie offen zu. Auch andere historische Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten ergänzt Schiller frei zu seinen dramaturgischen Zwecken, wie zum Beispiel die Erfindung Mortimers, die Inszenierung der als unwahrscheinlich geltenden Begegnung Elisabeths mit Maria und das Abendmahl vor der Hinrichtung. Diese Ergänzungen finden sich nicht in Schillers zugänglichen Quellen. Ebenso dient Schiller die erotische Beziehung Marias zu Leicester zum Ausbau seiner Charakterdarstellungen.[5] Die Annäherung an ihre Person wird unter der Leitfrage, wie es zu ihrer Wandlung am Schluß des Dramas kommt, geschehen.