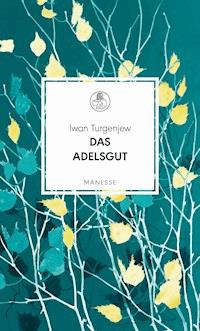
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Iwan Turgenjews erzählerisches Glanzstück endlich in Neuübersetzung
Fjodor Lawrezki kehrt nach Jahren im Westen in seine Heimat zurück, um das Gut seines Vaters zu übernehmen. Seine Ehe mit der selbstbezogenen Warwara ist gescheitert und Fjodor muss sich neu finden. Gegen seinen Willen verliebt er sich in Lisa, eine pflichtbewusste junge Frau, für die ihre Mutter eine ganz andere Partie vorgesehen hat. Der Beginn einer schwierigen Liebesgeschichte... Für seine Landschaftsschilderungen und den lyrischen Grundton seiner Prosa berühmt, war es Iwan Turgenjew, der die russische Literatur endgültig nach Europa gebracht hat. Den Geburtstag dieses bedeutendsten Vertreters des russischen Realismus feiern wir mit einer vielstimmigen Neuübersetzung eines erzählerischen Hauptwerks.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr als nur die Grenze trennt Mitte des 19. Jahrhunderts Russland von Europa – und damit auch Fjodor von Lisa. Auf einem idyllischen Landgut angesiedelt, erzählt Turgenjews zarte Liebesgeschichte von entgegengesetzten Lebensentwürfen und einer Heimkehr mit Hindernissen.
«Dieser Roman vom gefundenen und sogleich wieder verlorenen Glück atmet Poesie.» Michail Schischkin
Iwan Turgenjew, 1818 im russischen Orjol geboren und 1883 in Bougival bei Paris gestorben, verbrachte wie der Held seines Romans die prägenden Jahre seines Lebens im europäischen Ausland.
Michail Schischkin (geb. 1961 in Moskau) ist einer der meist gefeierten russischen Autoren der Gegenwart. Seine Romane (u. a. «Venushaar», «Briefsteller», «Die Eroberung von Ismail») wurden national und international vielfach ausgezeichnet. Seit 1995 lebt Michail Schischkin in der Schweiz.
Christiane Pöhlmann (geb. 1968) übersetzt aus dem Russischen und Italienischen und arbeitet als Literaturkritikerin (FAZ, Glanz & Elend).
Iwan Turgenjew
DAS ADELSGUT
Roman
Aus dem Russischen übersetztvon Christiane Pöhlmann
Nachwort von Michail Schischkin
MANESSE VERLAG
1
Der helle Frühlingstag neigte sich seinem Ende zu. Hoch oben am klaren Himmel hingen kleine rosafarbene Wölkchen, die indes nicht über diesen davonwanderten, sondern vom Azurblau aufgesogen zu werden schienen.
Vor dem weit geöffneten Fenster einer prachtvollen Villa in einer der Straßen am Rande der Gouvernementstadt O. – die Geschichte ereignete sich im Jahre 1842 – saßen zwei Frauen, die eine etwa fünfzig Jahre alt, die andere bereits hochbetagt und um die siebzig.
Erstere hieß Marja Dmitrijewna Kalitina. Ihr Gatte, der einstige Staatsanwalt des Gouvernements – seinerzeit als Mann von ausgesprochener Tatkraft bekannt, ebenso bestimmt und resolut wie ruppig und dickköpfig –, war vor rund zehn Jahren gestorben. Er hatte eine vorzügliche Erziehung genossen und sogar studiert, gleichwohl war ihm, da aus ärmlichen Verhältnissen stammend, früh klar geworden, dass er sich seinen Weg aus eigener Kraft bahnen und unbedingt Geld machen musste. Marja Dmitrijewna hatte ihn aus reiner Liebe geheiratet, war er doch ein Bild von Mann, klug und, so er wollte, äußerst galant. Bereits in ihrer Kindheit hatte Marja Dmitrijewna (geborene Pestowa) die Eltern verloren, danach einige Jahre in einem Moskauer Mädchenpensionat zugebracht und schließlich, von dort zurückgekehrt, fünfzig Werst1 von O. entfernt auf dem Stammgut Pokrowskoje gelebt, zusammen mit ihrer Tante und ihrem älteren Bruder. Besagter Bruder sollte schon kurz nach ihrer Rückkehr zum Dienst nach Petersburg2 übersiedeln und von diesem Moment an Schwester wie Tante nur noch mit Brosamen bedenken, bis der Tod seinem Dasein überraschend ein Ende setzte. Marja Dmitrijewna erbte Pokrowskoje, blieb jedoch nicht mehr lange dort. Ein gutes Jahr nach ihrer Hochzeit mit Kalitin, der ihr Herz binnen weniger Tage erobert hatte, wurde Pokrowskoje gegen eine andere Besitzung eingetauscht, die wesentlich mehr Gewinn abwarf, allerdings reizlos und ohne Herrenhaus war. Gleichzeitig erwarb Kalitin eine Villa in der Stadt O., wo seine Frau und er fortan residierten. Zu ihr gehörte ein großer Garten; dieser grenzte auf der einen Seite an ein Feld, das bereits außerhalb der Stadt lag. «Na also», hatte Kalitin frohlockt, der dem ruhigen Leben auf dem Stammgut nicht das Geringste abzugewinnen vermochte. «Damit besteht ja wohl kein Grund mehr, raus aufs Land zu zuckeln.» Marja Dmitrijewna tat es zwar oft genug in der Seele leid um ihr schönes Pokrowskoje mit dem munteren Flüsschen, den endlosen Wiesen und den grünen Waldstücken; ihrem Mann machte sie deswegen jedoch nie einen Vorwurf, vielmehr beugte sie sich ganz seinem Verstand und seiner Lebensklugheit. Als er dann nach fünfzehnjähriger Ehe starb und sie mit einem Sohn sowie zwei Töchtern zurückließ, hatte sich Marja Dmitrijewna bereits dermaßen an ihre Villa und das Leben in der Stadt gewöhnt, dass sie aus freien Stücken in O. blieb.
In ihrer Jugend war Marja Dmitrijewna der Ruf eines entzückenden Blondschopfes vorausgeeilt, und selbst mit fünfzig Jahren hatte sie ihre Anmut nicht eingebüßt, obschon sie ein wenig mollig und rund geworden war. Eine gewisse Herzensgüte war ihr nicht abzusprechen, vor allem aber entflammte sie leicht und pflegte bis in ihr reifes Alter die Allüren einer Pensionatsschülerin. Sie übte sich selbst gegenüber stets Nachsicht, geriet rasch in Wut oder brach gar in Tränen aus, sobald etwas nicht seinen gewohnten Gang ging; andererseits konnte sie durchaus zauberhaft und zärtlich sein, sobald ihr sämtliche Wünsche erfüllt wurden und niemand ihr Widerpart bot. Ihr Haus zählte zu jenen in der Stadt, in denen man besonders gern verkehrte. Sie verfügte über ein stattliches Vermögen, dies weniger aufgrund ihrer Erbschaft als vielmehr aufgrund der geschäftlichen Erfolge ihres Mannes. Die beiden Töchter wohnten noch bei ihr, ihr Sohn besuchte eine der angesehensten staatlichen Erziehungsanstalten in Petersburg.
Bei der betagten Frau, die mit Marja Dmitrijewna am Fenster saß, handelte es sich um ebenjene Tante – eine Schwester ihres Vaters –, mit der sie damals einige Jahre gänzlich zurückgezogen in Pokrowskoje zugebracht hatte. Ihr Name lautete Marfa Timofejewna Pestowa. Sie galt als leicht wunderlich, ließ sich von niemandem etwas vorschreiben, sagte allen unumwunden die Wahrheit ins Gesicht und verstand es, bei spärlichsten Mitteln so aufzutreten, als schwämme sie in Geld. Den verstorbenen Kalitin hatte sie partout nicht ausstehen können, weshalb sie sich nach der Hochzeit ihrer Nichte sofort auf ihr Gehöft zurückgezogen hatte, um die nächsten zehn Jahre bei einem der Bauern eine verräucherte Hütte zu bewohnen. Marja Dmitrijewna empfand selbst heute noch ein wenig Angst vor ihr, denn Marfa Timofejewna, diese kleine schwarzhaarige Frau mit den auch im hohen Alter noch flinken Augen und der spitzen Nase, bewegte sich unverändert gleich einem Wiesel, hielt sich wie gehabt aufrecht und brachte ihre Worte stets mit klarer, fester Stimme heraus, ganz ohne zu stammeln oder sich gar zu verhaspeln. Und nie war sie ohne weiße Haube oder weiße Schürze zu sehen.
«Was ist denn nun schon wieder?», fragte sie Marja Dmitrijewna unvermittelt. «Was gibt’s zu seufzen, Herzchen?»
«Ach, nichts weiter», erwiderte ihre Nichte. «Aber diese herrlichen Wolken heute!»
«Rühren dich glatt zu Tränen, was?»
Marja Dmitrijewna verkniff sich jede Antwort.
«Wo steckt eigentlich dein Gedeonowski?», wollte Marfa Timofejewna wissen, während ihre Stricknadeln in raschem Rhythmus klapperten (sie arbeitete an einem langen Wollschal). «Er würde bestimmt mit dir herumseufzen, falls er nicht gerade seinen üblichen Humbug zusammenfabuliert.»
«Dass Sie immer so schlecht von ihm sprechen müssen! Dabei ist Sergej Petrowitsch ein Ehrenmann.»
«Ein Ehrenmann!», echote die Tante in höhnischem Ton.
«Und wie treu er meinem verstorbenen Mann ergeben war!», säuselte Marja Dmitrijewna, die sich bis heute nicht ohne Rührung an den Gatten zu erinnern vermochte.
«Was Wunder! Schließlich hat er deinen Gedeonowski bei den Ohren gepackt und aus der Gosse gezogen», brummte Marfa Timofejewna, und ihre Stricknadeln bewegten sich gleich noch etwas flotter in ihren Händen. «Sieht immer aus, als könnte er kein Wässerchen trüben», fuhr sie nach einer Weile fort. «Mit seinem Kopf voll grauem Haar! Aber sobald er den Mund aufmacht, lügt er das Blaue vom Himmel herunter oder verbreitet nichts als Klatsch und Tratsch. Und so einer schimpft sich Staatsrat! Aber gut, da zeigt sich halt der Popensohn!»
«Wer von uns wäre denn ohne Fehl, Tante? Diese Schwäche seinerseits ist nicht zu leugnen, ganz gewiss nicht. Doch Sergej Petrowitsch ist nun einmal nicht in den Genuss einer guten Erziehung gekommen, deshalb spricht er ja auch kein Französisch. Aber – und so viel Gerechtigkeit muss sein – er ist und bleibt ein angenehmer Mann.»
«Sicher! Weil er dir immer die Händchen besabbert. Und dass er kein Französisch spricht – als ob das ein Makel wäre! Tu mich ja selbst schwer mit diesem Französischemang. Bei ihm wäre es allerdings besser, er würde in jeder Sprache schweigen, denn dann würde er wenigstens nicht lügen. Ach ja, wenn man vom Teufel spricht», fügte Marfa Timofejewna mit einem Blick aus dem Fenster hinzu. «Da kommt er anstolziert, dein angenehmer Mann. Was ist das nur für ein langer Kerl, der reinste Storch!»
Marja Dmitrijewna tupfte mit den Fingern sanft über ihre Locken. Marfa Timofejewna beobachtete sie mit einem Lächeln auf den Lippen.
«Was sehe ich denn da, Herzchen? Das wird doch kein graues Haar sein? Du solltest deiner Palaschka mal die Leviten lesen! Hat sie denn keine Augen im Kopf?»
«Wirklich, Tante, dass Sie es nie lassen können», murmelte Marja Dmitrijewna verärgert und trommelte mit den Fingern auf die Lehne ihres Stuhls.
«Sergej Petrowitsch Gedeonowski!», piepste da von der Tür her ein rotwangiger Page.
2
Ein trat ein hochgewachsener Mann in adrettem Gehrock und knapp knöchellangen Pantalons, mit grauen Wildlederhandschuhen und gleich zwei Halstüchern, einem schwarzen oben, einem weißen unten. Alles an ihm war darauf angelegt, schicklich und sittsam zu wirken, angefangen von dem wohlgefälligen Gesicht und den glatt gekämmten Koteletten bis hin zu den Stiefeln ohne Klackerabsätze und ohne Knarzsohlen.3 Er verneigte sich zunächst tief vor der Herrin des Hauses und danach vor Marfa Timofejewna, um sich schließlich, langsam seine Handschuhe abstreifend, über die Hand Marja Dmitrijewnas zu beugen. Nachdem er sie respektvoll und sogar zweimal hintereinander geküsst hatte, nahm er ohne jede Hast in einem Sessel Platz, rieb die Fingerspitzen gegeneinander, lächelte und erkundigte sich: «Ist Jelisaweta Michailowna wohlauf?»
«Das ist sie», antwortete Marja Dmitrijewna. «Gerade ist sie im Garten.»
«Und Jelena Michailowna?»
«Lenotschka ist ebenfalls im Garten … Haben Sie denn gar nichts Neues zu erzählen?»
«O doch, o doch, gewisslich», beteuerte der Besucher, blinzelte mehrmals bedächtig und schob die Lippen vor und zurück. «Also … ich würde schon sagen, dass ich eine Neuigkeit zu erzählen haben, noch dazu eine höchst erstaunliche. Fjodor Iwanytsch Lawrezki ist wieder im Lande.»
«Fedja!», rief Marfa Timofejewna aus. «Aber sicher schwindelst du wieder, was, mein Bester?»
«Bestimmt nicht, ich habe ihn doch mit eigenen Augen gesehen, ganz gewisslich.»
«Das besagt gar nichts.»
«Er sieht aus wie das blühende Leben», fuhr Gedeonowski fort, der ganz so tat, als hätte er den Einwand Marfa Timofejewnas nicht gehört. «In den Schultern ist er jetzt noch breiter, und richtige Apfelwangen hat er.»
«Er sieht aus wie das blühende Leben?», brachte Marja Dmitrijewna gedehnt heraus. «Ja war er denn vorher nicht auf dem Posten?»
«Das können Sie laut sagen», erwiderte Gedeonowski. «Jeder andere würde sich doch schämen, sich angesichts einer solchen Misere in der Öffentlichkeit zu zeigen.»
«Nun mal sachte!», fuhr Marfa Timofejewna ihn an. «Was ist das für ein Unsinn? Der Mann ist endlich in seine Heimat zurückgekehrt – warum bitte sollte er sich da verstecken? Selbst wenn er sich etwas hat zuschulden kommen lassen!»
«Verehrte gnädige Frau, es trägt doch immer der Mann die Schuld, würde ich zu behaupten wagen, wenn seine Gemahlin sich schlecht aufführt.»
«Das, mein Junge, behauptest du auch nur, weil du nicht verheiratet bist.»
Gedeonowski rang sich ein müdes Lächeln ab.
«Verzeihen Sie mir meine Neugier», bemerkte er dann nach längerem Schweigen, «aber für wen ist denn dieser hübsche Schal?»
Marfa Timofejewna sah ihn kurz an.
«Für jemanden», entgegnete sie, «der keine Gerüchte in die Welt setzt, niemanden hinters Licht führt und nichts zusammenfabuliert, falls es einen solchen Menschen überhaupt gibt. Ich kenne Fedja genau. Wenn ihm etwas vorzuwerfen ist, dann nur, dass er seiner Frau jede Laune hat durchgehen lassen. Und dass er aus Liebe geheiratet hat, das auch. Kommt schließlich nie etwas Gescheites bei heraus, bei diesen Liebesheiraten», ergänzte die betagte Dame, schielte zu Marja Dmitrijewna hinüber und erhob sich. «Und du, mein Junge, kannst nun herziehen, über wen du willst, von mir aus auch über mich, denn ich gehe jetzt und störe euch nicht länger.»
Daraufhin ging Marfa Timofejewna aus dem Raum.
«So ist das immer mit ihr», ergriff Marja Dmitrijewna, ihrer Tante hinterherblickend, das Wort. «Immer!»
«Ach, ja, gewisslich, das Alter, was will man da machen!», bemerkte Gedeonowski. «Da heißt es gern: für jemanden, der niemanden hinters Licht führt. Ja wer tut das denn heutzutage nicht? In diesen Zeiten! Ein Herr aus meinem Bekanntenkreis, ein geschätzter Mann und, das dürfen Sie mir glauben, durchaus von Rang, hat schon öfter behauptet, heutzutage führe sogar ein Huhn seine Körner hinters Licht, denn es schleiche sich nur noch von schräg hinten an sein Futter an. Aber wenn ich mir dann Sie anschaue, meine liebe gnädige Frau, Sie sind doch der reinste Engel. Ob ich wohl noch einmal Ihre schneeweiße Hand …?»
Marja Dmitrijewna deutete ein Lächeln an und streckte Gedeonowski ihre mollige Hand mit dem abgespreizten kleinen Finger entgegen. Er drückte seine Lippen darauf, sie rückte ihren Sessel an ihn heran, beugte sich leicht vor und fragte raunend: «Sie haben ihn also gesehen? Und – ist er wirklich wohlauf, das blühende Leben, gesund und munter?»
«O ja, gewisslich, völlig gesund und ebenso munter», flüsterte Gedeonowski zurück.
«Aber Ihnen ist nicht zufällig zu Ohren gekommen, wo seine Frau sich jetzt aufhält?»
«Bis vor Kurzem soll sie in Paris gewesen sein, jetzt aber, so hört man, lebt sie in Italien.»
«Wie furchtbar, in der Tat. Fedjas Lage, meine ich. Mir ist ein Rätsel, wie er das aushält. Ein jeder hat ja sein Päckchen zu tragen, das schon, doch über sein Unglück haben sämtliche Zeitungen Europas berichtet.»
Gedeonowski seufzte schwer. «Wohl wahr, wohl wahr, gewisslich. Sie soll angeblich sogar mit ‹Schauspielern› und ‹Pianisten› und wie die sich alle nennen, diese Salonlöwen und Platzhirsche, verkehrt haben. Einfach jede Scham hat sie verloren …»
«Das tut mir so leid, wirklich aufrichtig leid», beteuerte Marja Dmitrijewna. «Und dies, Sergej Petrowitsch, sage ich als Verwandte, schließlich ist er mein Großneffe.»
«Das weiß ich doch! Als ob ich nicht jede Einzelheit, die Ihre Familie betrifft, kennen würde …»
«Was denken Sie – wird er uns besuchen?»
«Ich würd’ doch meinen, ja, gewisslich, er soll nämlich zu seinem Gehöft unterwegs sein.»
Marja Dmitrijewna schickte einen Blick zum Himmel. «Ach, Sergej Petrowitsch, Sergej Petrowitsch, mir graust bei dem Gedanken, wie schnell wir – wir Frauen, meine ich – als unbesonnen gelten!»
«Scheren Sie nicht alle Frauen über einen Kamm, Marja Dmitrijewna. Es gibt zwar in der Tat einige flatterhafte Geschöpfe, leider gibt es sie … Tja, und dann ist auch hier alles eine Frage des Alters! Heute kriegt die Jugend ja keine Manieren mehr beigebracht.» Sergej Petrowitsch zog ein blaukariertes Taschentuch hervor und entfaltete es sorgsam. «Ohne Zweifel gibt es solche Frauen.» Er betupfte sich mit einem Zipfel des Tuchs seine Augen. «Aber ganz grundsätzlich gesprochen, also recht bedacht, will heißen … Der Staub in dieser Stadt ist ungeheuerlich», schloss er.
«Maman, maman»,4 rief mit einem Mal ein reizendes Mädchen von etwa elf Jahren und stürmte ins Zimmer. «Wladimir Nikolajitsch kommt angeritten!»
Sofort erhob Marja Dmitrijewna sich. Sergej Petrowitsch tat es ihr nach und verbeugte sich. «Meine Verehrung, Jelena Michailowna», begrüßte er das Mädchen, bevor er sich der Schicklichkeit halber in eine Zimmerecke zurückzog, um dort seine lange, ebenmäßige Nase zu schnäuzen.
«Was für ein prachtvolles Pferd!», fuhr das Mädchen fort. «Er ist Lisa und mir an der Pforte begegnet und hat uns gesagt, dass er zu uns will.»
Schon war Hufgeklapper zu hören, und der schlanke Reiter auf dem herrlichen Braunen bog auf den Weg ein und machte vor dem weit geöffneten Fenster halt.
3
«Seien Sie gegrüßt, Marja Dmitrijewna!», rief der Reiter mit klangvoller und angenehmer Stimme. «Was sagen Sie zu meiner neuesten Erwerbung?»
Marja Dmitrijewna trat ans Fenster.
«Seien auch Sie gegrüßt, Woldemar! Nein, welch edles Tier! Woher haben Sie es?»
«Von einem Remonteoffizier5 … Er hat mir ordentlich etwas dafür abgeknöpft, dieser Gauner!»
«Und wie heißt es?»
«Orlando … Zugegeben, ein dummer Name. Deshalb möchte ich es gern umtaufen … Eh bien, eh bien, mon garçon.6 Dass du auch nicht eine Sekunde stillstehen kannst!»
Das Pferd schnaubte, trippelte von einem Fuß auf den anderen und warf das schaumumflockte Maul hin und her.
«Streicheln Sie es ruhig, Lenotschka, nur keine Angst …»
Doch als das Mädchen eine Hand zum Fenster hinausstreckte, bäumte Orlando sich sofort auf und sprengte davon. Der Reiter indes hielt sich im Sattel, verschaffte sich mit den Schenkeln Gehorsam, zog dem Pferd die Gerte über den Hals und lenkte es trotz seines Widerstands zurück vors Fenster.
«Prenez garde, prenez garde»,7 murmelte Marja Dmitrijewna in einem fort.
«Kosen Sie ihn noch einmal, Lenotschka», sagte der Reiter. «Frechheiten dieser Art lasse ich ihm nicht durchgehen.»
Abermals streckte das Mädchen die Hand aus und berührte zaghaft die bebenden Nüstern Orlandos, der unaufhörlich zuckte und auf die Trense biss.
«Bravo!», rief Marja Dmitrijewna. «Und nun sitzen Sie ab und gesellen Sie sich zu uns!»
Unser Reiter wendete flugs sein Pferd, rammte ihm die Sporen in die Flanken und sprengte im kurzen Galopp über den Weg zum Eingang der Villa. Schon in der nächsten Minute stürmte er, mit der Reitgerte fuchtelnd, durch die Dielentür in den Salon; gleichzeitig trat durch eine andere Tür eine schlanke, hochgewachsene schwarzhaarige Frau von neunzehn Jahren. Dies war die ältere Tochter Marja Dmitrijewnas, dies war Lisa.
4
Der junge Mann, mit dem wir unsere Leser soeben bekannt gemacht haben, hörte auf den Namen Wladimir Nikolajitsch Panschin. Er bekleidete in Petersburg eine Stellung als Beamter für Sonderaufgaben im Innenministerium. Ein solcher Sonderauftrag hatte ihn kürzlich in die Stadt O. geführt, wo er sich zur Verfügung des Gouverneurs halten sollte, eines gewissen General Sonnenberg, mit dem er um mehrere Ecken verwandt war. Panschins Vater, ein Stabsrittmeister a. D. und notorischer Spieler, ein Mann mit hündischem Blick, verlebtem Gesicht und nervösem Zucken in den Mundwinkeln, war zeit seines Lebens um höhere Adlige herumscharwenzelt, hatte in beiden Hauptstädten den englischen Club8 besucht und im Ruf gestanden, ein schlauer, nicht gerade zuverlässiger, dafür aber umso umgänglicherer und geselligerer Bursche zu sein. All seiner Cleverness zum Trotz hatte er sich stets am Rande der Armut bewegt und seinem einzigen Sohn folglich nur ein bescheidenes, bereits zusammengeschmolzenes Vermögen hinterlassen. Auf die ihm eigene Art hatte er jedoch zumindest für dessen gute Erziehung gesorgt: Wladimir Nikolajitsch parlierte exzellent Französisch, leidlich Englisch und hundsmiserabel Deutsch, ganz wie es sich gehörte, schließlich hätte ein Mann von Welt sich geschämt, gepflegtes Deutsch zu sprechen; hie und da und zumeist um des reinen Amüsements willen ein deutsches Wort einflechten, das durfte man, ja mehr noch, c’est même très chic,9 wie es unsere Petersburger Pariser ausdrücken. Bereits mit fünfzehn Jahren verstand es Wladimir Nikolajitsch, unerschrocken jeden Salon zu betreten, aufs Angenehmste plaudernd darin herumzuschwirren und im exakt rechten Moment wieder abzuziehen. Ferner hatte Panschins Vater seinem Sohn etliche Türen geöffnet: Zwischen zwei Rubbern oder nach einem siegreichen Grand Slam kam er gern, noch die Karten mischend, gegenüber irgendeinem hohen, dem Spiel um Geld verfallenen Herrn auf seinen Wolodka zu sprechen. Wladimir Nikolajitsch seinerseits steuerte einige Bekanntschaften mit jungen Adligen bei, die er während seines Studiums geschlossen hatte – die Universität hatte er mit dem Rang eines Wirklichen Studenten10 verlassen – und dank derer er schon bald ein gern gesehener Gast in den besten Häusern war. Man empfing ihn überall mit Freuden, war er doch hübsch anzuschauen, unverkrampft, amüsant und für jeden Spaß zu haben; wo nötig, blieb er respektvoll, wo möglich, wurde er frech, kurzum, ein willkommener Zeitgenosse und charmant garçon11. Gelobtes Land tat sich vor ihm auf … Hinter das Geheimnis, wie man sich auf dem gesellschaftlichen Parkett bewegte, war Panschin rasch gekommen: Den Regeln dieser Welt vermochte er beflissenen Respekt entgegenzubringen, jedem Mumpitz halb ernst, halb scherzhaft nachzugehen und alles Ernste vorgeblich für Mumpitz zu halten; er tanzte wie ein Gott und kleidete sich wie ein Engländer. Schon nach kurzer Zeit galt er als einer der reizendsten und cleversten jungen Herren von ganz Petersburg. Und clever war er wahrhaftig, da stand er seinem Vater in nichts nach, überdies war er nicht untalentiert. Alles ging ihm leicht von der Hand: Er hatte eine angenehme Stimme, zeichnete mit Schwung, schmiedete Verse und machte sich auch auf der Bühne gut. Bereits mit siebenundzwanzig Jahren hatte er sich zum Kammerjunker hochgearbeitet, zudem zu einem mit erstaunlichem Rang.12 Panschins Glaube an sich selbst, an seinen Verstand und seinen Scharfsinn war durch nichts zu erschüttern; der junge Mann beschritt seinen Weg kühn, heiter und schwungvoll. Und sein Leben lief wie geschmiert. Er war daran gewöhnt, dass er allen gefiel, jung wie alt, und meinte, die Menschen zu kennen, insbesondere die Frauen, denn er wusste nur zu gut um ihre kleinen Schwächen. Als den Künsten gegenüber aufgeschlossener Mensch besaß er ein hitziges Temperament und neigte zu einer gewissen Leidenschaft und Exaltiertheit, was ihn zuweilen gegen seine eigenen Regeln verstießen ließ: Er prasste, pflegte einige nicht standesgemäße Beziehungen und gab sich insgesamt recht frei und zügellos; tief in seinem Innern blieb er jedoch auch in diesen Momenten kalt und kalkulierend, und selbst während eines noch so feuchtfröhlichen Gelages behielt er mit einem seiner wachen braunen Augen alles im Blick, beobachtete er genau. Dieser freche, dieser freigeistige junge Herr konnte sich nie ganz vergessen, konnte sich dem Rausch nie vollständig überlassen. Zu seiner Ehrenrettung sei gesagt, dass er sich seiner Siege niemals rühmte. In Marja Dmitrijewnas Haus war er kurz nach seiner Ankunft in O. eingeführt worden, bald darauf ging er dort ein und aus. Auch Marja Dmitrijewna hatte einen Narren an ihm gefressen.
Panschin verbeugte sich charmant vor allen im Salon Anwesenden, drückte Marja Dmitrijewna sowie Lisaweta Michailowna die Hand, klopfte Gedeonowski sanft auf die Schulter, schnellte auf dem Absatz herum, umfasste Lenotschkas Kopf und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn.
«Haben Sie denn gar keine Angst, ein so böswilliges Pferd zu reiten?», erkundigte sich Marja Dmitrijewna.
«Ich bitte Sie, das Tier könnte sanfter kaum sein. Wollen Sie wissen, wovor ich wirklich Angst habe? Wirklich Angst habe ich davor, mit Sergej Petrowitsch Préférence zu spielen. Gestern Abend hat er mich bei den Belenizyns nach allen Regeln der Kunst ausgenommen.»
Gedeonowski brach in ein hauchzartes und serviles Lachen aus, mit dem er den glänzenden jungen Beamten aus Petersburg, diesen Liebling des Gouverneurs, für sich zu gewinnen suchte. Wenn er sich mit Marja Dmitrijewna unterhielt, betonte er immer wieder die bemerkenswerten Fähigkeiten Panschins. «Wie aber», so fragte er sie, «nicht angetan sein von einem Mann wie ihm? Der schon in jungen Jahren in höchsten Gesellschaftskreisen Erfolg hat, der seinen Dienst so vorbildlich versieht und dennoch nicht den geringsten Stolz zeigt.» Tatsächlich schätzte man Panschin auch in Petersburg als tüchtigen Beamten: Die Arbeit ging ihm flott von der Hand; doch ganz wie es sich für einen Mann von Welt ziemte, witzelte er über sie und maß seinem Handeln kein besonderes Gewicht bei, sondern sah sich lediglich als «Macher». Um einen solchen Untergebenen reißt sich jeder Vorgesetzte; er selbst hatte freilich nicht den leisesten Zweifel daran, dass er es, so er nur wollte, mit der Zeit auch zum Minister bringen könnte.
«Ich mag Sie, wie Sie es auszudrücken beliebten, nach allen Regeln der Kunst ausgenommen haben», flötete Gedeonowski. «Aber wer hat mich denn in der letzten Woche um zwölf Rubel erleichtert? Und in der …»
«Sie Schurke, Sie infamer Schurke», fiel ihm Panschin mit sanfter, wiewohl leicht verächtlicher Nonchalance ins Wort und trat dann, ohne ihn eines weiteren Blickes zu würdigen, an Lisa heran.
«Ich konnte die Ouvertüre zum ‹Oberon›leider nirgends auftreiben», holte er aus. «Die Belenizyna tönt zwar, sie habe sämtliche Noten aus dem klassischen Repertoire im Haus, doch bis auf ein paar Polkas und Walzer findet sich bei ihr rein gar nichts. Ich habe bereits nach Moskau geschrieben, in einer Woche werden Sie die Ouvertüre in Händen halten. Bei der Gelegenheit …», bemerkte er dann, «gestern habe ich eine neue Romanze geschrieben. Der Text stammt ebenfalls von mir. Soll ich sie Ihnen vortragen? Ob sie mir geglückt ist, weiß ich wirklich nicht. Die Belenizyna fand sie allerliebst – doch was heißt das schon? Ich wünsche Ihre Meinung zu hören! Allerdings wäre es vielleicht besser, wir warten noch etwas.»
«Warum das?», mischte sich Marja Dmitrijewna ein. «Warum nicht gleich?»
«Wenn Sie denn unbedingt wollen», erwiderte Panschin mit einem strahlenden, gewinnenden Lächeln, das ebenso schnell auf seinem Gesicht erschien, wie es wieder verschwand, schob den Stuhl mit dem Knie ein Stück nach vorn, setzte sich ans Fortepiano, schlug einige Akkorde an und begann, jedes einzelne Wort klar artikulierend, nachfolgende Romanze zu singen:13
Hoch droben geht auf zwischen Wolk’ und Sternen
Ein Mond so fahl,
Und doch lässt wogen die Wellen, die fernen
Sein Zauberstrahl.
Längst meines Herzens Meer seinen Mond sich nahm
Und wählte dich,
Nun bewegst in Stunden von Freud und von Gram
Allein du mich.
Der Liebe Pein und bittres Leid ungehemmt
Nie mich verschont,
Mir blutet die Seel’, dir jedes Leid ist fremd
Ganz wie dem Mond.
Die zweite Strophe trug Panschin mit besonderem Nachdruck und voll Kraft vor; aus der stürmischen Klavierbegleitung ließ sich das Wogen der Wellen regelrecht heraushören. Nach den Worten «Mir blutet die Seel’» hingegen seufzte er matt, schloss die Augen und senkte die Stimme. Morendo.14 Sobald er endete, nahm Lisa das Motiv auf, während Marja Dmitrijewna konstatierte: «Exquisit», und Gedeonowski krähte: «Hinreißend! Poesie und Harmonien – beides einfach hinreißend!» Lenotschka schaute den Sänger mit kindlicher Ehrfurcht an. Kurz und gut, allen Anwesenden hatte das Werk des jungen Musikliebhabers in höchstem Maße gefallen; einzig dem eben eingetroffenen, bereits älteren Mann, der hinter der Tür zum Salon in der Diele lauerte, hatte – das legten sein Gesichtsausdruck, der zu Boden gesenkte Kopf und das Zucken seiner Schultern nahe – Panschins Romanze, so allerliebst sie auch sein mochte, kein Vergnügen bereitet. Nachdem er kurz abgewartet und mit einem derben Taschentuch den Staub von den Stiefeln gewischt hatte, verengte er entschlossen die Augen, presste die Lippen finster aufeinander, krümmte seinen ohnehin krummen Rücken noch weiter und betrat gemessenen Schrittes den Salon.
«Ah! Christoph Fjodorytsch, guten Tag!», rief Panschin vor allen anderen und sprang flugs vom Stuhl auf. «Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie hier sind, sonst hätte ich es nie gewagt, meine Romanze vorzutragen. Ich weiß schließlich, dass Sie kein Liebhaber solch leichter Kost sind.»
«Keinen Ton hab ich nicht gehört», brachte der Mann in miserablem Russisch hervor, drang weiter in den Salon vor und blieb dann, nachdem er sich reihum vor allen verbeugt hatte, unbeholfen mitten im Raum stehen.
«Monsieur Lemm», wandte sich Marja Dmitrijewna an ihn, «Sie sind sicher gekommen, um Lisa ihre Klavierstunde zu erteilen?»
«Nein, nicht Lisafet Michailowna, sondern Jelen Michailowna.»
«Ah, ja … sicher … bestens! Lenotschka, gehe mit Herrn Lemm nach oben!»
Der alte Mann schickte sich an, dem Mädchen zu folgen, doch Panschin hielt ihn auf.
«Verlassen Sie uns nach dem Unterricht nicht gleich, Christoph Fjodorytsch», bat er. «Lisaweta Michailowna und ich möchten noch vierhändig eine Sonate von Beethoven spielen.»
Lemm murmelte etwas, woraufhin Panschin ins Deutsche wechselte, die Worte jedoch sehr schlecht aussprach: «Lisaweta Michailowna hat mir die geistige Kantate gezeigt, die Sie ihr verehrt haben. Eine ganz hervorragende Arbeit! Glauben Sie bitte nicht, dass ich ernste Musik nicht zu schätzen wüsste, ganz im Gegenteil: Sie ist zuweilen zwar langweilig, dafür aber sehr ersprießlich.»
Der alte Mann wurde rot bis zu den Ohren, warf Lisa einen scheelen Blick zu und eilte aus dem Raum.
Marja Dmitrijewna bat Panschin, ihnen die Romanze ein zweites Mal darzubringen, doch dieser verkündete, die Ohren des braven Deutschen nicht beleidigen zu wollen, und fragte Lisa, ob sie sich nicht der Beethoven-Sonate widmen wollten. Marja Dmitrijewna antwortete lediglich mit einem Seufzer und lud nun ihrerseits Gedeonowski ein, mit ihr durch den Garten zu schlendern. «Ich würde gern noch ein wenig mit Ihnen weiterplaudern», behauptete sie, «und mich mit Ihnen über unseren armen Fedja austauschen.» Gedeonowski strahlte über beide Backen, verneigte sich, griff mit Daumen und Zeigefinger seinen Hut, nahm die akkurat auf der Krempe drapierten Handschuhe an sich und entfernte sich in Begleitung Marja Dmitrijewnas. Damit verblieben nur Panschin und Lisa im Zimmer. Sie holte die Sonate hervor und schlug sie auf. Schweigend setzten sich beide ans Fortepiano. Von oben drangen die schwachen Klänge der Tonleitern zu ihnen, die Lenotschka mit zittrigen Fingern hinauf- und hinunterspielte.
5
Christoph Theodor Gottlieb Lemm wurde im Jahre 1786 geboren, im Königreich Sachsen, in der Stadt Chemnitz, in einer Familie armer Musikanten. Sein Vater spielte das Waldhorn, seine Mutter die Harfe; er selbst übte bereits mit fünf Jahren drei verschiedene Instrumente. Mit acht Jahren verlor er seine Eltern, mit zehn begann er sich sein täglich Brot mit seiner Kunst zu verdienen. Lange Zeit führte er ein Vagabundenleben, spielte einfach überall, in Schenken wie auf Jahrmärkten, bei Bauernhochzeiten wie auf Bällen; schließlich kam er in einem Orchester unter, stieg darin immer weiter auf und brachte es sogar zum Dirigenten. Seine Instrumente beherrschte er nicht unbedingt meisterlich, doch von Musik verstand er eine Menge. In seinem achtundzwanzigsten Lebensjahr ging er nach Russland. Damit folgte er der Einladung eines angesehenen Gutsherren, welcher der Musik zwar rein gar nichts abzugewinnen vermochte, sich aus Dünkel aber ein Orchester leistete. Lemm blieb sieben Jahre lang als Kapellmeister bei ihm, und als er ihn verließ, tat er dies mit leeren Händen: Der Gutsherr hatte sein Vermögen durchgebracht und wollte ihm daher nur einen Wechsel ausstellen, sah am Ende jedoch selbst davon ab. Mit einem Wort, er zahlte Lemm nicht eine Kopeke. Man riet ihm, das Land zu verlassen, bettelarm indes wollte er nicht nach Hause zurückkehren, nicht aus Russland, dem großen Russland, dieser Goldgrube für alle Künstler; er beschloss also zu bleiben und sein Glück zu machen. Über zwanzig Jahre sollte der arme Deutsche es vergeblich versuchen: Er fand bei verschiedenen Herren Anstellung, lebte in Moskau oder in Gouvernementstädten, ertrug und erlitt manches, lernte Armut kennen und mühte sich ab wie ein Fisch auf dem Trockenen. All den Schwierigkeiten, mit denen er zu kämpfen hatte, zum Trotz ließ ihn der Gedanke an die Rückkehr in seine Heimat niemals los, im Gegenteil, dieser allein hielt ihn aufrecht. Das Schicksal versagte ihm dieses letzte Glück, das zugleich sein erstes gewesen wäre: Mit fünfzig Jahren gelangte er, krank und vor der Zeit hinfällig, in die Stadt O. und blieb dort hängen, nunmehr ohne jede Hoffnung, das ihm verhasste Russland zu verlassen, und sein karges Dasein mit Stunden sichernd. Lemms Äußeres gereichte ihm leider nicht zum Vorteil. Bei nur geringer Körpergröße hatte er eine krumme Haltung, vorspringende Schulterblätter und einen ausgemergelten Leib, große Plattfüße und blassblaue Fingernägel an den steifen, ungeschmeidigen Fingern seiner sehnigen, geröteten Hände. Er besaß ein von Falten durchfurchtes Gesicht, hohle Wangen und verkniffene Lippen, die er in einem fort bewegte, als mümmelte er, was bei der ihm eigenen Schweigsamkeit einen nahezu bösartigen Eindruck erweckte. Sein graues Haar hing ihm strähnig in die flache Stirn, wie eben gelöschte Kohlestücke glommen seine winzigen, starren Augen ohne jedes Feuer. Er bewegte sich stapfend, warf seinen steifen Körper bei jedem Schritt nach vorn. Gelegentlich erinnerte sein Gebaren an das unbeholfene Geputze einer Eule im Käfig, die zwar spürt, dass jemand sie anschaut, mit ihren großen gelben, ebenso erschrocken wie verschlafen blinzelnden Augen selbst aber kaum etwas sieht. Der tief verwurzelte, gnadenlose Kummer hatte dem armen Musikus seinen unauslöschlichen Stempel aufgedrückt, hatte den ohnehin unschönen Körper weiter gekrümmt und verunstaltet; demjenigen indes, der sich vom ersten Eindruck nicht abschrecken ließ, offenbarte sich in diesem halb zerstörten Wesen etwas Gutes und Aufrichtiges, etwas Außergewöhnliches. Als Bewunderer Bachs und Händels, als Kenner seines Faches, als Mann mit lebhafter Fantasie und ebenjener Kühnheit des Denkens, die einzig dem deutschen Volk eignet, wäre Lemm – wer weiß? – mit der Zeit vielleicht gar zu einem der größten Komponisten seines Landes geworden, hätte das Schicksal ihm nicht so übel mitgespielt, hätte sein Leben nur unter einem besseren Stern gestanden. Etliche Werke hatte er im Laufe der Jahre geschrieben, doch nicht eines davon war je veröffentlicht worden; nie gelang es ihm, sich seiner Arbeit in der gebührenden Weise zu widmen, kein einziges Mal brachte er es über sich, bei passender Gelegenheit zu katzbuckeln oder zu rechter Zeit Fürsprache für seine Schöpfung einzulegen. Vor sehr langer Zeit hatte einmal ein Bewunderer und Freund, ebenfalls ein Deutscher und ebenfalls ein Hungerleider, auf eigene Kosten zwei Sonaten Lemms herausgegeben, doch auch sie versauerten in den Kellern der Musikalienhandlungen; irgendwann verschwanden sie sang- und klanglos, fast, als hätte jemand sie des Nachts in den Fluss geworfen. Am Ende schickte sich Lemm in sein Los; obendrein forderten die Jahre ihren Tribut: Er verhärtete, versteifte gleich seinen Fingern. In O. lebte er allein, einzig mit seiner alten Köchin, die er aus einem Armenhaus geholt hatte – verheiratet war er nie –, in einer kleinen Wohnung, ganz in der Nähe der Kalitins; er ging viel spazieren, las die Bibel, las die Sammlung evangelischer Psalme, las Shakespeare in der Übersetzung Schlegels. Das Komponieren hatte er da längst aufgegeben; erst Lisa, erst seiner besten Schülerin gelang es, ihn noch einmal aus seiner Lethargie zu reißen: Für sie hatte er jene Kantate geschrieben, die Panschin erwähnt hatte. Den Text hatte er teils besagter Psalmsammlung entnommen, einige Zeilen auch selbst verfasst. Sie war für zwei Chöre gedacht, den Chor der Glücklichen und den Chor der Unglücklichen; zum Ende hin fanden sie zusammen und sangen gemeinsam: «Oh, barmherziger Gott! Uns Sünder all erlöse! All uns Sünder schütze! Vor allem was hienieden böse, vor Hoffnung, welch unnütze!»
Auf dem Titelblatt prangten, in sorgfältiger Schrift ausgeführt und mit Zierwerk versehen, die Worte:
«Nur mit den Gerechten ist das Recht. Eine kirchliche Kantate. Verfasst von Ch. T. G. Lemm, gewidmet Jelisaweta Kalitina, seiner herzensguten Schülerin.»
Die Worte: «Nur mit den Gerechten ist das Recht» und «Jelisaweta Kalitina» umgab ein Strahlenkranz. Am unteren Rand stand noch:
«Dlja was odnich. Für Sie allein.»
Ebendeshalb war Lemm errötet und hatte Lisa einen verstohlenen Blick zugeworfen; das Herz hatte es ihm zerrissen, als Panschin ihm gegenüber die Kantate erwähnt hatte.
6
Panschin schlug die ersten Akkorde der Sonate kräftig an – er spielte den zweiten Part –, doch Lisa setzte mit ihrem nicht ein. Er hielt inne und sah sie an. Lisas Augen, unverwandt auf ihn gerichtet, brachten ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck, ihre Lippen verweigerten ein Lächeln, ihr ganzes Gesicht wirkte streng, fast traurig.
«Was ist mit Ihnen?», erkundigte er sich.
«Warum haben Sie nicht Wort gehalten?», fragte sie zurück. «Ich hatte Ihnen Christoph Fjodorytschs Kantate unter der Bedingung gezeigt, dass Sie ihn nicht darauf ansprechen.»
«Ich bekenne mich schuldig, Lisaweta Michailowna, das ist mir einfach herausgerutscht.»
«Damit haben Sie ihm keine Freude bereitet – und mir auch nicht. Er wird mir nun nie wieder vertrauen.»
«Wissen Sie, was Sie da von mir verlangen, Lisaweta Michailowna? Seit ich denken kann, sticht mich der Hafer, wenn ich einen Deutschen sehe. Ich muss ihn dann zwangsläufig foppen.»
«Wie können Sie es nur wagen, Wladimir Nikolajitsch? Dieser Deutsche ist ein armer, einsamer und geschlagener Mann – und Sie haben kein Mitleid mit ihm?! Sie wollen ihn noch foppen?»
Panschin wurde verlegen.
«Sie haben ja recht, Lisaweta Michailowna», gab er zu. «Aber daran ist einzig und allein meine ewige Gedankenlosigkeit schuld. Nein, widersprechen Sie mir nicht! Diese Gedankenlosigkeit hat mich schon oft genug in Teufels Küche gebracht. Ihr habe ich es zu verdanken, dass ich allenthalben als Egoist gelte.»
Panschin verstummte. Wie auch immer er ein Gespräch begann, er beendete es gewöhnlich damit, dass er die Rede auf sich selbst brachte, was ihm geradezu galant und graziös, was ihm so leger gelang, als geschähe es gegen seinen Willen.
«Nicht anders ergeht es mir in Ihrem Hause», fuhr er fort. «Ihre Frau Mama, diese gute Frau, ist mir selbstverständlich wohlgesinnt. Sie … tja, Ihre Meinung von mir kenne ich nicht. Dafür kann mich Ihre Tante schlicht und ergreifend nicht ausstehen. Ganz bestimmt habe ich auch sie mit irgendeinem gedankenlosen, dummen Wort gekränkt. Denn Sie pflichten mir doch bei, dass sie mich nicht in ihr Herz geschlossen hat?»
«Stimmt», gab Lisa nach kurzem Zögern zu. «Sie mag Sie nicht.»
Panschins Finger glitten flink über die Tasten, und ein kaum wahrnehmbares Lächeln huschte über seine Lippen.
«Was denken Sie denn nun?», brachte er dann heraus. «Halten Sie mich auch für einen Egoisten?»
«Ich kenne Sie ja noch kaum», erwiderte Lisa. «Trotzdem halte ich Sie nicht für einen Egoisten. Im Gegenteil, ich bin Ihnen dankbar …»
«Oh, ich weiß, was Sie sagen wollen», fiel Panschin ihr ins Wort und ließ seine Finger abermals über die Tasten eilen. «Sie sind mir dankbar für die Noten und die Bücher, die ich Ihnen mitbringe, für die lausigen Zeichnungen, die ich in Ihr Album pinsele, und so weiter und so fort. Nur kann ich all dies tun – und dennoch ein Egoist sein. Ich bilde mir ein, dass Sie sich in meiner Gesellschaft nicht langweilen und mich nicht für einen ungehobelten Mann halten – gleichwohl dürften Sie der Ansicht sein, dass ich für ein Bonmot – wie heißt es doch? – meine Großmutter verkaufe.»
«Sie sind fahrig und vergesslich wie jeder Grandseigneur», bemerkte Lisa, «das ist alles.»
Panschin verzog ein wenig das Gesicht.
«Wissen Sie was?», erwiderte er. «Reden wir nicht mehr davon! Lassen Sie uns lieber unsere Sonate spielen! Um eines möchte ich Sie jedoch bitten», schob er noch nach und strich mit der Hand über die Seiten des auf dem Notenpult stehenden Hefts. «Denken Sie von mir, was Sie wollen, nennen Sie mich notfalls gar Egoist! Doch nennen Sie mich niemals mehr einen Grandseigneur. Diesen Spottnamen ertrage ich nicht. Anch’io sono pittore, auch ich bin ein Künstler, allerdings ein schlechter, und ebendas – also, dass ich ein schlechter Künstler bin – werde ich Ihnen jetzt sofort beweisen. Wir brauchen bloß anzufangen!»
«Gut, fangen wir also an», sagte Lisa.
Das erste Adagio klang recht passabel, selbst wenn Panschin ein paarmal danebengriff. Eigene Stücke und einstudierte Werke brachte er überaus anrührend dar, doch vom Blatt spielte er erbärmlich. Deshalb misslang der zweite Satz der Sonate, ein recht schnelles Allegro, gänzlich: Beim zwanzigsten Takt kapitulierte Panschin, der bereits zwei Takte hinterherhinkte, und schob lachend den Stuhl zurück.
«Nein!», rief er aus. «Ich spiele heute einfach miserabel! Nur gut, dass Lemm uns nicht gehört hat, er wäre glatt in Ohnmacht gefallen.»
Lisa erhob sich, schloss das Fortepiano und drehte sich Panschin zu.
«Was machen wir stattdessen?», wollte sie wissen.
«Das ist Lisaweta Michailowna, wie sie leibt und lebt! Nie können Sie untätig dasitzen! Nun gut, wenn Sie wollen, lassen Sie uns noch etwas zeichnen, bevor es endgültig dunkel ist. Vielleicht ist mir diese andere Muse, also die Muse der Zeichenkunst, diese … da habe ich doch glatt vergessen, wie sie heißt … aber vielleicht ist sie mir ja geneigter. Wo ist Ihr Album? Wenn ich mich nicht irre, ist meine Landschaft noch nicht fertig.»
Lisa verließ das Zimmer, um ihr Album zu holen, derweil zog Panschin, nunmehr allein, ein Batisttuch aus seiner Tasche, polierte damit seine Fingernägel und schielte beiläufig auf seine Hände. Diese waren sehr weiß und sehr gepflegt; den Daumen der linken Hand zierte ein spiralförmiger goldener Ring. Sobald Lisa zurückkehrte, setzte sich Panschin ans Fenster und schlug das Album auf.
«Ah», rief er, «wie ich sehe, haben Sie angefangen, meine Landschaft zu kopieren – noch dazu ganz hervorragend. Wirklich exzellent! Nur hier … geben Sie mir rasch einen Stift! … hier sind die Schatten nicht kräftig genug ausgeführt. Das muss so sein!»
Und Panschin warf mit großer Geste einige lange Striche aufs Papier. Er zeichnete stets ein und dieselbe Landschaft: im Vordergrund hohe windzerzauste Bäume, dahinter eine Lichtung und am Horizont zerklüftete Berge. Lisa linste über seine Schulter auf die Arbeit.
«In einer Zeichnung, wie aber auch im Leben generell», erläuterte Panschin, der den Kopf bald nach rechts, bald nach links neigte, «sind Schwung und Kühnheit das A und O.»
In diesem Augenblick kam Lemm ins Zimmer, um sich mit einer reservierten Verbeugung zu verabschieden.
Panschin legte Album und Stift kurzerhand zur Seite und versperrte ihm den Weg. «Sie wollen doch nicht schon aufbrechen, verehrter Christoph Fjodorytsch? Bleiben Sie denn nicht zum Tee?»
«Ich muss nach Hause», knurrte Lemm. «Ich habe Kopfschmerzen.»
«Seien Sie nicht albern, Sie bleiben! Wir wollen doch noch über Shakespeare disputieren.»
«Ich habe Kopfschmerzen», wiederholte der Alte.
«In Ihrer Abwesenheit haben wir uns bereits die Beethoven-Sonate vorgenommen», fuhr Panschin fort, der Lemm wie einen alten Freund bei der Taille fasste und ihn anstrahlte, «aber es war das reine Fiasko. Stellen Sie sich vor, ich habe keine zwei Noten hintereinander richtig gespielt!»
«Hätten Sie halt viel besser Ihre Romanze wieder gesungen», erwiderte Lemm, löste Panschins Hände von seinen Seiten und ging davon.
Lisa eilte ihm nach. An der Vortreppe holte sie ihn ein.
«Christoph Fjodorytsch, ich muss mit Ihnen reden», sagte sie auf Deutsch, während sie ihn über das kurze grüne Gras zum Tor begleitete. «Ich bin Ihnen gegenüber schuldig geworden, bitte verzeihen Sie mir.»
Lemm erwiderte kein Wort.
«Ich habe Wladimir Nikolajewitsch Ihre Kantate nur gegeben, weil ich mir sicher war, dass er sie zu schätzen weiß. Und ganz genau so war es ja auch, sie hat ihm ausnehmend gut gefallen.»
Lemm blieb stehen.
«Schon vergeben», entgegnete er auf Russisch, um dann in seiner Muttersprache hinzuzufügen: «Aber er kann dergleichen nicht verstehen. Wieso begreifen Sie das bloß nicht? Er ist ein Dilettant, und damit Punktum!»
«Sie sind ihm gegenüber ungerecht», widersprach Lisa. «Es gibt nichts, von dem er nichts versteht, und in fast allen Bereichen schafft er zudem Eigenes.»
«Ja, aber nichts Originelles, sondern nur leichte Ware und hingeworfenes Stückwerk. Dergleichen gefällt, und also gefällt auch er, mehr will er nicht. Bravo, sag ich da nur! Im Übrigen gräme ich mich nicht, diese Kantate und ich, wir sind beide alte Narren. Das Ganze ist mir zwar ein wenig peinlich, aber das geht vorbei.»
«Verzeihen Sie mir, Christoph Fjodorytsch», brachte Lisa noch einmal hervor.
«Schon vergeben», versicherte er abermals auf Russisch. «Sie sind ein gutes Mädchen … Da will jemand zu Ihnen. Leben Sie wohl. Sie sind wirklich ein sehr gutes Mädchen.»
Mit eiligen Schritten hielt Lemm auf das Tor zu, durch das gerade ein ihm unbekannter Herr in grauem Mantel und mit einem breiten Strohhut trat. Der Deutsche begrüßte ihn mit einer höflichen Verbeugung – das hielt er allen neuen Personen in der Stadt O. gegenüber so, während er sich von Menschen, die er kannte, prinzipiell abwandte –, entschwand durchs Tor und stapfte dicht am Zaun entlang davon. Der Unbekannte sah ihm verwundert hinterher, blickte dann zu Lisa hinüber und lief schnurstracks auf sie zu.
7
«Sie werden mich nicht mehr kennen», bemerkte er und zog den Hut. «Aber ich habe Sie gleich erkannt, auch wenn schon acht Jahre seit unserer letzten Begegnung vergangen sind. Damals waren Sie noch ein Kind. Ich bin Lawrezki. Ist Ihre Frau Mama zu Hause? Kann ich sie wohl sprechen?»
«Meine Mutter wird sich freuen», erwiderte Lisa. «Sie hat bereits von Ihrer Ankunft gehört.»
«Sie heißen doch Jelisaweta, nicht wahr?», bemerkte Lawrezki und stieg die Vortreppe hinauf.
«Ja.»
«Ich erinnere mich noch gut an Sie. Bereits als Kind hatten Sie ein Gesicht, das man nicht vergisst. Damals hatte ich immer Süßigkeiten für Sie dabei.»
Lisa errötete. «Was für ein seltsamer Mann», dachte sie. Lawrezki wartete in der Diele, Lisa ging in den Salon, in dem Panschin sein Lachen und seine Stimme ertönen ließ; er hinterbrachte Marja Dmitrijewna und Gedeonowski – die beiden waren aus dem Garten zurückgekehrt – den städtischen Tratsch, wobei er selbst am lautesten über seine Geschichten lachte. Bei Lawrezkis Namen geriet Marja Dmitrijewna in helle Aufregung, wurde kreideblass und eilte ihm entgegen.
«Willkommen, mein lieber cousin, herzlich willkommen!», rief sie mit gedehnter und beinah tränenerstickter Stimme. «Was für eine Freude, Sie zu sehen!»
«Guten Tag, meine beste Cousine», erwiderte Lawrezki und drückte aufs Freundlichste die Hand, die sie ihm entgegenstreckte. «Wie ist das werte Befinden?»
«Setzen Sie sich, so setzen Sie sich doch, mein teurer Fjodor Iwanytsch! Ach, was für eine Freude! Erlauben Sie, dass ich Ihnen zunächst meine Tochter Lisa vorstelle …»
«Ich habe mich Lisaweta Michailowna bereits bekannt gemacht», unterbrach Lawrezki sie.
«Monsieur Panschin … Sergej Petrowitsch Gedeonowski … Und nun setzen Sie sich endlich! Selbst jetzt, da Sie vor mir stehen, mag ich meinen Augen kaum trauen. Wie ist es Ihnen ergangen?»





























