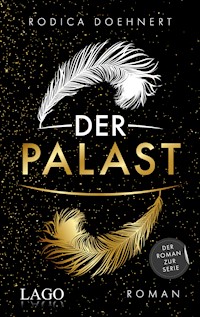Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Berlin 1994. Fast ihr ganzes Leben hat Sonja Schadt im legendären Adlon am Brandenburger Tor verbracht. Sie hat seine Gründung erlebt, die Glanzzeit und den Niedergang. Sie hat den Geist des Ortes gehütet. Und immer hat sie darauf gewartet, ihr Familiengeheimnis zu lösen. Als sie endlich ihrer Enkelin gegenübersteht, ist sie neunzig Jahre alt. Katharina Zimmermann gehört zum Architektenteam, das am Wiederaufbau des Adlon arbeitet. Eine schicksalhafte Begegnung. Gegen alle inneren und äußeren Widerstände decken Großmutter und Enkelin eine Familienlüge auf. Rodica Doehnert, deren Drehbuch zu "Das Adlon – Eine Familiensaga" den TV-Dreiteiler zu einer Fernsehsensation mit 9 Millionen Zuschauern machte, lässt in ihrem Roman das packende emotionale Geschehen vor historischer Kulisse lebendig werden. Während Sonja Schadt ihrer Enkelin die Geschichte des legendären Hotels, seiner Glanzzeit und seines Niedergangs erzählt, erfährt der Leser endlich die ganze Dramatik rund um Sonja Schadts wahre Herkunft. Gemeinsam mit ihrer Enkelin löst Sonja den Fluch auf, der die Frauen in ihrer Familie am Glücklichsein hindert: Fünf starke Frauen und ihre Suche nach Selbstbestimmung – eine Familiengeschichte, die mit einer Lüge begann und mit der Rodica Doehnert Liebe endet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
RODICA DOEHNERT
DAS
ADLON
Eine Familiensaga
ROMAN
Trotz sorgfältiger Recherche konnten nicht alle Bildbeiträger bzw. deren Rechtsnachfolger ausfindig gemacht werden. Sollten unberücksichtigte Rechtsansprüche bestehen, so sind diese beim Verlag geltend zu machen.
1. eBook-Ausgabe 2022
© 2019 Europa Verlag, ein Imprint der Europa Verlage GmbH, München
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, unter Verwendung von Motiven von: © Lee Avison/Arcangel und © ZDF
Layout & Satz: Danai Afrati & Robert Gigler
Konvertierung: Bookwire
ePub-ISBN: 978-3-95890-326-5
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
FÜR DIE WEGGEFÄHRTINNEN UND WEGGEFÄHRTEN,DIE NACH ERKENNTNIS STREBEN
FREUDE SCHÖNER GÖTTERFUNKEN,TOCHTER AUS ELYSIUM,WIR BETRETEN FEUERTRUNKEN,HIMMLISCHE, DEIN HEILIGTUM …
INHALT
PROLOG
BUCH 1. Alma
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
BUCH 2. Sonja
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
BUCH 3. Anna-Maria
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
PROLOG
Pandora missachtete Zeus’ Rat und öffnete die Büchse. So kam all das Böse über die Welt: Krankheiten und Seuchen. Dürre und Hungersnot. Neid und Missgunst. Lieblosigkeit. Kriege, und mit ihnen, Verderben und der Tod.
Die Legende sagt, dass es auch etwas Gutes gab. Die Hoffnung. Dass aber die Büchse verschlossen wurde, noch bevor sie sich zeigen konnte.
Auf die Frage, was es denn mit der Hoffnung auf sich habe und ob wir uns nicht glücklich schätzen könnten, dass diese im Schutze der Büchse ruhe, antwortete ein deutscher Philosoph, dass die Hoffnung, das Schlimmste sei, weil sie die Menschen immer wieder dazu antreibe, die Schrecken neu zu erproben …
Doch nun ist es genug!
BUCH 1
Alma
Es war zwingend, dass sich die Enkelin und die Großmutter begegneten. Ein Fluch musste aufgelöst werden: »Die Frauen in unserer Familie taugen nichts.« So hatten es die Mütter ihren Töchtern über Generationen weitergegeben. Und alle litten sie unter diesem Makel und kämpften dagegen an. Doch jeder Kampf schien nur erneut Zeugnis über ihr verderbtes Wesen abzulegen.
Doch nun ist es genug!
1. Kapitel
Sonja Schadt war um fünf Uhr aufgestanden. Je älter sie wurde, desto früher zog es sie aus dem Bett. Und auch wenn sie viel weniger schlief als früher, hatte sie das Gefühl, dass die Stunden des Tages gar nicht ausreichten, um all die Dinge zu tun, die sie so sehr liebte. Der Morgen begann stets mit einer großen Kanne Kaffee. Dabei las sie die Zeitung.
An diesem Tag, einem Donnerstag, Anfang Oktober 1994 fiel Sonjas Blick auf die Schlagzeile ADLON OBLIGE – BERLIN BAUT DAS NOBELHOTEL WIEDER AUF. Die Reste des alten Gebäudes waren zehn Jahre zuvor gesprengt worden. Da stand die Berliner Mauer noch, und die Stadt war in Ost und West geteilt. Heute gab es gegenüber vom Brandenburger Tor neben der Akademie der Künste nur noch eine Wüste aus Schutt und Geröll. Verblüfft zog Sonja die Zeitschrift zu sich heran und griff nach der Lupe, um das Foto, das unter der Schlagzeile abgedruckt war, genauer zu betrachten. Ihr Vergrößerungsglas wanderte über die Gesichter der Gruppe, die sich zur Auftragsvergabe auf dem Pariser Platz zusammengefunden hatte. Neben der Berliner Baustadträtin stand der Regierende Bürgermeister, daneben die Star-Architekten Joachim Paarmann und Winfried Heller, selbstbewusste Männer um die fünfzig. Sonjas Vergrößerungsglas fing eine junge Frau ein, die am Rande des Bildes stand, als sei sie nur zufällig dabei und gehöre nicht wirklich dazu. Die Lupe der alten Dame hob das Gesicht der Jüngeren deutlicher hervor. Sonja las den Namen. Einmal – und ein zweites Mal.
Katharina Zimmermann lief eilig über den Pariser Platz und sah Paarmann und Heller, ihre Chefs, Matthias Seifert, den Bauleiter, und die beiden Arbeiter der Wasserwirtschaft am stillgelegten Springbrunnen warten.
»Tut mir leid, Stau!«, murmelte sie verlegen und war froh, dass keine weiteren Fragen oder Beschwerden folgten.
»Sie können loslegen«, sagte Paarmann zu den beiden Arbeitern. Er war ein Hüne, in dessen dunkler Künstlermähne sich graue Strähnen breitmachten. Im Gespann mit seinem Architektenkollegen Winfried Heller, einem gut aussehenden Endfünfziger, gab er den Ton an.
Die Arbeiter setzten ihre Helme auf und begannen, die Abdeckung des Brunnenbodens mit Eisenstangen zu öffnen. Alle beobachteten die Anstrengung ehrfürchtig. Sie waren sich des historischen Moments bewusst.
Die Arbeiter hebelten und stießen in die Rille, die bei jeder Bewegung einen Millimeter breiter wurde. Endlich hatte einer den Rand des Deckels mit der Eisenstange gegriffen.
»Geh runter mit deinem Haken«, sagte der Arbeiter atemlos zu seinem Kollegen.
Die zweifache Hebelbewegung verdoppelte die Kraft. Knirschend bewegte sich der Deckel nun zentimeterweise zur Seite und gab endlich den Einstieg frei. Voller Respekt schauten alle in den Schlund, der in die Katakomben unter dem Pariser Platz führte und weiter in die Kellergewölbe des alten Adlon. Die Arbeiter traten zur Seite und zündeten sich eine Zigarette an. Sie würden warten, bis alle wieder oben waren, und dann den Brunnen verschließen.
Seifert gab ein Zeichen, dass die Architekten ihre Helme aufsetzten, und machte sich an den Abstieg. Heller folgte. Paarmann ließ Katharina den Vortritt.
Als sie die schmale Eisentreppe hinunterstieg, spürte Katharina, wie ihr Herz schlug. Adlon! Der Name des Hotels hatte ihre Kindertage begleitet und war Inbegriff für den Verrat, der in ihrer Familie geschehen war. Wenn sie ihre Mutter dazu befragte, wich diese aus.
Als Katharina den Fuß auf den staubigen Boden des Gewölbes unter dem Pariser Platz setzte, durchfuhr sie plötzlich der Gedanke, dass sie möglicherweise nur aus diesem Grund Architektur studiert hatte, um einmal hier herunterzusteigen und zwischen den Trümmern des untergegangenen Adlon nach Antworten zu suchen.
Nach wenigen Schritten glich der Abstieg einer Zeitreise. Der Lichtkegel von Katharinas Taschenlampe fiel auf das Emblem der untergegangenen DDR, das mit Ölfarbe an die Wand gemalt worden war: Hammer und Sichel wurden durch einen Zirkel gehalten und von einem Ährenkranz umschlungen. Hier unten war bis vor fünf Jahren die Grenze zwischen Ost- und Westberlin verlaufen.
Katharina sah Hakenkreuze, die nur notdürftig überpinselt worden waren. Sie schienen sich durch die Farbe zu fressen. »Schlagt Hitler«, verkündete eine Parole, die aus der Weimarer Republik Ende der Zwanzigerjahre stammte, genauso wie die Warnung: »Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg!«
»Hier beginnt der Keller des Adlon«, rief ihnen Seifert zu. Er zeigte auf eine zum Teil eingestürzte Wand, wo eine Eisentür immer noch verschlossen und majestätisch den Einlass verwehren wollte.
Sie stiegen einer nach dem anderen über die Steine und das Geröll neben der Tür in das legendäre Hotel. Nach wenigen Schritten blieb Paarmann stehen und fragte eine Spur zu pathetisch:
»Was spüren Sie, Katharina?«
Sie schaute sich um und wich aus. »Viel Arbeit!«
»Die Seele«, sagte Paarman. »Die Seele des alten Adlon.«
Natürlich wusste Katharina, was er meinte. Aber sie wollte sich seiner Gefühlserregung nicht anschließen, sondern nüchtern und wach bleiben. Für sie stand zu viel auf dem Spiel.
»Hier war der Weinkeller.« Der Lichtkegel von Hellers Taschenlampe erfasste morsche, zum Teil in sich zusammengefallene Holzregale, in denen sich sogar noch ein paar unversehrte Flaschen befanden. Paarmann griff sich eine und blies den Staub vom Etikett.
»Weinhandlung Lorenz Adlon.«
Katharina bückte sich nach einem Messer, das im Schutt zwischen Glasscherben lag, und polierte den Griff an ihrer Jacke blank, bis die Gravur LA zu lesen war.
»Lorenz Adlon«, murmelte sie.
»Oder Louis Adlon«, rief Paarmann herüber. »Der Sohn hat das Hotel nach dem Tod des Vaters weitergeführt.«
»Wir müssen noch die Denkmalbehörde durchschicken«, mahnte Seifert, während er die Kopie einer Karte auf einem maroden Holztisch ausbreitete. »Ein Kanalisationsplan aus dem letzten Jahrhundert.«
Er nahm den Hammer von seinem Gürtel und begann die Mauern abzuklopfen. Als Bauleiter musste er sich einen Überblick über die tragenden Wände und deren Zustand verschaffen. Katharina trat näher und sah, dass Seifert die Karte bereits für ihre Zwecke eingerichtet hatte.
»Das Nebengebäude, die Akademie der Künste, muss geschützt werden. Sie könnten schon mal einen Termin mit dem Statiker ausmachen.« Paarmann schaute über Katharinas Schulter. »Die Denkmalbehörde wird uns die nächsten Wochen für eine gründliche Vorbereitung schenken. Die gehen hier erst wieder raus, wenn sie jeden Stein und jedes Holzstück dreimal umgedreht haben. Vorher sind wir chancenlos. Also nutzen wir die Zeit für die Anträge und den Behördenkram.«
Als sie nach dem Abstieg zurück ins Architekturbüro kamen, wurden sie von Paarmanns Assistentin Laura mit der Nachricht erwartet, dass eine Frau Schadt angerufen habe.
»Sie behauptet, dass sie fast fünfzig Jahre im Adlon gelebt hat, und freut sich, wenn sie helfen kann, falls es Fragen gibt.«
Katharina schaute Laura entgeistert an: »Sonja Schadt?«
»Sie lebt in einer Pension in Prenzlauer Berg. Soll ich einen Termin ausmachen?«
»Ich kümmere mich drum«, sagte Katharina schnell und riss Laura den Zettel, auf dem die Angaben notiert waren, förmlich aus der Hand. Paarmann warf seiner Assistentin einen beschwichtigenden Blick zu.
»Sie müssen uns unbedingt in die Keller unter dem Pariser Platz begleiten, Laura, dann werden Sie verstehen, warum Frau Zimmermann vor Neugierde und Abenteuerlust platzt.«
Laura zog belustigt die Augenbrauen hoch und ging.
»Kümmern Sie sich um die Denkmalpfleger?«, rief Paarmann Katharina zu, die schon auf dem Weg zu ihrem Schreibtisch war. Als sie nicht reagierte, wiederholte er energischer: »Die Denkmalbehörde, Katharina, muss so schnell wie möglich mit der Arbeit beginnen.«
»Bin schon am Telefon.« Katharina hob zur Bekräftigung den Hörer in seine Richtung. Paarmann nickte und verschwand in seinem Büro. Katharina legte den Zettel mit dem Namen und der Telefonnummer auf den Schreibtisch und sah, dass er von ihrer Hand feucht geworden war.
Während sie die Französische Straße zum Gendarmenmarkt hinunterlief, verkroch sich Katharina in ihrer Jacke. Ein eisiger Wind kündigte den Winter an.
Zuerst hatte Katharina die Denkmalbehörde angerufen, dort niemanden erreicht und dann eine Weile auf den zerknitterten Zettel gestarrt, bis sie sich entschloss, die Handynummer ihrer Mutter zu wählen. Sie war überrascht, als Anna-Maria sofort ans Telefon ging, und noch mehr, als sie erfuhr, dass die Mutter wegen einer Gerichtsverhandlung in Berlin war und erst am nächsten Tag zurück nach Frankfurt fliegen musste. Als Anna-Maria hörte, dass ihre Tochter sie dringend sprechen wollte, schlug sie ein Kaffeehaus in der Nähe des Gendarmenmarkts vor. Es kam selten vor, dass sich Mutter und Tochter so spontan trafen. Normalerweise hatte Anna-Maria einen übervollen Kalender, und eine Verabredung mit der Tochter musste langfristig geplant werden. Katharina war daran gewöhnt, dass die Mutter oft in letzter Minute absagte, weil eine Gerichtsverhandlung oder das Anliegen eines Mandanten wichtiger waren.
Gleich nach dem Abitur, die Berliner Mauer stand noch, war Katharina zu Hause ausgezogen und nach Westberlin gegangen, um an der Technischen Universität Architektur zu studieren. Wenn sie überhaupt noch nach Frankfurt fuhr, dann zu den Feiertagen. Die Mutter ihrerseits mied Berlin und kam nur in die geteilte Stadt, wenn ein Verhandlungstermin das erforderte. Das blieb auch so, als die Mauer fiel. Mutter und Tochter hatten sich früh verloren. Aber vielleicht hatten sie sich auch nie wirklich gefunden.
Katharina sah das Kaffeehaus mit den roten Markisen schon von Weitem. Die Fenster warfen ein warmes Licht auf die Straße. Drinnen saß ihre Mutter, las die FAZ und rauchte. Der Kellner brachte ihr einen Espresso. Sie entdeckte die Tochter, legte die Zeitung aus der Hand, stand auf und kam Katharina entgegen. Sie umarmten sich.
»Weißt du, wie lange wir uns nicht gesehen haben?« Anna-Maria schüttelte den Kopf. »Ich hab vorhin mal nachgerechnet. Und war ganz erschrocken.«
Sie setzten sich einander gegenüber.
»Du wolltest mich letzten Sommer auf dem Darß besuchen.« Katharina sagte es leichthin, versuchte jeden Vorwurf zu vermeiden und blätterte in der Getränkekarte, ohne etwas wahrzunehmen.
Die Mutter nickte bedauernd. »Ich bin im Sommer einfach nicht aus der Kanzlei weggekommen. Vielleicht sollte ich mir endlich einen Sozius nehmen. Aber du weißt ja, dass ich am liebsten allein arbeite.«
Sie griff sich die nächste Zigarette und holte ein Wochenmagazin aus ihrer Handtasche, fand die Seite schnell und legte die Zeitschrift aufgeschlagen auf den Tisch.
ADLON OBLIGE – BERLIN BAUT DAS NOBELHOTEL WIEDER AUF
Anna-Maria tippte auf das Foto, auf dem ihre Tochter rechts außen am Bildrand klemmte.
»Wie kommt es, dass ausgerechnet du bei diesem Bauprojekt dabei bist?«
Katharina schloss die Getränkekarte und schaute ihre Mutter an. »Ich habe mich beworben.«
»Wie beworben?«
»Lebenslauf. Bewerbungsschreiben. Vorstellungsgespräch«, sagte Katharina spöttisch. Dabei wurde ihr schwer ums Herz. Sie war gekommen, um ihrer Mutter Fragen zu stellen. Doch die übernahm augenblicklich die Gesprächsführung und brachte die Tochter in die Defensive. Einmal Anwältin, immer Anwältin, dachte Katharina und versuchte, die Ruhe zu bewahren.
»Du bewirbst dich, um diesen reaktionären Kasten aus Kaiserzeiten wiederaufzubauen?«
Statt einer Antwort griff Katharina in ihre Jackentasche, holte den zerknitterten Zettel hervor und legte ihn auf den Tisch. Anna-Maria folgte Katharinas Blick und las den Namen und eine Telefonnummer. Es wurde sehr still.
»Was ist damit?«
»Deine Mutter hat sich bei uns im Büro gemeldet.«
Anna-Maria zündete sich eine weitere Zigarette an.
»Wusstest du, dass sie noch lebt?«
»Sonja und ich, wir haben seit Jahrzehnten keinen Kontakt mehr«, erwiderte Anna-Maria kühl.
Katharina schüttelte den Kopf. »Wir haben keine Verwandten … keine Familie … ich kenne meinen Vater kaum … habe nur dich … Und jetzt meldet sich deine Mutter, und dich interessiert das nicht?«
Anna-Maria antwortete scharf: »Meine Mutter hat ihr Fähnchen immer nach dem Wind gehängt. Sie hatte keine politische Meinung, weder zu den Nazis noch zu den Kommunisten. Sie hat im Adlon gelebt, und mehr wollte sie nicht.«
»Sie wird zu uns ins Architekturbüro kommen. Und dann werde ich sie kennenlernen.«
Anna-Maria trank einen Schluck Kaffee. Katharina sah, dass ihre Hand zitterte. »Grab nicht in der Vergangenheit.«
Katharina wollte widersprechen, sich erklären. Doch Anna-Maria wiederholte: »Lass die Finger davon!«
Als Katharina kurze Zeit später wieder durch die nasskalten Straßen lief, war es stockdunkel. Sie waren ohne jede Annäherung auseinandergegangen. Als sich Katharina die Begegnung mit der Großmutter nicht ausreden lassen wollte, hatte Anna-Maria die Rechnung geordert, ihre Tochter mit einem letzten, kritischen Blick bedacht und war gegangen.
2. Kapitel
Das Spaghetti-Wasser kochte über. Alexander wischte mit routinierten Handbewegungen die Ceranoberfläche trocken.
»Deine Mutter hat wirklich nie über sie gesprochen?«, rief er ins Wohnzimmer.
Dort saß Katharina am Esstisch und hielt sich an einem Rotweinglas fest.
»1936 soll meine Großmutter ihren Mann und ihre Tochter im Stich gelassen haben. Da war Anna-Maria noch nicht mal drei Jahre alt. Vater und Tochter mussten Deutschland Hals über Kopf verlassen. Mein jüdischer Großvater hat keinen Fuß mehr zurück in seine Heimat gesetzt. Er hat die israelische Staatsbürgerschaft angenommen und nur noch hebräisch gesprochen. Ich hab ihn nie kennengelernt. Mutter und ich sind einmal nach Tel Aviv geflogen. Das war zu seiner Beerdigung. Da war ich neun.«
Alexander begann die Bolognese zu würzen. Die Zutaten richtig zu dosieren verlangte seine ganze Konzentration. Als die Soße bei kleiner Hitze köchelte, kam er ins Wohnzimmer und goss sich ein Glas Wein ein.
»Wir gründen unsere eigene Familiendynastie …« Er setzte sich Katharina gegenüber und schaute sie an. Sie wich seinem Blick aus. »… Knipsen Fotos, kleben sie in Alben. Machen Familienfeste.«
Sie ärgerte sich augenblicklich über ihren Zynismus und darüber, dass Alexander nicht aufgab, obwohl er doch wusste, dass sie nicht auf seinen Vorschlag, zu heiraten, wenigstens zusammenzuziehen, eingehen würde. Verflucht noch mal, warum musste er immer wieder damit anfangen?
Alexander prostete ihr zu.
»Genauso!« Er stand auf und ging zurück in die Küche.
Katharina war traurig. Sie schaute in ihr Glas, auf dessen Grund sich Weinstein abgesetzt hatte, und wusste selbst nicht, warum sie sich ein gemeinsames Leben nicht vorstellen konnte. Ganz bestimmt lag es nicht daran, dass sie ihn nicht genug liebte oder dass sie nicht zusammenpassten, weil er im Osten und sie im Westen aufgewachsen war. Sie genossen die unterschiedlichen Welten und ihre Erfahrungen und wurden nicht müde, sich die Geschichten ihrer Kindheit zu erzählen. Inzwischen sagten sie beide zum Supermarkt »Kaufhalle«, zum Spülmittel »Fit« und zu Papiertaschentüchern »Tempos«. Sie schufen sich eine vereinte Sprache und eroberten das ehemals geteilte Berlin. Sie waren ein ost-westdeutsches Paar.
Katharina war stolz, wenn sie Alexander ihren Freundinnen und Freunden vorstellte. Sie gehörten zusammen. Trotzdem hatte Katharina panische Angst vor einer verbindlichen Entscheidung. Eine gemeinsame Zukunft schien ein Raum zu sein, dessen Tür verschlossen war. Sie zu öffnen bedeutete Lebensgefahr.
Das Taxi hielt vor der Gründerzeitvilla mit den drei Etagen. Sonja zahlte und nahm die Quittung entgegen. Sie hatte rigoros abgelehnt, abgeholt oder begleitet zu werden. Immer noch war es für sie ein Abenteuer, frei und selbstbestimmt durch das wiedervereinigte Berlin zu fahren.
Als sie die wenigen Schritte zur Haustür ging, hatte sie das Gefühl, beobachtet zu werden. Doch sie widerstand dem Bedürfnis, sich umzudrehen. Die Tür öffnete sich mit einem Summton, und ein junges Mädchen kam ihr entgegen.
»Frau Schadt, wir haben telefoniert. Ich bin Laura. Wie schön! Ich hoffe, Sie hatten keine Umstände herzukommen«, sagte sie mit strahlendem Lächeln und mit einer Leichtigkeit, die zur Jugend gehört, wenn alles noch vor einem liegt. Wenn nichts getrübt ist durch die Last der Erfahrungen, dachte Sonja. Die Last der Erfahrungen? Spürte sie all die Erfahrungen, die sie in den neunzig Jahren ihres Lebens gemacht hatte, als Last?
An der Eingangstür zum Architekturbüro wurde Sonja von Lauras Chef erwartet.
»Was für eine Freude, Sie persönlich kennenzulernen, Frau Schadt. Ich bin Joachim Paarmann.«
Der Architekt schüttelte ihre schmale Hand. Sonja hatte das Gefühl, Botschafterin aus einer anderen Zeit zu sein. Dieses Gefühl amüsierte sie und verlieh ihr zugleich Selbstvertrauen.
Paarmann führte Sonja durch eine Zimmerflucht an Reißbrettern vorbei, an denen technische Zeichner arbeiteten. Ganz hinten befand sich der Konferenzraum, wo Laura inzwischen begonnen hatte, den Tisch mit Obst und Kuchen zu decken. Paarmanns Partner stand am Fenster zum Garten und telefonierte. Als er Sonja kommen sah, beendete er das Gespräch.
»So schön, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben, Frau Schadt. Ich bin Winfried Heller. Aber bitte setzen Sie sich doch.«
Er bot ihr einen Platz direkt vor der Leinwand an, auf der schon der Lichtkegel des Projektors für eine Diashow tanzte.
Laura war fertig mit dem Eindecken.
»Tee oder Kaffee? Frau Schadt, was darf ich Ihnen bringen?«, fragte sie.
»Einen Kaffee mit ein wenig Milch, keinen Zucker«, erwiderte Sonja erfreut. Schon lange hatte sie nicht mehr so viel Aufmerksamkeit genossen. In der Pension war stets sie die Gastgeberin.
»Sehr gern«, erwiderte Laura und wandte sich zum Gehen.
»Wenn Katharina kommt, schicken Sie sie bitte gleich zu uns nach hinten«, wandte sich Paarmann an seine Assistentin.
»Ich glaube, dass ich ihr Auto schon auf dem Parkplatz vor dem Haus gesehen habe«, sagte Laura unbekümmert.
»Na, dann wird sie ja gleich da sein.«
Sonja lächelte in stiller Vorfreude.
Katharina gab sich einen Ruck und rutschte hinter dem Lenkrad hervor, von wo aus sie die Ankunft ihrer Großmutter beobachtet hatte.
Nach dem Treffen mit Anna-Maria hatte Katharina Laura gebeten, bei Sonja Schadt anzurufen und einen Termin zu vereinbaren. Sie selbst war zu verwirrt, um sich als die vorzustellen, die sie war – Sonjas Enkelin.
Außerdem, wusste die Großmutter überhaupt, dass es Katharina gab, dass sie eine Enkeltochter hatte?
Plötzlich fürchtete Katharina, ihre Mutter könnte recht haben mit der Behauptung, dass die Beschäftigung mit der Vergangenheit nichts Gutes hervorbringen würde. »Auf den Frauen in unserer Familie liegt ein Fluch!«
Könnte die Begegnung mit Sonja diesen Fluch zum Leben erwecken? Katharina wollte sich nicht in einer dunklen Vergangenheit verstricken. Aber hatte sie das nicht schon getan, als sie sich bei Heller & Paarmann bewarb?
Es war genau vor einem Jahr gewesen. Katharina schrieb an ihrer Diplomarbeit, als sie zufällig von ihrem Mentor erfuhr, dass der Neubau des Hotel Adlon am Pariser Platz geplant war.
Katharina hatte keinen Augenblick gezögert und sich beim zuständigen Planungsbüro um eine Stelle als Junior-Architektin beworben. Sie dachte nicht einmal darüber nach, ob sie als Absolventin überhaupt geeignet war, an einem solch renommierten Projekt teilzunehmen. Als die Bewerbung abgeschickt war, vertiefte sie sich wieder in ihre Abschlussarbeit, in der es um die Verlagerung von Gewerbe und Handwerk an die Ränder der Städte ging. Neben dem theoretischen Teil fertigte sie das Modell eines Gründerzentrums an, das als Mittelpunkt des Gewerbegebietes unterschiedlichste Branchen beherbergen sollte, damit sich die einseitige Entwicklung konstruktiv wandeln könnte. Es war ein idealistisches Projekt, dem sich Katharina da verschrieben hatte und mit dem sie ihre soziale Ader auslebte.
Als ihr Telefon klingelte, hatte sie gerade die Finger voller Klebstoff und einen Kurzzeitwecker auf dem Tisch, der sie erinnern sollte, die mit Leim präparierten Teile zum richtigen Zeitpunkt auf die entsprechenden Stellen zu setzen.
»Katharina hier«, sagte sie kurz angebunden, darauf aus, den Anrufer so schnell wie möglich abzuwimmeln. Es meldete sich die Sekretärin von Heller & Paarmann, um sie zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen.
Mit klebrigen Fingern suchte sie nach ihrem Kalender und machte einen Termin aus. Dann legte sie auf und beobachtete regungslos, wie das Gründerzentrum in sich zusammensank, weil die fehlenden Teile inzwischen auf der Tischplatte statt im Modell festgeklebt waren.
Wenn etwas leicht geht, dann bist du auf dem richtigen Weg, hatte einmal ein Freund ihrer Mutter zu ihr gesagt. Sie hatte den Worten keine Bedeutung beigemessen. In ihrem Leben – davon war sie überzeugt – ging alles schwer. Sie hatte sich daran gewöhnt und auch daran, die Hürden zu nehmen, die diese Schwierigkeiten mit sich brachten.
Aber wider Erwarten war das Gespräch mit den Architekten einfach. Sie erzählte von den zwei Praxisjahren vor dem Studium, von den neun Semestern, die sie absolviert hatte, und von ihrer Diplomarbeit. Sie beantwortete die Fragen, die nicht spitzfindig waren, sondern ehrlich und interessiert. Drei Tage später kam ein Brief, der ihr mitteilte, dass Heller & Paarmann sie für ein Probejahr anstellen wollten. All dies machte Katharina skeptisch. Was stimmte hier nicht? Es ging zu leicht.
Sie diskutierte ihre Zweifel mit Alexander. Er lächelte und hob die Schultern.
»Vielleicht finden sie dich sympathisch?« Und mit einem Anflug von Eifersucht setzte er nach: »Oder einer der alten Herren ist scharf auf dich?«
Dass er dieses Thema aufbrachte, gefiel ihr nicht.
»Immerhin kennen sie die Beurteilungen meiner Praktika. Sie kennen meine Prüfungsergebnisse. Ich war ja schließlich nicht mit leeren Händen da. Und ich gehöre zu den Besten meines Jahrgangs.« Sie bemühte sich eifrig, die schnelle Entscheidung der Architekten mit ihren Leistungen zu begründen.
»Schon gut«, beruhigte Alexander sie. »Es war eben ganz einfach. Freu dich drüber.«
Jetzt hätte sie am liebsten laut losgelacht. Denn leicht war ihr in diesem Augenblick, in dem sie das Architekturbüro betrat, um Sonja Schadt zu treffen, nicht mehr zumute. Im Gegenteil, sie verfluchte, dass sie sich auf diese Unternehmung eingelassen hatte.
Im abgedunkelten Konferenzraum servierte Laura den Kaffee, während Sonja auf die Leinwand schaute, auf der eine Diashow mit den Fotos des alten Adlon ablief. Damals hatte Sonja jede Ecke, jede Nische, jeden Korridor, jedes Möbel gekannt. Der Blick aus allen Fenstern des Hauses war ihr vertraut aus einer Zeit, als der Pariser Platz und die Straße Unter den Linden noch in vollem Glanz erstrahlten, und auch danach, als die Bomber der Alliierten Berlin zerstört hatten.
»Und das wollen Sie jetzt alles wieder aufbauen?«, fragte Sonja verblüfft.
»Wir werden ein neues Haus bauen. Aber wir wollen auch den historischen Geist wieder aufleben lassen.« Paarmann lächelte stolz.
»Was reizt Sie daran? Sie werden sicher gutes Geld verdienen. Aber darüber hinaus?«
Sonja bemerkte, dass die Architekten von dieser Frage überrascht waren. Sie wollte niemanden aufs Glatteis führen und fügte mit milder Altersweisheit hinzu:
»Es tut mir leid. Manchmal weiß man alles schon zu Beginn, doch meistens offenbart sich einem der Sinn ja erst später bei der Arbeit.«
Heller hielt die Diashow an.
»Nehmen Sie die Frage nicht zurück, entlasten Sie uns nicht«, sagte er aufgeschlossen.
»Um ehrlich zu sein – ich bin kalt erwischt.« Paarmann lachte. »Natürlich könnte ich Ihnen gute Gründe nennen: Ich möchte dabei sein, wenn der Pariser Platz neu entsteht. Ich möchte dem Adlon wieder ein Gesicht geben.« Paarmann holte tief Luft. »Und selbstverständlich ist es für unser Büro eine Ehre, dass wir den Zuschlag für diesen Auftrag bekommen haben.« Er sah sie nachdenklich an. »Aber wahrscheinlich reichen Ihnen diese Gründe nicht.«
Sonja trank einen Schluck Kaffee.
»Ich habe über fünfzig Jahre im Adlon gelebt. Sie müssen verstehen, dass ich neugieriger bin, als es mir vielleicht zusteht.«
»Sie dürfen alles fragen … Sie haben im Adlon gelebt? Waren Sie dort auch angestellt?«
»Später. Zuerst bin ich als Gast eingezogen.«
Sonja unterbrach ihren Gedanken, weil die Tür aufging.
»Katharina Zimmermann, unsere Junior-Architektin«, stellte Paarmann vor.
»Freut mich. Sonja Schadt.«
Sie reichte der Jüngeren die Hand.
»Guten Tag!«, erwiderte Katharina.
Oft genug hatte sich Sonja ausgemalt, unter welchen Umständen – und ob überhaupt – sie sich das erste Mal begegnen würden, und nun passierte es ausgerechnet im Adlon. Unsinn, korrigierte sie sich in Gedanken, nicht im Adlon, sondern wegen des Adlon. War es Zufall? Schicksal?
Vor dem Termin hatte Sonja überlegt, ob sie sich offenbaren sollte. Aber sie hatte ja keine Ahnung, ob Katharina überhaupt wusste, dass es sie gab. Außerdem erschien ihr eine Familienzusammenführung vor den fremden Menschen hier im Büro undenkbar. Nein, es war nicht der richtige Moment.
Katharina setzte sich hinter ihre Chefs. Sonja wandte sich wieder der Diashow zu. Heller startete.
Sonja war in ihren Gedanken bei Katharina. Die Enkelin war schlank, groß gewachsen, mit blondem Haar wie Julian es gehabt hatte. Auch ihre Körpersprache ähnelte der des Großvaters.
»Hinter der alten Fassade, die wir fast originalgetreu wiederaufbauen, werden wir unsere eigene Architektur schaffen«, erklärte Heller.
»Ach ja? Warum denn?« Sonja drehte sich zu den Architekten um, wagte aber nicht, Katharina anzusehen. »Das alte Adlon war in allen Details durchdacht.« Sie bemerkte, dass ihr Herz klopfte, und fürchtete, dass sie den Blick nicht halten konnte.
»Andere Zeiten, andere Anforderungen«, begründete Paarmann das Konzept. »Ist Ihnen nicht gut?«
»Nein, alles bestens.« Sonja schaute zurück auf die Leinwand und erklärte: »Das sind die Suiten. Sie waren so begehrt, dass die Adlons bei großen Anlässen oft nicht wussten, wie sie alle ihre Gäste unterbringen sollte, ohne jemanden zu brüskieren. Sie planen doch auch Suiten?«
Sonja gab sich einen Ruck und wandte sich nun direkt an Katharina. Die nickte erschrocken.
»Selbstverständlich!«
Sonja war erleichtert, dass es ihr gelungen war, Kontakt zu Katharina aufzunehmen, und sie zeigte fast ein wenig übermütig auf das nächste Bild.
»Hier hat Pola Negri gewohnt, fast ein Jahr lang.« Sonja war so glücklich wie ein Mädchen, das bei seiner besten Freundin zum Spielen eingeladen ist. »Und das war Carusos Lieblingszimmer. Und hier hat Anton Kuh residiert, ohne einen Pfennig dafür zu zahlen. Der Mann wusste, wie man schnorrt.«
Dann war die Show zu Ende, und Heller zog die Vorhänge auf.
»Mehr haben wir nicht«, sagte er bedauernd. »Was Sie gesehen haben, ist das Material, das wir für die Präsentation vor den Investoren zusammengestellt haben.«
»Oh, schade!«, entfuhr es Sonja enttäuscht.
»Den neuen Bau kann man in den technischen Zeichnungen sehen«, ließ sich Katharina unvermittelt aus dem Hintergrund vernehmen. Ihre Großmutter schien keine Ahnung zu haben, wer sie war und dass es sie gab. Wie hatte sie das überhaupt denken können? Anna-Maria hatte Sonja ganz sicher keine Geburtsanzeige geschickt. 1968 – da war die Mutter schon über sieben Jahre aus der DDR fort.
»Das ist natürlich etwas ganz anderes als dieses wunderbare Bildmaterial.« Sonja schenkte Katharina ein Lächeln.
»Architektur muss in geometrische Abläufe und mathematische Gleichungen verpackt werden, die während der Bauarbeiten Stück für Stück Form annehmen, um dann als Gebäude für Jahrzehnte, vielleicht sogar für Jahrhunderte zu bestehen«, dozierte Paarmann. Er mochte es, ihrer Arbeit eine universelle Dimension zu geben.
»Das Adlon hat allerdings nur achtunddreißig Jahre gestanden, bis weite Teile abgebrannt sind«, hielt Sonja dagegen. »Danach war das mondäne Hotel nur noch ein Schatten seiner selbst.«
Paarmann lehnte sich in seinem Stuhl zurück, verschränkte die Arme hinter dem Kopf und fragte neugierig:
»Wie konnte ein Mann wie Lorenz Adlon keinen Geringeren als den deutschen Kaiser dazu bringen, ihn beim Bau eines Luxushotels zu unterstützen? Soweit mir bekannt ist, haben die notwendigen Genehmigungen wie der Abriss des Vorgängerbaus Palais Redern und die für diese Zeit ungewöhnlich sachliche Fassadengestaltung des Hotels nur wenige Monate gebraucht, um von Seiner Majestät persönlich bewilligt zu werden.«
»Für die Genehmigung des Märchenbrunnens im Volkspark Friedrichshain hat Wilhelm II. dreizehn Jahre gebraucht«, fügte Heller an.
»Ja, ein Brunnen fürs Volk ist was anderes als ein Grandhotel.« Sonja lachte. »Das ist doch heute nicht anders, oder?«
Sie provoziert im gleichen Ton wie Anna-Maria, dachte Katharina amüsiert.
»Lorenz Adlon hat sich aus einfachsten Verhältnissen hochgearbeitet«, ergriff Heller Partei für den Hotelier.
»Vom Tischler zum Millionär. Zu denken, das können nur die Amerikaner, ist ein Irrtum. Jedenfalls haben sich unsere Gründerzeitväter keine Beschränkungen auferlegt und mit großer visionärer Kraft ihr Imperium aufgebaut.«
Sonja dachte an das Lieblingsthema ihres Großvaters.
»Im ersten großen Krieg, als um uns herum alles zusammenbrach, hat Gustaf Schadt immer wieder über die Zeit erzählt, als Lorenz Adlon sein Grandhotel im Herzen Berlins aufbaute, und er ihn dabei unterstützen durfte …«
3. Kapitel
In den Speichen der dahineilenden Räder fing sich das Sonnenlicht. Zwei Droschken fuhren durch die Straße Unter den Linden. In der ersten Droschke saß der fünfzigjährige Lorenz Adlon im hochgeschlossenen schwarzen Mantel, auf dem Kopf trug er würdig einen Zylinder. Dahinter folgte die zweite Droschke mit vier Livrierten. Ihre Gesichter waren ernst, als wären sie sich bereits der historischen Tragweite ihres Auftrags bewusst.
Die Droschken hielten vor dem Tor des Berliner Stadtschlosses. Auf den Wink eines wachhabenden Leutnants öffneten die Soldaten eilig das Tor. Die beiden Wagen fuhren hinein und hielten nur eine Armlänge vom Portal entfernt. Die vier Livrierten sprangen heraus und entluden im Laufschritt ein Wunderwerk von Torte, das Modell eines Gebäudes in Safrangelb und Pistaziengrün mit einem Dach aus Schokolade.
Adlon entstieg dem Wagen. Auf sein Handzeichen schulterten seine Bediensteten das silberne Tablett und marschierten hinter ihrem Patron ins Schloss.
Aus den Fenstern schauten die Damen und Herren des Hofstaates … Impertinent! … Fabulös! … Der Adlon soll ja Millionen gemacht haben mit seinen Eisbechern! … Eis in Bechern! … Und seine Köche kommen aus Frankreich! …
Die kleine Prozession gelangte in den Audienzsaal. Dort stellten die Livrierten das exquisite Gebilde auf dem Besprechungstisch ab, vor dem der Hofstaat wartete. Ein weiteres Mal öffnete sich die Flügeltür, und Kaiser Wilhelm II. betrat den Raum.
»Ihre Majestät wollten ein Modell sehen.« Adlon machte eine großartige Geste. »Dieses Haus wird Berlin verändern.«
Kellner zauberten silbernes Besteck hervor, deckten Teller auf, arrangierten bestickte Servietten und zückten blitzende Messer und Tortenheber, während der Souverän um das Wunderwerk herumschritt. Alle hielten den Atem an. Der Kaiser griff nach einem Löffel, stach mitten hinein in die safrangelbe Sahne. Den Löffel schon im Mund, hielt er plötzlich inne.
»Aber das ist ja kalt. Eiskalt!«, stöhnte er.
Hofstaat und Lakaien erstarrten.
Lorenz Adlon behielt die Fassung. Er trat sogar einen Schritt näher an den Kaiser heran.
»Eine Kreation aus Sahneeis.«
Des Kaisers persönlicher Adjutant erklärte beflissen: »Seine Majestät müssen wissen, dass der Adlon sein Geld mit Eis gemacht hat.«
Der Kaiser winkte ab. Es war ihm bekannt, dass Lorenz Adlon ein Kaffeehaus auf den Zooterrassen führte. Mit großem Erfolg. Doch hier handelte es sich um keine gewöhnliche Torte. Das Kunstwerk aus Eiscreme war ein Modell. Dieser Adlon scheut keine innovative Idee, um mir zu gefallen, dachte der Kaiser und begann, die schmelzende Süßigkeit zu genießen, weil nun auch seine Zähne bereit dazu waren.
»Formidable! Adlon, ganz ausgezeichnet.« Seine Majestät naschte wie ein Kind. »Und das soll also Sein Hotel werden, Adlon?«
»Wir werden Berlin mit einem Haus ausstatten, das allerhöchsten Ansprüchen genügt.«
»Wir übertreffen London?«, fragte Wilhelm II. und dachte an seine verstorbene Tante Queen Victoria und ihr Ritz am Piccadilly.
Adlon nickte selbstbewusst und gratulierte sich insgeheim zu seinem Instinkt, der ihn zu diesem Spektakel inspiriert hatte.
»Wir übertreffen das Waldorf Astoria in New York?« Wilhelms Stimme klang kühn.
»Mindestens dreihundert Betten, fließend warmes und kaltes Wasser, Fahrstühle, Staubsaugersystem, Zentralheizung und natürlich die Suiten für die Gäste Ihrer Majestät. Französische Küche ganz selbstverständlich«, entgegnete Adlon.
Der Kaiser schluckte bei dem Gedanken an gutes Essen und drohte spielerisch mit dem Finger.
»Er will ein Haus errichten, das mein Stadtschloss in den Schatten stellt?«
»Ich werde ein Haus errichten, das die Hauptstadt Ihrer Majestät in höchstem Glanz erstrahlen lässt.«
Der Kaiser schlug Adlon auf die Schulter.
»Mein Schloss ist eine Bruchbude. Hier ist es kalt. Es zieht.« Er wandte sich an seinen Hofstaat. »Wer hat kein Rheuma?«
Klagende Gesichter. Sie kränkelten alle. Womöglich aber nicht von der Kälte im Schloss, sondern vom Nichtstun und vom Überdruss.
»Baue Er das beste Haus am Platze, Adlon«, befahl Wilhelm II. begeistert und gab seine Eistorte mit einer Handbewegung für die Damen und Herren des Hofes frei. Die stürzten sich auf die kühle Köstlichkeit und pikten mit dem Finger in die Stücke, die sie haben wollten.
»Wo soll Ihr Haus denn stehen? Ich will zu Fuß rüberkommen«, raunte Seine Majestät Adlon ins Ohr.
»Es gibt nur einen Platz, der diesem Haus angemessen ist. Der Pariser Platz.«
»Wo will er denn da bauen? Ist doch alles schon voll am Brandenburger Tor.«
»Ich dachte an die Stelle von Palais Redern …«
Adlon wusste, dass er jetzt zum Höhepunkt seiner Darstellung vorstieß. Die nächsten Minuten würden alles entscheiden.
»Unverkäuflich, Adlon!«, schnarrte der Kaiser.
Lorenz Adlon verneigte sich untertänig, um sich sofort wieder zu voller Größe aufzurichten.
»Es geht nur dort.«
Den Leuten des Hofes stand der Mund offen vor so viel Impertinenz.
»Er will das Gebäude einreißen, das Meister Schinkel gebaut hat? Lieber Adlon, er hat mich schon weit gebracht, aber hier kann und darf ich nicht zustimmen. Seiner Denkmalbehörde ist auch ein Kaiser verpflichtet.«
Adlon deutete wiederum eine Verneigung an.
»Das Palais Redern sanieren, um darin ein Hotel unterzubringen? Ihre Majestät werden verstehen, dass dies unserer Vision keinesfalls angemessen ist.«
Der Kaiser atmete hörbar aus. »Finde Er ein anderes Grundstück, Adlon, und bringe Er mir dann die Pläne.«
Seine Majestät beendete die Audienz und verließ den Saal.
Das Hotel aus Eis wankte. Ein erstes süßes Rinnsal floss über den Rand des Tabletts auf das Parkett. Die Fassade sackte in sich zusammen.
»Natürlich ließ sich Lorenz Adlon nicht von seinem Konzept abbringen.«
Sonja machte eine Pause, trank einen Schluck Kaffee und sah in die Gesichter der Architekten und in das ihrer Enkelin. Sogar Laura, die frischen Kaffee gebracht hatte, war an der Tür stehen geblieben und lauschte der Erzählung.
Ein paar Tage nach dem ersten Gespräch ließ der Kaiser Lorenz Adlon zu sich rufen. Diesmal standen sie im Salon neben dem Thronsaal. Adlon nahm die intimere Situation zufrieden wahr. Wilhelm II. ging unruhig auf und ab.
»Eine marode Florentinische Fassade erhalten oder Platz schaffen für das Moderne? Das geht mir nun nach Seinem letzten Besuch nicht mehr aus dem Kopf.«
»Soweit mir bekannt ist, wollte Ihre Majestät das Brandenburger Tor umbauen lassen als Symbol einer neuen Weltzeit. Davor, auf dem Pariser Platz, könnte das Grandhotel seiner Weltstadt stehen.«
Der Kaiser schwieg. Adlons Vorschlag war so verführerisch wie seine Eistorte.
»Wir haben jede Möglichkeit, die Gesetze zu verändern. Schließlich geht es hier ums Prinzip!«, sinnierte der Kaiser.
»Alles ist eine Frage des Prinzips. Und nur ein Kaiser kann über Prinzipien entscheiden«, stimmte Adlon zu.
Wilhelm II. schaute den Hotelier verblüfft an. Der Mann hatte recht. Er war der Kaiser. Er legte die Prinzipien fest.
»Schreiben Sie«, wandte er sich an seinen Sekretär, »der Redern soll seine Vermögensverhältnisse offenlegen. Wenn er nicht sanieren kann, steht meine Entscheidung fest. Abriss! Punktum!«
Sonja hatte die Geschichte so bildhaft erzählt wie einstmals Gustaf Schadt. Alle hofften, dass sie fortfahren würde. Und das tat sie.
»Während sich Lorenz Adlon in jenem Frühling 1904 seinen Lebenstraum zu erfüllen begann, wurde ich geboren.«
4. Kapitel
»Pressen … du musst pressen!«
Ottilie hatte die Ärmel ihres Kleides hochgeschoben, stützte den Kopf ihrer Tochter und gab unerbittlich Kommandos.
Galla, das schwarze Dienstmädchen, kam mit einer Kanne heißen Wassers und goss es für die Hebamme in eine Schüssel. Voller Mitgefühl schaute sie auf Alma, die unter Schmerzen stöhnte. Die Fünfzehnjährige begriff nicht wirklich, was mit ihr geschah, doch sie tat ihr Bestes, um dem Kind, das aus ihrem Leib wollte, die Freiheit zu geben.
»Nicht nachlassen. Pressen!«, forderte die Mutter.
Die fünfunddreißigjährige Ottilie hatte Schweißperlen auf der Stirn.
Galla beugte sich über Alma, die sie seit ihrem zehnten Lebensjahr kannte.
»Atmen nicht vergessen, Alma, kräftig atmen«, riet sie leise, wie sie es als Kind gehört hatte, wenn die Frauen in ihrem Dorf auf dem Boden der Hütten ihre Kinder bekamen.
Alma klammerte sich an das Lächeln ihrer schwarzen Dienerin und brachte mit einem Schrei ein Mädchen zur Welt.
Ottilie beobachtete, wie Galla ihrer Tochter das Gesicht abtrocknete, wie die Hebamme das Kind wusch und wickelte und das Dienstmädchen die blutigen Laken abzog und in einem Korb verstaute, um das Bett wieder frisch zu beziehen.
Ottilie wusch sich die Hände und dachte daran, dass in wenigen Minuten nichts mehr von dem Malheur zu sehen sein würde, außer dem Kind. Die Hebamme kam und legte ihr den Säugling in den Arm. Sie schaute auf das zerknautschte Köpfchen, auf die rosigen Hände, auf den kleinen Mund, der schon die Brust zu suchen begann.
»Es ist ein Mädchen, Alma.«
»Darf ich es sehen?«
Ottilie beugte sich zu ihrer Tochter, die erschöpft im frischen Bett lag, ließ sie einen Blick auf ihr Kind werfen und sagte dann sanft:
»Jetzt ruh dich aus.«
Benommen ließ sich Alma zurück in die Kissen fallen.
Ein paar Zimmer weiter bettete Ottilie das Neugeborene in eine Wiege, die in einem perfekt eingerichteten Kinderzimmer stand. Das winzige Mädchen schaute sie aus großen blauen Augen an, als erforsche es Ottilies Absichten.
Es klopfte. Das Dienstmädchen kam.
»Die Amme ist da, gnädige Frau.«
Ottilie drehte sich um. An der Tür knickste eine junge Frau, üppig, mit großen Brüsten.
»Sie werden meine Tochter stillen, wenn sie Hunger hat. Ich möchte kein Geschrei im Haus«, befahl Ottilie. »Alles bleibt so friedlich, wie es ist.«
Die Amme schaute die Herrin überrascht an.
»Denken Sie nur über die Dinge nach, die mein Kind betreffen.«
Die Amme verstand und nickte wortlos.
Es war tief in der Nacht, als Alma erwachte. In der Ferne glaubte sie das feine Stimmchen ihres Kindes zu hören. Nur den Hauch eines Augenblicks, dann war es wieder still. Ohne sich darüber Gedanken zu machen, ob ihr geschundener Körper das schon aushalten konnte, stand Alma auf und tappte barfuß aus dem Zimmer. Der lange Flur im ersten Stockwerk der Villa lag leer und verlassen, ganz anders als am Tage, wenn die Dienstboten treppauf und treppab liefen und alles für sie und die Mutter richteten. Der Vater war die meiste Zeit des Jahres auf Reisen. Gustaf Schadt verdiente sein Vermögen mit dem Handel in den deutschen Kolonien. Kaffee, Kakao, Nüsse, Trockenobst, exotische Gewürze, tropische Hölzer und Elfenbein schaffte er nach Deutschland, um die Waren hier teuer zu verkaufen.
Am Ende des Flurs in einem der ehemaligen Gästezimmer sah Alma einen schwachen Lichtschein. Dort hatte die Mutter das Zimmer für ihr Kind eingerichtet. Die Tür war nur angelehnt. Alma schob sie vorsichtig auf und sah eine fremde Frau, das Neugeborene an ihrer Brust.
Die Amme schreckte auf, als sie das Mädchen im Türrahmen stehen sah. Der Säugling verlor die Brust und begann zu wimmern. Routiniert schob die Amme dem Kind die Brustwarze zurück in den Mund.
»Sie sollten schlafen, Fräulein«, sagte sie abwehrend, als sie Almas Blick bemerkte. »Ich kümmere mich um Ihr Schwesterchen.«
»Aber es ist doch …«, stammelte Alma.
Die Amme wollte nichts hören.
»Machen Sie mir keinen Ärger, Fräulein, und gehen Sie zurück ins Bett.«
Alma war erschüttert. Das Kind, das sie vor wenigen Stunden unter Schmerzen auf die Welt gebracht hatte, lag in den Armen einer anderen Frau und schien ihre, Almas, Nähe nicht einzufordern.
»Es wird der Kleinen an nichts fehlen«, versicherte die Amme.
Benommen tappte Alma zurück in ihr Zimmer, legte sich ins Bett, das noch warm war, und begann zu weinen.
Am nächsten Vormittag kam Galla mit dem Frühstück und der Nachricht, dass Ottilie dem Mädchen einen Namen gegeben hatte. Sonja, nach ihrer eigenen Mutter.
»Soll ich Friedrich Bescheid geben?«, flüsterte Galla.
Alma nickte, wieder kamen die Tränen. Galla streichelte ihr übers Haar und summte die ersten Takte eines afrikanischen Wiegenliedes.
Ein paar Tage später verließ Alma das Kindbett. Ottilies Macht war so groß, dass die Tochter nicht wagte, den Anordnungen der Mutter zu widersprechen. Alma musste ihr normales Leben fortsetzen. Die Hauslehrer, die in den letzten Wochen ihrer Schwangerschaft mit der Begründung abbestellt worden waren, dass Alma krank sei, kamen nun wieder täglich, um sie in Geschichte, Literatur, Englisch und Französisch zu unterrichten.
Ottilie lebte weiter wie bisher. Sie lag bis spät am Vormittag im Bett und las einen ihrer umfangreichen Romane, die jeden Monat mit der Post kamen.
Alma traf die Mutter erst zum gemeinsamen Mittagessen. Bei Tisch ging die Konversation stockend. Sie hatten sich nur wenig zu sagen. In den ersten Tagen nach der Geburt des Kindes wollte Alma das Gespräch auf ihren Wunsch bringen, Sonja selbst zu versorgen.
Doch Ottilie ließ sie gar nicht erst zu Wort kommen.
»Ich werde dafür sorgen, dass Papa nicht schimpft und wir alle unseren Frieden haben.« Damit war das Thema für sie abgeschlossen.
Alma grübelte, was zu tun wäre, wohin sie mit ihrem Kind fliehen könnte. Friedrich, seine Eltern und seine Geschwister waren über Nacht aus der Remise, wo sie all die Jahre gewohnt hatten, rausgeschmissen worden. Friedrichs Mutter hatte die Wäsche für die Schadts gewaschen, und sein Vater arbeitete als Gärtner. Und nun gab es Familie Loewe nicht mehr, und es durfte nicht über sie gesprochen werden – so lautete Ottilies Befehl, an den sich alle hielten.
Inzwischen hatte Alma einen Brief von Friedrich bekommen:
»Meine liebste Alma, vielen Dank für Deine Nachricht, die mir Galla überbracht hat. Es ist also ein Mädchen mit dem Namen Sonja. Wie gern möchte ich sie sehen. Bitte lasse mir über Galla Bescheid geben, wenn es Dir besser geht und ich Dich besuchen kann. Habt Ihr schon wieder einen neuen Gärtner? Ist unsere Remise wieder bewohnt? Sonst könnten wir uns dort treffen und alles besprechen. Dein Friedrich«
Friedrich Loewe war kaum älter als Alma. Die beiden waren gemeinsam aufgewachsen. Bei Familie Loewe fand Alma die Fürsorge und Wärme, die sie von ihren Eltern nicht bekam. Friedrichs Mutter zeigte ihr, wie man eine Suppe kochte, ließ sie die Nähmaschine ausprobieren und ein Tuch umsäumen. Vater Loewe mochte die Freundschaft seines Sohnes mit der Tochter des Hauses nicht. Doch er war kein Mann, der Verbote aussprach.
Ottilie hatte keine Ahnung, wie die heranwachsende Tochter ihre Tage verbrachte, was sie brauchte, wonach sie suchte. Alma und Friedrich verbargen ihr Spiel mit der Liebe sowohl vor seinen Eltern als auch vor Ottilie und der Dienerschaft. Selbst Galla bemerkte weder, dass die junge Herrin ihre Unschuld verloren hatte, noch die ersten Zeichen einer Schwangerschaft. Auch Alma verdrängte das Spannen in den Brüsten und die wachsende Wölbung ihres Bauches.
Ottilie, die der Entwicklung ihrer Tochter bis dahin keine besondere Beachtung geschenkt hatte, fiel eines Tages auf, dass Alma üppiger geworden war. Ihre Tochter wurde also eine Frau, stellte Ottilie fest. Eines Morgens überraschte sie die Tochter im Badezimmer. Da war Alma schon im siebten Monat. Zuerst flog eine Ohrfeige, dann wurde sie in ihrem Zimmer eingeschlossen. Eine Hebamme kam und untersuchte das junge Mädchen, um festzustellen, dass es nur noch wenige Wochen bis zur Geburt eines Kindes waren. Ottilie musste nicht lange überlegen, wer der Vater war. Zornig schickte sie Galla als Einzige, der sie in der Situation vertraute und die um die Umstände wissen durfte, in die Remise, um die Loewes fristlos zu entlassen. Alma und Friedrich hatten nicht einmal mehr Gelegenheit, sich zu verabschieden. Seitdem verwilderte der Garten.
Das schadtsche Anwesen lag südlich des Brandenburger Tors neben anderen prächtigen Villen. Der hintere Teil grenzte an den Tiergarten. Ottilie und Alma standen am Fenster und beobachteten, wie die Kutsche über die polierten Buckel der Pflastersteine in den Innenhof der Villa rollte. Als der Wagen hielt, verließen Mutter und Tochter den Salon und durchquerten die Halle bis zur großen Eingangstür. Davor hatte sich die Dienerschaft aufgebaut. Der Kutscher öffnete dem Herrn, der über ein halbes Jahr auf Reisen gewesen war, die Wagentür. Gustaf Schadt, ein Mittfünfziger mit Backenbart und Mittelscheitel im immer noch üppigen Haar, schälte sich aus der Kabine, reckte sich nach der langen Reise und richtete sich zu seiner stattlichen Größe von fast einem Meter neunzig auf. Dann pfiff er nach einem vielleicht zwölfjährigen afrikanischen Jungen, der neben dem Kutscher gesessen hatte.
Zwischen den Bediensteten stand Galla. Ihr Herz machte einen Sprung. Der Herr hatte sein Versprechen gehalten! Der Kleine sah die farbige Dienerin an, überrascht, in dem kalten und fremden Land auf seinesgleichen zu treffen. Gustaf griff ihn am Ärmel und erklärte für alle, vor allem aber in Gallas Richtung:
»Das ist Tawonga. Er wird als mein Butler arbeiten.«
Er gab dem Jungen eine Kopfnuss und schob ihn zu Galla.
»Macht euch bekannt. Es wird deutsch gesprochen. Galla, du bringst es ihm bei.«
»Sehr wohl, gnädiger Herr.«
Galla knickste überglücklich. Sie würde den Jungen über ihre Heimat ausfragen, vielleicht kannte er sogar ihre Familie.
Alma stand neben ihrer Mutter bereit, den Vater zu begrüßen. Wie sehr hatte sie diesen Tag gefürchtet. Was würde sie dafür geben, einfach zu verschwinden. Sie hielt den Blick auf die Spitzen ihrer Schuhe gerichtet, auf deren blauem Samt sich ein wenig Staub abgesetzt hatte.
Gustaf machte sich den Spaß, Ottilie vor der Dienerschaft besitzergreifend in den Arm zu nehmen und aus seiner Lust nach Monaten der Abwesenheit kein Hehl zu machen. Dann wandte er sich seiner Tochter zu.
»Mausebär, lass dich anschauen. Bist ja erwachsen geworden und noch hübscher.«
Er griff der Tochter unters Kinn. Alma machte auf dem Absatz kehrt und rannte ins Haus. Irritiert drehte sich Gustaf nach seiner Frau um.
»Was hat sie denn?«
Ottilie schob ihre Hand unter seinen Arm und bedeutete ihm, mit ihr hineinzugehen.
Als die Eltern ins Haus traten, saß Alma am Klavier und spielte eine Nocturne von Chopin. Je mehr Zeit vergangen war, desto größer war auch Almas Abstand zu ihrem Kind geworden. Sie wusste wohl, dass die Kleine ihre Tochter war, doch sie fühlte es nicht mehr und floh aus der Realität in stundenlanges Klavierspiel. Vielleicht muss der Mensch Schmerzen empfinden, um sich selbst zu spüren, dachte sie und griff schräg in die oberste Oktave. Schrill knallte die Dissonanz in den Raum, und sie genoss die Tränen, die über ihre Wangen, ihr Dekolleté und auf ihre Hände tropften.
Gustaf stand vor dem Kinderbett und schaute auf das fremde Wesen.
»Deine Tochter wollte das Malheur nicht wahrhaben, hat es unter ihren Kleidern versteckt«, sagte Ottilie in angespannter Erwartung, wie ihr Mann die Entscheidung, die sie hinter seinem Rücken getroffen hatte, aufnehmen würde. »Als ich es dann bemerkt habe, war es zu spät.«
Ottilie wusste, dass sie ihm keine Zeit lassen durfte. Je schneller sie ihm ihren Plan vortrug, desto größer war die Möglichkeit, dass er ihn schluckte.
»Wer ist denn der Vater?«
Schadt war um Orientierung bemüht. Wer konnte seiner Tochter das angetan haben? Was war jetzt von ihm gefordert? Er hätte sich nach der langen Reise weiß Gott etwas Besseres vorstellen können.
»Der Sohn vom Gärtner.«
»Der Friedrich? Ja, kann der denn schon?« Gustaf sah seine Frau verblüfft an. »Der ist doch noch ein Kind.«
Zumindest war es ihm so erschienen, als er Anfang des Jahres nach Afrika aufgebrochen war.
»Ich habe die Leute entlassen.«
»Wer weiß von der Sache?« Gustafs Ton wurde schärfer.
»Alle!« Ottilie ging zu einem Sessel und holte eine Zeitung unter einem bestickten Kopfkissen hervor, die sie dort für diese Unterredung deponiert hatte. Die Annonce nahm durch die Größe der Lettern fast eine halbe Seite ein.
GUSTAF SCHADT UND GATTIN GEBEN DIE GEBURT IHRER TOCHTER SONJA BEKANNT.
»Ich war dieses Frühjahr unpässlich und habe mich kaum in der Gesellschaft gezeigt.« Ottilie schaute ihrem Mann offen in die Augen. »Dann habe ich mich einmal … es war schon sehr peinlich«, sie machte eine Geste für einen dicken Bauch, »so in die Stadt fahren lassen zu einem unserer Vereinstreffen. Ich habe ein paar Scheine in die Sammelbüchse geworfen und bin wieder von der Bildfläche verschwunden. Du hättest ihre Gesichter sehen sollen. Aber«, sie triumphierte, »es hatte seine Wirkung. Alle haben mir die Schwangerschaft geglaubt.«
Das Baby begann zu weinen. Ottilie holte es aus der Wiege, ging ein paar Schritte und wippte es hin und her. Sie hoffte, dass sie ihren Mann berühren konnte, so wie damals, als sie junge Mutter gewesen war, und Alma ihr Spielzeug, mit dem sie vor seinen Augen poussierte.
Schadt war nach der langen Reise immer noch nicht ganz anwesend. Er entschied sich für Ruhe und Bequemlichkeit. Was sollte er sich einmischen, wenn seine Frau schon alles bedacht und organisiert hatte? Er trat näher und tippte mit dem Zeigefinger auf das Kind.
»Bist ja ein süßer Fratz, was!«
Ottilie rief erleichtert nach der Amme, die vor der Tür gewartet hatte, übergab ihr das Kind und verließ mit ihrem Mann das Zimmer.
Der Vater trat in den Salon. Alma spielte weiter. Tawonga folgte seinem Herrn mit einer Reisetasche, die ihn fast zu Boden zog.
»Stell sie auf den Tisch am Fenster«, befahl Gustaf und zeigte, was er meinte. Der Junge verstand und setzte sich dann mit gekreuzten Beinen auf den Boden.
»Stell dich gerade hin!«
Gustaf hob den Jungen am Ohr hoch und richtete ihn aus. Dann trat er zu seiner Tochter.
»Na, Mausebär, willst du deine Geschenke sehen?«
Alma brach ihr Spiel ab. Schadt beugte sich zu ihr herab und raunte verschwörerisch:
»Der Papa ist im Bilde.«
Alma wusste nicht, ob sie erleichtert sein sollte. Gustaf begann auszupacken. Zuerst einen Zulu-Speer, dann eine Maske aus Holz, die er sich vors Gesicht hielt, um seine Tochter zu erschrecken. Als Alma nicht reagierte, legte er sie zum Speer, holte ein Säckchen mit Kakaopulver hervor und rief nach Galla. Sie kam eilig.
»Lass für unsere Alma in der Küche eine heiße Schokolade machen, damit sie wieder gut mit ihrem Papa ist, der sich so auf zu Hause gefreut hat.«
Galla nahm den Kakao und ging wie befohlen.
Gustaf zauberte eine Kette aus Halbedelsteinen hervor und wollte sie seiner Tochter um den Hals legen. Abrupt stand Alma auf, entzog sich ihrem Vater und verließ den Salon. An der Tür stieß sie mit der Mutter zusammen.
»Alma!«, empörte sich Ottilie. »Komm sofort zurück!«
Doch Alma lief weiter, die Treppe hoch, schloss die Tür ihres Zimmers und lehnte sich dagegen. Sie musste hier weg. Jetzt war es ihr klar geworden.
»Ich habe doch nichts falsch gemacht?«, fragte Gustaf hilflos und legte die Kette für die Tochter zu den anderen Geschenken auf dem Flügel.
»Sie hat sich noch nicht von dem Schock erholt«, erwiderte Ottilie kühl und betrachtete die Dinge, die ihr Mann für die Tochter aus Afrika mitgebracht hatte.
Gustaf wusste, dass auch seine Frau endlich ein Geschenk erwartete.
Er griff ihre Hand, küsste sie und steckte ihr einen Diamantring von beträchtlicher Größe an den Zeigefinger, weil die Ringfinger bereits belegt waren.
»Ich habe den Stein einem Stammeshäuptling abgeschwatzt und in Amsterdam schleifen lassen.« Gustaf lachte zufrieden. »Meine Liebe, das hast du großartig gemacht, werden wir noch mal Eltern auf unsere alten Tage.«
»Ich finde, dass uns das Kleine jung hält«, sagte Ottilie kokett und betrachtete den kostbaren Stein im Licht der Abendsonne, die sich zwischen den schweren Vorhängen in den Salon schob.
»Das Kind ist dir großartig bekommen.« Gustaf fasste seiner Frau an den Hintern. »Nach fast zwanzig Jahren Ehe werde ich mich wohl wieder in meine Frau verlieben.«
Ottilie kicherte wie ein junges Mädchen.
»Es sind doch erst sechzehn, Gustl«, berichtigte sie und war erleichtert, dass sich alles aufs Angenehmste fügte.
5. Kapitel
Ein paar Tage später fand ein Fest zu Ehren von Gustafs Rückkehr statt. Ab den frühen Morgenstunden hörte man Ottilies Befehle. Das gesamte Personal war mit der Vorbereitung beschäftigt. Am späten Nachmittag war alles gerichtet, und die Kerzen wurden angezündet. Das Haus erstrahlte in vornehmer Eleganz. Ottilie schritt ihr Werk ab. Die Gesellschaften, die sie in den wenigen Monaten, in denen Gustaf zu Hause war, gab, waren eine willkommene Abwechslung in ihrem sonst so eintönigen Leben.
Alma saß festlich gekleidet vor dem Spiegel. Galla bürstete ihr das lange Haar. Ottilie trat ein.
»Mach dich nur recht hübsch! Die Adlons kommen, und ich habe auch die Familie von Tennen eingeladen. Sie bringen ihren Sohn Siegfried mit.«
Ottilie begutachtete die Tochter. Alma zeigte keine Reaktion.
Die Gesellschaft bestand aus Lorenz Adlon und seinem Sohn Louis mit dessen Ehefrau Tilly, einer charmanten Österreicherin, dem Ehepaar Graf und Gräfin von Tennen und deren beiden Söhnen, dem achtzehnjährigen Siegfried und seinem zehn Jahre jüngeren Bruder Sebastian. Ottilie hatte Alma neben Siegfried von Tennen gesetzt. Der dünne Gymnasiast mit Pubertätspickeln im Gesicht erklärte ihr eifrig, dass er gerade seine Reifeprüfung ablege und danach in die Armee Seiner Majestät eintreten werde. Alma blieb schweigsam und war froh, als das Dessert gereicht wurde. Danach fand man sich im Salon zusammen. Alma erfüllte den Wunsch ihres Vaters und spielte in einer Klavierversion Beethovens Ode an die Freude.
Ottilie und Frau von Tennen – die beiden kannten sich aus dem Kolonialverein – warfen sich einen bedeutsamen Blick zu.
Alma beendete das Stück und bekam Applaus. Gustaf schnäuzte sich gerührt und verkündete:
»Wenn man wie ich den halben Erdball bereist, weiß man doch, dass wir Deutschen zur Bildung und Erziehung der Völker berufen sind.«
»Soweit mir bekannt ist, werden unsere Siedlungen neuerdings immer wieder von Negern angegriffen?«, wandte sich der alte von Tennen, Offizier der Kaiserlichen Armee, interessiert an Gustaf.
»Allerdings! Ich hoffe, dass Seine Majestät endlich mehr Truppen entsendet und einen guten Strategen, der die Situation beendet. Ich befürchte, dass wir hart durchgreifen müssen.«
Es ging Gustaf nahe, was er in Deutsch-Südwest erlebte, auch wenn er den Eingeborenen dafür die Schuld gab. Es kam ihm nicht in den Sinn, dass sie selbst es waren, die deutschen Kolonisten, die den Einheimischen ihre Lebensgrundlagen stahlen.
»Immerhin habe ich Galla und meinen Butler aus ihren armseligen Familien geholt und hierhergebracht«, brüstete sich Gustaf. »Man tut, was man kann, wenn man erst einmal in eine fremde Lebensweise involviert ist, die mit der unsrigen um Jahrhunderte differiert.«
»Aber auch den Deutschen müssen die Kolonien immer noch nahegebracht werden. Sie haben keine Ahnung, was unsere Männer in der Wildnis leisten«, gab Ottilie Gustafs Einschätzung recht. »Es müsste die Menschen doch interessieren, wie lange der Kaffee unterwegs ist, bis er in der Kanne aufgebrüht werden kann. Aber sie trinken ihn, als kämen die Kaffeebohnen aus unserer schönen Mark Brandenburg.«
Gustaf tätschelte seiner Frau den Arm, um ihr zu verstehen zu geben, dass sie das Thema nun nicht weiter vertiefen wollten. Er hatte in Afrika genug zu tun, die immer neuen Verordnungen der deutschen Behörden im Auge zu behalten und dabei die Nachfrage seiner Kunden nach Waren zu befriedigen. Und dann die Hitze, die Insekten, das schlechte Wasser, die Krankheiten – und schließlich auch noch die Eingeborenen. Gustaf mochte über all das an diesem Tag nicht mehr nachdenken. Mit einer Geste lud er die Männer in die Bibliothek zum Rauchen ein.
Ottilie führte die Damen in den Salon und befahl einem der Hausmädchen, Tee und Punsch zu servieren. Alma klappte den Deckel des Flügels zu und sah mit Erleichterung, dass sich Siegfried von Tennen, der sie die ganze Zeit nicht aus den Augen gelassen hatte, der Männerrunde anschloss. Der kleine Sebastian setzte sich brav zu den Frauen und spielte mit seinen Zinnsoldaten.
Alma stand auf und strich sich das Kleid glatt. Da niemand von ihr Notiz nahm, nutzte sie die Möglichkeit und verließ die Gesellschaft.
»Lieber Gustaf, ich bin froh, dass du wieder da bist, denn es warten große Aufgaben auf dich.«
Lorenz Adlon zündete sich bedächtig eine Zigarre an. Gustaf tat es ihm nach. Sie kannten sich seit ihrer Schulzeit in Mainz, wo sie beide armer Leute Kind gewesen waren. Über die Jahrzehnte hatten sie sich an die Spitze der Berliner Gesellschaft gearbeitet und genossen das Wissen um den Weg, den sie zurückgelegt hatten.
»Wozu willst du mich verdonnern?«
Gustaf trank einen Schluck vom Kognak, der weit mehr als den Boden seines Glases bedeckte.
»Ich brauche deine Mitarbeit bei meinem Hotel. Du musst mir erstklassige Materialien aus den Kolonien herbeischaffen. Mahagoni … Und dann wünsche ich mir luxuriöse Besonderheiten. Elfenbein und Intarsien aus Schildpatt.«
Gustaf lächelte geschmeichelt.
»Die Bauarbeiten am Pariser Platz haben bereits begonnen«, setzte Lorenz Adlon seine Rede fort. »Das Schinkelpalais ist entfernt. Ein paar Monate noch und die Fassade steht. Unser Kaiser hat von seinem Fassadenrecht Gebrauch gemacht und uns den Rücken gestärkt. Wir haben also die Genehmigung für eine vierte Etage bekommen. Ich verhandle gerade wegen des Zukaufs des Nachbargrundstücks Unter den Linden 2. Es ist zäh, aber aussichtsreich.«
Louis Adlon horchte auf, als sein Vater diese Neuigkeiten in die Runde warf, über die er nicht unterrichtet war.
Gustaf hob das Glas.
»Auf den großen Visionär unserer Hauptstadt.«
»Fast vierzig Jahre schon trage ich mein Hotel im Kopf herum. Da werde ich keine Kompromisse machen«, verkündete Lorenz mit entschlossener Selbstgewissheit. Alle hoben ihr Glas und tranken. Louis beließ es bei der Geste.
»Ein Genie, Ihr Herr Vater«, wandte sich Gustaf nun an den Sohn und reichte ihm die Schachtel mit den Zigarren. »Und Sie führen die Geschäfte indes im Continental?«
Louis wollte gerade antworten, als ihm der Vater ins Wort fiel.
»Wenn mein Herr Sohn nicht gerade im Tiergarten ausreitet.«
»Du folgst deinen Leidenschaften, Vater. Ich folge den meinen.«
Gustaf bemerkte die Spannung zwischen Vater und Sohn und wechselte das Thema:
»Die Afrikaner machen Likör aus den Früchten des Marula-Baums, auch Elefantenbaum genannt.«
Er stand auf und ging zu einem Wagen mit Schnäpsen.
»Ich muss euch das zum Probieren geben.«
Gustaf bedeutete seinem Hausdiener, Gläser herbeizuschaffen, und entkorkte persönlich die Flasche.
Tilly im Salon nebenan wurde auf das Gespräch der Männer aufmerksam. Ein Blick zu Louis sagte ihr, dass der Schwiegervater ihren Mann wie so oft in Gesellschaft brüskierte.
»Und dass er dann noch diese Neger mitbringen muss«, beklagte Ottilie Gustafs Enthusiasmus. »Als wenn ich nicht schon genug Sorgen hätte. Sie können sich nur schwer an die deutschen Verhältnisse gewöhnen. Außerdem muss man immer befürchten, dass sie krank werden.«
Ottilie nippte geziert an ihrer Tasse Tee.
»Aber lassen wir das Thema. Sie müssen sich damit nicht auseinandersetzen«, wandte sie sich zuerst an Frau von Tennen und dann an Tilly.
»Wie geht es denn Ihrem Susannchen?«
Das erste Kind von Louis und Tilly Adlon war nur ein paar Monate älter als Sonja.
»Sehr gut. Sie ist ein friedliches Kind.«
Tilly sprach mit dem weichen Akzent der Wienerin.
»Aber von mir aus könnt’ ich es gern bei dem Susannchen bewenden lassen. So ein Putzerl ist doch sehr anstrengend. Außerdem mache ich mir Sorgen um meine Figur. Der Louis ist ein Schöngeist. Ich will ihn nicht enttäuschen.«
Tilly schaute noch einmal zu Louis in der Männerrunde, der sich von seinem Vater und Gustaf Schadt abgewandt hatte und nun angeregt mit Oberst von Tennen plauderte.
»Mit Kindern hält man jeden Mann. Da darf auch die Figur ein wenig fraulicher werden«, sagte Ottilie.
»Sie haben aber auch keine Probleme«, entgegnete Tilly mit einem Blick auf Ottilies schlanke Gestalt. »So schnell wieder in Form nach der Geburt!«
Ottilie lächelte geschmeichelt. »Die Natur hat mich beschenkt.«
In diesem Augenblick glaubte sie sich selbst und war von dem Lauf der Dinge beeindruckt.