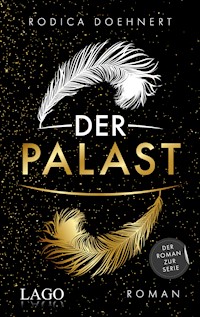Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Europa Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Der Besitzer des Hotel de l'Opera, das in wenigen Jahren Hotel Sacher heißen wird, stirbt. Ein elfjähriges Mädchen verschwindet in den Gassen Wiens. Zwei Paare, die unterschiedlicher nicht sein könnten, treffen im Foyer des Hotels aufeinander. Es ist die Nacht des 28. November 1892. In ihrem fesselnden Romandebüt lässt Rodica Doehnert, die mit dem TV-Dreiteiler Das Adlon. Eine Familiensaga ein Millionenpublikum begeisterte, erneut die Hallen eines legendären Hotels zum Schauplatz eines bewegenden Figurenreigens werden. Meisterhaft hebt sie den Vorhang zu einer Zeit, die längst vergangen scheint, erzählt vom Ringen ihrer Protagonisten nach seelischer Reifung und folgt ihnen durch den Niedergang der europäischen Monarchien in all die Widersprüche des 20. Jahrhunderts. Eine farbenprächtige Geschichte über die Sehnsucht nach Selbstbestimmung und die schöpferische Lust auf Erneuerung. Wien 1892: Anna Sacher will das Hotel nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes weiterführen. Resolut und gegen alle Widerstände erklimmt die junge Witwe den Platz der Prinzipalin: "I' bin der Herr im Haus!" Während Anna Sacher, Zigarre rauchend, umgeben von einer Schar Bullterrier und gemeinsam mit ihrem treuen Personal das Hotel zu einer Legende macht, begegnen sich zwei Paare: Der Prinz und die Prinzessin von Traunstein und das Berliner Verlegerehepaar Martha und Maximilian Aderhold. Ein Liebesdrama entspinnt sich zwischen den Suiten und Séparées des Hotels Sacher in Wien. Die Geschichte führt die Paare nach Gut Traunstein in Niederösterreich und ins Berlin der Jahrhundertwende. Gemeinsam mit ihnen erleben wir den Untergang einer alten Welt und den Übergang in die Moderne. Ein fesselnder Roman von der Sehnsucht nach dem einen anderen Menschen und der Suche nach dem Sinn des Lebens."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 359
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1. eBook-Ausgabe 2016
© 2016 Europa Verlag GmbH & Co. KG,
Berlin · München · Zürich · WienUmschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich,unter Verwendung zweier Fotos von © ullstein bild – Imagno / SammlungHubmann und © Petro Domenigg/FILMSTILLS.ATLayout & Satz: BuchHaus Robert Gigler, MünchenRedaktion: Carsten Schmidt
Konvertierung: Brockhaus/CommissionePub-ISBN: 978-3-95890-123-0ePDF-ISBN: 978-3-95890-124-7
Das eBook einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Alle Rechte vorbehalten.
www.europa-verlag.com
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Ich denke beim Schreiben an alle,die an dieser Geschichte mitgewebt haben.So wurde sie unsere gemeinsame.
Rezept für eine originale Sachertorte
140 Gramm weiche Butter wird mit 110 Gramm Staubzucker und dem Mark einer halben Vanilleschote cremig gerührt. Nach und nach rührt man sechs Eidotter ein und schlägt dies zu einer dickschaumigen Masse. Inzwischen sollte man 130 Gramm dunkle Schokolade im Wasserbad geschmolzen haben und ebenfalls unterrühren. Die sechs Eiklar werden mit 110 Gramm Kristallzucker steif geschlagen, bis der Schnee schnittfest ist. Dieser wird nun auf die Masse gehäuft, 140 Gramm Mehl darüber gesiebt und danach mit einem Kochlöffel untergehoben.
Die Springform ist inzwischen mit Backpapier ausgelegt, der Rand mit Butter eingefettet und mit Mehl bestäubt.
Hier hinein wird nun die gesamte Masse gefüllt, glatt gestrichen und im vorgeheizten Backrohr eine knappe Stunde bei 170 °C gebacken.
Während der ersten 10 bis 15 Minuten bitte die Backrohrtüre einen Spalt offen lassen! Die Torte ist fertig, wenn ein zarter Druck mit dem Finger sanft erwidert wird. Sodann in der Form stürzen und auskühlen lassen. Nach circa 20 Minuten Papier abnehmen, umdrehen und in der Form ganz kalt werden lassen. Aus der Form nehmen und mit einem Messer waagrecht teilen. Die mild erwärmte Marillenmarmelade glatt rühren, auf beide Tortenböden streichen und diese wieder zusammensetzen. An den Außenseiten ebenfalls mit Marillenmarmelade bestreichen und leicht antrocknen lassen.
Für die Glasur 200 Gramm Kristallzucker und 125 Milliliter Wasser 5–6 Minuten aufkochen, danach abkühlen lassen. 150 Gramm dunkle Schokolade im Wasserbad schmelzen, nach und nach mit der Zuckerlösung zu einer dickflüssigen, glatten Glasur verrühren. Die noch warme, aber nicht zu heiße Glasur in einem Zug über die Torte gießen und mit wenigen Strichen glatt verstreichen. Trocknen lassen, bis die Glasur erstarrt ist. Mit geschlagenem Obers servieren!
Die Sachertorte wurde 1832 von dem jungen Franz Sacher für den Fürsten von Metternich als Dessert kreiert. Metternich war ein Restaurator der Monarchie, ein Gegner jeder bürgerlich-liberalen Bewegung. Aber er war auch einer der Initiatoren des Wiener Kongresses 1814 bis 1815. Die teilnehmenden Staaten und ihre Vertreter begriffen die fundamentale Krise, die durch die Napoleonischen Kriege ausgelöst worden war, als Chance und setzten auf friedliche Lösungen. Diese Zusammenkunft der europäischen Mächte bewies, dass über alle nationalen und politischen Widersprüche hinweg kooperatives Handeln der Völker möglich war.
Es war ein erster gemeinsamer europäischer Versuch, die Krise des Kontinents mit den Mitteln der Vernunft und diplomatischer Verhandlungen zu lösen.
Hundert Jahre später siegte wiederum die irrationale Lust auf Zerstörung in einem gewaltvollen Krieg, an dessen emotionalen und politischen Folgen wir heute noch zu tragen haben.
Und doch!Wir hätten alles füreinander sein können.Alles.
PROLOG
Der Nebel senkte sich feucht über die Stadt. Im fahlen Licht der Gaslaternen zog er von der Donau über die Gassen und Plätze, über die unzähligen Baustellen, hüllte die Palais auf der Ringstraße ein, kroch den Kutschern der Fiaker unter die Mäntel und legte sich feucht und schwer auf die Hüte der Passanten.
Der Tod, geschmeidig, etwas zu dünne Glieder im schwarzen Anzug, eine erkaltete Zigarette im Mundwinkel, streifte umher, durchaus nicht ziellos.
Sie, die Liebe, bewegte sich kokett am Lärm und Schmutz der großen Stadt vorbei ins goldene Licht des Vestibüls im Hotel de l’Opera, das in wenigen Jahren »Sacher« heißen würde. Ihr luftiges Kleid schien für die Jahreszeit und für diesen Tag unangemessen.
Dies war der Abend des 22. November 1892. In dieser Nacht würden sie sich begegnen, nicht zum ersten Mal und nicht zum letzten Mal in dieser Stadt und an diesem Ort. Und immer trug ihre Begegnung Bedeutsames.
Während sie, die Liebe, auf einem der Sofas im Vestibül Platz nahm, sie hatte Zeit und würde warten, erklomm er, der Tod, mit einem geübten Schwung die kleine Mauer am Hintereingang und schwang sich hinauf zum ersten Stock des Hotels, wo der Patron, noch nicht einmal fünfzig, im Sterben lag. Die Grippe hatte ihm alle Kraft geraubt, um dieser Begegnung zu trotzen.
Vor dem Hauptportal hielt ein Fiaker, der den Vater des sterbenden Mannes vom Bahnhof brachte. Franz Sacher drückte dem Kutscher eilig das Fahrgeld in die Hand und betrat das Hotel, wo ihn der Portier ehrfürchtig begrüßte. Sacher senior nickte den Angestellten des Hauses zu, die aufmerksam wurden auf seine Ankunft, und ging eilig zur Treppe und hinauf.
Während sich der Tod an der Fassade entlanghangelte, um das richtige Fenster zu finden, fiel sein Blick auf das Mädchen, das, einen Topf mit Suppe fest an die Brust gedrückt, das Hotel durch den Hintereingang verließ. Marie Stadler hatte vier Stunden lang die Böden der Küche und der Patisserie gewischt. Dreimal in der Woche kam sie, um diese Arbeit zu verrichten. Mit dem Lohn trug die Elfjährige als ältestes von vier Kindern zum Lebensunterhalt ihrer Familie bei. Außerdem gab es jedes Mal einen Topf Suppe fürs Abendessen.
Der Tod erinnerte sich daran, dass die Kleine von ihm in Augenschein genommen werden musste. Vielleicht sollte er sich die Arbeit erleichtern und den Mann und das Kind in einem Gang hinüberbringen? Ein Zeitgewinn. Schließlich war diese Nacht dafür angetan, um die Dinge neu zu ordnen. Nun, die Kleine lief ihm nicht weg, er würde sich ihr jederzeit widmen können. Der Mann, Besitzer des Hotels, war wichtiger. Sein Tod würde von Interesse sein und Geschichte schreiben. Darum vor allem ging es in dieser Nacht.
Buch 1
»DER TOD«
1
Die Luft in der Patisserie war schwer von Zucker, Schokolade und Konfitüre. Anna Sacher, nur wenig über dreißig Jahre, sog den Duft ein. Die Süße gab ihr die Gewissheit, dem Sterben, das ihre Kindheit begleitet hatte, entronnen zu sein, den Todesschreien der Rinder und Schweine, der Kälber und Lämmer, die das morgendliche Schlachten begleitet hatten.
Anna verglich die gefertigten Torten mit der Zahl ihrer Bestellungen. Ein halbes Dutzend mussten noch hinüber in die Oper gebracht werden. Das Haus war ausverkauft, und in der Pause würde man der Torte zusprechen. Der Sachertorte, gefertigt aus Teig mit viel Kakao, reichlich Marillenmarmelade unter der Schokoladenglasur. Ein Rezept ihres Schwiegervaters. Als Anna sicher war, dass in der Küche alles reibungslos lief, entschloss sie sich, zu ihrem Mann zu gehen.
Die Liebe auf dem Sofa im Vestibül sah Anna kommen. Die Patronin richtete sich im Gehen das Kleid, das ihre sinnliche Figur betonte, und schaute mit Strenge in die fragenden Augen ihrer Angestellten. »Richten S’ alles, dass die Gäste keine Einschränkungen haben. Ich verlass mich auf Sie, Mayr«, war ein Befehl, den sie Mayr, dem Portier, als dem Marschall ihrer Truppe gab. Dann schritt sie die Treppe hinauf zu den privaten Räumen in der ersten Etage.
Die Liebe folgte ihr nicht. Sie strich mit der Hand über den glatten Stoff des Sitzmöbels und wartete.
Und da kamen sie. Martha und Maximilian Aderhold aus Berlin. Ein schönes Paar. Jung und wach. Er trug einen modischen Mantel und einen Hut, der einen Teil seines Gesichtes verbarg. Marthas schlanke Gestalt wurde durch einen nachtblauen Samtmantel mit aufwendigen Stickereien betont.
»Willkommen in Wien. Wir haben notiert, dass Sie auf Hochzeitsreise sind«, der Portier ließ mit keiner Miene erkennen, wie aufgewühlt er durch die Ungewissheit war, was nach dem Tod des Patrons mit dem Hotel und seiner eigenen Position geschehen würde. Möglicherweise würden die nächsten Stunden sein gesamtes Leben verändern.
Maximilian Aderhold legte den Arm um seine schöne Frau. Ein strahlendes Lächeln spiegelte den Besitzerstolz des Frischvermählten.
»Ich darf Ihnen die besten Wünsche des Hauses aussprechen. Wenn S’ die Formalitäten, bittschön.« Der Portier schob ihm den Meldezettel zu.
Martha Aderhold trat einen Schritt zurück und schaute sich in der Halle um. Bequeme Sitzmöbel standen auf schweren Perserteppichen. An der Wand ein Gobelin zeigte drei Nymphen im Spiel mit der Nacht. Das Parkett und die Wandtäfelung waren aus erlesenen Hölzern gefertigt. Darüber die Tapete war aus Stoff im kaiserlichen Rot mit eingewirkten Ornamenten.
Martha und Maximilian hatten ein paar Tage zuvor in Berlin den Verlag Aderhold gegründet. Nun wollten sie Schriftsteller finden und sie unter Vertrag nehmen. Wien schien ihnen dafür ein aufregender Ausgangspunkt zu sein.
Die Liebe sah hinüber zu der jungen Verlegerin aus Berlin und wusste, dass dies kein leichter Ritt werden würde. Sie betrachtete ihren Mann, Maximilian Aderhold, dessen Gesicht von einer hohen Stirn eingenommen wurde, die Stirn eines Künstlers, eines Menschen, der Großes gebären will.
Dann glitt der Blick der Liebe hinüber zur Treppe, wo die Prinzessin von Traunstein am Arm ihres Mannes, des Prinzen von Traunstein, auf dem Weg in die Oper herunterkam.
Die siebzehnjährige, ebenfalls frisch vermählte Prinzessin betrachtete Martha Aderhold überrascht, als erkenne sie eine gute alte Bekannte. Über Marthas Gesicht huschte nur ein flüchtiges Lächeln. Sie war viel zu sehr mit dem Ankommen beschäftigt, als dass sie sich hätte im Blick der Prinzessin spiegeln wollen.
Der Prinz von Traunstein grüßte die Aderholds mit einer höflichen Neigung des Kopfes und trat zum Portier. »Wie geht es dem Patron, Mayr?«, erkundigte er sich diskret und erkannte die traurige Antwort bereits im Blick des anderen. »Mein Bedauern«, murmelte er betroffen.
An der Tür zur Straße, die Seiner Durchlaucht Georg von Traunstein und der Prinzessin von einem Pagen aufgehalten wurde, hatte Traunstein den Impuls, sich noch einmal umzuwenden, um den Portier mit einem aufmunternden Blick zu trösten. Da sah er, wie sich Martha Aderhold den Hut abnahm. Sie tat es ohne Eitelkeit und wie nebenbei. Eine Welle dunklen Haares ergoss sich über ihre Schultern und hob ihre feinen Gesichtszüge hervor. Georg von Traunstein schaute sie fasziniert an. Martha Aderhold erwiderte seinen Blick überrascht. Dann war der Augenblick auch schon vorbei. Georg verließ mit seiner Frau das Hotel und Martha wandte sich ihrem Ehemann zu.
Die Liebe war nun in der vollständigen Gewissheit, dass es mit den vier Menschen ein Ritt durch den Sturm werden würde. Was hätte sie darum gegeben, eine Zigarette zu rauchen?
2
Eine Etage über dem Geschehen im Vestibül war inzwischen der Tod in das Zimmer eingetreten, in dem der Kranke lag. Sein kühler Atem legte sich über den Raum, so wie sich der Nebel über die Stadt gelegt hatte.
Anna Sacher kam. Ihr Schwiegervater, Franz Sacher, noch in Reisekleidung, ließ die Hand seines Sohnes vorsichtig aufs Deckbett gleiten und ging seiner Schwiegertochter entgegen. Sie küssten sich zur Begrüßung auf beide Wangen. Dann beugte sich Anna über ihren Mann.
»Ich werde die Enkel holen.« Franz Sacher verließ das Zimmer.
»Anna, meine liebe … Anna«, flüsterte der Sterbende. Es fehlte ihm schon an Atem.
»Im Haus geht sich alles aus, Eduard. Mach dir keine Sorgen.« Anna tupfte ihrem Mann den Fieberschweiß von der Stirn.
Der Tod saß im Lehnstuhl am Fenster und genoss die Stille.
Zwei Querstraßen vom Sacher entfernt stand ein Mann im Schutze eines Hauseingangs: kalte Augen, grobe, pockennarbige Haut.
Eine Kutsche kam in schneller Fahrt heran. Die dunkle Gestalt löste sich von der Hauswand. Ein Samtbeutel fiel direkt vor seine Füße. Der Mann in der Kutsche blieb im Dunkeln. Nur für einen kurzen Augenblick war seine Hand zu sehen und das Wappen eines Siegelringes: ein Geier mit zwei Köpfen.
Ohne ihre Geschwindigkeit zu verändern, fuhr die Kutsche vorbei. Die Gestalt griff sich den nachtblauen Beutel, wog ihn in der Hand und steckte ihn in die Tasche ihres Mantels.
Das Mädchen, Marie Stadler, ging schnellen Schrittes durch die Gasse. Ihr Blick war gesenkt. Die Wärme des Suppentopfes war ihr angenehm. Die Straßenlaternen zeichneten im Nebel milchige Lichtkegel.
Der Wagen, der die Traunsteins die wenigen Meter vom Hotel zur Oper brachte, fuhr an ihr vorbei. Einen flüchtigen Moment sah die Prinzessin von Traunstein das dahineilende Kind.
Marie dachte an die Münzen in ihrer Tasche, die sie von der Hausdame für ihre Arbeit erhalten hatte. Eine davon durfte sie behalten. Sie malte sich aus, wie sie das Geldstück in die Spardose stecken würde. Dann wären dort vierundsechzig. Noch vier weitere Wochen und sie konnte sich die Haarschleife kaufen, die sie im Schaufenster um die Ecke vom Hotel gesehen hatte.
Seit ihrem sechsten Lebensjahr arbeitete Marie. Zuerst hatte sie der Mutter bei der Wäsche geholfen, die sie für die Herrschaften wusch. Inzwischen war Marie groß genug für eigene Arbeit. In manchen Monaten verdiente sie mehr als die Mutter. Einem Kind brauchte man weniger zu zahlen. Und wenn ein Kind genauso viel wegschaffte wie eine Erwachsene, dann holte man das Kind eben gern zum Arbeiten.
Die Schritte hinter Maries Rücken wurden lauter. Sie roch Zigarettenrauch und ging näher an die Hauswand, um den Mann vorbeizulassen. Doch der blieb hinter ihr. Marie legte an Tempo zu. Ein wenig Suppe lief aus dem Topf und rann ihr über das Kleid und die Holzschuhe. Die Mutter würde schimpfen.
Plötzlich packte eine Hand ihre Schulter. Die andere verschloss ihr den Mund. Das Suppengefäß schepperte auf das Straßenpflaster. Die Brühe ergoss sich in den Rinnstein. Marie wehrte sich heftig. »Bist still jetzt, oder i’ bring dich um«, zischte der Fremde und drückte ihr Gesicht an seinen Hals. Sein Mantel roch muffig. Als er ihr ein mit Äther getränktes Tuch auf Mund und Nase pressen wollte, biss sie ihm in die Hand. Er schrie vor Wut und Schmerz auf, trug sie rasch auf die Hintertür eines Bordells zu, von denen es viele hier im Umkreis gab.
Die Luft im Haus war parfümgeschwängert. Auf der Stiege gelang es Marie, sich loszureißen. Halb benommen stolperte sie los, suchte eine Tür, verirrte sich. Der Fremde folgte ihr. Endlich fand sie einen Ausgang und stand in einem Gewölbe zwischen Wäsche, die auf Leinen hing. Marie spürte den kalten Hauch der Nachtluft. Hinter ihr war die Tür geöffnet worden. Der Verfolger und das Mädchen waren nur durch die Wäschestücke voneinander getrennt. Marie sah eine weitere Tür, lief darauf zu, griff in Todesangst nach der Klinke. Sie war offen. Dahinter war es stockfinster. Marie fiel ein paar Stufen hinab, rappelte sich hoch, tastete sich vorwärts. Hinter ihr wurde ein Streichholz angezündet, das wieder verlosch. Der kurze Lichtschein hatte genügt, ihr den Weg zu zeigen. Der Verfolger stolperte in der Dunkelheit, fluchte, zündete ein weiteres Streichholz an. Marie fand eine marode Holztür und rannte einen mit mattem Glühlicht beleuchteten Kellergang entlang. »Hilfe«, Marie versuchte zu schreien. Doch ihre Stimme brach vor Todesangst. Der Verfolger kam näher.
Der Notenwart der Oper wurde auf die Geräusche aufmerksam. Er war gerade damit beschäftigt, einen Satz Orchesterstimmen für die Probe am nächsten Tag zur Bühne zu bringen. Er hörte einen unterdrückten Schrei. Würtner ließ seinen Rollwagen mit den Noten stehen und ging zur Eisenstiege, die in den Keller führte. Vorsichtig lief er die Stufen hinab und sah einen Schatten an der Wand. Dann einen Mann, der ein Mädchen in seine Gewalt brachte. Würtner nahm die Verfolgung auf. Hier unten kannte er sich aus, nur noch ein paar Schritte bis zur Nische, wo die Feuerwehr ihre Äxte deponierte.
Der Entführer zerrte das Mädchen zurück in den Teil des Kellers, der aus der Oper in eines der umliegenden Häuser führte.
Getrieben von dem Willen, das Mädchen zu retten, griff Würtner nach einer Axt. Später würde er nicht mehr wissen, woher er den Mut dazu aufgebracht hatte. Mit wenigen Schritten erreichte er den Mann, der das sich heftig wehrende Kind trug, und hieb ihm die Axt auf den Hinterkopf. Das scharfe Eisen grub sich in den Knochen und spaltete den Schädel.
Der Mann blieb reglos stehen, der Griff seiner Hände lockerte sich, das Mädchen kam los – dann, nach einer endlos erscheinenden Zeit, brach der Entführer zusammen. Aus seiner Tasche fiel der blaue Samtbeutel.
Marie sah auf das Blut zu ihren Füßen. Langsam hob sie ihren Kopf, blickte in Würtners fassungsloses Gesicht und verlor das Bewusstsein.
Der Tod hatte die Beine lässig über die Armlehne des Stuhles gelegt. Seine Schuhspitzen glänzten im Schein der Kerze, die Anna Sacher auf dem Nachttisch des Sterbenden angezündet hatte. Er dachte an das Mädchen.
Die Uhr tickte unablässig. Gleich würde die Oper aus sein und die bestellten Tische in den Separees eingenommen werden. Anna grübelte, ob sich der Zustand des Patrons herumgesprochen haben könnte. Womöglich blieben die Gäste aus Pietät oder Aberglaube aus? Vielleicht sollte sie den Schwiegervater bitten, beim Sterbenden zu wachen, und selbst nach dem Rechten sehen?
Anna fühlte die heiße Hand ihres Gemahls und erinnerte sich an ihre Hochzeit in der Votivkirche. Einundzwanzig Jahre war sie damals gewesen. Zwölf Jahre hatte die Ehe gedauert. Der Witwer und Hotelier war eine gute Partie in Wien gewesen. Eduard hatte Anna vom ersten Tag an respektiert und ihr freie Hand gelassen. Sie war niemals in Eduard Sacher verliebt gewesen. Sie liebte das Hotel und die Verantwortung. Sie dachte es nüchtern und klar.
Ihre Betrachtung rang dem Tod ein respektvolles Lächeln ab. Er mochte Menschen, die klar dachten. Die meisten Menschen verloren sich im Strudel ihrer Emotionen. Der Tod hätte ihnen gern von dem Raum erzählt, den die Seelen betraten, wenn sie die Welt verließen, und zu dem er nun Eduard Sacher bringen würde. Dieser Raum, so wusste der Tod, war reinster Segen. Hier galt nur der Zustand des Seins. Ein Sein ohne Zukunft und ohne Vergangenheit. Ein Raum höchstmöglicher Ruhe. Ein tröstliches Nichts, aus dem sich selbst zu gebären Vollendung bedeutete. Der Tod wusste auch, dass fast alle, die er bis zu dieser Schwelle begleitete, den Raum voll Verlangen betraten, so als hätten sie ihr gesamtes Leben nur darauf gewartet. Er selbst blieb stets respektvoll vor dem Tor zurück.
Franz Sacher kam mit den Kindern. Für die zehnjährige Annie war es schlimm. Der nur zwei Jahre jüngere Eduard hatte das nüchterne Naturell seiner Mutter. Er nahm den Tod des Vaters als eine Angelegenheit, die es zu bewältigen galt. Die Jüngste, Franziska, hatte von jeher keine Beziehung zum Vater gehabt.
Annie klammerte sich an den Sterbenden, als könnte sie ihn so im Leben halten. Und da – im Ringen um ihren Vater wichen die Nebel. Annie sah am Fenster im Lehnstuhl den Mann mit den wippenden glänzenden Schuhspitzen. Sie sah dem Tod direkt in die Augen. Dies alles dauerte kaum eine Sekunde. Auch die Erinnerung daran würde bald im Nebel des Vergessens verschwinden. Aber das Gefühl, dieses Gefühl, hinter den Vorhang geschaut zu haben, würde Annie von nun an begleiten.
Ein letzter Atemzug entrang sich Eduards Brust. Und mit der Luft wich das Leben aus ihm. Der Tod erhob sich und begrüßte die Seele des Mannes; hüllte die Schöße seiner Jacke um dieses tiefste Geheimnis des Menschen und verließ mit ihm den Raum.
Anna Sacher schloss die Augen des Leichnams und faltete die Hände. Dann hielt sie das Pendel der Uhr an. Auf eine bestimmte Art war sie erleichtert, so wie sie als Mädchen erleichtert gewesen war, als ihr Vater starb und sie den Schlachthof verließen.
Franz Sacher schaute auf seinen toten Sohn und begriff plötzlich, was ihn stets an Eduard irritiert hatte: die Angst vor dem Leben.
Franz fühlte, wie sich die kleine, feuchte Hand seiner Enkelin Annie in die seine schob. Mit tränenüberströmtem Gesicht blickte das Kind auf den toten Vater.
Marie schlug die Augen auf und sah in das Gesicht eines Mannes. Die schrecklichen Bilder ihrer Entführung bedrängten sie. Sie begann zu zittern.
»Musst keine Angst haben, Vogerl«, sagte Würtner beschwörend und hielt ihr einen Blechlöffel mit Zuckerwasser vor den Mund.
»Er kann dir nichts mehr tun.«
Würtner hatte sie in seine Räume gebracht. Hinter den Archivregalen gab es eine kleine Kammer, die er nutzte, wenn er bis zum Morgengrauen die Orchesterstimmen kopierte und zu müde war, um noch nach Hause zu gehen. Dort hatte er Marie auf das zerschlissene Sofa gelegt. Aus der Ferne waren Musik und Gesang zu hören.
»Bist doch ein so klein’s Mädel, dir darf keiner was tun.« Seine Stimme hatte einen hellen Klang und passte nicht zu seiner gedrungenen, dicklichen Gestalt.
Ganz nah kam der Mann Marie. So nah, dass Marie unter seinem schon schütteren Haar die gelbliche Kopfhaut sah. Und weil er nicht abließ, mit dem Löffel vor ihrem Mund herumzukreisen, und wohl auch aus Todesangst, öffnete Marie den Mund.
Es schmeckte süß und kühl. Mit jedem Schluck kam ihre Kraft wieder. Als das Glas leer war, wischte sie sich den Mund und fragte mit feiner Stimme: »Kann i’ nach Haus?«
Als der Mann nichts sagte, schlüpfte sie unter der Decke hervor, stand auf und ging zur Tür.
»Was willst denn zu Haus?« Seine Stimme hatte einen schärferen Klang.
Marie wandte sich ängstlich um. »Die Mama wartet doch auf mich.«
»Die wartet nimmer.« Er lachte grob. »Deine Eltern haben dich verkauft.«
Marie starrte Würtner an.
»Ja, was glaubst, wohin dich der Mann bringen wollt? Von der Syphilis wollen die Männer kuriert werden. Dafür holen s’ so kleine Mädel wie dich von der Straßen.«
Marie begann zu weinen.
»Glück hast gehabt!« Er schob sie von der Tür weg, zurück zum Sofa. Dort setzte er sie neben sich und nahm väterlich ihre Hand. Sie roch seinen Schweiß. »Aber jetzt pass i’ auf dich auf«, sagte er und meinte es ernst. Er würde das Kindchen, sein Vogerl, nicht mehr in die gefährliche Welt da draußen lassen. Er würde sie beschützen, so wie er als Junge selbst gern beschützt worden wäre.
Aus der Ferne schwoll die Musik ins Finale.
Kraftvolle Akkorde vereinten die Sänger, die Musiker und das Auditorium ein letztes Mal. Der Nachhall der Instrumente war kaum verklungen, als sich stürmischer Applaus erhob. Berührt schob Konstanze von Traunstein ihren Fächer zusammen. Musik wühlte die Prinzessin stets auf und erfüllte sie mit Wehmut. Sie wünschte sich, eine Künstlerin zu sein, Muse wenigstens für ein großes Genie. Sie schaute in das Profil ihres Mannes, sah, wie sich seine Hände enthusiastisch im Applaus bewegten. Mit ihm würde sie nun für immer ihr Leben teilen. Dieser Gedanke löste ein Unbehagen in ihr aus.
Georg fühlte Konstanzes Blick und wandte sich seiner Frau lächelnd zu. Sie war ihm fremd, auch nach einem halben Jahr Ehe noch.
Constanze Nagy-Károly war ein Goldstück unter den Heiratskandidatinnen gewesen. Die Traunsteins hatten lange gesucht nach Alter und Titel, vor allem nach einem Vermögen, das sich ihren Stammbaum kaufen wollte. Das Eheversprechen abzulegen war für Georg ohne jeden Zweifel gewesen. Er brauchte eine Frau. Er wollte eine Frau. In dieser Hinsicht suchte er ein unkompliziertes Leben. Georg war damit beschäftigt, ein sinnvolles Leben zu führen. Er spürte in sich die Berufung, die Welt besser zu machen. Dem wollte er seine Kraft widmen.
Georg atmete die zarte Note von Konstanzes Duftwasser ein, das sich mit dem Geruch ihres üppigen dunklen Haares mischte. Dieser Geruch löste Begehren aus. Er war überrascht. Zwar hatte er das Recht, seine Frau zu begehren. Aber eine gewisse Distanz, ein kühler und disziplinierter Umgang miteinander war ihm für die Ehe als notwendig vermittelt worden. Leidenschaft war etwas für die Bordelle und die Affären. Emotionen konnten einer Ehe vor allem schaden. Sie waren unberechenbar. Georg verachtete Menschen, die nicht kühlen Kopfes waren, auf die er sich nicht in jedem Augenblick und in jeder Situation verlassen konnte. Diesen Maßstab legte er vor allem an sich selbst.
3
Im Halbdunkel des hereinbrechenden Tages wurde der Sarg mit dem toten Eduard Sacher abgeholt. Die Belegschaft hatte sich auf dem Wirtschaftshof versammelt und gab ihrem Patron das letzte Geleit. Am Vormittag sollte die offizielle Bekanntmachung erfolgen. Dann würde der Leichnam der Wiener Gesellschaft und ihren Trauerbekundungen gehören. Die Angestellten würden nichts mehr tun können, als auf das Unwahrscheinliche zu hoffen, dass Anna Sacher das Haus weiterführen durfte.
Anna sah in die Gesichter ihrer Angestellten. Sie hörte unterdrücktes Schluchzen. Und sie wusste, dass hier alle um ihre Arbeit und um ihre Zukunft fürchteten. So mancher von ihnen hatte erst vor Kurzem eine Familie gegründet. Diese Leute brauchten sie, und sie brauchte die Leute. »An die Arbeit. Unsere Gäste sollen wissen, dass alles bleibt, wie’s ist.« Ihr Ton hatte eine neue Lage.
Sie ging zurück ins Haus, im Geiste ordnend, was für den Tag vorzubereiten wäre.
Als sie das Büro betrat, das sie mit Eduard geteilt hatte, saß der Schwiegervater auf ihrem Platz und sah die Bücher durch.
Anna hielt den Atem an. »Bist schon bei den Papieren?«
»Wir werden einen Verwalter einsetzen, bis ich einen Käufer gefunden habe, der uns einen guten Preis zahlt«, murmelte Franz. »Davon werden wir zumindest die Hypotheken auslösen. Was mein eigenes Geld betrifft, das ich in die Unternehmung gesteckt habe …« Er winkte ab.
Anna blieb neben ihm stehen. Es wäre ein Zugeständnis gewesen, wenn sie sich auf Eduards Seite gesetzt hätte. Sie wollte, dass er ihren Platz frei machte.
Es war sonst nicht Annas Sache, sich mit ihren Wünschen und Bedürfnissen zurückzuhalten. Doch jetzt musste sie schlau sein. Mit dem Tod ihres Mannes hatte sie die Konzession für den Hotel- und Restaurantbetrieb verloren. Auch den Titel Kaiserlicher und Königlicher Hoflieferant durfte sie nun nicht mehr führen. Sie war eine Witwe mit drei kleinen Kindern. Sie musste sich ihren Schwiegervater zum Verbündeten machen, den Verkauf des Hauses verhindern und mit seiner Hilfe die Behörden überzeugen.
»Der Eduard, der hätt’s«, sie hielt inne und ließ das »vielleicht« weg, »der hätt’s anders gewollt«.
Der Schwiegervater ging darauf nicht ein und sagte gutmütig: »Ich will zufrieden sein, wenn ich den Schaden für die Familie in Grenzen halt.«
Weil Anna nichts erwiderte, deutete Franz das als Zustimmung und wandte sich wieder den Papieren zu, deren leises Rascheln durch die Stille im Raum verstärkt wurde.
»Ich werd das Haus weiterführen.«
Franz Sacher sah auf. »Die Konzessionen laufen auf Eduards Namen. Einer Frau werden s’ den Titel Hoflieferant nicht überlassen«, sagte er irritiert. So naiv konnte Anna nicht sein.
»Sie sollen dem Haus den Titel lassen. Mir brauchen s’ gar nix überlassen.«
Ehe er etwas erwidern konnte, klopfte es. Der Portier trat ein. Ihm folgte ein junger Mann im abgetragenen Anzug.
»Tut mir leid!« Mayr hätte Anna Sacher und ihren Schwiegervater gern vor dem Besucher verschont. »Aber der Herr ist von der Polizei.«
»Habe die Ehre! Lechner mein Name, vom Polizeiagenteninstitut«, schaltete sich der junge Mann ein und verbeugte sich knapp. »Mein herzliches Beileid, Frau Sacher, Herr Sacher. Bitte nachsichtigst um Vergebung, dass ich ausgerechnet heut. Es geht um die Stadler-Marie. Das Kind ist gestern Abend nicht nach Haus gekommen. Wir haben nur ihren Suppentopf g’funden. Außerdem gab’s in der Nähe einen Toten. Ich müsst’ Ihre Leute befragen.« Unter dem Milchgesicht verbarg sich ein Mann mit Entschlusskraft.
»Ja, dann tun S’.« Anna hatte gerade keine Nerven für diese Angelegenheit. »Und, Mayr, sorgen S’ dafür, dass die Polizei uns anschließend durch den Wirtschaftseingang verlässt.«
Lechner zuckte unmerklich zusammen. Er war kein Lakai. Seit einer Woche war er Anwärter bei der Wiener Kriminalpolizei, und dies war sein erster eigener Fall. »Habe die Ehre.« Lechner zeigte mit keiner Miene, dass man ihn beleidigt hatte. Er verbeugte sich wiederum nur knapp und ging.
Anna wandte sich wieder ihrem Schwiegervater zu. »Das Hotel ist mein Leben, Franz. Ich werd’s nicht aufgeben.«
»Dein Leben sind die Kinder, Anna. Sie haben gerade den Vater verloren.«
Franz Sacher schaute wieder auf die Unterlagen. War er wirklich dagegen, dass seine Schwiegertochter das Erbe ihres Mannes weiterführte? Aber er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine Frau mit drei Kindern allein in Wien ein Hotel führen wollte – vor allem in der Qualität, wie es die Gäste gewohnt waren. Und er würde Baden nicht verlassen, um an die Stelle seines Sohnes zu treten. Franz Sacher war über siebzig. Er genoss das Leben als Pensionär, zwei kurze Fahrtstunden von der brodelnden Hauptstadt entfernt. Er liebte seine einsamen Spaziergänge, die Mittagsruhe und den Duft von Kaffee gegen vier Uhr am Nachmittag. Um nichts in der Welt wollte er noch einmal in der Gastronomie oder im Hotelbetrieb arbeiten. Er hatte seinen Teil getan und seine Söhne in die Spur geschickt. Der älteste Sohn führte schon seit über zehn Jahren ein Kurhotel.
Anna hatte keine Ahnung von den Gedanken ihres Schwiegervaters. Sie sah nur seine Strenge. Sie durfte sich jetzt nicht schwächen lassen. Sie musste sich auf das konzentrieren, was sie wollte.
4
Martha und Maximilian Aderhold, die jungen Verleger aus Berlin, saßen beim Frühstück. Martha griff mit Appetit zu.
Maximilian war an diesem Morgen schwer aufgewacht und wäre gern noch länger im Bett geblieben. Doch es drängte beide ins Café Griensteidl, nur fünf Gehminuten entfernt. Sie wollten Hermann Bahr treffen, den Dichterfürsten Wiens. Maximilian war von dessen Literaturkritiken und Schriften begeistert. Sie erhofften sich von ihm Ratschläge für ihren Verlag und durch seine Fürsprache junge Schriftsteller zu überzeugen, bei ihnen zu veröffentlichen.
Von Berlin aus glänzte die Hauptstadt des Habsburger Reiches im Licht künstlerischer Individualität. Die Literaten, Maler und Architekten waren jung, nicht älter als dreißig. Diese Künstler schienen Suchende zu sein, auf einem vollendeten handwerklichen Niveau. So war Maximilians enthusiastische Analyse – und er riss Martha mit.
Bei ihren nächtlichen Spaziergängen durch den Berliner Tiergarten hatten sie beschlossen, ihrem Verlag keineswegs Beschränkungen aufzuerlegen. Sie wollten Ausdruck der Moderne sein, frei in ihren ästhetischen Entscheidungen, erproben, wohin ihre Neigung und Begabung sie zogen.
Martha und Maximilian hatten sich vor etwas über einem halben Jahr im Lesesaal der Friedrich-Wilhelm-Universität in Berlin kennengelernt, wo Martha, die als Frau nicht zum Studium zugelassen wurde, sich aus Büchern holte, was man ihr im Hörsaal verweigerte.
Martha fühlte sich vom ersten Moment an zu dem Mann mit den hellen Augen hingezogen. Doch sie hatte die Geduld abzuwarten, bis er sie zu einem Spaziergang einlud. Die Bücher unter dem Arm, flanierten sie die Allee Unter den Linden entlang durchs Brandenburger Tor in den Tiergarten. Maximilian erzählte ihr von seinen eigenen Texten und versprach, am nächsten Tag eine Kostprobe mitzubringen. Sie gingen alle verschlungenen Wege mehrmals, bis es dunkel war. Dann nahm sich Martha eine Droschke und fuhr nach Hause.
Martha Grünstein hatte ihr Elternhaus in Bremen verlassen. Es zog sie nach Berlin, dem Geburtsort ihrer verstorbenen Mutter.
Arthur Grünstein gönnte seiner Tochter die Zeit, die sie noch ohne eheliche und familiäre Pflichten hatte. Denn für ihn galt es als ausgemacht, dass er der Tochter einen Mann finden würde, der sich als geeigneter Nachfolger für sein Importgeschäft erwies. Bis dahin sollte Martha sich ganz nach ihren Wünschen entfalten können. Dass sie sich verlieben und ihre eigenen Entscheidungen treffen könnte, ließ Grünstein bei seinen Plänen außer Acht.
Martha hatte kein schlechtes Gewissen, als sich in den Tagen des Beisammenseins mit Maximilian ihre gemeinsame Zukunft formte. Sie spürte, dass ihr Leben an der Seite des begabten Mannes einen Sinn bekam. Ihr Vater war durch den Handel mit Übersee reich geworden, und ein Gutteil seines Geldes würde ihre Mitgift sein. Genügend, um einen eigenen Verlag zu gründen – und, bis dieser Geld abwarf, recht gut zu überleben.
Als Martha alle unvollständigen Texte von Maximilian gelesen und sich kritisch und anerkennend dazu geäußert hatte, fühlte er sich von der drei Jahre Älteren gesehen und verstanden.
Martha, die doch sonst so besonnen und planvoll vorging, verdrängte eine mögliche Enttäuschung ihres Vaters. Es war sein Geschäft. Genauso, wie er es als junger Mann gegründet hatte, wollte sie nun auch ihre Unternehmung gründen. Außerdem erfreute sich der Vater bester Gesundheit. Er konnte seine Vision leben, anstatt das Geschäft einem Schwiegersohn zu übertragen, der womöglich nicht das gleiche Geschick wie er selbst bewies. Maximilian war in Geschäftsdingen völlig ungeeignet. Das hatte Martha schnell erkannt. Insofern sollte ihr Vater, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen und ohne familiäre Rücksichtnahme nach einem zahlungskräftigen Nachfolger Ausschau halten. Falls er seine Unternehmung überhaupt abtreten wollte. Martha hatte sich also ein Konzept zurechtgelegt und schuf Tatsachen, ehe irgendein Skrupel, ein Umdenken sie von ihren Plänen hätte abbringen können oder eine Intervention ihres Vaters möglich war.
Der Protestant Maximilian und die Jüdin Martha heirateten standesamtlich. Weder die eine noch die andere Kirche sollte in ihrem Leben eine Rolle spielen. Der Begriff des Atheisten war gerade in Mode gekommen. Nein, gottlos fühlten sich beide nicht. Im Gegenteil wollten sie dem Göttlichen, das in ihren Augen durch die Kunst am besten gespiegelt wurde, Raum geben. So waren sie nach der Trauung nach Wien gereist, um sich mit etwas zu verbinden, was noch keine Gestalt hatte, noch keinen Inhalt, was nur eine Ahnung war.
So ähnlich erklärte Martha es auch ihrem Vater in einem langen Brief, den sie im Zug sofort nach Verlassen des Bahnhofes verfasste und von Dresden aus aufgab. Als sie dem Postbeamten das Porto auf den Tresen legte, überfiel sie das schlechte Gewissen.
Und jetzt! An diesem ersten Morgen lag Wien im Nebel. Alles erschien zäh und undurchdringlich.
Maximilian roch an einem Kipferl und legte es wieder in den Korb zurück. Er konnte noch nichts essen. Es war eine Schwäche von ihm, dass er die Dinge vorausträumte, um dann enttäuscht zu sein. In solchen Momenten fühlte sich Martha stets herausgefordert, den Optimismus und das Ziel im Auge zu behalten. Sie war fest entschlossen, nicht mit leeren Händen nach Berlin zurückzukehren. Der Vater war ein Geschäftsmann und am besten mit Ergebnissen zu überzeugen.
Während sie nun an ihrem ersten Morgen in der fremden Stadt schweigend jeder für sich den Gedanken nachhingen, goss ein Kellner Kaffee nach. Maximilian sah in den Augen des Mannes größte Trauer. »Fühlen Sie sich nicht wohl?« Maximilian wollte keineswegs von einem Menschen bedient werden, der dies nicht mit freiem Willen tat.
»Heut Nacht«, die Stimme des Kellners zitterte, »ist der Herr Sacher junior … unser Patron ist verstorben.«
»Mein Gott«, entfuhr es Martha.
»Ja, wie denn?«, wollte Maximilian plötzlich sehr genau wissen. Denn schließlich hätte es sich auch um einen Mord handeln können.
»Die Grippe«, erwiderte der Kellner. »Wir möchten unsere Gäste selbstverständlich damit nicht aufregen. Darf’s bittschön noch etwas sein?«
Maximilian und Martha schüttelten gleichzeitig den Kopf. Wie hätten sie unter diesen Umständen noch was bestellen können?
Der Kellner ging mit einer Verbeugung.
Maximilian starrte Martha an. »Wir sind in einem Totenhaus.« Er war ehrlich entsetzt. »Das hätten sie uns doch bei der Anreise sagen müssen, dass der Direktor des Hauses im Sterben liegt.«
»Wir wären doch nicht in ein anderes Hotel umgesiedelt, Max. Gut, dass wir es nicht gewusst haben.« Martha sagte dies mit ihrer klaren Stimme, der sie in kritischen Momenten stets ein Leuchten zu geben wusste. Doch im tiefsten Innern war auch sie erschrocken. In der ersten Nacht ihrer Hochzeitsreise war nur wenige Meter von ihnen entfernt ein Mensch gestorben.
Die Liebe hatte sich an den Tisch ihnen gegenübergesetzt. Gegen den Tod kam sie nicht an. Anstatt die Liebe zu fühlen, erschraken die Menschen über den Tod. Er regte sie an und auf. Im Tod sah der Mensch eine Macht. Obwohl – die Liebe kräuselte nachdenklich die Stirn – sprach man nicht eigentlich von der Macht der Liebe? Und gab es nicht den Satz: Im Tode verlor er alle Macht? Dennoch fühlte sich die Liebe dem Tod unterlegen. Zumindest hier und jetzt. Aber nun würde sie sich endlich emanzipieren! Denn sie war das Leben selbst und der Tod das Alpha und Omega eines in Liebe gelebten Lebens. So sollte es sein. So mussten es die Menschen endlich fühlen. In diesem Sinne würde sie sich ihrem Auftrag widmen.
5
Konstanze von Traunstein betrachtete Stoffproben, die ihr von unterschiedlichen Wiener Raumausstattern ins Hotel gebracht worden waren. »Es wird hier schon alles weitergehen, Flora, warum sollt’s auch nicht?«, beruhigte die Prinzessin das Zimmermädchen.
Flora war den Tränen nahe. Sie war ins Appartement gekommen, um das Frühstücksgeschirr abzuräumen.
»Mit diesem Stoff wünsch ich mir mein kleines Sofa bezogen«, sagte Konstanze verspielt. Sie wollte das Gutsschloss, das sie mit Ehemann und Schwiegervater bewohnte, wenigstens teilweise nach ihrem Geschmack einrichten.
»Wunderschön!« Flora vergaß zu weinen.
»Wie findest du diese Tapete?« Konstanze zeigte ein Stück blaues Papier mit stilisierten Blüten in Gold. Dabei schaute sie prüfend zur alten Zofe, die am Fenster saß und stickte. Die verfolgte jedes Wort ihrer jungen Herrin. Sie hatte ein kantiges, freudloses Gesicht. Ihr graues Haar wurde straff von einem Knoten gehalten. Seit Jahrzehnten diente sie bei den Traunsteins. Konstanze mochte die Zofe nicht und war fest entschlossen, sie bei nächster Gelegenheit loszuwerden.
»Wunderschön … es ist alles so wunderschön«, hauchte Flora, angetan von der Eleganz der Proben und Skizzenblätter.
Konstanze machte sich bereit, das Thema zu wechseln. Sie hatte in der Wiener Zeitung eine kleine Notiz über das Verschwinden des Kindes Marie Stadler auf dem Heimweg aus dem Hotel gelesen, sich an ihre Fahrt in die Oper erinnert und war erschauert. »Und dies Mädel, das verschwunden ist, das kanntest du also?« Konstanze sah, wie die Zofe am Fenster kaum merklich zusammenzuckte.
Flora nickte eifrig. »Ihre Mutter ist Wäscherin. Der Vater fährt Kohlen. Die Polizei war auch schon da. Aber keiner vom Personal hat was g’wusst«, sagte das Zimmermädchen mit dramatischem Blick.
»Einfach verschwunden auf dem Weg nach Haus?«, sinnierte Konstanze.
Flora vergaß ihre Position und hauchte wie zu einer Freundin: »Es gab auch einen Toten.«
Konstanze bekreuzigte sich erschrocken.
»Die Madame vom Etablissement gerad’ gegenüber von der Oper hat ihn g’funden, ganz in der Nähe ihrer Kellertüre. Unter der Straßen gibt’s geheime Gänge, die von einer Seite zur anderen führen.« Floras Stimme bebte vor Aufregung. »Man sagt, dass es Leut’ in der Stadt gibt, die kleine Mädchen einfangen, um sie dann nachts …«
Die Zofe sah missbilligend auf. Flora verstummte.
»Ja, was?«, drängte Konstanze aufgeregt.
»… in dämonischen Ritualen zu opfern«, vollendete Flora ihren Satz.
Konstanze wurde blass. »Was redest da für wirres Zeug?«
Es klopfte. Ohne eine Aufforderung abzuwarten, betrat ihr Schwiegervater, der alte Fürst Josef von Traunstein, das Appartement. »Servus, Stanzerl.« Der Schwiegervater küsste ihr etwas intimer als notwendig die Hand.
Flora knickste mit gesenktem Blick, nahm eilig das Frühstückstablett und verließ das Zimmer.
Konstanze wendete sich ihren Stoffproben zu und tat geschäftig. »Ihr Sohn ist bei Hofe.«
»Haben Sie von der Entführung gehört, Schwiegerpapa? Und dem toten Mann?«, fragte Konstanze leise, Entsetzen in der Stimme.
Der Alte ging über ihre Frage hinweg. »Ich habe der Frau Sacher bereits kondoliert«, sagte er und griff sich eine der Stoffproben.
Konstanze sah ihn mit fragenden Augen an.
»Lass gut sein, Stanzerl.«
Erschrocken über seinen Ton wich sie zurück.
Josef von Traunstein sah die Zofe, die neugierig herüberschaute, warnend an. Dann betrachtete er sich eingehend die Stoffprobe. Sein Ton wurde jovial. »Ein Puppenhaus willst dir also einrichten?«
Konstanze spürte seinen mächtigen Körper nah bei ihrem und flüchtete hinter den Habitus eines schmollenden Kindes. »Ihr Sohn meint, das ist unnötiger Luxus, wenn ich die Räume im Schloss renovieren lasse.« Sie bekam ihn auf Abstand.
»Georg meint so manches«, erwiderte der Schwiegervater bissig und trat zur Anrichte, um sich einen Weinbrand einzugießen. »Ich red mit ihm.« Er trank das Glas in einem Zug aus und goss sich ein zweites ein. »Und sonst? Ich hoffe, mein Sohn erfüllt seine ehelichen Pflichten?«
Konstanze errötete peinlich berührt und schob geschäftig Stoffproben über die Grundrisse ihres künftigen Hauses.
Der Schwiegervater beobachtete sie. Der Ausdruck seines Gesichtes war süffisant.
Nach dem Tod seiner Frau vor fast zehn Jahren hatte sich Josef von Traunstein selbst nach einer geeigneten Heiratskandidatin umgeschaut, die seine schlechte wirtschaftliche Situation mit einer stattlichen Mitgift verbessern sollte. Nach Generationen, in denen der Reichtum verbraucht worden war, hatten Schloss und Ländereien frisches Geld dringend nötig. Doch es hatte sich kein Arrangement gefunden.
Das stellte sich ein paar Jahre später für Georg anders dar. Er war jung, und der makellose Stammbaum der Traunsteins war diesmal Geld wert. Mit der Verheiratung seines Sohnes hatte der Alte nun auch für sich selbst gesorgt.
6
Johann passte Flora im dunklen Seitenflur zum Hof hinaus ab. Hier waren der junge Kofferdiener und das Zimmermädchen für einen Moment allein. Johann ergriff Floras Hände und behielt sie fest in seinen. »Ich habe meiner Tante g’schrieben«, flüsterte er aufgeregt. »Vielleicht zahlt sie mich ja aus? Ich bin doch der einzige Erbe.« Er küsste sie voll Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft.
Sie waren sich vor gut einem Jahr nähergekommen, kurz nachdem Flora im Hotel eingestellt worden war. Johanns Anstellung als Kofferdiener ging bereits ins siebte Jahr. Er hatte mit fünfzehn zu arbeiten begonnen. »Unseren eigenen Gasthof könnten wir haben, Flora.«
Flora schaute ihn voller Zweifel an. Sie war neunzehn, vollkommen mittellos. Wieso sollte eine fremde Frau ihr Leben glücklich verändern? Auf einen solchen Gedanken wollte sie sich gar nicht erst einlassen. Er konnte nur Enttäuschung bringen. »Aber jetzt noch nicht, Johann … jetzt bestimmt noch nicht.«
Doch Johann blieb bei seinem Optimismus. »Wenn’s hier nicht weitergeht, wird sie uns schon helfen«, bekräftigte er entschieden. Flora lächelte kaum beruhigt.
Da riss sie die strenge Stimme der Patronin auseinander. »Nicht plauschen! An die Arbeit! Die Gäste sollen nicht das Nachsehen haben«, rief Anna Sacher streng. Sie hatte ihre Augen wirklich überall. Johann ließ Floras Hand los. Sie trennten sich eilig.
Annas Kinder hatten mit einem Teil des Personals zu Mittag gegessen. Es hatte Rindsgulasch gegeben und zum Nachtisch Topfenstrudel mit Vanillesauce vom Vortag. Man war schon beim Abräumen, denn jeder wollte so schnell wie möglich zurück an die Arbeit.
Tochter Annie aß noch. Sie stopfte die Nachspeise in sich hinein, schluckte und stopfte. Ihre Schwester drehte sich auf dem glatten Küchenfußboden und genoss den Schwung ihres Trauerkleides. Eduard junior stolzierte, die Hände in den Hosentaschen, durch die Küche. Als einziger Sohn hatte er – so viel wusste der Kleine bereits – ein Anrecht auf all dies.
Anna kam in die Küche und wandte sich an ihren Koch: »Die fürstliche Familie Schwarzenberg hat sich für heut Abend mit dreißig Personen angesagt.«
Der Koch hatte sich bereits um das Menü gekümmert und reichte ihr seinen Vorschlag. Sie überflog das Blatt und war zufrieden. Keinerlei Nachlässigkeit oder Abstriche. Alles wie immer. Das Küchenpersonal legte an Tempo zu. Die Hausdame nahm sich der Kinder an. Anna sah es dankbar.
»Wenn die Kinder brav sind, können Sie mit ihnen einen Spaziergang machen.«
»Zuerst die Schulaufgaben. Wenn Sie dann auf mich verzichten können, Frau Sacher, würd’ ich mit ihnen gehen«, erwiderte die Hausdame.
»Gibt’s was Neues von der Marie?«
Die Hausdame schüttelte den Kopf. »Niemand von uns konnt der Polizei was sagen.«
»Vielleicht ist sie nur fortgelaufen?«, sagte Anna.
»Die Marie ist so ein gutes, liebes Mädel.« Die Hausdame hatte der Kleinen stets die Suppe und den Lohn gegeben. Sie konnte sich einfach nicht erklären, was passiert war.
»Sagen S’ der Frau Stadler, dass es mir leidtät. Wenn sie was braucht, soll sie’s sagen«, beendete Anna das Thema.
Inzwischen hatte Annie die Platte mit dem Nachtisch zu sich herübergezogen.
»Genug gegessen! Du wirst Leibschmerzen bekommen, Annie, und dann liegst krank im Bett«, mahnte Anna ihre Tochter.
Eduard junior äffte aggressiv aus dem Hintergrund. »Wie der Papa.«
»I’ hab aber Hunger.« Annie füllte sich einen weiteren Löffel auf.