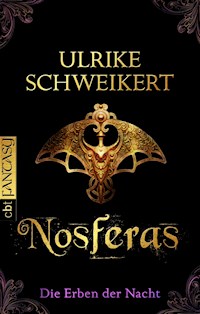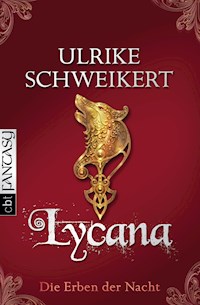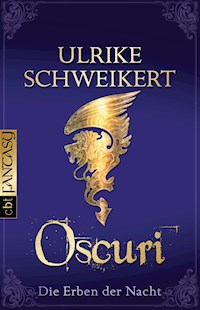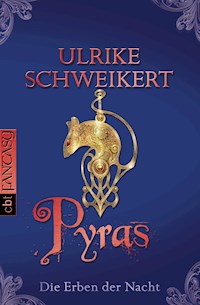Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Elisabeth-Reihe
- Sprache: Deutsch
Mutig, klug und eigenwillig: Die Tochter des Bischofs kämpft um ihr Glück – und ihre Ehre Würzburg um 1430: Mit der Absetzung des Fürstbischofs Johann II. von Brunn hat sich die Stadt aus der eisernen Faust des verschwenderischen Herrschers befreit, aber nicht zur Ruhe gefunden. Der Kampf um die Macht ist entbrannt, und wider Willen findet sich Elisabeth, die Tochter des entmachteten Bischofs, inmitten der politischen Wirren. Ohne es zu wissen, wird sie zum Spielball der Interessen ihres Vaters und ihrer großen Liebe, Albrecht von Wertheim, dem sie versprochen ist. Doch dann stimmt Albrecht zu, Nachfolger ihres Vaters zu werden – und wäre damit für ein weltliches Leben und Elisabeth verloren. Elisabeth muss sich entscheiden, wem sie ihr Vertrauen und ihr Herz schenkt, und erst im letzten Moment erkennt sie, dass Albrecht seinen Schwur gebrochen hat, um ihre Ehre zu retten …
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kurzbeschreibung:
Mutig, klug und eigenwillig: Die Tochter des Bischofs kämpft um ihr Glück – und ihre Ehre
Würzburg um 1430: Mit der Absetzung des Fürstbischofs Johann II. von Brunn hat sich die Stadt aus der eisernen Faust des verschwenderischen Herrschers befreit, aber nicht zur Ruhe gefunden. Der Kampf um die Macht ist entbrannt, und wider Willen findet sich Elisabeth, die Tochter des entmachteten Bischofs, inmitten der politischen Wirren. Ohne es zu wissen, wird sie zum Spielball der Interessen ihres Vaters und ihrer großen Liebe, Albrecht von Wertheim, dem sie versprochen ist. Doch dann stimmt Albrecht zu, Nachfolger ihres Vaters zu werden – und wäre damit für ein weltliches Leben und Elisabeth verloren. Elisabeth muss sich entscheiden, wem sie ihr Vertrauen und ihr Herz schenkt, und erst im letzten Moment erkennt sie, dass Albrecht seinen Schwur gebrochen hat, um ihre Ehre zu retten …
Ulrike Schweikert
Das Antlitz der Ehre
Historischer Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2019 Edel Germany GmbHNeumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © J2012 by Ulrike Schweikert
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Montasser Agentur
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-306-9
www.facebook.com/EdelElements/
www.edelelements.de/
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Epilog
Wichtige Personen
Glossar
Dichtung und Wahrheit
Kapitel 1
Die Räder der Kutsche rumpelten den unebenen Karrenweg entlang und ließen das prächtige Gefährt von einer Seite auf die andere schwanken. Obwohl sie vierspännig fuhren, kam die Kutsche nur langsam voran.
»Sind wir immer noch nicht da?«, stöhnte eine der beiden Frauen, die sich in der Kutsche auf den wohl gepolsterten Bänken gegenübersaßen. »Ich kann die Stunden nicht mehr zählen, die wir nun schon durchgerüttelt werden. Was ist das nur für ein Einfall, bei diesem Wetter solch eine lange Fahrt zu machen! Ich weiß zwar noch, dass eine Reise über die Landstraße eine arge Plage ist, nur hätte ich mir nicht träumen lassen, dass es in solch einer noblen Kutsche fast noch schlimmer ist, als zu Fuß über Stock und Stein zu gehen.«
Die Miene der Frau gegenüber schwankte zwischen Ärger und Amüsement.
»Urteilst du nicht ein wenig hart, liebe Jeanne? Vielleicht trügt dich da deine Erinnerung.«
Jeanne wollte etwas erwidern, doch stattdessen stieß sie einen Schrei aus, als das linke Vorderrad unvermittelt in eine Mulde sackte und die Kutsche sich zur Seite neigte. Ihr Knie stieß hart gegen das ihrer Gefährtin, ehe sie das Gleichgewicht wiederfinden konnte und in ihre Ecke zurückrutschte.
»Oh, das tut mir leid! Entschuldige, Elisabeth, das lag nicht in meiner Absicht.«
»Ich weiß, Jeanne. Es ist nichts passiert«, beschwichtigte sie die andere, auch wenn sie sich ihr Knie rieb und das Gesicht vor Schmerz verzog. Elisabeth schob den Vorhang beiseite und spähte hinaus.
»Ich kann nur Bäume nach allen Seiten ausmachen, aber der Weg steigt nun immer steiler an. Ich denke, wir haben die Burg bald erreicht.«
Als der Weg sich wieder abflachte, traten die Bäume zurück, und das späte Licht des Tages drang in die Kutsche. Elisabeth beugte sich ein wenig vor. Sie fuhren nun einen Höhenrücken entlang, dessen grasgrüne Oberfläche nur durch ein wenig Buschwerk unterbrochen wurde. Die Bäume, die hier früher einmal dicht an dicht in den Himmel geragt hatten, waren längst abgeschlagen worden. Einige der Baumstümpfe moderten noch vor sich hin.
Es war nicht nur die Folge des Bedarfs der Burg an Bauholz und Brennmaterial. Man war stets darauf bedacht, gute Sicht auf das umliegende Gelände zu behalten und einem möglichen Feind jede Deckung zu nehmen.
»Dort ist sie!«, rief Elisabeth und deutete nach vorn. »Ich kann den Bergfried sehen und die Ringmauer mit dem Torturm.«
Jeanne drängte sich neben sie ans Fenster. Je näher sie kamen, desto mehr Einzelheiten konnten die Frauen ausmachen. Die Französin nickte anerkennend.
»Das ist eine ordentliche Burg. Nicht so groß wie Unser Frauenberg, aber vielleicht ebenso gut gesichert. Sieh dir nur die beiden Ringmauern und die vielen Türme an.«
Die beiden Bewaffneten, die bis dahin hinter der Kutsche hergeritten waren, überholten sie nun und sprengten davon, um ihre Ankunft zu melden, damit die Brücke herabgelassen und das Tor geöffnet sein würde, wenn die Kutsche ihr Ziel erreichte.
»Ob es klug ist, dem Bischof eine solche Festung zu überlassen?«, fügte Jeanne nachdenklich hinzu.
Elisabeth wiegte den Kopf. »Ja, ich weiß nicht, ob er den Palas bequem und geräumig genug findet.«
Jeanne schnaubte undamenhaft durch die Nase. »Das habe ich nicht gemeint!«
»Ich weiß, was du gemeint hast, aber ich möchte keine weiteren Verleumdungen gegen den Bischof hören. Er hat eingesehen, dass seine Regierung dem Land schadet, und übergab deshalb alle politischen Geschäfte dem Pfleger von Wertheim. Das ist eine großmütige Tat, Würzburg und den Marienberg zu verlassen und sich hier in den dichten Wäldern auf den Zabelstein zurückzuziehen.«
»Ob das aus Einsicht herrührt? Ich dachte eher, das Kapitel und der fränkische Adel mussten ihn zu diesem Schritt zwingen«, murmelte das Kammermädchen.
Elisabeth runzelte die Stirn. »Du scheinst zu vergessen, dass er mein Vater ist.«
Jeanne lehnte sich wieder in die Polster der prächtigen Bischofskutsche zurück. »Nein, ich habe es nicht vergessen. Wie sollte ich? Müsste ich sonst nicht noch immer bei der Eselswirtin leben und den Männern Nacht für Nacht zu Diensten sein? Nur weil du seine Tochter bist, konntest du mich und Gret freikaufen.«
Elisabeth legte ihre Hand auf das Knie der früheren Dirne. »Denk nicht zurück. Vergiss die Zeit am besten.«
»Wie sollte ich?«, widersprach das Kammermädchen. »Kannst du einfach vergessen und den Träumen und Erinnerungen befehlen?«
Die Herrin seufzte. »Nein, das kann ich nicht. Bei Tage geht es recht gut, doch ich fürchte noch immer die Nächte.«
Jeanne nickte. »Ich weiß. Du sprichst oft im Schlaf. Von Else redest du und den anderen Frauen und von Meister Thürner, unserem Henker. Vergangene Nacht hast du von einem Ritter von Thann geredet.«
Fast ein Jahr hatte Elisabeth das Leben der Frauen in Elses Haus geteilt, nicht wissend, wer sie war und woher sie kam. Und auch nicht, woher der Schlag auf den Kopf gekommen war, der sie für so lange Zeit ihres Gedächtnisses beraubt hatte, bis die Erinnerungen endlich zurückkehrten.
Elisabeth zog eine Grimasse. »Ja, so manches verfolgt mich, auch wenn ich immer wieder erstaunt feststelle, dass nicht alle Erinnerungen an diese Zeit schlecht sind. Manches Mal ist es fast so, als würde ich die anderen Frauen vermissen.«
Jeanne lächelte. »Dass selbst du das sagst, die in einem Frauenhaus nichts verloren hatte! Nicht wie wir anderen. Es war unser Schicksal, dass unser Weg uns in Elses Haus brachte.«
»Nichts im Frauenhaus verloren?«, wiederholte Elisabeth, und ihre Stimme klang bitter. »Nein, nicht im Frauenhaus. Verloren habe ich mein Gedächtnis und damit meine Vergangenheit auf der Marienfestung durch den heimtückischen Anschlag der Männer, die meinem Vater ans Leben wollten.«
»Die beiden Ritter sind tot, und alles ist jetzt wieder gut«, beschwichtigte Jeanne die Freundin, die nun auch ihre Herrin war.
»Alles?«, sagte Elisabeth zweifelnd und richtete ihren Blick wieder auf die Burg vor sich, deren Mauern nun über ihnen aufragten und ihre Schatten über die Ostflanke warfen, die wie die Hänge im Norden und Westen steil abfiel. Nur nach Südosten war der Berg über einen mäßig ansteigenden Grat mit Pferd und Wagen zu erreichen. Hier sicherte ein tiefer Graben mit Türmen, Tor und Ziehbrücke den Zugang.
Die Räder des Wagens rumpelten über die Planken, und die Frauen erhaschten einen Blick in den von Unrat und Morast bedeckten Graben, ehe die Mauern sie umschlossen. Für einen Augenblick schwebten die Spitzen eines aufgezogenen Fallgitters über den Pferden und der Kutsche, dann fuhren die Reisenden in den Hof ein. Der Ruf des Kutschers ertönte, und die vier kräftigen Braunen kamen zum Stehen. Kurz darauf wurde der Wagenschlag aufgerissen, und der Kutscher half Elisabeth beim Aussteigen. Jeanne raffte ihre Röcke und kletterte hinterher. Staunend sah sie sich um.
»Bleib du bei unseren Kisten und sieh, wohin man sie bringt. Ich weiß nicht, wo unser Gemach sein wird«, wies Elisabeth sie an. Jeanne knickste und senkte den Blick.
»Jawohl, Herrin, wie Ihr wünscht«, sagte sie artig, wie sie es immer tat, wenn die beiden Frauen nicht alleine waren. Elisabeth fand zwar, dass sie es ein wenig übertrieb, Jeanne aber blieb dabei. Ob das Verhältnis zwischen Herrin und Kammermädchen so ihren Vorstellungen entsprach oder ob sie es sich irgendwo abgesehen hatte, wusste Elisabeth nicht. Und vielleicht war es ja ganz gut so, dass Jeanne darauf achtete, dass sie sich unter den scharfen Augen ihrer Umgebung so verhielten, wie man es von ihnen erwarten durfte. Ein zu vertraulicher Umgang mit ihren Mägden wäre ihrem eh schon ein wenig angeschlagenen Ruf vielleicht abträglich gewesen. Also erwiderte Elisabeth die Worte nur mit einem knappen Nicken und ließ Jeanne bei ihrem Gepäck zurück, während sie selbst dem Diener folgte, der sie die Stufen zum Palas hinauf und zu ihrem Vater brachte, dem von seinen Regierungsgeschäften abgesetzten Würzburger Fürstbischof Johann II. von Brunn.
»Sieht sie nicht ganz wunderbar aus, die Jungfrau Elisabeth, Eure liebreizende Tochter, verehrter Herr... ah... ich meine natürlich Eure bischöfliche Gnaden.«
Wieder einmal spürte Elisabeth den Drang, sich unter dem spöttischen Blick des Hofnarren zu ducken, doch sie unterdrückte ihn und richtete sich stattdessen noch ein wenig stolzer in ihrem Scherenstuhl auf.
Friedlein war für einen Mann ein wenig klein gewachsen, gar einige Zoll kleiner als Elisabeth, dafür von kräftigerem Körperbau. Sein linkes Bein war ein wenig kürzer als das andere und zwang ihn zu einem hinkenden Gang, sein Gesicht, das von dunklem, fast schwarzem Haar umrahmt wurde, wirkte irgendwie schief. Die grünen Augen dagegen sahen hell und klar in die Welt und sandten einen solch intensiven Blick aus, dass man ihm nur schwer standhalten konnte.
Er war ein intelligenter Mann, wortgewandt und voller Scharfsinn, wenn es darum ging, die politische Lage einzuschätzen. Vielleicht hatten seine körperlichen Mängel ihm den Posten als Berater eines Fürsten verwehrt, sodass er ins Narrengewand schlüpfte, um seine Meinung kundtun zu können und auch gehört zu werden. Bischof Johann jedenfalls schätzte die Ansichten seines Hofnarren, der von jeher mehr Ratgeber denn Possenreißer gewesen war.
Elisabeths Gefühle dem Mann gegenüber waren gemischt. Sie achtete seinen klugen Geist, fürchtete sich aber ein wenig vor seiner scharfen Zunge, denn einen Vorteil hatte der Posten des Narren für Friedlein allemal: Er durfte viel mehr aussprechen, ohne die Entlassung oder eine Strafe befürchten zu müssen, als andere Berater. Eine scharfe Zunge war bei einem Hofnarren geschätzt, bei Ratgebern nur selten. Und gerade deshalb fühlte sich Elisabeth, seit sie die Schande ihrer Zeit im Frauenhaus mit sich trug, in seiner Gegenwart unwohl. Bildete sie sich das nur ein oder legte er eine besondere Betonung auf das Wort Jungfrau?
Er konnte um ihr Geheimnis nicht wissen. Ihr Vater würde nicht über diese Schmach sprechen, nicht einmal mit dem von ihm so hochgeschätzten Friedlein. Das hoffte sie zumindest. Vielleicht bezog sich der Spott ja auch auf den jungen Domherrn Albrecht von Wertheim, der für sie bereit war, der kirchlichen Laufbahn, die er eben erst begonnen hatte, wieder zu entsagen. Dachte der Narr, sie habe seinem Werben bereits zu weit nachgegeben?
Nun, diese Vermutung war für sie weniger gefährlich, als wenn er in ihrer Vergangenheit kramen und das Jahr, das sie angeblich im Kloster verbracht hatte (wie die offizielle Erklärung ihres Verschwindens lautete), näher untersuchen würde.
»Ja, meine Tochter sieht prächtig aus, Friedlein«, bestätigte Johann von Brunn mit Stolz. »Komm her, meine Liebe. Es ist schön, dass du dich doch noch besonnen hast, das schwere Los, das man mir aufgebürdet hat, mit mir zu teilen.«
Elisabeth schüttelte den Kopf. »Nein, Vater.« Die Anrede schmeckte noch immer ein wenig seltsam, obgleich sie früher als Kind keine Schwierigkeiten damit gehabt hatte. »Ich komme nur, um nach Euch zu sehen und mich davon zu überzeugen, dass Ihr Euch wohl befindet.«
»Und dann? Wirst du sogleich zu Unser Frauenberg zurückkehren?« In seinem Tonfall schwang die Kränkung mit.
»Ja«, antwortete sie nur. Er wusste von ihren Plänen. Warum sie noch einmal aussprechen? Der Hofnarr schien allerdings nichts dabei zu finden, die Wunde noch einmal aufzureißen.
»Sie wird den jungen Domherrn Albrecht von Wertheim ehelichen, wenn er kein Domherr mehr ist, sondern wieder Ritter. Nicht mehr Euer Ritter natürlich, Exzellenz. Nein, ich vermute, eher der seines Bruders, des Pflegers Johann von Wertheim, der Euch als Bischof folgen wird, wenn Ihr – wie von vielen bereits sehnsüchtig erwartet – bald für immer die Augen schließt.«
Elisabeth zuckte zusammen und warf ihrem Vater einen Blick zu. Der schien sich nicht wirklich zu ärgern, obwohl er einen leeren Zinnbecher ergriff und nach seinem Hofnarren warf, der diesem jedoch geschickt auswich. Der Becher prallte gegen die Wand und blieb verbeult am Boden liegen.
»Vater, ich liebe Albrecht«, sagte Elisabeth. Sie ignorierte Friedlein, der spöttisch »Oh, die Liebe! Welch starke, himmlische Macht« murmelte.
»Steht es nicht schon in der Bibel, dass die Tochter ihr Vaterhaus verlassen und ihrem Gatten nachfolgen wird?«
»Du hast ja recht, meine Liebe, dennoch hätte ich dich gerne um mich. Geradina ist erst seit einer Woche hier, und ich muss gestehen, sie geht mir jetzt schon auf die Nerven.«
Elisabeth erwiderte nichts. Was sie über die jüngste einer ganzen Reihe von Mätressen des Bischofs dachte, behielt sie lieber für sich. Dass sich ihr Vater mit seinen mehr als siebzig Lebensjahren überhaupt noch mit Mätressen umgab, konnte ihr nicht gefallen, selbst wenn er nicht Bischof gewesen wäre. So schwieg sie lieber und ergriff die ihr entgegengestreckte Hand, um einen Kuss auf den Ring zu hauchen. Er war mit einem wertvollen Edelstein geschmückt, zeigte aber nicht das Siegel des Würzburger Fürstbischofs. Natürlich, das Siegel hatte der Vater in die Hände des Pflegers legen müssen, der nun die Regierungsgeschäfte für ihn übernahm, um das Land aus seinen zerstörerischen Fehden zu führen und vor allem von der drückenden Schuldenlast zu befreien, an der Johanns leichtfertige Lebensweise maßgeblich Schuld trug.
Ja, seine verschwenderische Hofhaltung und seine Schwäche für Mätressen musste sie ihm zur Last legen, und dennoch sah sie ihn mit gemischten Gefühlen entmachtet im Saal der Burg sitzen, die die Domherren ihm für seine letzten Jahre bis zu seinem Tod zugewiesen hatten. Bis es so weit sein würde, durfte er sich noch Bischof nennen. Das zumindest hatten sie ihm nicht genommen. Zu Elisabeths Überraschung schien ihr Vater recht guter Dinge zu sein und sich über den Verlust seiner Macht nicht zu grämen, abgesehen davon, dass er betonte, mit den wenigen Gulden, die das Kapitel ihm zubilligte, nicht weit zu kommen.
»So schlimm steht es doch gar nicht«, widersprach Elisabeth. »Ihr habt die Burg Zabelstein und Schloss Aschach mit allen Gütern und Einkünften zugesprochen bekommen und dreitausend Gulden jährliche Leibding.«
Der Bischof seufzte, sein Narr aber lachte.
»Dreitausend? Was sind dreitausend Gulden, wenn man einen fürstlichen Hof führen will?«
Elisabeth dachte an die wenigen Pfennige, die ein Handwerker am Tag verdiente, ja, und an die Münzen, die sie sich im Frauenhaus so schwer hatte verdienen müssen. Dreitausend Gulden! Es war für sie fast unvorstellbar, dass man in einem Jahr so viel Geld ausgeben konnte. Und dennoch hatte auch sie früher leichtfertig in die Schatulle des Vaters gegriffen, um sich teure Gewänder nähen zu lassen, Geschmeide anzufertigen oder die wundervollen Pferde zu kaufen, die sie so gerne ritt. War es nicht scheinheilig, wenn sie, die Tochter der Sünde, ihm Vorhaltungen machte?
Vielleicht ahnte der Bischof ihre Gedanken, denn er erhob sich schwerfällig aus seinem tiefen Polsterstuhl.
»Du darfst dich nun zurückziehen, meine Tochter, und ein Gewand anlegen, das meine Sinne erfreut. Ich werde nach dem Küchenmeister rufen lassen und ihm auftragen, eine besonders reiche Tafel zur Feier des Tages zu richten.«
Elisabeth erhob sich ebenfalls. »Das ist nicht nötig, Vater. Ich esse nicht viel. Ein leichtes Mahl wird mir genügen.«
»Das waren die falschen Worte«, tadelte der Hofnarr, dem die finstere Miene des Bischofs ebenfalls nicht entgangen sein konnte. »Wisst Ihr denn nicht mehr, dass es nur wenige Dinge gibt, die Seiner Exzellenz mehr Vergnügen bereiten als eine wohl gedeckte Tafel, die sich unter der Last der Speisen zu biegen scheint? Wobei der Wein natürlich nicht fehlen darf. Nein, wenn ich nachdenke, fällt mir nicht viel anderes ein, das ihm ein heiteres Gemüt und ein strahlendes Antlitz bereitet – und das, was mir sonst noch in den Sinn kommt, wäre in diesem Rahmen nicht anständig zu erwähnen«, fügte er mit einem unverschämten Grinsen an. »Ja, Essen und Trinken ist die Lust der späten Jahre, denn die Zeiten, da der Herr verwegen zur Jagd geritten ist und bei seinen Turnieren sich am liebsten selbst in den Sattel geschwungen hat, sind wohl vorbei.«
»Ich bin noch immer ein guter Reiter!«, widersprach der Bischof.
»Aber ja, Herr, keiner macht im Sattel eine so gute Figur wie Seine Exzellenz«, sagte Friedlein mit Spott in der Stimme, sodass der Bischof vermutlich erwog, noch einen Becher nach seinem Narren zu werfen. Er entschied sich dagegen, rief stattdessen einen Diener und verabschiedete Elisabeth mit freundlichen Worten.
»Wie schön, dass ihr wohlbehalten zurück seid!«, schallte es ihnen entgegen, als Elisabeth und Jeanne einige Tage später vom Zabelstein nach Würzburg zurückkehrten.
Eine burschikos wirkende Frau mit flammend rotem Haar, von dem einige Strähnen unter ihrer Haube hervorlugten, eilte mit ausgebreiteten Armen auf die Kutsche zu und schloss dann Jeanne in die Arme, dass deren Rippen knackten und sie vor Empörung aufschrie. Elisabeth schenkte sie nur ein Lächeln und ein Kopfnicken. Sie hier im Hof der Festung Marienberg zu umarmen wäre unschicklich gewesen.
»Ich grüße dich, Gret«, erwiderte Jeanne, als sie wieder zu Luft kam. »Du hast dich doch nicht etwa um uns gesorgt? Dass wir in die Hände von Strauchdieben gefallen sind oder in die eines der unzähligen Ritter, die der Bischof erzürnt hat und die ihm deswegen den Fehdebrief geschickt haben?« Sie zwinkerte vergnügt.
Gret winkte ab. »Aber nein, warum sollte ich mir um dich Sorgen machen? Unkraut vergeht nicht.« Jeanne stieß einen Ruf der Empörung aus und knuffte Gret am Oberarm. Doch die Küchenmagd sprach weiter, als sei nichts geschehen.
»Nein – wenn, dann galt meine Sorge unserer zarten Elisabeth.«
Diese zog eine Grimasse. »Zart? Ich glaube, die Zeiten sind schon lange vorbei. Aber danke, dass du dich gesorgt hast. Bist du zur Messe gegangen und hast für unsere sichere Rückkehr gebetet? Hast gar eine Kerze für uns gestiftet?«, fügte sie neckend hinzu.
Gret grinste und schüttelte den Kopf. »Nein, so weit bin ich nicht gegangen. Obwohl sich hier auf dem Marienberg einiges geändert hat, seit Pfleger Johann das Zepter schwingt. Die Kapläne lesen regelmäßig die Messe, und es geht sogar manch einer hin, um zuzuhören. Und auch der Pfleger selbst ist ungewöhnlich häufig in der Kirche anzutreffen.«
»Im Gegensatz zu Bischof von Brunn früher«, ergänzte Jeanne, brach dann aber ab, als Elisabeth das Gesicht verzog.
»Entschuldige bitte, ich wollte nichts Schlechtes über deinen Vater sagen.«
»Was wahr ist, darf man auch sagen«, widersprach Gret.
Elisabeth nickte. »Es entspricht leider der Wahrheit, dass der Bischof viele Jahre seine seelsorgerischen Pflichten arg vernachlässigt und selbst seine eigene Kirche hier auf der Burg nur selten betreten hat«, gab Elisabeth zu, doch dann wurde ihre Aufmerksamkeit von jemandem in Anspruch genommen, der oben auf den Stufen erschien, die zum großen Festsaal und zu den Gemächern der Fürstbischöfe im alten Palas führten.
Elisabeth merkte selber, wie sich ein Strahlen über ihrem Gesicht ausbreitete. Gret stieß Jeanne in die Rippen, und die beiden tauschten Blicke.
»Albrecht!« Sie war ihm die ersten Schritte bereits entgegengeeilt, als sie sich der beiden Freundinnen erinnerte, die noch immer neben der Kutsche standen.
»Ihr verzeiht?«
Die beiden lächelten. »Aber ja, gnädiges Fräulein«, sagte Gret mit warmer Stimme. »Geh du nur zu deinem Liebsten. Musst du da erst deine Mägde um Erlaubnis fragen?«
»Nein, das nicht, aber es ist nicht höflich, einfach so davonzulaufen.«
Gret verbeugte sich. »Dann danken wir für die höfliche Rücksicht. Und nun mach, dass du fortkommst!«
Doch statt dem Drängen zu folgen, ihm entgegenzulaufen, raffte Elisabeth den Saum ihres langen Reisekleides nur einige Zoll und ging, wie es sich gehörte, gemessenen Schrittes auf ihn zu. Albrecht kam ihr entgegen, und obgleich er heute wieder das lange Gewand der Domherren trug und nicht wenige Leute im Hof unterwegs waren, umarmte er sie kurz, als sie endlich vor ihm stand. Dass er sie gerne auch geküsst hätte, konnte sie in seiner Miene lesen. So weit ließ er sich jedoch nicht treiben.
»Ich habe sehnsüchtig die Tage gezählt, bis du endlich wieder da bist«, sagte er überschwänglich, obwohl sie kaum mehr als eine Woche auf dem Zabelstein geweilt hatte. »Komm, lass uns ein paar Schritte spazieren gehen, und berichte mir, wie es dir ergangen ist.«
Elisabeth willigte gerne ein. Es war für sie die einzige Möglichkeit, alleine miteinander zu sprechen, ohne Anstoß zu erregen. Im großen Saal war immer ein Kommen und Gehen. Ungestört würden sie dort nicht sein. Sich ohne Begleitung in ein Gemach zurückzuziehen kam gar nicht infrage. Das hätte zu Recht Anlass zu Gerede gegeben. Nicht, dass man es hier auf der Bischofsburg unter Johann von Brunn mit der Moral besonders genau genommen hätte. Aber gerade die über Jahre hinweg üblichen Ausschweifungen würden den Schluss nahelegen, dass es mit Elisabeths Moral ebenfalls nicht weit her sei. Und das konnten weder Albrecht noch Elisabeth wünschen. Lag nicht schon allein durch ihre uneheliche Geburt ein unauslöschlicher Schatten auf ihr? Ein Schatten, den die Menschen gern zu übersehen bereit waren, solange es sich bei dem Vater um einen hochadeligen und mächtigen Mann handelte!
Sie schritten zwischen dem Gewirr kleiner, aus Holz errichteter Häuser hindurch, das den Innenhof der Festung weitgehend ausfüllte, vorbei an der Basilika und der hohen Warte, die sich weithin sichtbar aus der Mitte des Hofes erhob. Die Wächter verbeugten sich höflich, als sie das innere Tor und die vorgelagerte Barbakane zur Vorburg durchschritten. Für einige Augenblicke blieben sie an der Pferdeschwemme stehen, durch die zwei Knechte gerade die prächtigen Rappen trieben, die der Bischof erst vor einigen Wochen erstanden hatte. Nun gehörten sie zum Besitz der Festung und wurden von Albrechts Bruder verwaltet, wie er sagte. Vielleicht würde er sie verkaufen. War nicht jeder Gulden in dieser misslichen Lage, in der sich das Bistum befand, wichtig?
Elisabeth versuchte, keinen Groll zu empfinden. Diese schönen Pferde standen weder ihr noch ihrem Vater zu. Rasch wandte sie sich ab und folgte Albrecht durch das äußere Tor. Als sie von den Wachen nicht mehr gesehen werden konnten, blieben sie stehen. Albrecht wandte sich ihr zu. Seine Hände verharrten einen Moment reglos in der Luft. Erst als sie seine lautlose Frage mit einem leichten Nicken beantwortete, legte er seine Arme um sie und zog Elisabeth an sich. Zart küsste er sie auf den Mund.
»Du musst dir keine Sorgen machen. Alles wird gut«, bekräftigte er, obwohl sie ihre Sorgen noch gar nicht geäußert hatte.
»Wir werden uns schon bald ein eigenes Haus suchen, in dem wir leben können. Vielleicht in Würzburg, ich weiß es noch nicht. Ach, ich stelle es mir wunderbar vor heimzukommen und von meiner Hausfrau – meiner Elisabeth – erwartet zu werden.« Er strahlte sie an.
»Wir werden Unser Frauenberg verlassen?«, hakte sie erstaunt nach. »Aber warum denn? Warum die Eile? Ich habe meine Gemächer, und auch du bist gut untergebracht. Wir können eine Hochzeit doch nicht so überstürzen. Das würde deiner Familie nicht gefallen. Und du dachtest doch nicht etwa daran, mit mir vor der Eheschließung ein gemeinsames Haus zu beziehen?«
»Nein, natürlich nicht«, rief er entrüstet. »Ich würde nichts tun, an dem dein Ruf Schaden nehmen könnte. Ich würde natürlich bis zu unserer Hochzeit nicht bei dir wohnen können, aber wenn du dein Kammermädchen hast und ich eine ältere Cousine zu deiner Gesellschaft so lange dort einquartieren würde, dann sollte niemand Anstoß daran nehmen.«
»Ich habe hier meine Gemächer«, wiederholte Elisabeth.
Nun schien Albrecht verlegen. »Ja, ich weiß. Dein Vater hat sie dir eingerichtet, aber er ist nicht mehr Herr dieser Festung, weißt du, und wenn nun der Pfleger oder ein anderer Obmann die Burg führt, wird er hier einziehen und die Räume des Bischofs übernehmen.«
Elisabeth dämmerte, wovon er sprach. Warum war sie noch nicht selbst darauf gekommen? »Ich muss aus meinen Gemächern, die ich seit meiner Kindheit bewohnt habe, ausziehen?«
Albrecht nickte mit zerknirschter Miene. »Ja, leider ist es so. Und es wäre gut, wenn es bald geschehen würde...«
»Sagt wer?«, gab Elisabeth kriegerisch zurück. Obwohl sie einsah, dass er recht hatte, wollte sie sich nicht so plötzlich ihres Heims verweisen lassen.
»Der Pfleger, dem das Kapitel die Rechte und Pflichten des Bistums und des Landes übertragen hat«, antwortete er ein wenig steif.
»Dein Bruder Johann?«, wiederholte sie ungläubig, obwohl das auch in ihrem Sinne sein musste. Wie konnte sie mit einem Domherrn zusammen im Palas leben? Nein, er war mit seiner Forderung im Recht, und dennoch ärgerte sie die Eile, mit der er ihr ihr Heim zu entziehen suchte. Und dass er mit seinem Bruder darüber gesprochen hatte statt mit ihr selbst. Stand ihr nicht wenigstens das zu? Oder würden stets Männer über ihr Geschick entscheiden?
»Er ist auf unserer Seite«, versicherte Albrecht. »Du darfst ihm nicht zürnen. Es würde sich wirklich nicht schicken. Nein, es ist ganz unmöglich, dass du hier im Palas des Marienberges bleibst.«
Resignierend hob sie die Schultern. »Nun gut, dann sei es so, wie es sein muss. Warum aber in Würzburg ein eigenes Haus? Wird dein Vater nicht wollen, dass du erst einmal auf die elterliche Burg heimkehrst, und dir dann eine seiner Festen überlassen?«
Albrecht wand sich. »Ja, vielleicht, das weiß ich nicht.«
»Du weißt es nicht? Ja hast du denn mit deinem Vater nicht darüber gesprochen?«
»Nein, noch nicht; ich werde es jedoch beizeiten tun.«
Elisabeth runzelte die Stirn. »Ihr habt über die Hochzeit gesprochen, aber nicht darüber, wo wir wohnen werden? Das verstehe ich nicht.« Als Albrecht schwieg und den Blick abwandte, wurde es ihr klar.
»Du hast noch gar nicht mit deinem Vater gesprochen? Warum denn nicht? Hat er unserer Verbindung nicht immer wohlwollend entgegengesehen? Er weiß, dass du dich mir versprochen hast.«
»Ja, das ist wahr. Das war bevor... nun ja... ehe all das geschehen ist.« Er machte eine ausholende Geste, die sie und die ganze Festung erfasste.
Elisabeth wich ein Stück zurück. Hatte er von ihrer Schande erfahren? Wusste er von ihrem Jahr im Frauenhaus? Und wusste auch sein Vater davon und lehnte sie deshalb als Gemahlin seines Sohnes ab? Verständlich, aber wie konnte das sein? Noch ehe sie die Frage formulieren konnte, wurde ihr klar, dass Albrecht nicht davon sprach, was ihr geschehen war.
»Stört er sich an meiner unehelichen Geburt?« Sie blickte Albrecht provozierend an. Er blieb stumm.
»Davon wusste er, seit er mich als Kind das erste Mal sah, und dennoch hatte er früher nichts dagegen einzuwenden, dass ich die Tochter des Bischofs bin.«
»Das schon. Nun ist die Lage jedoch eine andere«, sagte er schwach.
»Du meinst, jetzt, nachdem mein Vater seiner Regierungsgeschäfte enthoben und in die Verbannung geschickt wurde, bin ich keine geeignete Gattin mehr für seinen Sohn, weil Bischof von Brunn nun kein Geld und keine Macht mehr an die Mitglieder seiner Familie und Verbündeten vergeben kann, nicht wahr? Denn darin war er stets mehr als großzügig. Ja, ich erinnere mich, das war einer der Vorwürfe, weswegen das Domkapitel ihn absetzte. Aber das war es auch, was mich in den Augen deines Vaters – trotz des Makels meiner Geburt – als geeignete Braut erscheinen ließ. Ich verstehe. Dieser Vorteil ist nun geschwunden, und nur der Makel ist geblieben.«
»Sprich nicht so«, bat Albrecht und griff nach ihren Händen, doch sie entzog sie ihm und wich zurück.
»Ist es nicht wahr?«
Er wand sich, nickte dann aber kleinlaut. »Ja, doch du darfst nicht denken, dass ich seine Ansichten teile. Mir ist es gleich, ob eine Ehe mit dir meiner Familie Vorteile bringt oder nicht. Nur du bist mir wichtig! Ich brauche weder das Geld noch die Pfründe, die dein Vater verteilen konnte«, fügte er leidenschaftlich hinzu.
Nun war es Elisabeth, die nach seinen Händen griff. »Ich glaube dir. Aber so einfach ist es nicht. Wie stellst du dir das vor? Willst du mich gegen den Willen deines Vaters und ohne sein Wissen heiraten und darauf hoffen, dass er dir irgendwann vergibt? Wovon sollen wir leben, wenn du in Ungnade fällst? Wie du weißt, habe ich keine üppige Mitgift mehr zu erwarten!«
Ein trotziger Zug trat in seine Miene. »Mein Bruder steht noch immer hinter mir. Er hat nichts dagegen, wenn ich dich heirate, und wird mich in sein Gefolge nehmen. Jetzt ist er erst Pfleger des Stifts, aber wenn der Bischof endlich...« Er hielt inne und setzte neu an. »Ich meine, später, wenn vom Kapitel ein neuer Bischof gewählt wird, dann werden sie ihn in das hohe Amt berufen, so steht es im Vertrag. Dann haben wir keine Sorgen mehr, ganz gleich, was mein Vater dazu sagt. Mein Bruder Johann wird unser Schirm und Schutz sein. Dafür stehe ich mit meinem Schwert an seiner Seite. Ich denke, er wird uns dann auch einige Räume hier auf der Festung zur Verfügung stellen, sodass du in dein Heim zurückkehren kannst – wenn auch sicher nicht in die Gemächer deiner Kindheit«, fügte er rasch noch hinzu. Er wagte es, ihr Gesicht zwischen seine Hände zu nehmen und ihre Stirn zu küssen. Seine Stimme klang zärtlich.
»Mach dir keine Sorgen. Es wir alles gut. Deine Geburt ist nicht deine Schande. Sie ist die deines Vaters und deiner Mutter, die als eheliche Ratsherrenfrau ihren Gatten verlassen hat, um an der Seite des Bischofs jahrelang ein sündiges Leben zu führen. Du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen, und nur das zählt. Für mich liegt kein Schatten über dir. Du bist so glänzend rein wie die Jungfrau Maria im Himmel.«
Obwohl er ihr mit den Worten sicher hatte schmeicheln wollen, breitete sich in ihr Entsetzen aus, und Elisabeth taumelte zurück.
»Was ist, Geliebte? Du bist plötzlich so blass. Bekommt dir die Sonne nicht? Sollen wir zurückgehen?«
Elisabeth schüttelte heftig den Kopf. »Nein, das ist es nicht. Du irrst dich in mir. Ich bin ganz bestimmt nicht strahlend rein! Es wäre Blasphemie, mich mit der Jungfrau Maria zu vergleichen.« Rasch bekreuzigte sie sich. »Ich bin eine Sünderin! Nenn mich besser Magdalena. Nein, unterbrich mich nicht, ich muss es dir erzählen, bevor du dich an mich bindest, denn ich könnte es nicht ertragen, wenn du irgendwann einmal davon erfährst und dich dann getäuscht und verraten fühlst. Ich müsste sterben, wenn du dann deine Liebe von mir wenden würdest«, fügte sie leise hinzu.
»Jeder von uns ist ein Sünder«, sagte er sanft. »Nichts, was du getan haben könntest, würde meiner Liebe zu dir auch nur einen Streich versetzen.«
»Sag so etwas nicht so leichtfertig. Nicht, solange du nicht alles gehört hast«, gab Elisabeth mit erstickter Stimme zurück. Tränen traten ihr bei dem Gedanken in die Augen, welche Worte sie gleich würde aussprechen müssen, und bei der Furcht, Entsetzen und dann Ablehnung oder gar Abscheu in seinen Augen zu lesen. War ihr Traum heute und hier zu Ende? Was würde aus ihr werden, wenn Albrecht sich nun von ihr abwandte? Sie wagte kaum zu hoffen, dass seine Liebe stark genug war, die grausame Wahrheit zu überstehen.
Was blieb ihr dann noch? Vielleicht war der Wunsch ihres Vaters, sie in seiner Verbannung an seiner Seite zu wissen, ihre einzige Wahl. Und wenn er dereinst nicht mehr sein sollte? Nein, darüber durfte sie im Augenblick nicht nachdenken. Sonst würde sie der Mut verlassen, und sie würde die Kraft zu dieser Beichte nicht finden.
»Nun?«, half Albrecht nach, der ihren inneren Kampf aufmerksam verfolgte. »Was liegt dir so schwer auf dem Herzen? Lass mich dir deine Sorgen nehmen. Oder schweig, wenn es dir lieber ist. Ich verzeihe dir alles, auch ohne es aus deinem Mund gehört zu haben.«
Ach, wie verlockend die Versuchung sie umgarnte! Aber Elisabeth wusste, dass Albrechts Fantasie nicht so weit ging, den wahren Schrecken zu erfassen. Wie konnte sie! War dies nicht eine ganz unglaubliche Geschichte, die eigentlich so nicht geschehen konnte? Und doch hatte Elisabeth sie erlitten. Konnte eine unschuldige Liebe so stark sein, so etwas zu überdauern?
Elisabeth räusperte sich. »Du hast gehört, dass ich mich in ein Kloster zurückgezogen und ein Jahr lang unter den Nonnen gelebt habe.« Sie holte tief Luft, aber ehe sie weitersprechen konnte, unterbrach sie ein Ruf vom Tor her.
»Herr? Ach, hier seid Ihr! Ich habe Euch schon überall gesucht.«
Gunter, Waffenknecht und Diener des jungen von Wertheim, kam über die Wiese geeilt.
Albrecht wandte sich ihm zu. »Was ist denn? Du siehst, ich habe keine Zeit für dich.«
»Es ist wichtig, hat der Herr Pfleger, Euer Bruder, mir gesagt. Ich solle Euch sofort suchen und zu ihm bringen. So waren seine Worte, und wie kann ich etwas dagegen sagen?« Entschuldigend hob er die Achseln. »Jungfrau Elisabeth, es tut mir leid zu stören.«
Albrecht stieß etwas aus, das ein wenig nach einem Fluch klang. »Nein, natürlich konntest du nicht anders. Dann sage meinem Bruder, dass ich sogleich zu ihm komme. Ich geleite nur noch meine Dame zu ihren Gemächern.«
»Natürlich, Herr.« Gunter verbeugte sich hastig und eilte zur Festung zurück. Albrecht bot Elisabeth den Arm. »Mein Herz, wir müssen uns schon wieder trennen. Die Pflicht ruft. Du weißt, dass ich meinen Bruder nicht erzürnen sollte. Also verzeih die Unterbrechung. Beschwere deinen hübschen Kopf und dein liebes Herz nicht mit Zweifeln. Nichts und niemand wird uns unser Glück rauben können. Hab Vertrauen!«
Elisabeth schob die Hand in seine Armbeuge und ließ sich in die Festung zurückgeleiten. Sie schwieg. Nichts, was ihr auf der Seele brannte, hätte sie hier auf dem Weg so einfach erzählen können.
Kapitel 2
Da seid Ihr ja, mein Herr und Bischof«, sagte der Narr in seiner üblichen spöttischen Art, und auch seine Verbeugung war ganz und gar nicht ehrerbietig, wie ein Fürstbischof – auch ein entmachteter Fürstbischof? – es verlangen durfte. Er hatte seinen Herrn auf der Plattform des Bergfrieds hoch über dem Grund gefunden. Dort stand Johann von Brunn mit gefalteten Händen, an denen zahlreiche Juwelen funkelten, und sah mit gerunzelter Stirn über das Land, das sich nun nach Sonnenuntergang rasch verdunkelte.
»Was ist? Habt Ihr die vielen Stufen überwunden, um Euch selbst davon zu überzeugen, dass in Euren Ländereien alles zum Besten steht? Es herrscht Ruhe, und kein Feind ist in Sicht.«
»Meine Ländereien. Ja, wie beschaulich sie zu meinen Füßen liegen«, brummte der Bischof, und sein Narr wusste genau, was er damit sagen wollte.
»Überschaubar ist das rechte Wort«, sagte er mit einem liebenswürdigen Lächeln.
»Genau«, rief Bischof von Brunn erbost. »Früher habe ich über Ländereien geherrscht, die man in mehreren Tagen nicht durchreisen konnte...«
»Bis Ihr sie dann nach und nach alle verkauft und verpfändet habt«, wagte der Narr ihn zu erinnern.
»Ach, schweig! Was verstehst du von Politik?«
Friedlein legte die Stirn in Falten. »Dass sie auszuüben viel Geld kostet und dass ihr Fehlen zu Langeweile führt, vielleicht?«
In der Miene des Bischofs stand zuerst Ärger, doch dann schmunzelte er. »Ja, vielleicht hast du wie üblich den Kern getroffen. Mir fehlt nicht nur das Geld für meine Hofhaltung, mir fehlt das ganze Leben auf dem Marienberg.«
»Und die so unterhaltsamen Streitereien mit dem Domkapitel, dem fränkischen Adel und Eurer Stadt Würzburg«, fügte der Narr hinzu.
Der Bischof lachte und nickte. »Ja, auch das, mein Lieber, auch das. Es ist lange keine Abordnung mehr bei mir gewesen, um sich zu beschweren und mich zu ermahnen, mein verschwenderisches Leben zu ändern.«
Inzwischen war es dunkel geworden.
»Wollen wir hinuntersteigen und nachsehen, ob Euer Koch nicht etwas zustande gebracht hat, das Eure Stimmung zu heben im Stande wäre? Ach, und wenn wir von gehobener Stimmung sprechen: Geradina hat nach Euch gefragt. Sie wartet bestimmt schon im Saal, um all Eure Wünsche zu erfüllen.«
Der Bischof schnaubte durch die Nase. »Ha, es liegt bestimmt nicht in der Macht dieses Weibes, mir meine Wünsche zu erfüllen! Was bildet sie sich ein?«
»Sie ist ein Weib«, sagte der Narr mit einem Schulterzucken, als sage dies alles.
»Ja, sie ist nur ein Weib«, bestätigte der Bischof und machte sich an den beschwerlichen Abstieg. »Und sie ist schon viel zu lange um mich. Sie langweilt mich. Ich werde sie wegschicken und mir etwas anderes nehmen. Ich habe da schon ein Mädchen im Blick, das sich über die Ehre, von mir erwählt zu werden, sicher beglückt zeigen wird.«
Ausnahmsweise schwieg der Hofnarr. Er ließ seinen Blick über die Gestalt des Bischofs gleiten. Alt war er, das Gesicht rot, der Leib aufgedunsen von Wein und Schlemmerei. Was allerdings viel schwerer wog: Er hatte keine Macht, keine Vergünstigungen und kein Geld mehr zu bieten, um mit seinem unzüchtigen Ansinnen Begehrlichkeit zu wecken.
»Was machst du denn für ein Gesicht?«, forschte Gret nach, als sich die Frauen nach Einbruch der Dunkelheit auf der Schütt, ihrem Lieblingsplatz, der aufgeschütteten Bastion auf der Mainseite vor dem Fürstenpalas, trafen. Der Herbst nahm bereits seinen Lauf, die Blätter fielen, und mit ihm kam die Nacht jeden Tag ein wenig früher, der Wind wurde stürmischer und kälter. Bald würden sie sich im Innern der Festung ein Plätzchen für ihre heimlichen Zusammenkünfte suchen müssen. Heute jedoch schenkte der Herbst ihnen einen schönen Abend, den man mit einem warmen Umschlagtuch um die Schultern wohl ertragen konnte. Elisabeths Umhang war aus kostbarem Stoff, bestickt und mit Pelz gefüttert, die von Gret und Jeanne aus grob gewebter Wolle.
Elisabeth ließ den Blick den Schlossberg hinunterwandern zur Vorstadt mit ihren drei Klöstern und dann über den dunklen Main, dessen schäumende Flut die stolze Brücke überspannte. Am anderen Ufer erhob sich die Stadt. Das prächtige Würzburg mit seinen Mauern und Türmen, dem Dom, dem Neumünster und den anderen Kirchen, die sich noch vor dem zunehmend dunkleren Abendhimmel abhoben.
»Heilige Jungfrau, es ist geschehen?«, stieß Jeanne aus. »Du hast es ihm gesagt, nicht wahr?«
»Und er ist mit Entsetzen vor dir zurückgewichen«, knurrte Gret empört, obwohl Elisabeth noch keinen Ton erwidert hatte.
»Nein, ist er nicht, oder? Er ist nun vielleicht ein wenig verwirrt, aber er wird zu seinem Wort stehen. Nicht wahr? Er ist ein Ritter!« Jeanne drückte drängend Elisabeths Hand.
Gret schnaubte. »Ha, ein Ritter, mit den berühmten Tugenden, die man vielleicht in alten Sagen findet, aber nicht bei denen, die heute unter uns leben. Jeanne, du bist ein Schaf. Ritter oder nicht, er ist ein Mann, der kein Weib vor den Altar führen wird, das bereits mehr als ein anderer besessen hat.«
Elisabeth unterdrückte ein Stöhnen.
»Gret! Wie kannst du so herzlos sein, so etwas zu sagen?«, rief Jeanne.
»Was wahr ist, muss man auch sagen, sei es nun herzlos oder nicht. Ich habe sie ja gewarnt, wieder und wieder, aber du bist so blind, dass du sie auch noch in ihrem Wahnsinn bestärkt hast! Nun ist das Unglück geschehen, und keiner kann die Worte mehr zurücknehmen.«
Die beiden standen sich mit erbostem Gesichtsausdruck gegenüber, die Hände in die Hüften gestemmt, und funkelten einander an, bis Elisabeth zwischen sie trat.
»Schluss jetzt, ihr beiden! Ihr ereifert euch ganz unnötig. Nichts ist passiert, denn ich habe es Albrecht immer noch nicht gesagt.«
»Endlich ist sie zur Vernunft gekommen«, rief Gret, während Jeanne wissen wollte, was sie noch immer davon abhalte.
»Du willst doch nicht etwa auf Gret hören? Tu das nicht. Gott wird dich strafen, wenn du deine Liebe auf einer Lüge aufbaust!«
»Blödsinn!«, fiel ihr Gret ins Wort. »Alle Männer belügen und betrügen die Frauen. Hast du nicht einmal das in deiner Zeit im Frauenhaus gelernt, Jeanne? Warum sollte Elisabeth es nicht auch so halten?«
»Und wenn er es irgendwann herausfindet?«, entgegnete Jeanne.
»Das wäre nicht gut, aber dennoch nicht so schlimm, als wenn er es jetzt schon erführe und sie gar nicht erst heiratete. Er würde ihr böse sein und sich hintergangen fühlen, aber er würde nicht so weit gehen, sie zu verstoßen. Zu viel der Schande bliebe an ihm selbst hängen. Nein, es könnte nur in seinem Interesse sein, die Sache zu vertuschen und nach außen eine gute Miene zum bösen Spiel zu zeigen.«
»Nur wenn wir alleine wären, würde er mich seine Verachtung spüren lassen, ja mich hassen für das, was ich ihm angetan habe«, sagte Elisabeth leise. »Meinst du, so könnte ich leben?«
»Es ist besser, als ohne Freunde, Geld und Ehemann auf der Straße zu stehen. Du müsstest wissen, wohin das eine Frau treibt«, antwortete Gret brutal.
Elisabeth nickte. »Ja, ich habe es erfahren, und dennoch kann ich mein Leben und meine Liebe nicht auf einer Lüge aufbauen. Ich werde nicht mit ihm vor den Altar treten, ohne ihm alles gebeichtet zu haben.«
Jeanne drückte ihr warm die Hände. »Du tust das Richtige, Liebes.«
Gret dagegen schnaubte. »Dann wirst du gar nicht vor den Altar treten, so wahr ich hier stehe. Kein Mann wird dich heiraten, wenn er die Wahrheit kennt.«
»Nun, dann muss ich eben ein anderes Leben wählen.« Sie reckte sich ein wenig und sah die Freundinnen fest an. »Meine Entscheidung ist unumstößlich!«
»Sie ist so stolz und edel«, seufzte Jeanne.
»Nein, nur dumm, obwohl sie es besser wissen sollte«, widersprach Gret, doch dann lächelte sie, und ihre Miene wurde weich. »Und dennoch bin ich für immer deine Schwester, mit allem, was mir möglich ist.«
»Ich auch!«, rief Jeanne. »Ich werde immer für dich da sein, Lisa, egal, was das Schicksal dir noch bringen mag.«
Elisabeth umarmte beide. Tränen der Rührung standen ihr in den Augen. »Wenn mir früher einmal jemand gesagt hätte, ich würde die edelsten Geschöpfe auf Erden in einem Frauenhaus finden, ich hätte ihm nicht geglaubt.«
»Früher hätte niemand in deiner Gegenwart gewagt, so etwas Sündiges wie ein Frauenhaus auch nur zu erwähnen«, entgegnete Gret trocken.
Als Elisabeth am nächsten Morgen die Augen aufschlug, drangen ungewohnte Laute zu ihrem Gemach herauf. Sie schlug die Decke zurück und sprang aus dem Bett.
»Was ist denn dort drunten los?«, fragte sie Jeanne, die wie üblich bei der ersten ihrer Bewegungen herbeigeeilt kam, um nach den Wünschen ihrer Herrin zu fragen.
Jeanne hob die Schultern. »Ich weiß es nicht. Ich war noch nicht unten. Ich wollte nicht riskieren, dass du erwachst und ich nicht da bin.«
»Übertreibst du es nicht ein wenig mit deinen Pflichten?«
»Ist es klug, eine Magd so etwas zu fragen?«, gab Jeanne mit einem schelmischen Lächeln zurück. »Was ist, wenn ich dies als Aufforderung verstehe, meine Arbeit zu vernachlässigen?«
»Dann zause ich dir das Haar und schimpfe ganz fürchterlich mit dir«, antwortete Elisabeth mit einem Lachen. »Nun gut, dann hilf mir schnell in mein Gewand, und lass uns sehen, was der ungewohnte Aufruhr im Hof bedeutet.«
Sie mussten hinaus in die Vorburg, um eine Antwort auf ihre Frage zu finden. Im großen Burghof um die Warte trafen sie bereits auf einige ihnen unbekannte Männer, die schwer beladen mit Kisten und Bündeln scheinbar ziellos durcheinanderliefen, während ein kleines Männchen versuchte, Ordnung zu schaffen.
»Was hast du da? Nein, das muss in den Keller hinunter. Dort drüben, und stell es irgendwohin, wo es feucht ist. Feucht und dunkel, hast du gehört, sonst verdirbt alles! Und du? Halt, wohin gehst du? Ins Zeughaus? Blödsinn, trag es in die große Halle. Wir werden die Kiste später selbst auspacken. Und sei vorsichtig, du Tölpel. Lass sie auf keinen Fall herunterfallen. He, Bursche, ja, du dort drüben, komm her und fass mit an, dass er die Kiste heil die Treppe hochbekommt.« Das Männlein wischte sich den Schweiß von der Stirn und ließ den Blick schweifen, bis er an zwei Burschen hängen blieb. »Nein, was macht ihr denn? Vorsicht! Vorsicht!«, er rannte mit seltsam tippelnden Schritten davon, um dem einen eine kleine Kiste zu entreißen. Mit einem Seufzer barg er sie an seiner Brust und wiegte sie ein paar Mal, als halte er ein Kind in den Armen. Elisabeth und Jeanne tauschten belustigte Blicke. Was ging hier vor sich? Natürlich kamen hier immer wieder Händler mit Waren auf die Festung. Die Lieferungen reichten von den verschiedenen Nahrungsmitteln, die die zahlreichen Bewohner täglich benötigten, bis hin zu edlen Pferden, luxuriösen Stoffen und Geschmeide. So einen Auflauf hatte Elisabeth jedoch noch nicht erlebt.
Die Frauen passierten das innere Tor und die Barbakane und schritten über die Zugbrücke, zumindest bis zur Mitte, denn dort blieb Elisabeth wie angewurzelt stehen.
»Das ist doch nicht möglich«, hauchte sie.
Auch Jeanne blieb jetzt stehen und wandte sich ihr mit fragender Miene zu. »Was ist nicht möglich?«
»Georg«, hauchte Elisabeth, was Jeanne nicht weniger fragend dreinschauen ließ.
»Georg«, wiederholte Elisabeth ungläubig. Dann breitete sich ein Strahlen über ihrem Gesicht aus, und sie jauchzte: »Er ist zurück! Er ist tatsächlich wohlbehalten zurück!«
Jeannes Frage, von wem sie spreche, verhallte ungehört. Elisabeth raffte ihre Röcke und stürzte über die Brücke auf den Hof und in die Arme eines Mannes, der sich gerade rechtzeitig umdrehte, um sie aufzufangen und an sich zu drücken.
»Gibt es da irgendetwas, das wir nicht mitbekommen haben?«, erklang eine Stimme hinter Jeanne.
Gret trat mit hochgezogenen Brauen neben Jeanne, die anscheinend so entsetzt war, dass sie keinen Ton herausbrachte. Gret dagegen murmelte: »Ich könnte mir vorstellen, dass unser Herr Albrecht von Wertheim das nicht gerne sehen würde.« Rasch blickte sie sich um, konnte ihn aber glücklicherweise nicht entdecken. »Nun, es wird schon einen freundlichen Menschen hier auf dieser Burg geben, der ihn mit jeder unnötigen Einzelheit versorgt; davon bin ich überzeugt.«
»Ich hoffe nicht«, hauchte Jeanne, die noch immer geschockt schien.
»Unterschätze nicht die Bosheit der Menschen. Er wird es erfahren!«
Nun schwenkte der Fremde Elisabeth gar im Kreis, dass sie hell aufjauchzte. Fröhlich wie ein unbeschwertes Kind, das die Härte des Lebens noch nicht erfahren hat. So hatten die beiden Frauen Elisabeth noch nie erlebt. Ihr Lachen schallte über den Hof. Langsam traten die beiden näher. Endlich löste sich Elisabeth von dem Fremden und trat einen Schritt zurück. Ihre Wangen waren gerötet, und ihr Atem ging ein wenig schneller. Ein Strahlen ließ ihre graugrünen Augen aufleuchten. Einige Strähnen ihrer honigblonden Locken hatten sich aus ihrer Frisur gelöst und ringelten sich um ihren Hals bis über die Schultern.
»Georg!«, stieß sie aus und lächelte zu dem jungen Mann hoch, der kaum älter schien als sie. »Der Tag hätte mir keine größere Freude bringen können als deine Rückkehr.«
»Nun, ich war gerne weg, das will ich nicht verhehlen, aber dich wieder in die Arme schließen zu können, darauf habe ich mich gefreut, seit wir Persien verlassen haben. Und ich bin froh, dass die Gerüchte, die mich in fernen Landen erreichten, du habest dich in ein Kloster zurückgezogen, der Wahrheit entbehren.«
Elisabeth senkte den Blick. »Das ist eine komplizierte Geschichte.« Sie war erleichtert, dass er nicht darauf einging.
»Dann wirst du also doch noch unseren heißblütigen Rittersmann Albrecht ehelichen, wie ich es schon vor vielen Jahren prophezeite, als du noch ein Fratz warst und Zöpfe trugst?«
»Wenn er mich noch haben will«, sagte Elisabeth leise, ohne den Blick zu heben. Der Fremde lachte.
»Da müsste vorher die Welt untergehen und das Jüngste Gericht über uns kommen, ehe Albrecht etwas von seiner Vernarrtheit verliert. Von jeher war er völlig blind gegenüber deinen zahlreichen Fehlern und Makeln«, sagte er in scherzhaftem Ton und zupfte an einer ihrer Locken.
Elisabeth sah ihn empört an und knuffte ihm in die Rippen. »Wie kannst du so etwas behaupten? So viele Makel habe ich nicht...« Sie brach ab. »Hatte ich nicht«, fügte sie schwach hinzu.
»Ach, ich habe dich vermisst«, rief er unvermittelt und zog sie noch einmal in seine Arme. Elisabeth schloss die Augen und legte ihre Wange mit einem Seufzer an seine Schulter. »Ich dich auch«, hauchte sie.
Jeanne und Gret sahen einander an. »Jetzt verstehe ich gar nichts mehr«, stieß Gret aus, doch plötzlich begann ein Lächeln ihre Lippen zu heben und breitete sich dann über ihr ganzes Gesicht aus.
»Ich wüsste nicht, was es da zu grinsen gibt«, herrschte sie Jeanne an.
»Ich schon«, gab Gret zurück, und das Lachen wurde noch breiter. »Sieh ihn dir genau an. Sein Gesicht, die Nase, das blonde Haar und seine Augen. Ein schöner junger Mann, nicht wahr?«
»Ich wüsste nicht, was das zur Sache tut«, fauchte Jeanne, doch dann stutzte sie und stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. »Er ist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten.«
»Ja, das finde ich auch. Er hat Glück, dass er nicht nach seinem Vater gerät«, fügte Gret lästerlich hinzu.
In diesem Moment löste sich Elisabeth aus den Armen des jungen Mannes, und ihr Blick glitt zu den beiden Freundinnen, die noch immer auf der Brücke standen. Sie winkte sie zu sich.
»Gret, Jeanne, begrüßt meinen Bruder Georg, der von einer langen Reise zurückgekehrt ist. Georg, das sind meine vertrauten... äh... Mägde Gret und Jeanne, die sich stets um mein Wohlergehen bemühen.«
Während Gret und Jeanne vor dem Sohn des Bischofs artig knicksten, gönnte er ihnen nur ein flüchtiges Nicken.
Ein Mann mit einem Sack auf dem Rücken trat zu ihnen. »Verzeiht, dass ich störe, Meister Georg, aber wohin soll ich diesen Sack bringen, den Ihr in Indien erworben habt?«
Georg überlegte kurz. »Bring ihn in die leere Kammer neben dem Gemach, das Meister Thomas bewohnen wird. Wir werden dort eine kleine Alchemistenküche einrichten müssen.«
Der Mann nickte und strebte mit seiner Last auf die Zugbrücke zu.
»Wer ist Meister Thomas?«, fragte Elisabeth neugierig.
»Kurz gesagt, heute ein guter Freund; zu Anfang nur ein Mann, der sich dem Kaufmann, der mich in die Lehre nahm, auf seiner Reise angeschlossen hat. Du wirst Thomas kennenlernen. Lass mich aber zuerst dafür sorgen, dass alle Waren gut versorgt sind, dann können wir uns zum Mahl zusammensetzen, und ich werde dir alles erzählen. So lange wirst du deine Ungeduld wohl noch bezähmen müssen, auch wenn es dir schwerfällt.« Er strich ihr noch einmal über die Wange und lächelte verschmitzt. »Ich nehme an, Geduld gehört noch immer nicht zu deinen Tugenden, liebste Schwester?«
»Nein, gehört sie nicht«, seufzte Elisabeth, »und du hast sie verdammt lange strapaziert.«
»Schwester, ich bin entsetzt, ein Fluch aus deinem zarten, jungfräulichen Mund!«, spottete Georg gutmütig.
»Ja, ein Fluch ist hier durchaus angemessen. Drei ganze lange Jahre, die du auf Reisen warst und während derer ich nicht einmal wusste, ob du noch lebst!« Eine Träne rollte über ihre Wange. Georg hob die Hand und wischte sie ab.
»Ich werde es wiedergutmachen, Schwesterherz, ich verspreche es. Von nun an kannst du auf mich zählen. Ich bin als zorniger Jüngling aus Würzburg gezogen, und ich komme als gemachter Mann wieder. Ja, sieh mich nicht so ungläubig an. Trotz meiner Jugend habe ich viel erreicht. Von nun an werde ich meine eigenen Handelsreisen unternehmen. Ich habe alles gelernt, was Meister Johann mir beibringen wollte. Doch nun lass mich meine Arbeit tun. Später ist Zeit, zu allem Rede und Antwort zu stehen.«
Er wandte sich ab und trat zu einem Wagen, von dem gerade kleine hölzerne Kästchen abgeladen wurden. Elisabeth und die beiden Mägde sahen ihm noch eine Weile zu, dann schritten sie in die Burg zurück, um ein Mahl für die Männer der Handelskarawane zubereiten zu lassen.
»Ich werde ihm etwas ganz Besonderes kochen«, versprach Gret. »Wenn dieser Tyrann von einem Küchenmeister mich lässt«, fügte sie düster hinzu, ehe sie die Treppe zur Küche hinunterlief.
Viermal eilte Elisabeth in die Küche, und der Koch war nahe daran durchzudrehen, bis die Tafel in der Stube endlich ihren Wünschen entsprach. Sie hatte diesen kleinen, prächtigen Raum gewählt, in dem auch der Bischof zuweilen gespeist hatte, wenn er keine Gäste erwartete und nur wenige seiner engsten Vertrauten mit ihm zu Tisch saßen. Was in den vergangenen Jahren allerdings nicht häufig vorgekommen war. Elisabeth dagegen bevorzugte diese intime Runde und hoffte, ihr Bruder werde nicht zu viele seiner Reisegefährten mit zum Mahl bringen. Sonst würde sie womöglich alles in den großen Saal bringen lassen müssen.
Noch einmal umrundete sie die Tafel mit kritischem Blick. Heute war schließlich ein besonderer Tag. Hatte der Vater in der biblischen Geschichte nicht auch das Beste auftischen lassen, als der verlorene Sohn in die Heimat zurückkehrte?
Nun gut, Georg war nicht verloren gewesen, obwohl Elisabeth die meiste Zeit über nicht einmal gewusst hatte, durch welches ferne Land er gerade reiste, ja, ob er überhaupt noch am Leben oder vielleicht einem tückischen Leiden oder einer Bande Wegelagerer zum Opfer gefallen war. Und er war auch nicht gegen den Willen des Vaters mit dem Kaufmann Meister Johann von Würzburg davongezogen. Der Bischof hatte ihm seinen Segen erteilt, oder zumindest dem Drängen seines Sohnes nachgegeben.
Elisabeth ließ prüfend den Blick über die Tafel schweifen. Es war alles bereit. Nichts, was ihr Bruder begehren konnte, fehlte. Sie hatte alle Speisen herrichten lassen, die er früher gern gegessen hatte – soweit sie sich derer noch erinnerte.
Ein Geräusch ließ sie herumfahren. Johann von Wertheim stand in der Tür und ließ den Blick über die Tafel schweifen. Er sagte kein Wort, aber Elisabeth wurde es abwechselnd heiß und kalt. Wie hatte sie das auch nur einen Augenblick vergessen können? Sie war nicht mehr die Tochter des Hauses, die auf dem Marienberg schalten und walten durfte, wie es ihr beliebte. Ihr Vater saß auf seiner Burg in der Verbannung, und dem neuen Herrn musste sie gar dankbar sein, wenn er sie noch eine Weile duldete.
»Ich habe gehört, Besuch sei angekommen?«, begann der Pfleger, nachdem Elisabeth noch immer nichts sagte.
Sie nickte. »Ja, mein Bruder Georg und sein Meister, der Kaufmann Johann von Würzburg, sind von einer langen Reise zurückgekehrt. Sie konnten nicht wissen, dass sich die Verhältnisse hier im Land verändert haben; daher führte sie ihr Weg in der Heimat sogleich auf Unser Frauenberg.«
Der Blick des Pflegers ruhte noch immer auf der üppigen Tafel und den wenigen Stühlen, die um den Tisch gruppiert waren. Elisabeth spürte seinen Vorwurf, obwohl er nichts dazu sagte.
»Nun, dann werde ich mich später ein wenig zu Euch gesellen, um zu hören, welch Waren und Geschichten die Kaufleute von ihren Reisen mitbringen«, sagte er schließlich und verließ dann den Raum.
Elisabeth stand da, den Blick auf die Tafel gerichtet, die sie mit so viel Freude für ihren Bruder gerichtet hatte, doch nun wollte sich dieses Gefühl nicht mehr einstellen. Sie sah nur die Verschwendung, den unnötigen Überfluss, in dem sie am Hof ihres Vaters aufgewachsen war. Hatte ihre Zeit im Frauenhaus sie gar nichts gelehrt? Hatten dort nicht eine Schale Suppe und ein wenig Brot am Abend genügt, und sie war dankbar für Gottes Gabe gewesen? Deshalb war der Pfleger von Wertheim von den Domherren eingesetzt worden, um der Verschwendung Einhalt zu gebieten.
Wie gut, dass ihr Bruder diesen Augenblick für sein Erscheinen wählte und alle trübsinnigen Gedanken wie eine Sturmböe vertrieb. Sie spürte, wie ihr Gesicht erstrahlte, als sie seinen Schritt auf der Treppe vernahm. Er überquerte den Vorplatz und strebte auf sie zu.
»Ah, das duftet ganz vortrefflich. Was hast du nicht alles aufgetischt! So hatte ich die Festmähler stets in meiner Erinnerung, wenn ich bei kargem Mus auf einer öden Ebene frierend in meinem Zelt saß und mich fragte, welcher Dämon mich geritten hat, die Heimat zu verlassen. Thomas, komm schnell, und labe dich an diesem Anblick, ehe wir es uns schmecken lassen.«
Er sah den Freund an, der nun vortrat und sich artig vor Elisabeth verbeugte. »Thomas Klüpfel, gebürtig aus Bamberg«, stellte er sich vor. Das war also der angekündigte Reisegefährte, der sich zum Freund gewandelt hatte. Neugierig musterte Elisabeth ihn, während sie die anderen Männer aufforderte, Platz zu nehmen und kräftig zuzugreifen, was diese sich nicht zweimal sagen ließen.
Georg nannte ihr auch die Namen der anderen Gäste. Das kleine Männchen, das sie bereits im Hof angetroffen hatte, war der Kaufmann Johann Roderer, der Georg in die Lehre genommen hatte. Ein weiterer jüngerer Mann, größer gewachsen und schlanker in der Erscheinung, wurde als Johanns Sohn Eberhard vorgestellt. Neben ihm nahmen noch zwei weitere Männer Platz, die hauptsächlich mit chinesischer Seide handelten und die sich unterwegs mit ihren beiden Karren dem Zug des Würzburger Kaufmanns angeschlossen hatten. Elisabeth richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf den Freund ihres Bruders.
Thomas Klüpfel war ein großgewachsener Mann, schlank, ja fast ein wenig hager, und einige Jahre älter als ihr Bruder. Elisabeth vermutete allerdings, dass er die dreißig noch nicht erreicht hatte, obwohl sein Blick davon sprach, wie viel er bereits erlebt hatte. Gutes, aber auch die Härte, zu der das Schicksal fähig ist. Die Augen waren blau. Von einem tiefen, dunklen Blau. Sein intensiver Blick wanderte immer wieder zu ihr herüber. Sein erst kürzlich sauber geschnittenes Haar zeigte einen hellen Braunton, dem vermutlich die Sonne des Südens einen Goldton verliehen hatte. Die Wangen des harmonischen und doch männlich markanten Gesichts waren frisch rasiert. Außerdem trugen sowohl ihr Bruder als auch die Gäste saubere, farbenprächtige Gewänder aus teuren Stoffen mit Pelzverzierungen an den Säumen. Ganz so direkt hatte ihr Weg sie also nicht aus den wilden Ländern ihrer Reise auf den Marienberg geführt. Obwohl Elisabeth nur eine vage Vorstellung davon hatte, wie es bei solch einer Handelskarawane zuging, war sie sich dennoch sicher, dass sich die Männer nicht die Mühe machten, regelmäßig einen Barbier aufzusuchen oder auf saubere Kleider zu achten.
Thomas Klüpfel lachte und bestätigte Elisabeths Verdacht, als sie ihn laut äußerte. Er zwinkerte ihr zu. »Wir sahen gar aus wie die Wegelagerer, als wir das Schiff in Genua verließen, das kann ich Euch versichern, und unser Zug über die Alpen hat die Sache nicht besser gemacht. Nein, die Wächter hätten uns vermutlich mit vorgestreckten Hellebarden davongejagt und nicht einmal den verlorenen Sohn Georg wiedererkannt. Das konnten wir nicht riskieren!« Er lächelte verschmitzt. »Außerdem wollte Georg schließlich mit stolz geschwellter Brust unter seinem teuren Tuch hier erscheinen, um zu zeigen, dass sich die Jahre in der Fremde ausgezahlt haben, nicht wahr, guter Freund?«
Georg ging nicht auf die Neckerei seines Freundes ein. Er war zu sehr damit beschäftigt, sich die Köstlichkeiten von den zahlreichen Platten und Schüsseln auf den Teller zu häufen. Auch die anderen Männer griffen eifrig zu.
»Ah, Thomas, sieh nur, ein in Honig knusprig gebratener Kapaun, dort Wachteln in Wein gekocht und ein Rebhuhn mit süßen Beeren gefüllt.« Er seufzte und tat sich gleich zwei Stücke auf, ehe sein Blick weiterwanderte und er mit seiner Aufzählung fortfuhr. »Eine Mandelspeise mit Reis, saftige Würste und ein Braten, dem das Fett noch aus allen Poren quillt. Sieh dir die dicken, braunen Zwiebeln an, in bestem Essig eingelegt, dort der Salzfisch aus dem Norden und hier die gebratenen Fische im Kräutermantel direkt aus dem Main samt der Krebse, die liebevoll um sie herumdekoriert wurden. Vom Quittenmus und den kandierten Früchten erst gar nicht zu reden! Greift zu, liebe Freunde, es muss an nichts gespart werden. Esst und trinkt, und vergesst die kargen Tage, ja die Monate, die wir darben mussten.«
Er beugte sich vor und legte auch seinem Freund dicke Scheiben vom Braten und einige Zwiebeln auf. Elisabeth reichte duftendes warmes Brot. Ihr Bruder biss herzhaft in den knusprigen Schenkel des Kapauns. Gret trat ein und schenkte die hohen, mit Edelsteinsplittern besetzten Zinnbecher voll kühlen, roten Wein. Georg trank und ließ sich dann mit einem Seufzer in seinem Stuhl zurücksinken.
»Es hat sich nichts verändert. So habe ich es in meiner Erinnerung gesehen, wenn die Schwärze der Nacht über mir zusammenstürzte und Zweifel und Ängste mich frösteln ließen. Wie gut tut es, endlich zu Hause zu sein.«
Er hob den Becher und prostete ihnen zu. Sein Freund erwiderte die Geste und trank dann durstig, während Elisabeth nur an ihrem Wein nippte.
»Sosehr es mich schmerzt, dir das sagen zu müssen«, begann sie zaghaft, »aber nichts ist mehr so, wie es war, und dies ist auch nicht mehr unser Zuhause. Der Bischof, unser Vater...«