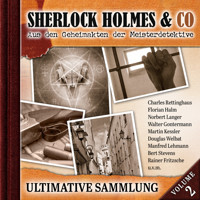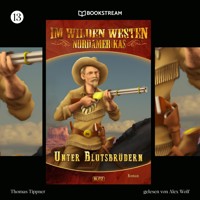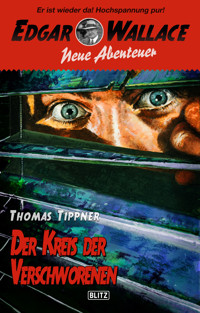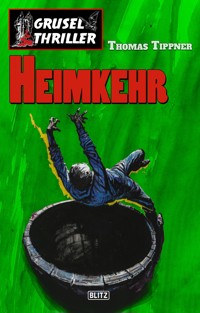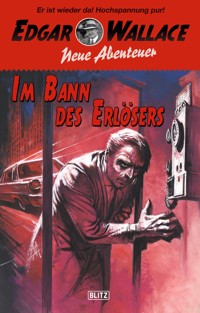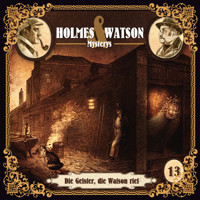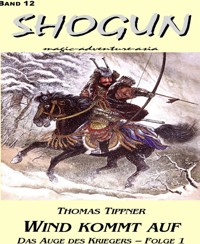
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Unheil braut sich über der Provinz Jo-Ko-Ho zusammen. Immer häufiger überschreiten die Krieger der „Freien Völker“ die Grenze, morden und plündern und bedrohen den bislang herrschenden Frieden. Und was planen die gefürchteten „Schwarzen Priester“ aus dem geheimnisvollen Kloster in den Kargländern? Und dann taucht auch noch ein schreckliches Ungeheuer auf, das offensichtlich große Lust auf Menschenfleisch hat. Dem stehen Fürst Joko Hiroshi und die Samurai seines Hofes zunächst macht- und ratlos gegenüber. „Wind kommt auf“ ist der furiose Auftakt der neuen Miniserie „Das Auge des Kriegers“ innerhalb der Reihe „Shogun“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Das Auge des Kriegers 1: Wind kommt auf
Shogun, Band 12
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorspann
Shogun – Band 12
Thomas Tippner – Wind kommt auf – Das Auge des Kriegers, Folge 1
1. eBook-Auflage – August 2014
© vss-verlag Hermann Schladt
Titelbild: Masayuki Otara
Lektorat: Armin Bappert
Das Auge des Kriegers
Folge 1
Wind kommt auf
von Thomas Tippner
1
Es war still …
So unendlich still, dass Holona sich nicht das erste Mal fragte, was um ihn herum geschehen war. Da war weder das unentwegte Knirschen und Knacken der dicht aneinander stehen Bäume, deren Äste sich berührten. Ebenso wenig gab es das leise, kaum wahrnehmbare, und doch immer vorhandene Rumoren und Brummen der Tiefen der Wälder. Ein Rumoren und Brummen, dass einen irgendwie in der Seele berührte und dazu verleitete ruhig oder nervös zu sein.
Ein Rumoren und Brummen, dass die Freien den Herzschlag des Waldes nannten. Und eben das schien zu fehlen.
Es war nicht mehr da … verloren gegangen in einem lautlosen Sturm, der über die Welt gekommen sein musste, um Unheil zu bringen. Holona, der schon immer an die Macht der Götter geglaubt hatte, wagte es kaum, in die tiefen Schatten des um ihn liegenden Waldes zu blicken, ohne dabei einen Kummer, einen Schmerz zu fühlen, der sein Herz schwer werden ließ.
Etwas ist verloren gegangen, dachte er bitter, und nahm dann wahr, als würde es sich jetzt erst bemerkbar machen, dass er auch die um ihn herrschenden Geräusche der Tiere nicht mehr wahrnehmen konnte. Da war kein Klopfen, kein Schaben, nicht ein Schrei …
Und das Röhren des sich in der Brunft befindenden Rotwilds war ebenso verschwunden, wie die nach Nahrung schreienden gerade geschlüpften Küken.
Und wir sind noch hier, kam ihm schaudernd der Gedanke, als er zu seinem leicht versetzt stehenden Freund Zuali schaute. Der kleine, gedrungene Mann, der hinter einem Strauch fast komplett verborgen war, stand ebenfalls da – regungslos, auf sich und seine Gedanken konzentriert, so als würde er ebenfalls bemerkt haben, dass hier etwas nicht stimmte.
Bevor Holona aber seine immer leise klingende Stimme erheben konnte, um seinen in einen Lendenschurz und ein aus groben Leinen gefertigten Hemd gekleideten Freund anzusprechen, war es Hanoschy, der sich polternd hinter ihm bemerkbar machte: »Das ist eine Spur«, bemerkte er dröhnend, und riss den völlig auf sich konzentrierten Holona aus seinen Gedanken.
Er, der eben noch voller Zweifel gewesen war, zuckte zusammen, als hätte er einen Schlag bekommen. Es war ihm, als hätte man ihn mit Gewalt aus einer kalten, ihn wie ein Eispanzer umgebende Welt hinein in eine aus Feuer und Hitze bestehende Höhle gestoßen.
Ein Extrem jagte das andere …
Es umschloss ihn hart und unnachgiebig, ließ ihn glaubten für einen kurzen Augenblick keine Luft zu bekommen.
Erst als Zuali mit gedämpft klingender Stimme fragte: »Wohin führt sie?«, war es ihm, als würde er wieder in das Hier und Jetzt, in seine Wirklichkeit zurückkehren.
Holona hatte erst geglaubt, dass er sich wieder einmal anstellte, um seine in ihm aufsteigen, zweifelnden Gedanken beiseiteschieben zu können. Dann aber, als er sich langsam umdrehte, um zu dem hochgewachsenen, für einen Freien unnatürlich großen Hanoschy zu schauen, fiel ihm auf, was er gedacht hatte, als er die Stimme Zualis hörte.
Gedämpft hatte sie geklungen – so, als ob es ihm Mühe bereitete, einen vernünftigen Ton anzuschlagen.
»Nach Süden. Richtung Grenze.«
»Dann folgen wir ihr nicht!«
Erleichterung durchdrang Holona wie ein weicher Regenschauer, nach langen Tagen, wo die Sonne so unnatürlich heiß brannte, dass man glaubte, vergehen zu müssen. Und noch ein Gefühl gesellte sich zu ihm – ein Gefühl, das ihn so sehr umklammerte, als würde er sich in einem Würgegriff befinden, der ihm unbarmherzig die Luft abschnürte.
»Warum das denn nicht?«
»Die Grenze«, erwiderte Zuali so leise, dass Holona sich anstrengen musste, um seine Worte zu verstehen.
Und ebenso wie Hanoschy reagierte, hätte auch Holona in einem Moment der Unbekümmertheit reagiert. Aber jetzt, wo sich irgendetwas zu verändern begann, konnte er die Reaktion seines Stammesfreundes in keinster Art und Weise nachvollziehen. Es war schlau, was Zuali sagte, und das abfällige, beinah spöttisch klingende: »Seit wann fürchtet sich Zuali vor der Grenze?«, klang in Holonas Ohren wie ein Angriff.
»Wir sollten der Spur nicht folgen«, erklärte Zuali, in seiner ruhigen, bedächtigen Art, die Holona so sehr an ihm schätzte. Es war ihm am liebsten, wenn er mit Männern aus seinem Stamm unterwegs war, die vorsichtig und bedacht handelten.
Nicht so wie die Heißsporne, wie Hanoschy, die keine Gelegenheit auslassen wollten, um die an der Grenze stehende Festung Roj und deren Besatzung zu provozieren.
Natürlich, er fand auch, dass die Herrscher der Provinz Jo-Ko-Ho nichts in den Freien Landen zu suchen hatten – dass sie sich schleunigst wieder zurückziehen sollten, um die Freien so leben zu lassen, wie sie leben wollten.
Aber weder die Herrscher der Provinz, noch die unbedachten, nach Krieg und Vergeltung schreienden jungen Männer, würden es schaffen, den einen, oder den anderen zu besiegen. Dafür hatten sich beide schon blutige Nasen abgeholt.
»Lass uns den Pfad da nehmen«, erklärte Zulani und riss seinen Freund aus seinen Gedanken. Der blinzelte gegen das schräg durch das dichte beieinander liegende Blätterdach fallende Sonnenlicht und fand, dass die um ihn liegenden Schatten immer dunkler wurden. Ja, es schien, als würden sie die wenigen Stellen, die im hellen Schein lagen, langsam ersticken, durch die Dunkelheit.
»Es ist so schrecklich still«, flüsterte Holona, und packte den Schafft seines Holzspeeres fester. »Als würde alles fort sein.«
»Nicht alles«, meinte Zulani plötzlich, als er neben Holona stand, und mit ihm zusammen in die immer dichter werdenden Schatten starrte. Schatten, die unnatürlich schwarz waren, dass man meinen konnte, sie würden das in sie fallende Licht verschlucken. Da war kein durchschneiden der Schwärze, keine Zurückeroberung verloren gegangener heller Flächen. Nein, Licht, das in die Dunkelheit fiel, ging einfach verloren.
»Was meinst du?«, fragte Holona mit zitternder Stimme.
Obwohl er die Frage stellte, hatte auch er gefühlt, dass sich etwas veränderte. Dass etwas anders geworden war.
Das Gefühl, in fremdes Interesse geraten zu sein, ließ ihm einen kalten Schauer des Entsetzens über den Rücken jagen.
»Es lauert da vorne«, erklärte Zulani, und deute durch das Recken seines Kinns die Richtung an, von der er sprach. »Gut versteckt.«
»Dann lass uns zurückkehren.«
»Hanoschy, komm. Wir gehen.«
»Aber.«
»Komm!«
Zulani war nie ein Mann gewesen, der seine Stellung ausnutzte. Nie hatte er den anderen gezeigt, oder ihnen deutlich gemacht, dass er der Sohn des Stammesführers war. Er hatte sich immer wie einer von ihnen verhalten. War weder hochnäsig, noch arrogant. Er war ein Mann von Ehre, den die ihm zustehende Ehre nicht interessierte.
Aber jetzt, in dem Moment, wo Hanoschy sich weigern wollte, mit ihnen zu kommen, nahm Zulanis Stimme einen herrschenden, einen befehlsgewohnten Klang an, dass Holona zusammenzuckte und sich, wie unter einem Schlag, duckte.
»Wir sollten keine Zeit verlieren«, erklärte Zulani, als sie sich zurückzogen, weg von dem Teil des Waldes, der etwas Unnahbares, etwas Unaussprechliches in sich barg, »und so schnell wie möglich ins Dorf zurück kehren. Die Schamane werden sich für …«
Zulanis Worte verloren sich plötzlich.
Holona, der erst gar nicht verstand, was geschehen war, merkte nur, dass ihn irgendetwas am Knöchel gepackt hielt.
Ein Ruck war durch seinen Körper gegangen, und schon hatte er am Boden gelegen.
Er kam gar nicht dazu, sich zu wehren.
Er wurde über den Boden geschleift, hin, zu der den Wald umschließenden Dunkelheit.
Holona bekam keinen Laut heraus.
Die nackte Panik, die ihn angesprungen hatte, wie ein wildes Tier, lähmte seinen Verstand, vereiste all seine Gedanken, all seine Gelenke. Er spürte zwar, wie sich am Boden liegende Äste in seinen Bauch bohrten, seine Haut verletzten und brennende Schrammen über sie zogen, ohne dass er aber etwas dagegen tun konnte. Es war ihm, als wäre er in einem Kokon gefangen, der ihn von der Außenwelt abschnitt. Kein Geräusch drang zu ihm. Kein Gefühl. Nichts.
Nur dass er unaufhaltsam über den Boden gezogen wurde, begriff er.
Mehr nicht.
Und dass er sich wehrte, registrierte er auch noch.
Das seltsame daran war nur, dass er das Gefühl hatte, gar nicht in seinem Körper zu stecken. Es war, als würde er über dem ganzen Geschehen schweben, alles beobachten, alles sehen, ohne aber eingreifen zu können.
Und so begriff er erst spät, dass er gar keine Chance gegen den Angreifer hatte.
Dass weder Zulani noch Hanoschy ihm helfen konnten.
Denn so schnell, wie der Angriff von statten gegangen war, so schnell war Holona im Dickicht des Waldes verschwunden. War unter die dicht bewachsenen Sträucher gezogen worden, hin, zu der Schwärze, die ein Geschöpf freigab, das er niemals im Leben gesehen hatte.
Ein Wesen, groß und wuchtig, von Schuppen bedeckt.
Reptilienaugen blinzelten gierig, als er sich auf den Rücken drehte, und verstand, dass er so gut wie tot war. Reptilienaugen, in denen ein unbändiges, ein ihm völlig unbekanntes Feuer loderte, das sich mit den spitzen, in einer länglichen Schnauze, liegenden Zähnen zu vermischen drohte.
Und erst jetzt, wo seine ungläubigen Blicke die wie ein Kamm über den Rücken wachsenden Hornplatten erkannten, kehrte er in seinen Körper zurück. Als wäre er gefallen, schlug seine Seele wieder in ihm ein, und schrie in wilder Panik, dass er sich endlich erheben und davon laufen sollte.
Dann aber, als er dem panischen Schrei Folge leisten wollte, hielt ihn sein Knöchel zurück. Schmerzen rasten durch seinen Fuß, explodierten unterhalb des Knies, nachdem er es gewagt hatte, sich zu bewegen.
Was ist das für ein Ding?, hämmerten ihn seine Gedanken durch den Kopf, als er versuchte, das vor ihm stehende Geschöpf in irgendeine bekannte Tierschablone zu pressen – ohne dass es ihm gelang.
Er schaffte es weder, sich in Sicherheit zu bringen, noch zu begreifen, was das da vor ihm war.
Das, was er begriff war, als das Geschöpft ihn ansprang, dass sich messerscharfe Krallen in seinen Bauch und Oberschenkel gruben. Dass ein pfeilschnelles Maul nach ihm schnappte – und ihm blutig die Kehle aufbiss.
Er versuchte zu schreien und starb, als das Reptilienartige ein zweites Mal zubiss …
*
»Saru ist ein unangenehmer Mensch«, flüsterte Lai und sprach ihrem Vater, Yoko Hiroschi aus der Seele. Ja, der langsam den zur kleinen Festung hinauf führenden Weg passierende Schwarze Priester, war unangenehm. Er war ein Mann von einer Mauer aus Gerüchten umgeben, der es sichtlich zu genießen schien, dass das ihm begegnende Volk ihm beinah panikartig auswich. »Es schüttelt mich, wenn ich ihn nur sehe«, fügte Lai hinzu, und zog fröstelnd ihre runden Schultern zu dem hübschen Kopf.
Hiroschi, der seine Tochter über alles liebte, sah sie nicht nur durch die Augen eines Vaters.
Nein, seine Tochter hatte all die Schönheit ihrer Mutter geerbt.
Was gut für sie ist, dachte er dabei immer scherzhaft, wenn er dabei an sich dachte.
Er, der kleine, gedrungene Mann, dessen Hände so klobig waren, dass man denken konnte, sie gehörten einem Bauern, und keinem Edelmann. Hinzu kam, dass Hiroschi sich im Allgemeinen nicht mehr leiden konnte. Schaute er aus seinen mandelbraunen Augen in einen Spiegel, sah er ein von Kummerfalten bedecktes, meist trüb dreinblickendes Gesicht. In seinen Augen lag nur selten der Glanz der Freude und noch seltener konnte er sich als das akzeptieren, was er war.
Der Herrscher der viergeteilten Provinz Jo-Ko-Ho.
Und wenn er seine oft nachdenklich aufeinander gepressten Lippen sah, dazu den zu einem dünnen Band gewixten Bart, der ihm bis zum Kinn fiel, fragte er sich gelegentlich, wie seine Mio sich damals in ihn verlieben konnte – wie sie sich ihm hingeben konnte, und ihm fünf prächtige Kinder schenkte.
Es liegt an meiner Vergangenheit, dachte er seufzend, und schaute von der Seite wieder zu seiner am ganzen Leib zitternden Tochter.
Und dabei sah er wieder ihr weiches, rundes Gesicht, das so viel Grazie besaß, dass sie niemals seine Tochter sein konnte.
Denn betrachtete er die aus dem runden Kinn weich zum Kopf laufenden Wangenknochen, war sie ihm beinah fremd. Hinzu kam, dass ihre zu feinen Schlitzen geformten Augen eine Klarheit besaßen, die beinah an grenzenlose Intelligenz erinnerten.