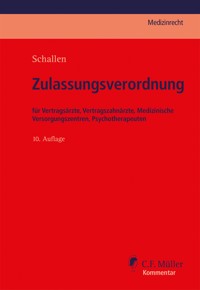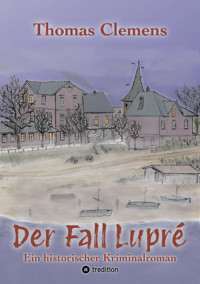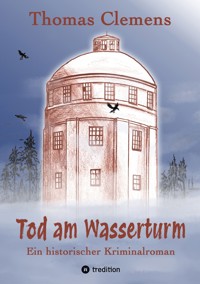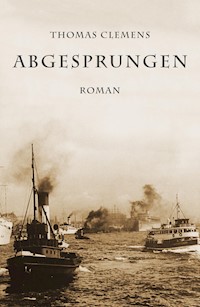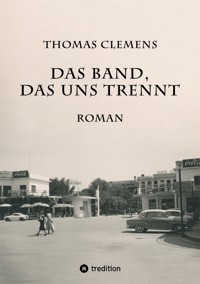
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Joe Seibel verschlägt es als Mitarbeiter der CIA in das Nachkriegsdeutschland der 50er Jahre. Aus einer anfänglich harmlosen Informantentätigkeit wird ein gefährlicher Agentenjob von dem seine Frau Rebecca zunächst nichts ahnt. Als Joe in immer brisantere Missionen gerät, wird seine Ehe auf eine harte Probe gestellt. Die gemeinsame Tochter Rahel erlebt ihre Kindheit und Jugend als Wechselbad aus familiärer Geborgenheit, Veränderung und Aufbruch in eine neue Zeit. Ein ebenso packender wie gefühlvoller Familienroman der 50er und 60er Jahre über Liebe, Trennung und die gesellschaftlichen Umbrüche der Zeit. Die vielschichtige Handlung führt den Leser in die USA, nach Europa und in den Nahen Osten. Mit seinem neuen Roman knüpft Thomas Clemens an das Schicksal der Schlüsselfiguren aus seinem letzten Buch "Abgesprungen" an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche

Thomas Clemens
Das Band,
das uns trennt
Roman

© 2023 Thomas Clemens
Umschlag, Illustration: Thomas Clemens
Umschlagfoto aus Bestand des Autors
Website: thomasclemens.art
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany
ISBN
Paperback978-3-347-72743-4
e-Book978-3-347-72745-8
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Namensgleichheiten mit tatsächlich existierenden Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Die Handlung ist, abgesehen von den historisch verbürgerten Ereignissen und Persönlichkeiten, erfunden.

Teil 1 (Mai 1954 bis Januar 1955)
In der Nähe von Philadelphia, USA, Mai 1954
Milde Frühlingsluft weht durch die heruntergekurbelte Autoscheibe. Die Nähe des Delaware River macht sich durch einen schwach modrigen Geruch bemerkbar. Voraus ist die Dunstglocke der Großstadt Philadelphia bereits zu erahnen. Joe Seibel ist früh am Morgen aufgebrochen. Wenn er weiter so gut vorankommt, wird er die gut 200 Meilen von Jersey City nach Washington D.C. bis zum Mittag geschafft haben, wenngleich er es nicht eilig hat. Er braucht Zeit zum Nachdenken, weshalb er mit dem Auto unterwegs ist und nicht mit dem Zug. Beim Autofahren kann er am besten nachdenken. Manchmal hatten sich ganze Reportagen während der langen Überland-Touren in seinem Kopf zusammengesetzt. „Was ist das für eine merkwürdige Vorladung?“, grübelt er einmal mehr. Eine Abteilung des Innenministeriums hatte ihn zu einer zweitägigen Befragung in die Hauptstadt vorgeladen. Ein gewisser Douglas Fenton, Head of Department 3.3, hatte unterschrieben. Wenn es etwas mit seinem kritischen Kommentar zur Kommunistenhatz des Senators McCarthy zu tun hatte, hätten sie ihn doch nicht in die Hauptstadt bestellt und schon gar nicht ein Zimmer in einem Hotel im Regierungsviertel für ihn gebucht. Dieser Fenton wollte ihn bereits heute Abend im Hotel kontaktieren, anstatt in seiner Behörde. Stanton Park Inn heißt das Hotel. Das klingt nicht gerade nach einer Absteige. Nein, mit dem Artikel konnte es eigentlich nichts zu tun haben, aber wer weiß? Er hatte sich darin klar vom Sowjetkommunismus distanziert, aber eben doch zwischen einem gemäßigten Sozialismus und der von Stalin geprägten und nun von Nikita Chruschtschow fortgeführten aggressiven sowjetischen Außenpolitik differenziert. Sein Entwurf war in der Redaktion des Evening Observers auf Widerstand gestoßen, er hatte Korrekturen vornehmen müssen und hatte sich den Unmut des Chefredakteurs zugezogen. Vor zwei Wochen war der Artikel endlich erschienen, zu einem Zeitpunkt, wo McCarthy bereits erheblich an Einfluss eingebüßt hatte. Dennoch waren einige Leserbriefe aus verschiedenen politischen Lagern eingegangen. Nein, es musste etwas anderes sein, auch wenn das politische Klima in den USA immer bedrückender wurde und er mehrmals schon um die Pressefreiheit fürchtete, wenn es sich um unbequeme Themen handelte. Rätselhaft blieb die Sache mit der Vorladung allemal, weil man nicht so recht daraus schlau wurde, welche Dienststelle des Innenministeriums dahintersteckt. In der Redaktion des Evening Observers hatte man ihn zähneknirschend drei Tage freigestellt. „Sie wissen hoffentlich, was Sie tun und sind sich möglicher Konsequenzen bewusst“, hatte Bill Carrothers, der Chefredakteur, mit einem drohenden Unterton bemerkt und ihm einen Blick zugeworfen, dass er sich wie bereits gefeuert fühlte.
Voraus erscheinen die gewaltigen Pylonen der seit kurzem fertiggestellten Delaware Memorial Brücke aus dem Dunst, die ein bequemes Überqueren des gewaltigen Flusslaufes ermöglicht. Kurz darauf fährt er die lange Rampe zur Brücke hinauf, vorbei an riesigen Werbetafeln für Motels und Autowerkstätten. Schließlich blickt er auf das braune, träge strömende Wasser des Delaware River. Amerika ist das Land der gigantischen Brücken, findet Joe. Eines von vielen Attributen, welche ihn an den USA faszinieren.
Jersey City, USA, zur gleichen Zeit
Ein Brief aus Israel für sie und ein Brief aus England an Familie Joe Seibel adressiert und ein weiterer aus Deutschland für Joe, sowie zwei Rechnungen. Rebecca schließt den Briefkasten vor dem Wohnblock. Seit Joe vor einigen Tagen diese rätselhafte Vorladung nach Washington erhalten hatte, bekommt sie stets ein wenig Herzklopfen, wenn sie nach der Post sieht. Heute am frühen Morgen war er mit gemischten Gefühlen losgefahren. Zwei Nächte würde er dortbleiben. Sie steigt die Treppe zu ihrer Wohnung in das dritte Stockwerk hinauf, wo sie bald sieben Jahre mit Joe und Rahel wohnt. Auf der Treppe grüßt sie eine Nachbarin. Viel Kontakt hatte sie hier nicht. Ein befreundetes Ehepaar, Linda und Steve mit ihrer Tochter, waren zwei Jahre zuvor nach San Diego gezogen, tausende Meilen entfernt an der Pazifikküste gelegen.
Der Brief aus Israel ist von ihrer Tante Judith, die ihr alle paar Monate vom harten Überlebenskampf des von feindlichen Ländern umgebenen jungen Staates Israel keineswegs wehklagend, sondern begeistert berichtet. Ein missbilligender Unterton, dass Rebecca sich so wenig ihrer Wurzeln bewusst sei und noch nicht einmal zu Besuch ins gelobte Land gereist sei, ist stets unüberhörbar. Von ihren jüdischen Wurzeln, geschweige denn Glauben war in der Tat kaum etwas übriggeblieben und das Wenige beschränkte sich auf Kulinarisches und ein paar Rituale zu hohen Feiertagen, wie Jom Kippur oder Chanukka. Eine Synagoge hatte sie schon seit Jahren nicht von innen gesehen, aber Israel würde sie eines Tages, wenn sich die Situation dort beruhigt hatte, besuchen. Dennoch - Judiths Briefe verursachten ihr stets Unbehagen und unbehaglich ist ihr bereits, weshalb sie den Brief ungeöffnet zwischen die Milchglasscheiben des Küchenschrankes steckt. Den Brief von Bernhard Monroe aus London, einem Bekannten aus Kriegszeiten, würde sie zusammen mit Joe öffnen. Stattdessen räumt sie das Frühstücksgeschirr in die Spüle. Rahel hatte wieder nicht aufgegessen. Sie isst zu wenig, bevor sie in die Schule geht, findet Rebecca. Mit Rahel spricht sie stets Französisch, während Joe Englisch mit ihr spricht. Daher beherrscht sie nun beide Sprachen auf dem Niveau einer Achtjährigen. Ebenso kann sie beide Sprachen auch ein wenig lesen und schreiben. Alles das hatte Rebecca ihr beigebracht mit der Folge, dass Rahel in der amerikanischen Grundschule völlig unterfordert ist und sich zu langweilen beginnt. Gern hätten sie ein Geschwisterkind für Rahel, aber der Frauenarzt hatte ihr unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie nicht mehr schwanger werden kann und dankbar für eine gesunde Tochter sein soll. Die erste Geburt mit einunddreißig Jahren sei für die meisten Frauen reichlich spät, da müsse man sich nicht wundern.
Sie blickt aus dem Küchenfenster, von wo sie über die Dächer der gegenüberliegenden Häuserfront die Spitzen der New Yorker Wolkenkratzer sehen kann, ein Anblick an den sie sich in der Gleichförmigkeit der Monate und Jahre gewöhnt hat. Sie haben es hier in Amerika zu bescheidenem Wohlstand gebracht, eine hübsche, etwas zu kleine Wohnung in einem ganz passablen Stadtteil, von dem man in weniger als dreißig Minuten das flirrende Manhattan erreichen konnte, wo sie allerdings selten hinfährt. Sogar ein Auto konnten sie sich seit einiger Zeit leisten. Dafür sorgt Joe durch seinen anstrengenden Job als Reporter beim Evening Observer, einer mittelgroßen Tageszeitung. Meistens berichtet er von mehr oder weniger spektakulären Gerichtsprozessen im Staat New York. In letzter Zeit hat er auch politische Kommentare und Kolumnen verfasst, was ihm gut gelingt, findet sie. Irgendjemand muss gegen diese Kommunismus-Paranoia dieses McCarthy und gegen den Rassismus in weiten Teilen der USA anschreiben. Hoffentlich bekommt er deshalb keinen Ärger. Sie versucht ihre Sorgen zu verdrängen. Draußen scheint die Sonne. Ich werde ein paar frische Lebensmittel einkaufen, ein kleines Stück am Hudson spazieren gehen und dann ist es Zeit das Mittagessen zu bereiten, wenn Rahel aus der Schule kommt. Ich werde einen Eintopf, einen klassischen pot au feu bereiten, überlegt sie. Ihre Küche ist französisch geprägt, sie hatte fast neun Jahre ihres Lebens in Frankreich verbracht, war vor dem Krieg nach Paris geflohen. Als die Deutschen Frankreich besetzten, musste sie sich in der Provinz verstecken. Später hatte sie sich der Résistance angeschlossen. Nach der Befreiung verbrachte sie ein paar Jahre als Untermieterin in einem französischen Haushalt. Ihre Vermieterin brachte ihr das Kochen französischer Gerichte bei. Manchmal wünscht sie sich tatsächlich, nach Paris zurückzukehren.
Auf dem Weg nach Washington D.C., etwas später
Joe hat inzwischen den Susquehanna River auf einer weiteren großen Brücke überquert und fährt weiter auf der Federal 40 Richtung Baltimore. Zwei Drittel der Strecke hat er geschafft. Er steuert eine Tankstelle an. Neben einigen Gallonen Benzin braucht der betagte Oldsmobile Sixty ein Kännchen Öl und er selbst ein Kännchen Kaffee bevor es weitergeht.
Am frühen Nachmittag erreicht Joe die amerikanische Hauptstadt. Obwohl er erst zweimal in seinem Leben in Washington war, findet er sich erstaunlich gut zurecht. Das im Rechteckmuster angelegte Straßennetz und wenige markante Gebäude, die Kuppel des Kapitols und das nadelförmige über 500 Fuß hohe Washington Monument erleichtern schon von weitem die Orientierung in dem ansonsten hochhausfreien Stadtbild.
An der Rezeption des Stanton Park Inn überreicht man Joe eine Nachricht. Ein Mister Fenton erwarte ihn um 20 Uhr im Restaurant des Hotels zu einem Abendessen. Joe bezieht sein Zimmer, gehobene Mittelklasse, stellt er fest. Er beschließt, die Zeit bis zum Abendessen zu nutzen und sich im nahen Regierungsviertel umzusehen. Als er die Maryland Avenue zur Constitution hinüberläuft, schlägt ihm die feuchtheiße Nachmittagsluft entgegen. Kaum ein Amerikaner würde bei dem Wetter auf die Idee kommen, weiter als einen Block zu Fuß zu gehen. Darin unterscheidet er sich von seinen Landsleuten. Er ist notorischer Fußgänger und läuft den ganzen Weg, vorbei an den Monumentalbauten, klassizistischen Fassaden, die typisch sind für die Hauptstadt, vorbei am Weißen Haus bis zum Lincoln Memorial, durch die ausgedehnten Parkanlagen zurück zum Kapitol und schließlich wieder zum Hotel – beeindruckend. Von dieser Seite hatte er Washington noch nicht gesehen, obwohl es jener Teil ist, den wohl viele amerikanische Schulklassen einmal besuchen.
Ein Hotelangestellter führt Joe, der seinen besten Anzug trägt, zu einem Separee des Restaurants. Am Tisch sitzen bereits zwei Männer, die höflich aufstehen, als sie ihn gewahr werden. „Mister Seibel, hatten Sie eine angenehme Anreise? Douglas Fenton, mein Name“, begrüßt ihn ein sportlicher jedoch förmlich gekleideter Mittvierziger freundlich. Joe erklärt, dass er mit dem eigenen Wagen angereist sei und gut vorangekommen ist. „Das freut mich, Mister Seibel. Ich darf Ihnen Professor David Rochford von der Georgetown Universität vorstellen.“ Der zweite Mann, ist deutlich älter, hochgewachsen mit grauem Borstenhaarschnitt und kantigen Gesichtszügen. Er begrüßt ihn mit festem Händedruck. Rochford könnte auch ein pensionierter General sein, denkt Joe. „Professor Rochford ist Sprachwissenschaftler. Aber nehmen wir erstmal Platz.“ Fenton gibt einem Kellner ein Zeichen, ordert die Aperitifs. „Mister Seibel, ihre Muttersprache ist Deutsch, wie wir wissen und Professor Rochford möchte die Unterhaltung am heutigen Abend gern auf Deutsch mit Ihnen führen.“ „Meine Herren, vielleicht klären Sie mich zunächst einmal auf, mit wem ich es zu tun habe und um was es hier geht. Sie verstehen, ich bin ein wenig verwundert über die, mit Verlaub, rätselhafte Vorladung.“ „Sorry, Mister Seibel, ich dachte, das wäre Ihnen bekannt.“ Fenton zieht einen Ausweis aus der Innentasche seines Sakkos und klappt ihn diskret dicht über der Tischplatte auf. CIA, liest Joe. Geheimdienst, damit hat er nicht gerechnet. „Wie komme ich zu der Ehre“, fragt er, wobei er das Wort Ehre mit einem zweifelnden Unterton ausspricht. „Ich bitte mit dieser Information vertraulich umzugehen. Also, eines nach dem anderen, Mister Seibel. Stoßen wir erstmal auf den Abend an.“ Joe greift zögernd zu seinem Martini, der zwischenzeitlich serviert wurde. Er fühlt sich überrumpelt auf etwas anzustoßen, was er vielleicht gar nicht will. Die Art der Kontaktaufnahme hier im Restaurant ist ebenso merkwürdig, wie die Vorladung selbst, denkt er. „Also Professor“, nickt Fenton dem Gelehrten zu. Der spricht in grammatikalisch einwandfreiem Deutsch mit kaum merklichem Akzent. „Sie wohnen in Jersey City, stammen jedoch aus Deutschland, aus Hamburg, Herr Seibel. Erzählen Sie mir von Ihrer Kindheit!“ Joe ist verwirrt, muss seine Gedanken sortieren. Er ist es nicht mehr gewohnt Deutsch zu sprechen, aber verlernt hat er die Sprache keineswegs. „Was möchten Sie denn wissen, was die Firma von Mister Fenton nicht ohnehin schon weiß?“ „Darum geht es nicht, Herr Seibel. Ich möchte ein wenig Deutsch mit Ihnen plaudern, hören, wie Sie es sprechen. Dabei ist es einigermaßen egal, ob Sie mir Märchen erzählen oder die Wahrheit.“ Was, verdammt, wollen die von mir? Ein Professor für Sprachen wird doch keinen Deutschunterricht von mir nötig haben, fragt Joe sich. „Also, Herr Seibel, wie war Ihre Schulzeit in Hamburg?“ Joe beginnt zunächst unsicher, nach passenden Worten suchend, zu erzählen, dass er eine höhere Schule besucht hatte, das Lernen von Sprachen ihm äußerst leichtfiel. Dass sich die letzten drei Jahre vor dem Abitur durch Hitlers Machübernahme der Schulalltag stark veränderte, er Schwierigkeiten bekam, weil er sich den Zwängen der Nazi-Diktatur so gut es ging, zu entziehen versuchte. Außerdem war er seinerzeit bereits mit seiner jetzigen Frau, die Jüdin sei, befreundet gewesen. Rochford hört konzentriert zu, während Fenton sich kurz entschuldigt, um mit dem Ober die Bestellung des Abendmenus zu klären. „Wenige Monate vor dem Abitur“, fährt Joe fort, „flog ich von der Schule, weil ich in einem Swing-Keller erwischt wurde.“ „In einem – was?“, fragt Rochford. „Wir haben uns heimlich getroffen, um Swing zu hören und danach zu tanzen. Das war in Deutschland seinerzeit in gewissen Kreisen sehr angesagt, jedoch verboten. Die SA hat die Veranstaltung brutal aufgelöst, uns verprügelt und für ein paar Tage in ein finsteres Loch gesteckt“, erklärt Joe. „Und danach haben Sie Deutschland verlassen?“ „Nein, damals war ich erst siebzehn Jahre alt. Ich habe später im Hotel meiner Familie in Hamburg gearbeitet.“ Den unseligen Streit mit seinem Vater, der überzeugtes Mitglied der NSDAP war, lässt Joe weg. Vermutlich wissen sie es ohnehin. „Ich habe 1938 als Steward auf einem deutschen Überseedampfer angeheuert und bin zur See gefahren, Liniendienst von Bremerhaven nach New York.“ „Und Ihre jüdische Freundin, also Ihre werte Gattin?“, fragt der Professor mit einfühlsamer Stimme. „Sie konnte Deutschland im gleichen Jahr verlassen und floh mit ihrer Mutter nach Paris.“ Der Ober serviert eine nach Curry duftende Suppe. „Mullygatawny Soup, Herr Seibel, ich hoffe Sie mögen sie, guten Appetit!“ Sie essen und führen die Konversation auf Deutsch fort, wobei Fenton offensichtlich kaum etwas versteht. „Joe berichtet weiter, dass er wenige Tage vor Ausbruch des Krieges in Europa vom Schnelldampfer Bremen nachts in den Hudson gesprungen sei, um in die Vereinigten Staaten von Amerika einzuwandern und dem Kriegsdienst im Dritten Reich zu entkommen. „Aber das wissen Sie sicherlich alles, Mister Fenton“, sagt er zu dem CIA-Mitarbeiter, um festzustellen, ob der mitbekommen hatte, was er die ganze Zeit erzählt hat. „Wir wissen viel, aber niemals genug, Herr Seibel“, entgegnet der auf Englisch und lächelt süffisant. „Und Ihre werte Gattin? Also Ihre damalige Freundin“, fragt der Professor. „Rebecca befand sich bereits in Paris, während ich in New York Fuß zu fassen begann. Eine ziemlich belastende Situation, insbesondere als die Nazis Frankreich überfielen“, erklärt Joe. Ihm wird bewusst, wie unbefangen er diesen Leuten berichtet hatte. Weshalb war er nicht einfach vom Tisch aufgestanden und wieder nach New Jersey zurück gefahren, fragt er sich. Er hat das Gefühl sich bereits im Spinnennetz des Geheimdienstes verfangen zu haben. Außerdem hat es nur wenige Minuten gedauert, bis sein Deutsch wieder fehlerfrei und fließend war. Die Hauptspeisen werden serviert, saftige Rindersteaks mit knackigem Salat, was ihm Zeit zum Nachdenken gibt. „Ich habe einen kalifornischen Rotwein ausgewählt, ich hoffe er sagt Ihnen zu, Mister Seibel, zum Wohle!“, wünscht Fenton und hebt sein Glas.
Nach dem Essen berichtet Joe dem Professor, dass im Jahre 1940 ein einflussreicher Bürger der Vereinigten Staaten von Amerika eine Bürgschaft für ihn geleistet und seine zügige Einbürgerung ermöglicht hatte. Im Gegenzug hatte er sich freiwillig zum Dienst bei der US-Navy zu melden. Der Professor gibt Fenton ein unmerkliches Zeichen, welches Joe allerdings nicht entgeht. Fenton setzt das Gespräch auf Englisch fort. „Kein geringerer als Director Burns hat für sie gebürgt. Zunächst waren Sie bei der Navy und später bei der Army, wo Sie eine erstaunliche Karriere machten, Mister Seibel. Sie waren am D-Day in der Normandie und später bei der Befreiung von Paris dabei. Sie wurden ins Offizierskorps der US-Army aufgenommen. Sie wurden verwundet und mit dem Silver Star ausgezeichnet. Nach dem Krieg waren Sie in Heidelberg stationiert und wurden später als Dolmetscher und Berichterstatter zu den Nürnberger Prozessen berufen.“ Joe nickt. „Und weshalb haben Sie mich hierher bestellt?“ „Darüber reden wir morgen, Mister Seibel.“ „Meine Leute werden Sie um Punkt Zehn Uhr vor dem Hotel abholen. Professor Rochford und ich werden uns jetzt zur Beratung zurückziehen. Wir sehen uns Morgen und vielen Dank für Ihre Hilfe.“ Die beiden verabschieden sich mit festem Händedruck und ernstem Blick.
Der schwarze Cadillac hält exakt zeitgleich mit dem Glockenschlag eines nahen Kirchturms vor dem Stanton Park Inn. Ein kräftiger Mann in dunklem Anzug und Sonnenbrille, so hatte Joe sich Geheimdienstler immer vorgestellt, kommt direkt auf ihn zu, obwohl mehrere Hotelgäste vor dem Eingang warten. „Mister Joe Seibel?“ „Ja.“ „Steigen Sie in den Wagen, wir bringen Sie zu Mister Fenton!“ Der Wagen biegt auf die schnurgerade, endlos lange Massachusetts Avenue ab. Der Fahrer und sein Begleiter schweigen während der Fahrt. Joe ist mulmig zumute. Er hatte in der Nacht kaum geschlafen, hatte stattdessen noch einen doppelten Whisky an der Hotelbar genommen, ziemlich teuren Scotch, die Schotten brannten einfach den besseren Whisky. Er hatte den Beruhigungsdrink auf die Rechnung setzen lassen, wer auch immer die beglich. Sie wollen ihn für eine Geheimdiensttätigkeit gewinnen, soviel ist klar. Unklar ist, welche Risiken und Chancen damit verbunden sind. Schließlich war er zu der Einschätzung gelangt, dass er nicht einfach verschwinden konnte. Wenn die Kerle etwas von ihm wollen, würden sie ihn ohnehin nicht in Ruhe lassen. Und der Evening Observer würde ihn möglicherweise feuern, wurde ihm immer mehr bewusst. Er würde sich zunächst einmal anhören, worum es eigentlich geht. Auf dem Weg zurück in sein Hotelzimmer hatte er überlegt, ob er zu dieser späten Stunde noch Rebecca anrufen soll. Nein, er muss den heutigen Tag abwarten, er hätte sie nur unnötig beunruhigt.
Sie fahren im mäßigen Tempo weiter die Massachusetts Ave hinauf und biegen am Du Pont Circle in Richtung Georgetown ab, wo sich die gleichnamige Universität befindet. Schließlich halten sie vor einem unscheinbaren Gebäude. „Bitte, Mister Seibel!“, sagt sein Begleiter und bedeutet ihm auszusteigen. Man führt ihn in das Gebäude, kein Schild an der Tür, nichts was auf irgendetwas schließen lässt, was sich dort drinnen befinden mag. Sie gehen einen Gang entlang. Hinter einer Glastür sieht Joe zwei Männer an ihren Schreibtischen arbeiten. Schließlich begrüßt Douglas Fenton ihn in einem fensterlosen Besprechungsraum mit sachlich nüchterner Einrichtung. „Haben Sie gut geschlafen, Mister Seibel?“ „Wie Sie sich denken können, habe ich nicht gut geschlafen, Mister Fenton.“ „Nun, Professor Rochford ist der Meinung, dass Sie ein absolut authentisches Deutsch sprechen, welches auf eine norddeutsche Herkunft schließen lässt.“ Joe sieht ihn fragend an. „Mister Seibel, wir brauchen Ihre Fähigkeiten als Mitarbeiter der CIA in Deutschland. Sie würden dort offiziell als freier Auslandskorrespondent für verschiedene Nachrichtenagenturen normale Pressearbeit leisten. Dabei hätten Sie Zugang zu Pressekonferenzen, politischen Beratungen und kulturellen Veranstaltungen und so weiter. Wir brauchen Dossiers zu bestimmten Persönlichkeiten aus deutschen Ministerien und aus der Wirtschaft. Diese zu beschaffen ist nicht wesentlich anders als übliche Pressearbeit. Hintergrund ist die Wiederbewaffnung Westdeutschlands, welche dort und erst recht in Europa nicht unumstritten ist, jedoch einen wichtigen machtpolitischen Faktor innerhalb der westlichen Allianz darstellt. Inzwischen hat die westdeutsche Regierung ein Gesetz verabschiedet, welches eine grundsätzliche Aufstellung von eigenen Streitkräften ermöglicht und einen Artikel in ihrem Grundgesetz, so nennen sie ihre Verfassung, geändert. Die USA begrüßt dies nicht nur, sondern fördert die Aufstellung einer westdeutschen Armee sogar, allerdings würden wir gern ein bisschen mehr über die Leute wissen, die an den deutschen Schaltstellen sitzen. Zum anderen geht es darum, wie die westdeutsche Öffentlichkeit darauf reagiert. Das geschieht alles im Sinne der freien westlichen Gesellschaften. Wir brauchen in Europa stärkere Allianzen gegen den sich ausbreitenden Sowjetkommunismus. Kurzum, das Beschaffen von personenbezogenen Informationen ist eine von zwei Aufgaben.“ Fenton mustert ihn aufmerksam. „Und weshalb kommen Sie gerade auf mich?“ „Erstens: Ihre authentischen Sprachkenntnisse und Ihre deutsche Herkunft. Zudem sprechen Sie außer Deutsch auch Französisch. Zweitens: Sie sind dekorierter Reserveoffizier unserer Streitkräfte und haben somit gewisse Loyalitätspflichten. Drittens: Sie führten im Krieg eine Einheit für psychologische Kriegsführung, zu der Sie sich freiwillig versetzen ließen. Daher haben Sie bereits Erfahrungen in der Beschaffung und Verbreitung von Informationen. Erinnert haben wir auch Ihre klugen Kommentierungen und Dossiers während Ihrer Tätigkeit bei den Nürnberger Prozessen. Sie haben eine seltene Gabe Menschen einzuschätzen. Sie haben seinerzeit in Nürnberg in einer Ihrer Kommentierungen den Suizid von Hermann Göring vorausgesagt!“, wirft Fenton ein. „Ich war nicht der Einzige, der das gedacht hat. Wer sich solche Schuld, wie die Angeklagten von Nürnberg aufgeladen hat und zum Tode verurteilt wird – nun da haben sich schon Menschen aus niedrigeren Bewegründen selbst ins Jenseits befördert.“ „Sie haben es aber aufgeschrieben und wir haben es gelesen. Zudem, Informationen sammeln ist unser Job und bevor wir Sie hierher bestellten, haben wir auch ein wenig über Sie in Erfahrung bringen können.“ „Zum Beispiel, dass ich Familie habe“, fällt Joe ihm ins Wort. Fenton geht nicht darauf ein. „Bedenken Sie Folgendes, Mister Seibel. Sie erweisen den Vereinigten Staaten von Amerika einen Dienst. Sie erweisen der freien Welt einen Dienst und …“ Fenton macht eine Kunstpause und mustert ihn, „Sie erweisen sich selbst einen Dienst, indem Sie zu deutlich mehr Wohlstand und Ansehen kommen. Sie werden ein angesehener Auslandskorrespondent werden und hochinteressante Menschen kennenlernen, wozu wir Ihnen die Türen öffnen, alles nur für ein paar Informationen.“ Joe sagt nichts. „Was hindert Sie, Mister Seibel?“ „Die derzeitige amerikanische Innenpolitik, zum Beispiel.“ Fenton lacht gequält. „Ja, wir haben Ihre politischen Artikel, insbesondere den von letzter Woche, gelesen. Unter uns, Senator McCarthy ist so gut wie erledigt, er hat die Sache überzogen, als er sich mit der Army anlegte und sogar Präsident Eisenhower kritisierte. Daher werten wir Ihren Artikel als kritisch intellektuelle Auseinandersetzung mit der sozialistischen Ideologie.“ „Und wenn ich an Ihrem Angebot nicht interessiert bin, Mister Fenton?“ „In diesem Falle, Mister Seibel“, Fenton knetet sich das Kinn und sieht ihn mitleidig an, „für den recht unwahrscheinlichen Fall, dass Sie nicht kooperieren, nun dann könnte man Ihren Artikel womöglich als staatsfeindlich interpretieren, insofern, dass Sie mit den Kommunisten sympathisieren und das, Mister Seibel, wäre ihrer beruflichen Karriere gar nicht förderlich, auch dafür könnten wir sorgen. Sehen Sie, so funktioniert Geheimdienst: Finde die Leiche im Keller deines Feindes und lege sie ihm vor die Tür oder vergrabe sie in der Tiefe.“ „Wollen Sie mir drohen?“, fragt Joe. „Sagen wir mal, ich erläutere Ihnen die Alternativen. Ach, ehe ich es vergesse, Ihre zweite Aufgabe wäre übrigens, gezielt Informationen zu verbreiten, eine subtile Form der Einflussnahme. Sie sehen, wir verlangen nicht, dass Sie in sowjetische Atomwaffenstützpunkte eindringen, sondern nur ein bisschen Konversation am Rande einer Konferenz, an der Hotelbar ein bisschen die Ohren aufsperren, hier und da ein Gerücht verbreiten. Leichte Arbeit in angenehmer Atmosphäre.“ Fenton kommt näher heran und beschwört ihn eindringlich: „Normalerweise muss man sich bei uns um so einen Job bewerben. Sie bekommen ihn quasi auf dem Silbertablett serviert, bedenken Sie das und geben Sie sich einen Ruck! Sie wollen Ihrer Frau und Ihrer Tochter doch etwas bieten.“ Joe schwirrt der Kopf. In dem Raum ist es heiß und stickig. Er braucht dringend eine Pause und frische Luft, aber Fenton lässt ihm keine Ruhe. „Sie sind dort in Deutschland nicht auf sich allein gestellt. Die Firma hat überall ihre Leute sitzen und die Firma sorgt gut für ihre Mitarbeiter.“ „Für den eher unwahrscheinlichen Fall, ich würde Ihr Angebot annehmen, was ist mit meiner Familie?“, fragt Joe. „Was würden Sie tun, wenn Ihre Zeitung Sie nach Deutschland versetzt?“, stellt Fenton die Gegenfrage. „Normalerweise würden wir umziehen.“ „Aber…?“ „Meine Frau wird, aus Ihnen bekannten Gründen, nie mehr deutschen Boden betreten.“ „Wird sie das nicht?“ Fenton schnalzt despektierlich mit der Zunge. „Nun in diesem Fall, zu Weihnachten spendiert Ihnen die Firma einen Rückflug nach New York, dann können Sie Ihre Frau besuchen, wenn sie hierbleiben möchte.“ Joe sieht ihn grimmig an. „Das müssen Sie mit Ihrer werten Gattin klären! Ihr Einsatzort ist Bonn, der Regierungssitz Westdeutschlands. Sie bekommen dort eine komfortable Dienstwohnung zu sehr günstigen Konditionen, sowie die Besoldung eines Lieutenants, ihr letzter Dienstgrad bei der Army, hinzu kommen Auslandszulagen. Allein davon können Sie und Ihre kleine Familie in Deutschland recht komfortabel leben. Dazu noch die üblichen Spesen, Pensionsansprüche, kostenlose medizinische Versorgung und die Honorare, welche Sie von den Presseagenturen erhalten.“
Obwohl es früher Abend ist, steht die feuchte Hitze in den Straßen und Parkanlagen Washingtons. Die Firma, diese Bezeichnung hatte sich inzwischen bei ihm eingeprägt, hatte ihm angeboten ihn ins Stanton Park Inn zu fahren. Am nächsten Tag hatte man ihn bereits um neun Uhr zu jenem Gebäude in Georgetown einbestellt. Er solle mit seinem eigenen Wagen kommen. Joe hatte sich in der Nähe des Lincoln Memorials von dem Fahrer des schwarzen Cadillacs absetzen lassen. Der hatte nur den Kopf geschüttelt, weil Joe die restliche Strecke zu Fuß gehen wollte, für die meisten Amerikaner eine absurde Idee. Er läuft am Ufer des Potomac entlang, in der Hoffnung, dass die Luft hier etwas erträglicher ist. Stattdessen trieft die ganze Gegend nur so von amerikanischem Pathos, an jeder Ecke ein Monument für Persönlichkeiten und ihr Wirken, welches Amerika zu dem gemacht hat, was es ist. Auf dem anderen Ufer des Potomac der gigantische Heldenfriedhof Arlington für die Söhne dieses großartigen Landes, welche ihr Leben gaben, um die Freiheit, wessen auch immer, zu verteidigen. Nach wenigen hundert Metern ist er völlig verschwitzt und seltsam erschöpft. Was sollte er tun, es riskieren, dass die CIA ihm seine berufliche Karriere ruiniert. Hatten sie wirklich soviel Macht? Zumindest würden sie ihm weitere Steine in den Weg rollen. Andererseits, ginge er endgültig auf Fentons Angebot ein, wie schwierig wäre es dann, die Geheimdiensttätigkeit zu beenden, wenn er erst als Auslandskorrespondent den Fuß in der Tür hätte? Hatte er es selbst in der Hand, wie weit er mit der geforderten Informationsbeschaffung ging? Vermutlich nicht. Andererseits, als er sich seinerzeit freiwillig zur Navy gemeldet hatte, und später zu einer Spezialeinheit der Army, war er viel größere Risiken eingegangen. Dagegen war das was Fenton von ihm verlangte gar nichts. Nur – jetzt hatte er Familie, eine Frau, die kaum Verständnis dafür aufbringen würde mit ihm nach Deutschland zu kommen, wo er einer Geheimdiensttätigkeit nachging. Zudem durfte er gar nicht mit ihr darüber reden. Und Rahel? Er würde sie aus ihrer gewohnten Umgebung herausreißen – Verdammt! Er kickt einen Stein vom Fußweg in den Potomac. Am Jefferson Memorial besteigt er ein Taxi und lässt sich ins Hotel bringen.
Nördlich von Washington D.C. am nächsten Abend
Die Firma hätte ihm eine weitere Nacht im Stanton Park Inn spendiert, so dass er bequem und ausgeruht am nächsten Morgen hätte nach Hause fahren können, aber Joe wollte so schnell wie möglich weg aus Washington. Seine Gedanken waren derartig aufgewühlt, dass er ohnehin keinen Schlaf gefunden hätte. Vor seiner Abfahrt hatte er noch kurz mit Rebecca telefoniert, ihr berichtet, dass er ein verlockendes Angebot als Auslandskorrespondent bekommen und die Verträge unterschrieben hatte, dass er wesentlich mehr verdienen wird. Er würde gleich losfahren und irgendwann in der Nacht oder am frühen Morgen zu Hause ankommen. Rebecca hatte natürlich sofort die richtigen Schlüsse gezogen und gefragt, ob er in ein anderes Land versetzt würde, womöglich nach Europa und wie er sich das alles vorstelle? „Wir gehen natürlich zusammen dorthin“, hatte er beteuert. „Wohin, Joe?“, hatte sie wissen wollen. „Lass uns in Ruhe darüber reden, wenn ich zurück bin, Liebes“, hatte er sie zu beruhigen versucht und gleichzeitig gewusst, dass er genau das Gegenteil bewirkt hatte. Sie hatte nochmal nachgefragt, er war ihr ausgewichen. Dann hatte sie das Thema gewechselt: Er solle vorsichtig fahren und lieber unterwegs in einem Motel übernachten, als die ganze Nacht durchzufahren und sie hätten im Radio ein schweres Unwetter für Maryland und das westliche Pennsylvania angesagt. Dann war das Gespräch unterbrochen worden.
Sie hatten bisher nie Geheimnisse voreinander gehabt, Rebecca und er. Das würde sich jetzt mit Sicherheit ändern. Von seiner Tätigkeit für die CIA durfte er ihr nichts sagen. Douglas Fenton und zwei weitere Männer hatten ihn heute weichgeklopft, an seine Loyalität gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika appelliert. Einer der Kerle hatte die ganze Zeit nichts gesagt, der war wohl zum Beobachten dort. Als Joe noch beim Militär war, konnte man an den Streifen auf der Schulter seines Gegenübers sofort erkennen, ob man es mit einem Sergeant oder einem Colonel zu tun hatte, mit lässigem Handkante an die Mütze oder mit einem strammen „Sir, Jawohl, Colonel Sir!“ zu reagieren hatte. Beim Geheimdienst trugen alle Anzug und Krawatte, nie wusste man, mit wem man es tatsächlich zu tun hatte. Schließlich hatte er einige Papiere unterschrieben. In einigen Tagen würde er zu Trainingszwecken erneut nach Washington bestellt werden. Schließlich hatte Fenton ihm ein Couvert mit einem Scheck in die Tasche seines Sakkos gesteckt. Er solle sich und seiner werten Gattin schon mal eine passende Reisegarderobe beschaffen. Jetzt steckte das Couvert ungeöffnet in seiner Tasche. Man hatte ihm einiges zur Geheimdienstarbeit erklärt, dass er seinen Vorgesetzten in Bonn kennenlernen würde. Auch hatte man von der neuen CIA-Zentrale berichtet, welche sich noch im Aufbau befinde, einem riesigen Komplex an einem Ort namens Langley, nicht weit entfernt in Virginia gelegen. Von dort würde die Firma in Zukunft alle Fäden ziehen. Am Ende des Tages konnte er sich eines gewissen Stolzes nicht erwehren, Teil der Firma zu sein und doch loderte Zweifel tief in seinem Innern. Nur zwei Tage hatten sie gebraucht, um ihn zu überzeugen.
Von Osten ziehen dunkle Wolken heran. Joe erreicht den Stadtrand von Baltimore und beschließt die Stadt diesmal westlich zu umfahren. Eigentlich muss er nur aufpassen, die Federal 1 nicht zu verlassen, die würde ihn direkt in Richtung New Jersey leiten. Dann führt ihn eine Umleitung in eine andere Richtung. Joe fährt weiter durch Vororte und lässt die Großstadt schließlich hinter sich. Weiter in Grübeleien versunken, ob er die richtige oder gar eine verhängnisvolle Entscheidung getroffen hatte und wie er Rebecca beibringen sollte, dass sie bereits in wenigen Wochen nach Deutschland abreisen müssen, fährt er in die beginnende Dämmerung. Er achtet nicht auf Straßenschilder, weil er glaubt längst wieder auf der richtigen Straße zu sein. Regen und böiger Wind setzt ein, zerrt an der Lenkung. Die Gegend wird hügeliger und einsamer. Die Straße ist viel zu schmal für eine Hauptstraße. Verdammt, zu allem Überfluss hatte er sich auch noch verfahren. Joe hält am Straßenrand, versucht sich mit Hilfe einer Landkarte zu orientieren. Er hat keine Ahnung, wo er sich befindet. Erstmal weiterfahren bis zur nächst größeren Ortschaft, beschließt er. Hinter den Hügeln Wetterleuchten, dann Gewitterblitze. Bald darauf trommelt Hagel auf das Autodach, man kann nur noch langsam fahren. Schließlich erreicht er ein Motel mit Tankstelle. Nur zwei Autos parken dort, ein uralter Ford Pickup und ein Dodge. Als er sein Gepäck aus dem Kofferraum hebt, setzt extrem starker Regen ein. Die Anmeldung des Motels, nur wenige Meter entfernt, erreicht er völlig durchnässt.
Joe hatte schon häufig in Motels übernachtet und war einiges an Geschmacklosigkeit gewohnt, aber dieses Etablissement stellt alles Bisherige in den Schatten. Fleckige braune Tapeten, gelber Bodenbelag aus Kunststoff, hässliche resopalbeschichtete Möbel. Das Radio ist kaputt, einzige Unterhaltung scheint die obligatorische Bibel auf dem Nachtschrank zu sein. Bei den Spesensätzen der Firma würde er vermutlich nie mehr in so einer Absteige übernachten müssen. Draußen tobt das Gewitter, der Sturm rüttelt an den dünnen Wänden, die vom Fliegendreck fleckige Deckenlampe flackert bedenklich. Joe beschließt nochmal bei Rebecca anzurufen. Er läuft zurück in das Büro der Anmeldung. Ob man telefonieren könne. Der alte Mann hinter dem Tresen weist auf den altmodischen Münzapparat an der Wand. Joe hebt den Hörer ab. Die Leitung ist tot.
Jersey City zur gleichen Zeit
„Wann kommt Papa zurück?“, fragt Rahel. „Morgen früh, wenn du aufwachst, ist er bestimmt schon hier, mein Liebling.“ Rahel nickt. „Darf ich vor dem Schlafengehen noch ein bisschen spielen?“ „Ja, aber nur bis acht Uhr und du putzt dir vorher schon die Zähne!“, erklärt Rebecca resolut. Rahel läuft eilig ins Badezimmer, um ihr Pflichtprogramm schnell zu absolvieren damit möglichst viel Zeit zum Spielen übrigbleibt, bis ihre Mutter das Licht löscht.
Rebecca beobachtet ihre Tochter nachdenklich, wie sie vor ihrer prachtvollen Puppenstube hockt. So eine hatte sie in ihrer Kindheit in Hamburg auch besessen. Sie hatten in den Kaufhäusern und Spielzeuggeschäften New Yorks lange nach so einem schönen Stück gesucht und waren in einem Antiquitätengeschäft fündig geworden. Rahels Puppenstube ist wie ein dünner Faden, der sie mit ihrer eigenen Kindheit in Hamburg verbindet, denkt Rebecca.
Später als Rahel schläft, versucht Rebecca noch ein wenig zu lesen, aber sie kann sich nicht konzentrieren. Sie stellt ihr Buch, Bonjour Tristesse von Françoise Sagan, zurück in ihren Bücherschrank, wo sich über die Jahre eine richtige Bibliothek aus überwiegend französischen Romanen angesammelt hat. Aus dem Radio klingt leise Country-Musik von Hank Williams, I won’t be home no more. Irgendetwas war merkwürdig vorhin als Joe anrief, grübelt sie. Wenn er einen besseren Job ergattert hatte, sollte er sich doch freuen, aber er war seltsam bedrückt. Er sagte, dass er den Vertrag bereits unterschrieben hatte. Womöglich gehen wir bald ins Ausland, aber Amerika ist für mich auch irgendwie Ausland, auch wenn es uns hier ganz gut geht. Wenn Joe nach Frankreich versetzt werden würde, nach Paris, das wäre großartig. Sie liebt die Stadt immer noch. Und Rahel würde sich dort bestimmt auch wohl fühlen, immerhin beherrscht sie die Sprache sogar etwas besser als Englisch. Und sie selbst würde in Frankreich möglicherweise interessante Arbeit finden, vielleicht in einem kleinen Buchladen in Saint Germain des Prés auf Tuchfühlung mit den französischen Existenzialisten, Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre, deren literarische Werke sie gelesen hatte. Ach, was träumte sie? Wer weiß wie unsere Zukunft tatsächlich aussieht, aber als Heimchen am Herd, wie in den letzten Jahren, wollte sie nicht versauern und ein Ortswechsel wäre nicht das Schlechteste.
Der Glockenklang von Saint Eustàche holt Rebecca aus einem unruhigen Schlaf, aber sie ist nicht in Paris, sie hat nur geträumt, wird ihr einen Augenblick später klar, als sie sich in ihrem Schlafzimmer in Jersey City umblickt. Der einst vertraute Glockenschlag entpuppt sich als Gepolter blecherner Mülltonnen unten auf der Straße. Joes Betthälfte neben ihr ist leer. Dann ist er wohl ihrem Rat gefolgt und übernachtet auf der Strecke. Sie steht auf, blickt wie jeden Morgen zuerst aus dem Fenster. Die Morgensonne glitzert in den Wolkenkratzern jenseits des Hudson. Unten auf der Straße, wenig Verkehr, der Wagen vom Milchmann hält vor dem Haus. Sie schaltet das Radio ein. Ein wildes Stück erklingt: Rock around the Clock, von einem gewissen Bill Haley and his Comets. Unten vor der Haustür greift sie sich die beiden Milchflaschen, wie jeden Morgen und bereitet das Frühstück, bevor sie Rahel weckt.
Irgendwo in Maryland zur gleichen Zeit
Eine kristallklare, kühle Luft vom Gewitter gereinigt. Die wenigen Autos vor dem Motel sind mit abgerissenen Zweigen, Blättern und Tannennadeln bedeckt. Eine Werbetafel ist umgeweht. Riesige Pfützen überall. „Kann man hier irgendwo frühstücken?“, fragt Joe den alten Mann, der immer noch am Tresen der Anmeldung sitzt. „Drüben an der Tankstelle.“
Während des erbärmlichen Frühstücks, laffes wässriges Rührei und von ranzigem Fett triefender Speck auf gummigem Toast, dazu grässlicher Kaffee, erfährt Joe, dass einige Straßen wegen des Unwetters gesperrt sind, unter anderem jene Strecke, auf welcher er von Baltimore hier heraufgekommen war. So fährt er weiter in die ursprüngliche Richtung, um irgendwo nach Norden abzubiegen, eine Fährverbindung oder Brücke hinüber Richtung Philadelphia zu erreichen. Aber auf der entsprechenden Straße versperrt ein Polizeiwagen den Weg. Die Strecke sei unpassierbar, er solle am besten bis hinauf nach Harrisburg fahren und dort den Susquehanna überqueren. Ein großer Umweg, denkt Joe, aber der Himmel ist blau, die Landschaft Pennsylvanias schön und die Luft selten klar, gute Bedingungen, um nachzudenken.
Auch am Hudson ist das Wetter schön, als Joe dort am frühen Nachmittag eintrifft. Er begibt sich aber zunächst nach New York City in die Redaktion des Evening Observers, anstatt nach Hause zu fahren. Er braucht jetzt Gewissheit, ob man ihn bereits gefeuert hat und ob möglicherweise die Firma ihre Finger im Spiel hatte. Seine Befürchtungen bestätigen sich, als er den großen Büroraum der Redaktion betritt. Viele Kollegen sind um diese Zeit noch nicht dort, aber die Blicke einzelner sagen alles: Du bist draußen, Mann! Auf seinem Schreibtisch mit der schwarzglänzenden Schreibmaschine mit dem goldenen Underwood Schriftzug liegt ein einzelnes Couvert. Als er es öffnen will, winkt Carrothers ihn in seinen Glaskasten. „Sie sind gefeuert, Seibel, sorry, aber Sie haben es überzogen!“, teilt er ihm mit. „Womit, wenn ich fragen darf?“ „Dürfen Sie nicht, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Es gab Beschwerden von höher Stelle über Ihre Berichterstattung und Recherchemethoden.“ Carrothers hält Joes Blick stand. Dann nickt er, geht ohne weitere Worte zu seinem Schreibtisch und packt wenige private Sachen in seine Aktentasche. Mit einer lässigen Geste, halbmilitärisch, die Handkante an die Stirn, verabschiedet er sich ebenso wortlos von seinen Kollegen. Einer ruft: „Machs gut, Joe“, zwei weitere klatschen verhaltenen Beifall für seinen Abgang, der sich wie eine Niederlage anfühlt. Carrothers blickt grimmig aus seinem Glaskasten.
Wo bist du denn solange gewesen? Wir haben uns Sorgen gemacht!“, empfängt Rebecca ihn, während Rahel ihm mit großem Schwung in die Arme springt. „Ich hatte mich gestern Abend verfahren und heute morgen waren wegen des Unwetters viele Straßen gesperrt. Ich musste über Harrisburg fahren.“
„Also, wohin geht es? Paris? Rom? London?“, fragt Rebecca endlich, als Joe sein vom Mittag aufgewärmtes Essen löffelt. „Leider keins davon“, seufzt er. „Also Berlin, ich habe es befürchtet“, sagt Rebecca ernüchtert. „Nicht ganz, aber das Land stimmt schon mal.“ Rebecca sieht ihn fragend an. „Bonn.“ Sie runzelt die Stirn. „Das ist der neue Regierungssitz Westdeutschlands“, erklärt Joe. „Ist mir bekannt“, knurrt sie. „Und wie lange?“ „Bis auf weiteres.“ „Was heißt das?“ Ihre Stimme wird lauter. „Liebling da ist noch etwas. An dem Job als Korrespondent hängt auch eine Nebentätigkeit für die US-Regierung in Bonn. Daher ist der Job wirklich lukrativ.“ Er beobachtet, wie hinter Rebeccas Stirn ein Räderwerk zu arbeiten beginnt. „Und was ist mit deinem Job beim Observer?“ „Gefeuert“, knurrt er emotionslos. „Was! Seit wann weißt du es?“ „Eigentlich seit dem Tag bevor ich nach Washington abreiste. Vor einer Stunde habe ich meine Papiere in der Redaktion abgeholt. Hängt wohl doch mit diesem McCarthy-Artikel zusammen.“ Sie schüttelt den Kopf, schweigt einen Augenblick. „Was ist das für eine Nebentätigkeit bei deinem neuen Job?“ „Pressearbeit für das hohe Kommissariat der Vereinigten Staaten von Amerika, das ist quasi so etwas ähnliches wie ein Konsulat. Weil Deutschland kein voll souveräner Staat ist, betreiben wir dort kein offizielles Konsulat“ „Und das hast du alles schon unterschrieben?“ Er nickt mit gespielter Überzeugung, eine gute Entscheidung getroffen zu haben. Rebecca steht auf, geht mit gerunzelter Stirn im Zimmer umher und bleibt schließlich am Fenster stehen. Die Wolkenkratzer New Yorks, von denen sie stets nur die oberen Stockwerke zu sehen bekommt, leuchten gleißend in der Abendsonne. Joe tritt hinter sie, berührt sie sanft an den Schultern. Sie macht sich energisch los und blickt schmollend in die andere Richtung. „Wir bekommen dort eine komfortable Wohnung. Wir können Rahel auf eine gute Schule schicken, Bonn ist voller Diplomaten“, beteuert er. „Komme ich auf eine andere Schule?“, fragt Rahel, die gerade ins Zimmer gelaufen kommt. „Lässt du Mama und Papa noch einen Augenblick allein, Liebling?“, spricht Rebecca mit brüchiger Stimme. „Bist du traurig, Mama?“, will Rahel wissen. Sie kräuselt besorgt die Stirn. „Nein, komm mal her, meine Kleine!“ Sie schließt ihre Tochter in die Arme. „Komme ich denn nun auf eine andere Schule? Diese ist nämlich blöd und langweilig. Die anderen Kinder wissen nichts und manchmal ärgern sie mich, nur weil ich schon alles kann“, beklagt sie sich. „Wir wissen es noch nicht genau, Rahel. Geh noch einen Augenblick spielen, ja?“ Rahel verlässt zögerlich und mit besorgtem Blick das Zimmer.
„Wann soll es losgehen?“, fragt sie schließlich. „Anfang Juli, vorher muss ich nochmal nach D.C., wegen dieser Regierungssache.“ Sie schüttelt den Kopf. „Deutschland“, murmelt sie verächtlich. „Das Land hat sich verändert, Rebecca! Dieser Adenauer macht eine demokratische und versöhnliche Politik. Er hat vor zwei Jahren dieses Wiedergutmachungsabkommen mit Israel durchgesetzt, das Londoner Schuldenabkommen ratifiziert …“ „Ich weiß, Joe, du brauchst mir jetzt keinen politischen Vortrag zu halten. Ich lese auch Zeitung!“, schimpft sie und verlässt das Zimmer. Joe steht ratlos vor dem Küchentisch, wo sein halbgegessenes Essen steht. Wenigstens hat sie diese Regierungssache, die er angedeutet hatte, nicht näher hinterfragt, sagt er sich und räumt das Geschirr in die Spüle. Dann entdeckt er die Briefe aus London und aus Hamburg. Rebecca hatte sie noch nicht geöffnet.
Wilhelmine, seine ältere Schwester, die in Hamburg lebt, schreibt, dass sie Ingelore ihre Halbschwester bei sich aufgenommen habe, dass Rita, Ingelores Mutter, im Sterben liege – Blutkrebs! Mit Ingelore, die gerade ihren fünfzehnten Geburtstag gefeiert hatte, pflegt er gelegentlichen Briefkontakt. Er hatte sie zuletzt 1945 in Hamburg gesehen. Damals war sie etwa so alt wie Rahel jetzt. Von der Krankheit ihrer Mutter hatte sie ihm vor Kurzem geschrieben. In den schlimmen Nachkriegsjahren hatte er Rita und Ingelore mit Lebensmittel und Kleidungssendungen aus den USA geholfen. Wilhelmine schreibt, dass es zu zweit zwar eng in ihrer kleinen Wohnung wird, aber es schon gehen werde, Ingelore sei ein tüchtiges Mädchen. Wilhelmine bat nie um etwas, war unglaublich genügsam und bescheiden. Joe beschließt ihr zu helfen – Ironie des Schicksals, wahrscheinlich würde er die beiden demnächst in Deutschland besuchen können. Er legt den Brief auf den Tisch und reißt das hauchdünne Luftpostcouvert aus London auf. Der Brief ist von Bernhard Monroe und eigentlich eher an Rebecca gerichtet. Monroe war 1943 über Frankreich mit seiner Lancaster abgeschossen worden und hatte verletzt und hilflos an den Resten seines Fallschirms in einem Baum gehangen, Rebecca fand ihn, bevor es die Deutschen taten. Er hatte Rebecca sein Leben zu verdanken. Monroe konnte mit Hilfe der Résistance, der Rebecca seinerzeit angehörte, aus dem besetzten Frankreich fliehen und hatte einen Brief von ihr für Joe zugestellt, wodurch sie sich nach dem Krieg überhaupt wiederfinden konnten. Rebecca und Bernhard Monroe hatten sich danach nie mehr gesehen, aber zu Weihnachten und manchmal auch zwischendurch schickte Monroe Briefe aus London und sprach stets eine Einladung aus, falls sie jemals in die britische Hauptstadt kämen.
LaGuardia Airport, New York, Juli 1954
Für Rebecca und Rahel ist es das erste Mal in ihrem Leben, dass sie ein Flugzeug besteigen, sogar das erste Mal, dass sie ein derartig großes aus nächster Nähe sehen. Beide hatten bisher auch nie einen Gedanken daran verschwendet, einmal eine so weite Flugreise anzutreten. Rahel hopst aufgeregt an Rebeccas Hand. Noch aufgeregter ist Joe, der hinter den beiden auf die Lockheed Super Constellation der TWA mit ihren roten Streifen und dem charakteristischen Heckleitwerk zuschreitet. Das Röhren von Flugzeugmotoren und der Geruch nach Flugbenzin und Abgasen erfüllt die Luft. Für Joe wird es sein zweiter Flug. Das erste Mal war er 1943 in einer Kuriermaschine der Air Force von St. John’s auf Neufundland nach New York geflogen. Lieber verdrängt er das Erlebnis, als sie über dem Sankt Lorenz Golf in ein Unwetter gerieten. Am oberen Ende der Gangway begrüßt sie eine lächelnde Stewardess in ihrer adretten zum Flugzeug passenden roten Uniform.
Die Super Constellation, Connie, wie sie liebevoll genannt wird, hat knapp 100 Plätze für Passagiere, vier Sitze pro Reihe, dazwischen ein breiter Gang. Die Familie Seibel hat Plätze im hinteren Teil der Maschine. Rahel ergattert den Fensterplatz neben ihrer Mutter. Auf der anderen Seite, von Rebecca durch den Gang getrennt, nimmt Joe Platz. Er blickt zu seiner Frau hinüber. Sie sieht bezaubernd aus in ihrem eleganten Kleid. Changierendes Nachtblau, enger Rock nach aktuellstem modischem Schnitt. Dazu trägt sie eine passende Bolero-Jacke, beides gekauft bei Saks auf der 5th Avenue. Bezahlt hatte er mit dem Scheck, den Douglas Fenton in die Tasche seines Sakkos geschoben hatte. Rebecca erwidert sein Lächeln. Gottseidank, denkt Joe, hat sie sich mit der Übersiedelung nach Deutschland arrangiert. Tagelang hatte sie lamentiert, ob der Umzug wirklich sein müsse und bei jeder Gelegenheit: „Ausgerechnet Deutschland!“ geseufzt.
Langsam füllt sich das Flugzeug mit Passagieren und die Luft wird stickig. Joe lockert seine Krawatte, ist ziemlich nervös. Lieber hätte er mit dem Schiff den Atlantik überquert. Die United States, das schnellste Passagierschiff aller Zeiten, liegt gerade im New Yorker Hafen. Dennoch, mit dem Flugzeug gewinnen sie mehrere Tage, welche sie dazu nutzen wollen, Bernhard Monroe in London zu besuchen.
Ein lautes Geräusch erfüllt die Kabine, Joe sieht an seinem Sitznachbarn, der in einer Zeitung blättert vorbei durch das Fenster. Einer der vier Motoren wurde gestartet. Augenblicklich ziehen dichte Qualmwolken vorbei. Es riecht plötzlich nach Abgasen in der Kabine. Die Maschine vibriert ungewöhnlich, findet Joe. Erschrocken blickt er sich um. Die Stewardessen lächeln. Andere Flugpassagiere sind in entspanntes Plaudern vertieft, oder blättern in einer Illustrierten. Der Mann neben ihm bemerkt seine Besorgnis. „Das ist ganz normal, wenn die Motoren kalt sind, verbrennt jede Menge Schmieröl, davon kommt der Qualm da draußen.“ Der Mann erklärt ihm, dass so ein Flugzeugmotor ein technisches Wunderwerk sei und in seinem Innern nicht nur die achtzehn Kolben, in Doppelreihe sternförmig um die Kurbelwelle gruppiert, diese in Rotation versetzen, sondern sich hunderte weiterer Teile präzise bewegen und mit Öl versorgt werden müssen. Nach knapp zwanzig Minuten seien die Motoren warmgelaufen und das Schmieröl überall im Motor verteilt, sodass man starten kann. Joe nickt. Ihm ist nicht wohl bei dem Gedanken mit diesem qualmenden Gerät viele Stunden über den riesigen Atlantik zu fliegen. Ihm bricht der Schweiß aus, obwohl es langsam kühler wird in der Kabine. Eine Stewardess begrüßt die Passagiere im Namen der Trans World Airlines und bittet darum sich anzuschnallen sowie das Rauchen einzustellen. Die Flugzeit nach London beträgt voraussichtlich vierzehn Stunden mit einer Zwischenlandung in Gander International, jener riesige Flugplatz mitten in der Wildnis Neufundlands, wo fast alle Fluggesellschaften ihre Maschinen für den Transatlantikflug auftanken.
Die Maschine steht immer noch mit laufenden Motoren in Parkposition. Weiterhin zieht Qualm am Fenster vorbei. „Sind Sie aus der Flugzeugindustrie?“, fragt Joe seinen Sitznachbarn. „Nein“, lacht der Mann, sein Name sei Cyrus Boney, er sei zwar Ingenieur aber er konstruiere Raupenschlepper.
Endlich, nachdem sich die 72 Kolben der vier Curtiss-Wright Doppelsternmotoren ausreichend warmgeboxt haben, drückt der Flugkapitän die vier Schubhebel nach vorn. Aufbrausender Motorenlärm begleitet den Start der Maschine. Joe verkrampft seine Hände um die Armlehne und denkt an die vielen hundert bewegten Teile in den Motoren, die sich jetzt viele Stunden lang mit hoher Geschwindigkeit präzise in ihren vorgegebenen Bahnen bewegen müssen. Rahel staunt, als sie kurz darauf aus ihrem Fenster erst New York aus der Luft, die Wolkenkratzer klein wie Spielzeuge, und später den endlosen blauen Atlantik erblickt.
London Airport, vierzehn Stunden später
Als die Maschine der TWA in London aufsetzt, ist es dort erst Nachmittag. Für die Flugpassagiere ist es aber bereits Mitternacht. Joes Sitznachbar, Mister Boney, bemerkt: „Da hatten wir ja Glück, alle vier Motoren haben durchgehalten“, als handele es sich um eine alltägliche Nebensächlichkeit. Joe sieht ihn fragend an. „Häufig drehen nur noch drei Propeller nach ein paar Stunden Atlantikflug, ich wollte es Ihnen heute Morgen nicht so direkt sagen. Sie schienen besorgt zu sein, aber die Connie kommt auch mit drei Motoren heil über den großen Teich.“ „Zurück in die Staaten reisen wir mit dem Schiff“, knurrt Joe.
Steifbeinig kommen die Passagiere die Gangway herunter. Joe sieht sich auf dem Rollfeld um. Ein Dutzend Passagierflugzeuge stehen vor einem modernen Empfangsgebäude. Auf der gegenüberliegenden Seite befinden sich rostige Wellblechhallen, welche gerade von den Raupenschleppern aus Mister Boneys Firma abgerissen werden.
„Sind meine Spielsachen auch schon hier?“, fragt Rahel, die im Flugzeug geschlafen hatte und ziemlich munter ist. „Nein, das dauert einige Tage. Das Schiff, mit dem unsere anderen Sachen und dein Spielzeug gebracht werden, ist ja viel langsamer. Außerdem bringen sie es direkt zu unserer neuen Wohnung“, erklärt Joe seiner Tochter. „Und warum haben wir es nicht alles in das Flugzeug getan?“ „Weil es zu viele Sachen sind, Rahel. Soviel darf man im Flugzeug nicht mitnehmen. Das haben wir dir doch schon erklärt.“ „Und wenn die Leute vom Schiff gar nicht wissen, wo unsere neue Wohnung ist? Oder wenn das Schiff untergeht?“ „Rahel, mach dir keine Sorgen, in spätestens zwei Wochen sind deine ganzen Spielsachen, Mamas Bücher und unsere anderen Sachen da. Sie werden im Hafen von Hamburg ausgeladen und dann mit einem Lastauto nach Bonn gebracht.“ Rahel sieht ihre Eltern immer noch zweifelnd an.
Nachdem sie ihr Gepäck empfangen und die Einreiseformalitäten in das Vereinigte Königreich hinter sich gebracht haben, besteigen die drei ein Taxi. „Das ist aber ein komisches Taxi“, bemerkt Rahel. „Ja, und es fährt auf der falschen Straßenseite“, ergänzt Rebecca amüsiert. „Das Taxi mag komisch für Sie sein, aber es fährt nicht auf der falschen Seite, Ma’am!“, erklärt der Taxifahrer resolut, während er eine Großbaustelle am Flughafen passiert. Danach fahren Sie durch eine verlassene Ortschaft mit heruntergekommenen dem Zerfall preisgegebenen Gebäuden. Heath Row steht auf dem verblichenen Ortsschild.
London empfängt sie mit von Kohlenrauch und Industrieabgasen geschwängerter Luft und einem blassgrauen Himmel. Rostige Bahnanlagen und backsteinerne Fabrikgebäude, scheinbar aus der Frühzeit der Industrialisierung, ziehen vorbei, bevor das Taxi an einem Trümmerfeld vorbeifährt. „Warum ist denn hier alles so kaputt und alt, Mama?“, fragt Rahel. Ehe Rebecca antworten kann, erklärt der Taxifahrer resigniert: „Kriegsschäden, man hat es noch nicht aufgeräumt.“ Sie fahren weiter durch trostlose Straßen im East End wo heruntergekommene Backsteingebäude sich mit Baulücken und Trümmergrundstücken ablösen. Nur an wenigen Stellen werden neue Häuser gebaut.
Bernhard Monroe hatte ein Hotel in der Nähe seiner Wohnung in Hackney empfohlen und in Joes Namen zwei Übernachtungen mit Frühstück gebucht. Am nächsten Tag sind sie bei seiner Familie zum Tee und zum Abendessen eingeladen. Das Hotel ist einfach und uralt, aber weniger geschmacklos als die amerikanischen Motels. Dafür mutet das ganze Ambiente, inklusive der ebenfalls uralten Rezeptionistin recht gruselig an. Rahel drückt sich ein wenig ängstlich an ihre Mutter.
Es ist noch dunkel als Rahel am nächsten Morgen zwischen ihren Eltern in dem knarrenden Doppelbett aufwacht. „Mama, ich habe komische Geräusche gehört, so ein Gluckern, bestimmt haust in dem Badezimmer ein Geist!“, flüstert sie. Durch den überlangen Anreisetag waren Rebecca und Rahel am Abend zuvor nach einem knappen Abendessen früh eingeschlafen. Joe hatte sich die halbe Nacht mit Kopfschmerzen umhergewälzt, sich Gedanken wegen seines neuen Jobs bei der Firma gemacht. „Rahel, es gibt keine Geister und es ist noch sehr früh, du musst noch einen Augenblick weiterschlafen“, stöhnt Rebecca. „Kann ich aber nicht, wenn da der Geist im Badezimmer ist“, quengelt sie.
Zwei Stunden später sitzen sie beim Frühstück. Komische Sachen essen die Engländer morgens, findet Rahel: Toast mit Bohnensuppe drauf, oder zähen Haferschleim, Porridge genannt – Igittigitt! Die kleinen Würstchen gefallen ihr allerdings.
Ein klappriger Zug bringt sie zur Liverpool-Street-Station, wo sie einen der roten Doppeldecker Busse besteigen, der sie endlich dorthin bringt, wo die britische Hauptstadt so aussieht, wie man sie von Postkarten kennt. Bevor sie den Trafalgar Square überqueren und Richtung Themseufer laufen, schärft Rebecca ihrer Tochter ein, an den Straßen aufzupassen und zuerst nach rechts zu schauen, da die Autos in England ja auf der falschen Seite fahren. „Der Taxifahrer hat gesagt, dass sie auf der richtigen fahren!“, wendet Rahel ein. „Die Engländer denken das“, kichert Rebecca, „aber sie fahren wirklich auf der falschen Seite.“ Rahel beschließt, dass die Engländer ein bisschen komische Leute sind.
Dieser Eindruck verstärkt sich, als Bernhard Monroes Familie sie am Nachmittag zum Tee empfängt. Margret Monroe ist eine robuste Rothaarige mit kräftigem Cockney Slang. Herr Monroe hat eine rotgeäderte Nase, wie man sie bei Zeitgenossen findet, die deutlich dem Alkohol zusprechen. Frau Monroe bedankt sich überschwänglich für die edlen Pralinen, die Rebecca am Vormittag bei Fortnum & Mason an der Piccadilly gekauft hatte. Danach hantiert sie minutenlang mit dem Teegeschirr herum, beteuert mindestens einmal pro Minute, was für ein liebes, süßes Mädchen Rahel sei und ermahnt ihre drei Söhne, die älter sind als Rahel, sich höflich zu benehmen, der reizenden jungen Dame gegenüber. Rahel findet das alles übertrieben, da sie bisher ja noch gar nichts Liebes, Süßes gemacht hatte, außer brav guten Tag Misses Monroe zu sagen und sich auf den ihr zugewiesenen Stuhl zu setzen. Die drei Jungen, Randolph, Barney und Harold, stupsen sich in einem fort unter dem Tisch an und müssen mehrmals von Frau Monroe ermahnt werden. Herr Monroe freut sich so sehr Mama und Papa zu sehen, dass er Tränen in die Augen bekommt. Er bittet bei Papa förmlich um Erlaubnis, Mama einmal herzlich umarmen zu dürfen, seine Lebensretterin! Dann sitzen alle am Tisch und bekommen schrecklich bitteren Tee eingeschenkt, in den die Engländer Milch gießen, was Rahel nicht mag. Dazu gibt es ein leckeres Gebäck, welches man hierzulande Scones nennt, welches man mit Rahm, Clotted Cream genannt, oder Marmelade isst. Neben den kleinen Frühstückswürstchen, den Soldaten mit den hohen Pelzmützen vor dem Palast der Königin und den roten Doppeldeckerbussen landen die Scones auf Rahels Positivliste für England. Die drei Söhne albern weiter herum, sehen zu Rahel hinüber, stoßen sich an und kichern. Ich sollte ihnen vielleicht mal die Zunge rausstrecken, denkt Rahel, lässt es aber lieber bleiben. Nachdem alle aufgegessen haben, schlägt Frau Monroe vor, dass die Kinder vielleicht spielen gehen sollten und ermahnt ihre Söhne abermals, sich von ihrer besten Seite Rahel gegenüber zu zeigen. Barney und Harold, die beiden Älteren, springen ungeachtet der Ermahnungen ihrer Mutter auf und rennen, sich gegenseitig Boxhiebe austeilend, durch den Flur während Randolph, ihr aufmunternd zunickt, ihn in das Kinderzimmer zu begleiten. Das Schlaf- und Spielzimmer der drei Jungen enthält ein Etagenbett und ein einzelnes Bett, einen verschrammten Kleiderschrank, einen niedrigen Tisch und Spielzeug, Holzklötze aus einem Baukasten und verschrammte Blechautos liegen unordentlich in einer Zimmerecke. Die beiden älteren Jungen balgen auf einem der Betten herum. Randolph sieht Rahel etwas ratlos an. Offensichtlich fühlt er sich für ihre Unterhaltung verantwortlich. „Püppchen zum Spielen haben wir leider nicht!“, erklärt Harold, der Älteste schließlich, ohne seinen Bruder aus dem Schwitzkasten zu lassen, wobei er das leider übertrieben mitleidig betont. Rahel muss sich konzentrieren, um seinen Cockney Slang zu verstehen. „Wir können auch etwas anderes spielen!“, schlägt sie mit einem Blick auf die verschrammten Spielzeugautos vor. „Au ja, wir spielen Car-Crashing!“, schlägt der rotgesichtige Barney vor, in der Hoffnung endlich aus seines Bruder Schwitzkasten frei zu kommen. Harold lässt von seinem jüngeren Bruder ab und hakt ein langes Brett aus einem der Betten aus. Er legt es als schiefe Ebene auf die Bettkante, so dass man die Autos dort herunterrollen lassen kann.
Für Bernhard Monroe ist der zweite Weltkrieg noch nicht vorbei. In bunt schillernden Farben erzählt er Joe und Rebecca, wie im September 1943 eine Messerschmitt mit ihren Zwanzigmillimeter Kanonen seine Lancaster in ein Küchensieb verwandelt habe, dass Blut und die Eingeweide seiner Kameraden durch das Flugzeug gespritzt seien und er mit einer Schusswunde aus der abstürzenden Maschine gestiegen sei. Seine Frau, welche die Geschichte wahrscheinlich schon dutzende Male gehört hatte, erträgt seinen Vortrag mit stoischer Miene. Voller Pathos fährt er fort, wie er eine halbe Ewigkeit in seinem zerrissenen Fallschirm hilflos in diesem verdammten französischen Baum gehangen habe, und dass Blut aus seiner Fliegermontur tropfte. Die ganze Zeit hatte er befürchtet von einem Trupp Krauts gefangengenommen zu werden. Da endlich sei Rebecca, seine Retterin, wie ein Engel erschienen, habe ihn zusammen mit ihren Kampfgefährten aus dem Baum befreit und in Sicherheit gebracht.
Rahel hatte beschlossen, dass Jungs zwar ziemlich meschugge sind, es aber manchmal sehr lustig mit ihnen sein konnte. Das Zercrashen von Blechspielzeug hatte jedenfalls eine Menge Spaß gemacht. „Lasst uns lieber Krieg spielen!“, schlägt Harold nach einer Weile vor. Eine Schachtel mit winzigen Plastik-Spielzeugsoldaten wird auf dem Boden ausgekippt. Diese werden auf zwei Mannschaften verteilt. Randolph und Rahel, welche die Krauts seien, die fuckin’ Krauts, wie Harold mehrmals beteuert und Barney und Harold, welche natürlich die sieggewohnte Britische Armee spielen. Eine Weile sind die vier damit beschäftigt grüne und graue Soldaten in zwei Haufen zu sortieren. Diese werden auf Festungsmauern aus Bauklötzern nach strategischen Gesichtspunkten aufgestellt. Zuletzt werden Tonmurmeln verteilt, um sie mittels Katapultbrettchen auf die gegnerischen Truppen abzufeuern. Barney und Harold sind ziemlich siegessicher, treffen aber zunächst nur mit lautem Klacken den Kleiderschrank. Dann ist Rahel an der Reihe zurückzuschießen. Barney und Harold grinsen. Rahel zielt genau und vernichtet eine halbe Kompanie Royal Sutherland Highlanders. Daraufhin ändert Harold seine Taktik und wirft wütend einen Bauklotz mit den Worten: „Take this, fuckin’ Krauts!“, trifft jedoch nicht die German Parachuters, der Klotz prallt vom Boden ab und trifft Rahel am Kopf. Die greift sich erschrocken an die Stirn. Totenstille herrscht plötzlich im Kinderzimmer. Die drei Brüder erwarten sekündlich ein lautes Geheule von Rahel und augenblicklich das Erscheinen der beiden Mütter und ein Mordstheater. „Oh, so sorry!“, entschuldigt Harold sich kleinlaut. Jetzt bloß nicht heulen, denkt Rahel und beißt die Zähne zusammen, obwohl es höllisch wehtut und sie unter ihrer Hand spürt, wie eine Beule an ihrer Stirn wächst. „Tut es sehr weh?“, fragt Randolph und berührt sie mitfühlend an der Schulter. „Geht schon wieder, spielen wir weiter“, sagt sie zur Überraschung der Brüder, wirft ebenfalls einen Bauklotz und radiert damit das gegnerische Royal Engineers Corps aus. Kurz darauf werfen die vier in einer völlig außer Kontrolle geratenen Schlacht Bauklötze auf die verbliebenen gegnerischen Stellungen. Weil das Werfen von Bauklötzen ziemlich laut ist, kommt Frau Monroe in das Zimmer und schimpft ihre Söhne, wegen ihres ungezogenen Verhaltens und das, wo sie doch so reizenden Besuch hätten. Der reizende Besuch hatte sich inzwischen allerdings den Respekt ihrer drei Jungen erworben, weil er den Treffer von Harolds Bauklotz an seiner Stirn ohne großes Aufsehen weggesteckt und dazu wesentlich zur Vernichtung der britischen Plastik-Armee beigetragen hatte. Rahel hält noch einen Bauklotz abwurfbereit in ihrer Hand, versteckt hinter ihrem Rücken, damit Frau Monroe es nicht sieht, und sie weiterhin für lieb und süß hält. Die weist ihre Söhne an, das Chaos aufzuräumen und dann zum Abendessen zu kommen. Rahel solle am besten gleich mitkommen. „Nein, ich muss doch beim Aufräumen helfen!“, widerspricht sie. Die Jungen beeilen sich, indem sie das ganze Spielzeug in eine Zimmerecke häufen, weil mit dem Öffnen der Tür der Geruch des Abendessens ins Zimmer drang. „Es gibt Eel Pie and Mash“, verkündet Randolph voller Vorfreude. Rahel kann sich darunter nicht soviel vorstellen und auch den Essensgeruch findet sie nicht wirklich verlockend.
Das Abendessen entpuppt sich als gekochter Aal in Aspik mit Petersiliensoße und Kartoffelstampf, ein traditionelles Essen aus dem Londoner East End, erklärt Margret Monroe stolz. Dann sehen die beiden Mütter fast gleichzeitig Rahels Beule an der Stirn. „Kind, was ist denn da passiert?“, fragt Frau Monroe entsetzt und sieht ihre Söhne vorwurfsvoll an. Harold errötet und öffnet den Mund, ohne dass ein Wort herauskommt. „Wir haben gespielt und ich habe mich gestoßen“, erklärt Rahel schnell. Frau Monroe blickt trotzdem ihre Söhne an und schüttelt den Kopf. „Tut es noch weh, meine Süße? Soll ich etwas zum Kühlen holen?“ Rahel verneint. Sie hat ganz andere Sorgen, nämlich wie sie dieses glibberige Zeug auf ihrem Teller hinunterbekommen soll. Sie beginnt erstmal mit einer Gabel voll Kartoffelstampf, der besser schmeckt als er aussieht.
Herr Monroe und Papa hatten Whisky getrunken. Jetzt haben sie jeder eine Flasche Bier neben ihrem Teller stehen. Die anderen trinken Limonade. Während des Essens erzählt Herr Monroe komische Sachen, nämlich dass die Briten ihre Briefkästen und Telefonzellen aus dem vollen Gussstahlblock fertigen und so eine derartig solide britische Telefonzelle durchaus in der Lage sei, einen deutschen Tiger Panzer aufzuhalten. Trotzdem sei die britische Wirtschaft am Boden, während die Deutschen schon wieder wirtschaftlich obenauf seien und bald wieder eine eigene Armee hätten. Zu allem Überfluss haben die Krauts auch noch die Fußball Weltmeisterschaft gewonnen. Rahel beschließt indessen, sich die englischen Telefonzellen und Briefkästen genauer anzusehen. Monroe fährt fort, indem er pathetisch erklärt, dass die britische Industrie viel besser ist, als ihr Ruf. Ihre Flugzeugindustrie habe schon immer hervorragende Maschinen gebaut. Zum Beispiel die Comet IV von DeHavilland, als erstes brauchbares Düsen-Verkehrsflugzeug ist ein leuchtendes Beispiel dafür. Inzwischen haben die Comet IV-Maschinen internationales Startverbot, nur weil zwei Flugzeuge abgestürzt waren, eine Schande ist das. Er leert sein Whiskyglas mit einem großen Zug und füllt es sogleich wieder. Seine Frau wirft ihm einen ungnädigen Blick zu, schweigt aber.