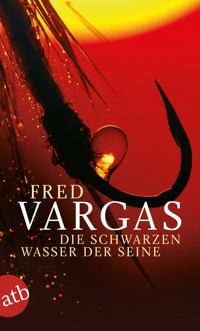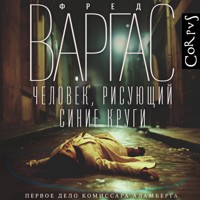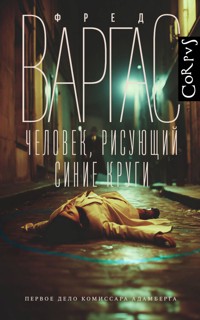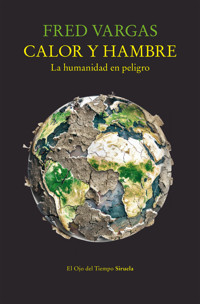10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Adamsberg ermittelt
- Sprache: Deutsch
Adamsberg ist zurück, und seine Ermittlungen führen ihn in die blutige Zeit der Französischen Revolution und in die tödliche Kälte Islands ...
Innerhalb weniger Tage werden die Leichen einer Mathematiklehrerin und eines reichen Schlossherrn in Paris entdeckt, die vermeintlich Selbstmord begangen haben. Die brutale Szenerie alarmiert zwar die Polizei, doch es scheint keine Verbindung zu geben. Bis Jean-Baptiste Adamsberg auf unauffällige Zeichnungen an beiden Tatorten aufmerksam wird. Kurz darauf stellt sich heraus, dass die Lehrerin vor ihrem Tod dem labilen Sohn des zweiten Toten geschrieben hat. Der Brief führt Adamsberg auf die Spuren einer verhängnisvollen Reise nach Island, die zehn Jahre zuvor stattfand – und von der zwei Personen nicht zurückkamen. Sowie in die Untiefen einer Geheimgesellschaft, die sich Robespierre und der Terrorherrschaft während der Französischen Revolution verschrieben hat. Weitere Menschen sterben, und für Adamsberg beginnt ein Wettrennen gegen die Zeit und einen ebenso wandelbaren wie unbarmherzigen Mörder …
»Fred Vargas' Krimis sind etwas Besonderes – eigenwillig, mit geradezu genialem Plot und viel französischem Esprit!« Bestsellerautorin Sophie Bonnet
»Lässig, klug, anarchisch und manchmal ziemlich abgedreht – die Krimis von Fred Vargas sind sehr französisch und zum Niederknien gut.« Bestsellerautor Cay Rademacher
»Fred Vargas erschafft nicht nur Figuren, sondern echte Charaktere. Sie kennt die Abgründe, die Sehnsüchte und die Geheimnisse der Menschen – und Commissaire Adamsberg ist für mich einer der spannendsten Ermittler in der zeitgenössischen Literatur.« Bestsellerautor Alexander Oetker
Wenn Ihnen die Krimis um Kommissar Adamsberg gefallen, lesen Sie auch die Evangelisten-Reihe unserer internationalen Bestseller-Autorin Fred Vargas!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
FredVARGAS
Das barmherzige Fallbeil
Roman
Aus dem Französischen von Waltraud Schwarze
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Temps glaciaires« bei Flammarion.
Der Limes Verlag ist ein Unternehmen der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH.
© der Originalausgabe 2015 by Fred Vargas und Flammarion
© der deutschsprachigen Ausgabe 2015 by Limes Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: DEEPOL by plainpicture/Mario Martinez; www.buerosued.de
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17500-9V003
www.limes-verlag.de
1
Nur noch zwanzig Meter, zwanzig kleine Meter bis zum Briefkasten, sie hatte es sich leichter vorgestellt. Blödsinn, sagte sie sich, es gibt keine kleinen oder großen Meter. Meter ist Meter, Punkt, aus. Seltsam, dass man an der Schwelle des Todes, an diesem unvergleichlichen Ort, noch immer über solche Belanglosigkeiten nachsinnt, während man doch eher annehmen würde, dass man irgendeinen bedeutenden Satz spricht, der sich mit glühendem Eisen in die Annalen der menschlichen Weisheit einbrennen wird. Einen Satz, der später einmal hier und da kolportiert werden wird: »Wissen Sie, was Alice Gauthiers letzte Worte waren?«
Wenn sie auch nichts Denkwürdiges zu erklären hatte, so trug sie doch eine schwerwiegende Botschaft in der Hand, die sich in die Annalen der menschlichen Schande einbrennen würde, welche ja sehr viel umfangreicher waren als die der Weisheit. Sie sah auf den Brief, der in ihrer Hand zitterte.
Also weiter, noch sechzehn kleine Meter. Noémie beobachtete sie von der Haustür aus, bereit, beim geringsten Schwanken hinter ihr herzustürzen. Noémie hatte alles versucht, ihre Patientin davon abzuhalten, dass sie sich allein auf die Straße wagte, aber Alice Gauthiers gebieterisches Wesen duldete keinen Widerspruch.
»Damit Sie mir über die Schulter schauen, um die Adresse zu lesen?«
Noémie war beleidigt, so etwas tat sie nicht.
»Das machen alle, Noémie. Einer meiner Freunde – ein alter Gauner im Übrigen – sagte immer zu mir: ›Wenn du ein Geheimnis wahren willst, dann wahre es.‹ Und so habe ich eins über lange Zeit gewahrt, nur in den Himmel komme ich damit nicht. Wobei mir der Himmel auch sonst nicht sicher wäre. Verkrümeln Sie sich, Noémie, und lassen Sie mich gehen.«
Lauf, Alice, verdammt noch mal, sonst hast du Noémie gleich wieder auf der Pelle. Sie stützte sich auf ihren Rollator, schob sich neun Meter weiter, nun ja, acht große Meter waren es auf jeden Fall. Jetzt nur noch an der Apotheke vorbei, danach am Waschsalon, an der Bank, und schon wäre sie dort, bei dem kleinen gelben Briefkasten. Während sie bei dem Gedanken an ihren nahen Sieg schon leise lächelte, wurde ihr schwarz vor Augen, sie ließ das Gefährt los und brach vor einer Frau in Rot zusammen, die sie mit einem Schrei in ihren Armen auffing. Der Inhalt ihrer Tasche verteilte sich über den Boden, der Brief glitt ihr aus der Hand.
Die Apothekerin kam angerannt, fragte, befühlte, legte große Geschäftigkeit an den Tag, während die Frau im roten Mantel die verstreut herumliegenden Dinge aufsammelte, in die Handtasche zurücklegte und diese neben die auf dem Boden liegende Frau stellte. Damit erschöpfte sich ihre flüchtige Rolle auch schon, der Rettungsdienst war unterwegs, sie hatte hier nichts mehr zu tun, zögernd richtete sie sich auf und trat zurück. Könnte sie sich nicht doch noch irgendwie nützlich machen, um noch ein wenig länger am Unfallort zu bleiben, könnte einer der Feuerwehrleute, die jetzt in großer Zahl eintrafen, nicht wenigstens ihren Namen notieren? Aber die Apothekerin hatte bereits alles in die Hand genommen, assistiert von einer furchtbar aufgeregten Frau, die erklärte, die Krankenpflegerin zu sein: Sie weinte ein wenig und rief, Madame habe es strikt abgelehnt, sich von ihr begleiten zu lassen, sie wohne nur einen Steinwurf entfernt, in der 33 a, nein, sie habe wirklich nicht fahrlässig gehandelt. Man legte die Frau auf eine Trage. Das war’s, Kindchen, die Sache geht dich nun nichts mehr an.
Doch, dachte sie im Weitergehen, doch, sie hatte wirklich etwas getan. Indem sie die stürzende Frau aufgefangen hatte, hatte sie verhindert, dass diese mit dem Kopf aufs Pflaster schlug. Vielleicht hatte sie ihr damit das Leben gerettet, wer konnte das Gegenteil behaupten?
Obwohl es erst Anfang April war, wurde es schon mild in Paris, wenn die Luft an sichauch noch frisch war. Die Luft an sich. Wie sollte die Luft denn sonst sein? Außer sich? Marie-France runzelte die Stirn, genervt von solchen blöden Fragen, die ihr durch den Kopf schwirrten wie müßigeMücken. Schon gar, wo sie gerade ein Leben gerettet hatte. Oder sagte man die Luft selbst? Sie zupfte ihren roten Mantel zurecht und schob die Hände in die Taschen. Rechts ihre Schlüssel, ihr Portemonnaie, aber links ein dickes Papier, das sie nie dort hineingesteckt hatte. Die linke Manteltasche war ihrer Fahrkarte und den achtundvierzig Cent für das Brot vorbehalten. An einem Baum blieb sie stehen und überlegte. In der Hand hielt sie den Brief, den die arme Frau hatte fallen lassen. Dreh deinen Gedanken sieben Mal im Kopf herum, bevor du handelst, hatte ihr Vater ihr fortwährend eingehämmert, der übrigens nie in seinem Leben wirklich gehandelt hatte. Wahrscheinlich war er über vier Drehungen nicht hinausgekommen. Die Schrift auf dem Umschlag war zitterig, und der Name der Absenderin, Alice Gauthier, prangte in großen, etwas unsicheren Buchstaben auf der Rückseite. Ja, das war eindeutig ihr Brief. In der Eile, mit der Marie-France die aus der Handtasche gefallenen Sachen, Papiere, Geldbörse, Tabletten und Brille zusammengerafft hatte, bevor der Wind sie verwehte, hatte sie auch den Umschlag in ihren Mantel gesteckt. Er hatte auf der anderen Seite der Handtasche gelegen, die Frau musste ihn in der linken Hand gehalten haben. Darum also, dachte Marie-France, war sie allein aus dem Haus gegangen: um einen Brief einzuwerfen.
Sollte sie ihn ihr zurückbringen? Doch wohin? Man hatte sie in die Notaufnahme irgendeiner Klinik gebracht. Sollte sie ihn der Pflegerin in der 33 a aushändigen? Vorsicht, Marie-France, Vorsicht. Dreh deinen Gedanken sieben Mal herum. Wenn die kleine Madame Gauthier das Risiko auf sich genommen hatte, allein zum Briefkasten zu gehen, dann doch sicherlich, weil sie um keinen Preis wollte, dass der Brief jemand anderem in die Hände fiel. Sieben Mal, aber nicht zehn, nicht zwanzig Mal, sonst nutzt der Gedanke sich ab, und es kommt gar nichts mehr dabei heraus. Man kennt solche Leute, die sich immer nur grübelnd im Kreis drehen, traurig so was, brauchst dir ja nur deinen Onkel anzuschauen.
Nein, nicht die Pflegerin. Madame Gauthier war nicht umsonst allein auf ihre Expedition gegangen. Marie-France sah sich auf der Suche nach einem Briefkasten um. Dort drüben, das kleine gelbe Rechteck auf der anderen Seite des Platzes. Sie strich den Umschlag auf ihrem Bein glatt. Sie, Marie-France hatte einen Auftrag: Sie hatte die Frau gerettet, und sie würde auch den Brief retten. Schließlich war er geschrieben worden, um abgeschickt zu werden, oder? Also tat sie nichts Böses, ganz im Gegenteil.
Sie ließ den Umschlag in den Schlitz »Banlieue« gleiten, nachdem sie sich mehrmals vergewissert hatte, dass er auch bestimmt ins Departement 78, Les Yvelines, gehen sollte. Sieben Mal, Marie-France, nicht zwanzig, sonst geht die Post nie ab. Dann schob sie ihre Finger unter der Klappe durch, um sicher zu sein, dass er auch wirklich hineingefallen war. So, das war getan. Letzte Leerung um 18 Uhr, es war Freitag, der Empfänger würde ihn am Montag in aller Frühe haben.
Einen schönen Tag noch, Kindchen, einen wunderschönen Tag.
2
Kommissar Bourlin vom 15. Pariser Arrondissement saß in einer Sitzung mit seinen Beamten und kaute unschlüssig auf seinen Wangen herum, die Hände über dem dicken Bauch gefaltet. Er war einmal ein schöner Mann gewesen, erinnerten sich einige Ältere, bevor binnen weniger Jahre das Fett von ihm Besitz ergriffen hatte. Aber eine stattliche Erscheinung war er noch immer, die respektvolle Aufmerksamkeit, mit der seine Stellvertreter ihm begegneten, bezeugte es. Selbst dann, wenn er sich geräuschvoll, ja geradezu demonstrativ schnäuzte wie gerade eben. Frühjahrsschnupfen, erklärte er. Der nicht anders war als ein Schnupfen im Herbst oder Winter, aber doch etwas Luftiges, weniger Gewöhnliches, irgendwie Heiteres hatte.
»Wir sollten den Fall zu den Akten legen, Kommissar«, fasste Feuillère, der hitzigste seiner Lieutenants, die Meinung aller zusammen. »Es ist jetzt sechs Tage her, dass Alice Gauthier gestorben ist. Es war Selbstmord, da beißt die Maus keinen Faden ab.«
»Ich mag Selbstmörder nicht, die keinen Brief hinterlassen.«
»Der Mann in der Rue de la Convention vor zwei Monaten hat auch nichts Schriftliches hinterlassen«, wandte ein Brigadier ein, der fast dieselbe Statur hatte wie der Kommissar.
»Aber der war besoffen wie ein Schwein, einsam und völlig pleite, das kann man nicht miteinander vergleichen. Hier haben wir eine Frau mit gutem Auskommen, Mathematiklehrerin im Ruhestand, ein geradliniges Leben, wir haben alles unter die Lupe genommen. Und ich mag auch Selbstmörder nicht, die sich am Morgen noch die Haare waschen und Parfum auflegen.«
»Eben drum«, sagte eine Stimme. »Wenn schon tot, dann wenigstens schön.«
»Und am Abend dann«, sagte der Kommissar, »lässt Alice Gauthier sich ein Bad ein, zieht ihre Schuhe aus und steigt, immer noch im Kostüm, ins Wasser, um sich die Pulsadern aufzuschneiden?«
Bourlin nahm sich eine Zigarette, das heißt zwei, denn mit seinen dicken Fingern bekam er eine einzelne gar nicht zu fassen. So blieben immer ein paar einsame Zigaretten neben seiner Schachtel liegen. Aus demselben Grund benutzte er auch kein Feuerzeug, dessen Zündrädchen er gar nicht richtig hätte greifen können, sondern eine Art Kaminhölzer, deren große Schachtel seine Tasche wölbte. Er hatte dekretiert, dass in diesem Raum des Kommissariats das Rauchen erlaubt sei. Denn das Rauchverbot brachte ihn auf die Palme. Da wurden pro Jahr sechsunddreißig Milliarden Tonnen CO², sechsunddreißig Milliarden!, wütete er, auf die Geschöpfe dieser Erde abgelassen – »Ich sage ›Geschöpfe‹, auf alle Geschöpfe!« –, und es war nicht erlaubt, auf einem Bahnsteig, im Freien, auch nur eine Zigarette zu rauchen?
»Sie war todkrank, Kommissar, und sie wusste es«, beharrte Feuillère. »Ihre Pflegerin hat’s uns erzählt: Stolz, wie sie war, und eine Person mit eisernem Willen, hat sie letzten Freitag noch versucht, allein einen Brief zum Kasten zu bringen, und ist dabei zusammengeklappt. Ergebnis: Fünf Tage später schneidet sie sich in der Badewanne die Pulsadern auf.«
»Einen Brief, der vielleicht ihre Abschiedsworte enthielt. Was erklären würde, dass sich bei ihr zu Hause keiner fand.«
»Ihr Letzter Wille sozusagen.«
»Und für wen bestimmt?«, fiel ihm der Kommissar ins Wort und nahm einen langen Zug von seiner Zigarette. »Erben hat sie nicht und auch keine großen Ersparnisse auf der Bank. Ein neues Testament hat ihr Notar nicht erhalten, ihre zwanzigtausend Euro gehen an eine Stiftung zum Schutz der Eisbären. Und obwohl dieser entscheidende Brief verlorengeht, bringt sie sich lieber um, als ihn neu zu schreiben?«
»Weil inzwischen dieser junge Mann bei ihr war, Kommissar. Am Montag und dann noch einmal am Dienstag, da ist sich der Nachbar ganz sicher. Er hat gehört, wie er klingelte und sagte, er käme wegen der Verabredung. Zu dem Zeitpunkt, zu dem sie jeden Tag allein in der Wohnung war, zwischen 19 und 20 Uhr. Demnach hat sie diese Verabredung selbst getroffen. Sie wird ihm ihren Letzten Willen mitgeteilt haben, womit der Brief überflüssig wurde.«
»Und dieser unbekannte junge Mann hat sich seitdem in der Landschaft verloren. Bei der Beerdigung waren nur betagte Herrschaften zu sehen. Kein junger Mann. Also? Wo ist er abgeblieben? Wenn er ihr so nahestand, dass sie ihn in großer Eile zu sich bestellen konnte, dann war er ein Verwandter oder ein Freund von ihr. In diesem Fall wäre er zur Beerdigung gekommen. Aber nein, er hat sich in Luft aufgelöst. In kohlendioxydgesättigter Luft, wohlgemerkt. Doch zur Sache, der Nachbar hat gehört, wie er sich vor der Tür mit seinem Namen meldete. Wie war der noch gleich?«
»Er hat ihn nicht so genau verstanden. André oder ›Dédé‹, ganz sicher ist er sich nicht.«
»André, so heißen ältere Leute. Wieso sagt er, es sei ein junger Mann gewesen?«
»Das hat er an seiner Stimme erkannt.«
»Kommissar«, warf ein Lieutenant ein, »der Richter verlangt, dass wir den Fall abschließen. Wir sind noch keinen Schritt weiter, weder mit der Messerstecherei am Gymnasium noch mit dem Überfall auf die Frau am Parkplatz Rue de Vaugirard.«
»Ich weiß«, sagte der Kommissar und griff sich die zweite Zigarette, die neben seiner Schachtel lag. »Ich habe mich gestern Abend mit dem Kerl unterhalten. Sofern man das Unterhaltung nennen kann. Suizid, Suizid, schließen Sie die Akte und weiter zum nächsten Fall – auf die Gefahr hin, dass man Tatsachen, und seien sie noch so geringfügig, in den Boden tritt wie Löwenzahn.«
Der Löwenzahn, dachte er, ist der arme Mann in der Gesellschaft der Blumen, er wird nicht geachtet, man tritt ihn mit Füßen oder gibt ihn den Kaninchen zu fressen. Während niemand auf den Gedanken käme, auf eine Rose zu treten. Und schon gar nicht, sie den Karnickeln zu geben. Alles schwieg, jedermann war im Zwiespalt zwischen der Ungeduld des neuen Richters und der schlechten Laune des Kommissars.
»Also, ich schließe ab«, gab Bourlin sich seufzend geschlagen. »Unter der Bedingung, dass wir vorher noch herauszufinden versuchen, was das Zeichen bedeutet, das die Frau neben ihre Badewanne geschrieben hat. Sehr klar, sehr entschieden, aber unverständlich. Dort steht sie, ihre letzte Botschaft.«
»Aber nicht zu entschlüsseln.«
»Ich rufe Danglard an. Der hat vielleicht eine Idee.«
Und dennoch, dachte Bourlin und folgte seiner Gedankenwindung, ist der Löwenzahn ein zähes Pflänzchen, während die Rose ständig leidet.
»Commandant Adrien Danglard?«, fragte ein Brigadier. »Von der Brigade criminelle im 13. Arrondissement?«
»Genau der. Er weiß Dinge, die ihr in dreißig Leben nicht lernen werdet.«
»Aber hinter ihm«, murmelte der Brigadier, »steht Kommissar Adamsberg.«
»Und?«, sagte Bourlin und erhob sich beinahe majestätisch, die Fäuste auf den Tisch gestemmt.
»Nichts, Kommissar.«
3
Adamsberg griff nach seinem Telefon, schob einen Stapel Aktenordner beiseite, legte die Beine auf den Schreibtisch und beugte sich in seinem Arbeitssessel vor. Er hatte letzte Nacht kaum ein Auge zugetan, eine seiner Schwestern hatte sich, weiß Gott wie, eine Lungenentzündung eingefangen.
»Die Frau aus der 33 a?«, fragte er. »Pulsadern aufgeschnitten in der Badewanne? Warum nervst du mich mit so was um 9 Uhr früh, Bourlin? Laut internen Berichten handelt es sich um Selbstmord. Zweifelst du daran?«
Adamsberg mochte Kommissar Bourlin. Ein großer Esser vor dem Herrn, großer Raucher, großer Trinker, ein Vulkan in fortwährender Eruption, ständig auf Hochtouren und immer dicht am Abgrund, hart wie ein Stein und eigensinnig wie ein junges Lamm, war er ein ernstzunehmender Gegner, der noch in hundert Jahren auf seinem Posten sein würde.
»Der neue Richter Vermillon sitzt mir im Nacken wie eine Zecke«, sagte Bourlin. »Du kennst doch Zecken?«
»Aber ja. Wenn du einen Leberfleck an dir entdeckst, dem Beine wachsen, dann hast du eine Zecke.«
»Und was mache ich dann?«
»Du ziehst sie durch eine Drehbewegung mit einer winzigen Zange heraus. Du rufst mich aber hoffentlich nicht deswegen an?«
»Nein, wegen dieses Richters, der nichts anderes ist als eine riesige Zecke.«
»Willst du, dass wir die zu zweit und mit einer riesigen Zeckenzange rausziehen?«
»Er verlangt, dass ich den Fall ad acta lege, aber das will ich nicht.«
»Und warum nicht?«
»Die Selbstmörderin, nach Parfum duftend und frisch frisiert wie am frühen Morgen, hat keinen Brief hinterlassen.«
Adamsberg hörte sich mit geschlossenen Augen an, wie Bourlin die Geschichte abspulte.
»Ein unverständliches Zeichen, sagst du? Neben der Badewanne? Und womit, denkst du, soll ich dir helfen?«
»Du selbst gar nicht. Ich will nur, dass du mir den Kopf von Danglard schickst, damit er sich das mal ansieht. Ihm sagt es vielleicht was, jemand anderes fällt mir nicht ein. Und zumindest hätte ich dann ein ruhiges Gewissen.«
»Nur seinen Kopf? Und was mache ich mit dem Körper?«
»Den lässt du nachkommen, soweit möglich.«
»Danglard ist noch nicht im Büro. Du weißt, er hat seinen eigenen Stundenplan, je nach den Tagen. Beziehungsweise den Abenden davor.«
»Hol ihn aus dem Bett, ich erwarte euch beide dort. Noch was, Adamsberg: Der Brigadier, der mich begleiten wird, ist ein junger Schnösel. Der muss noch Patina ansetzen.«
Adamsberg saß auf Danglards alter Couch und trank einen starken Kaffee, während er darauf wartete, dass der Commandant sich fertig anzog. Er war zu dem Schluss gekommen, dass es die schnellste Lösung wäre, ihn an Ort und Stelle wachzurütteln und direkt in sein Auto zu verladen.
»Ich habe nicht mal Zeit, mich zu rasieren«, schimpfte Danglard und beugte seinen großen, schlaffen Körper vor, um sich im Spiegel zu betrachten.
»Ins Büro kommen Sie auch nicht immer rasiert.«
»Das ist was anderes. Hier werde ich als Experte erwartet, und ein Experte rasiert sich.«
Adamsberg verzeichnete beiläufig die beiden Weißweinflaschen auf dem Couchtisch, das auf den Boden gefallene Glas, den noch feuchten Teppich. Weißwein hinterlässt keine Flecken. Danglard schien gleich auf dem Sofa eingeschlafen zu sein, ohne sich diesmal um die argwöhnischen Blicke seiner fünf Kinder sorgen zu müssen, die er wie Zuchtperlen aufzog. Die Zwillinge waren inzwischen in Richtung Universitätscampus ausgeflogen, und die Leere im Haus machte die Sache nicht viel besser. Immerhin blieb ihm noch der Jüngste, der mit den blauen Augen, der nicht von Danglard war und den seine Frau ihm als ganz kleines Kind zurückgelassen hatte, als sie fortgegangen war, ohne sich im Flur noch ein einziges Mal umzudrehen, wie er hundertmal erzählt hatte. Im vergangenen Jahr hatte Adamsberg auf die Gefahr hin, dass es zum Bruch zwischen ihnen beiden kommen würde, die Rolle des Folterers auf sich genommen und Danglard zum Arzt geschleppt, und der Commandant hatte als weinseliger Zombie auf seine Untersuchungsergebnisse gewartet. Die sich als ganz und gar untadelig erwiesen. Es gibt Leute, die können durch den Regen laufen, ohne nass zu werden, und das war nicht die geringste von den Gaben des Commandant Danglard.
»Als Experte wofür eigentlich?«, fragte Danglard, während er seine Manschettenknöpfe richtete. »Worum handelt es sich? Sagten Sie ›Hieroglyphen‹?«
»Die letzte Zeichnung einer Selbstmörderin. Ein nicht zu entschlüsselndes Symbol. Kommissar Bourlin ist sehr unglücklich, er will verstehen, was dieses Zeichen bedeutet, bevor er die Akte schließt. Der Richter sitzt ihm im Nacken wie eine Zecke. Eine ziemlich große Zecke. Wir haben nur ein paar Stunden.«
»Ah, um Bourlin geht es«, sagte Danglard und entspannte sich, während er gleichzeitig sein Jackett glatt strich. »Fürchtet er, der neue Richter kriegt eine Krise?«
»Zeckenmäßig betrachtet, fürchtet er wohl eher, dass er sein Gift auf ihn spuckt.«
»Zeckenmäßig betrachtet, fürchtet er, dass er ihm den Inhalt seiner Speicheldrüsen injiziert«, korrigierte Danglard, während er sich die Krawatte band. »Die Zecke hat nichts mit einer Schlange oder einem Floh zu tun. Und sie ist auch kein Insekt, sondern ein Spinnentier.«
»Genau. Und was halten Sie vom Inhalt der Speicheldrüsen des Richters Vermillon?«
»Offen gesagt, nichts Gutes. Aber abgesehen davon, bin ich kein Experte für kryptische Zeichen. Ich bin der Sohn eines nordfranzösischen Bergmanns«, sagte der Commandant voller Stolz. »Ich weiß nur hie und da ein paar Bruchstücke.«
»Dennoch hofft er auf Sie. Wegen seines Gewissens.«
»Also, die Gelegenheit, als gutes Gewissen zu dienen, kann ich mir nicht entgehen lassen.«
4
Danglard hatte sich auf den Rand der blauen Badewanne gesetzt, in der Alice Gauthier sich die Pulsadern aufgeschnitten hatte. Er betrachtete den Rand des Waschtischs, auf den sie das Zeichen mit einem Kajalstift geschrieben hatte. Adamsberg, Bourlin und sein Brigadier warteten schweigend hinter ihm in dem kleinen Bad.
»Sagt doch was, bewegt euch, verdammt noch mal, ich bin nicht das Orakel von Delphi«, rief Danglard gereizt, weil er das Zeichen nicht auf Anhieb entschlüsselt hatte. »Brigadier, könnten Sie so freundlich sein und mir einen Kaffee machen, man hat mich aus dem Bett geholt.«
»Aus dem Bett oder aus einer Bar am frühen Morgen?«, murmelte der Brigadier halblaut, zu Bourlin gewandt.
»Ich habe ein feines Ohr«, sagte Danglard, wie er da in eleganter Pose auf dem Rand der Wanne saß, ohne den Blick von dem gezeichneten Motiv zu wenden. »Ich habe nicht um einen Kommentar gebeten, sondern um einen Kaffee, in aller Freundlichkeit.«
»Einen Kaffee«, bekräftigte Bourlin, indem er den Brigadier am Arm fasste, den seine große Hand mühelos umschloss.
Danglard zog ein krummgesessenes Notizbuch aus seiner Gesäßtasche und zeichnete das Symbol ab: ein großes H, dessen Querbalken jedoch schräg verlief. Und unter dem Balken verlief außerdem eine konkave Linie:
»Könnte es einen Zusammenhang mit ihren Initialen geben?«
»Sie hieß Alice Gauthier, mit Mädchennamen Vermond. Ihre beiden Vornamen allerdings sind Clarisse und Henriette. H wie Henriette.«
»Nein«, sagte Danglard und schüttelte seine weichen, vom Grau seiner Bartstoppeln verschatteten Wangen. Das ist kein H. Der Querstrich verläuft eindeutig schräg, er weist entschieden nach oben. Und es ist auch keine Unterschrift. Eine Unterschrift verändert sich mit der Zeit immer, sie absorbiert die Persönlichkeit des Schreibenden, sie neigt sich, verformt sich, schrumpft. Nichts, was mit der Geradlinigkeit dieses Buchstabens vereinbar wäre. Das ist die getreue, fast schülerhafte Reproduktion eines Zeichens, eines Siegels und wurde noch nicht sehr oft ausgeführt. Sie hat es vorher vielleicht ein, zwei, wenn’s hoch kommt, fünf Mal gezeichnet. Es ist die Arbeit eines eifrigen, gewissenhaften Schulkinds.«
Der Brigadier kam mit dem Kaffee zurück und drückte Danglard mit herausfordernder Miene den brühend heißen Plastikbecher in die Hand.
»Danke«, murmelte der Commandant, ohne sich etwas anmerken zu lassen. »Wenn sie sich umgebracht hat, dann weist sie damit auf diejenigen hin, die sie in den Selbstmord getrieben haben. Warum sollte sie in diesem Fall das Zeichen verschlüsseln? Aus Angst? Und für wen? Für ihr nahestehende Menschen? Sie fordert zur Nachforschung auf und verrät doch niemanden. Und wenn man sie umgebracht hat – und das ist Ihre Vermutung, nicht wahr, Bourlin? –, dann bezeichnet sie damit zweifellos ihre Angreifer. Aber noch einmal, warum tut sie das nicht in aller Offenheit?«
»Dann war es wohl doch Selbstmord«, brummte Bourlin resigniert.
»Darf ich?«, fragte Adamsberg, der an der Wand lehnte, und zog eine zerknautschte Zigarette aus seiner Jackentasche.
Das Signal für Kommissar Bourlin, der als Antwort ein gewaltiges Streichholz hervorholte und sich seinerseits eine anzündete. Beleidigt verließ der Brigadier das augenblicklich verqualmte, winzige Bad und wich zum Eingang zurück.
»Ihr Beruf?«, fragte Danglard.
»Mathematiklehrerin.«
»Was auch nichts hergibt. Es ist kein mathematisches und auch kein physikalisches Symbol. Weder ein Sternzeichen noch etwas Hieroglyphenähnliches. Weder von den Freimaurern noch von einer satanischen Sekte. Nichts von alledem.«
Verdrossen und in sich gekehrt grummelte er einen Augenblick vor sich hin.
»Es sei denn«, fuhr er fort, »es handelt sich um einen altnordischen Buchstaben, eine Rune, vielleicht sogar ein japanisches oder auch chinesisches Schriftzeichen. Da gibt es schon ähnliche H mit schräg verlaufendem Querstrich. Aber sie haben alle nicht diesen konkaven Bogen darunter. Da liegt der Hase im Pfeffer. So bleibt uns nur die Hypothese eines kyrillischen Buchstabens, wenn auch eines etwas missglückten.«
»Kyrillisch? Sie meinen das russische Alphabet?«, fragte Bourlin.
»Das russische, aber auch das bulgarische, serbische, mazedonische, ukrainische … ein weites Feld.«
Mit einem Blick beendete Adamsberg den gelehrten Diskurs über die kyrillische Schrift, zu dem der Commandant, wie er spürte, gerade ausholte. Und tatsächlich verzichtete Danglard mit Bedauern darauf, die Geschichte der Schüler des heiligen Kyrill zu erzählen, die das Alphabet geschaffen hatten.
»Es gibt im Kyrillischen einen Buchstaben Й, nicht zu verwechseln mit dem И«, erklärte er, indem er beide auf ein Blatt seines Notizbuchs schrieb. »Sie sehen, dieser Buchstabe hat ein konkaves Zeichen obendrauf, eine Art kleine Schale. Er spricht sich ungefähr oi oder ai aus, je nach dem vorausgehenden Buchstaben.«
Danglard bemerkte einen neuerlichen Blick von Adamsberg und brach seine Darlegung ab.
»Angenommen«, fuhr er fort, »in Anbetracht der Entfernung zwischen Badewanne und Waschtisch, den sie nur mit ausgestrecktem Arm erreichen konnte, wäre es der Frau schwergefallen, den Buchstaben korrekt zu schreiben, dann könnte ihr der Kringel möglicherweise von oben in die Mitte gerutscht sein. Doch wenn ich mich nicht irre, steht dieses Й nie am Wortanfang, sondern immer am Ende. Und ich habe noch nie von einer Abkürzung gehört, die ein Wortende benutzt. Prüfen Sie dennoch, ob sich auf ihrer Anruferliste oder in ihrem Adressbuch jemand findet, der das kyrillische Alphabet verwendet haben könnte.«
»Das wäre verlorene Zeit«, wandte Adamsberg sanft ein.
Wenn Adamsberg sanft sprach, dann nicht, um Danglard nicht zu kränken. Von seltenen Gelegenheiten abgesehen, pflegte der Kommissar nie laut zu werden, und er nahm sich auch alle Zeit beim Reden, selbst auf die Gefahr hin, sein Gegenüber einzuschläfern mit seiner Moll-Stimme, die für manche Leute etwas Hypnotisierendes hatte, auf andere dagegen anziehend wirkte. Es war ein Unterschied, ob eine Vernehmung vom Kommissar selbst oder von einem seiner Beamten durchgeführt wurde. Adamsberg erreichte, dass die Leute entweder schläfrig wurden oder ihre Geständnisse plötzlich nur so aus ihnen heraussprudelten, so wie man widerspenstige Nägel mit einem Magneten herauszieht. Der Kommissar schenkte dem keine Beachtung, er gab sogar zu, dass er manchmal selbst dabei einschlief, ohne es zu bemerken.
»Wieso verlorene Zeit?«
»Doch, Danglard. Wir sollten vielmehr herauszufinden versuchen, ob die konkave Linie vor oder nach dem Schrägstrich gezeichnet wurde. Ebenso die beiden senkrechten Striche des H: Wurden sie vorher oder hinterher gezeichnet?«
»Was ändert das?«, fragte Bourlin.
»Und«, setzte Adamsberg seinen Gedanken fort, »ob der Schrägstrich von unten nach oben oder von oben nach unten gezogen wurde.«
»Stimmt«, räumte Danglard ein.
»Der Schrägstrich lässt an ein Durchkreuzen denken«, sagte Adamsberg weiter. »Wie wenn man etwas Geschriebenes streicht. Vorausgesetzt, man zieht den Strich eindeutig von unten nach oben. Wenn das Lächeln zuerst da war, heißt das, dass es anschließend gestrichen wurde.«
»Was für ein Lächeln?«
»Ich meine die konvexe Linie. Die die Form eines Lächelns hat.«
»Konkave Linie«, berichtigte Danglard.
»Wenn Sie wollen. Diese Linie erinnert, für sich betrachtet, an ein Lächeln.«
»Ein Lächeln, das einer hätte auslöschen wollen«, meinte Bourlin.
»So ähnlich. Und die beiden vertikalen Balken des H könnten das Lächeln einrahmen wie ein vereinfachtes Gesicht.«
»Sehr vereinfacht«, sagte Bourlin. »An den Haaren herbeigezogen.«
»Ziemlich an den Haaren herbeigezogen«, bestätigte Adamsberg. »Aber überprüfe es trotzdem. In welcher Reihenfolge, Danglard, schreibt man diesen Buchstaben im Kyrillischen?«
»Zuerst die beiden Senkrechten, dann den Schrägstrich, dann den Kringel obendrauf. So wie auch wir einen Akzent als Letztes draufsetzen.«
»Wenn also der Kringel vorher gemacht wurde, handelt es sich nicht um einen missglückten kyrillischen Buchstaben«, bemerkte Bourlin, »und wir brauchen unsere Zeit nicht damit zu verplempern, in ihrem Adressbuch nach einem Russen zu suchen.«
»Oder einem Mazedonier. Oder einem Serben«, ergänzte Danglard.
Bekümmert darüber, dass es ihm nicht gelungen war, das Zeichen zu entschlüsseln, folgte Danglard mit schlurfenden Schritten seinen Kollegen auf die Straße, während Bourlin per Telefon seine Befehle erteilte. Allerdings zog Danglard beim Gehen immer die Füße nach, wodurch sich seine Schuhsohlen in kürzester Zeit abnutzten. Und da der Commandant mangels irgendwelcher Attraktivität ganz und gar auf englische Eleganz setzte, hatte er ein Problem mit dem Nachschub für seine Londoner Schuhe. Darum wurde jeder, der über den Ärmelkanal reiste, gebeten, ihm von dort ein neues Paar mitzubringen.
Der Brigadier war beeindruckt von den Proben seines Wissens, die Danglard gegeben hatte, und lief jetzt folgsam an seiner Seite. Er hatte »ein wenig Patina angesetzt«, wie Bourlin gesagt hätte.
Auf der Place de la Convention trennten sich die vier Männer.
»Ich melde mich, sobald die Ergebnisse vorliegen«, sagte Bourlin. »Es wird nicht lange dauern. Vielen Dank für die Unterstützung, aber ich glaube, ich werde den Fall heute Abend abschließen müssen.«
»Wenn wir schon im Dunkeln tappen«, meinte Adamsberg im Fortgehen mit einer laxen Handbewegung, »kann man ja auch mal sagen, was einem so einfällt. Mich erinnert das Ding an eine Guillotine.«
Bourlin sah seinen Kollegen eine Weile nach.
»Wundere dich nicht«, sagte er zu seinem Brigadier. »Das ist Adamsberg.«
Als wäre damit alles erklärt.
»Aber dieser Commandant Danglard«, meinte der junge Mann, »was hat der in seinem Schädel, dass er das alles weiß?«
»Weißwein.«
Kaum zwei Stunden später rief Bourlin Adamsberg an: Die beiden senkrechten Linien waren als Erstes gezogen worden, zunächst die linke, danach die rechte.
»Wie man ein H anfängt«, fuhr er fort. »Aber dann hat sie die konkave Linie gezeichnet.«
»Also nicht wie ein H.«
»Und auch nicht wie was Kyrillisches. Schade, das hatte mir irgendwie gefallen. Als Letztes hat sie den Schrägstrich hinzugefügt, und zwar von unten nach oben.«
»Und damit das Lächeln gestrichen.«
»Genau. So bleibt uns nichts mehr, Adamsberg. Weder eine Initiale noch ein Russe. Lediglich ein unbekanntes Kürzel, das sich an eine Gruppe von unbekannten Personen wendet.«
»An eine Gruppe von Unbekannten, die sie für ihren Selbstmord anklagt oder die sie auf eine Gefahr hinweisen möchte.«
»Oder aber«, schlug Bourlin vor, »sie bringt sich schlicht und einfach um, weil sie krank ist. Doch vorher will sie auf etwas oder jemanden hinweisen, auf ein Ereignis in ihrem Leben. Ein letztes Geständnis, bevor sie diese Welt verlässt.«
»Und was könnte das für ein Geständnis sein, das man erst im letzten Moment preisgibt?«
»Ein schändliches Geheimnis.«
»Zum Beispiel?«
»Ein Kind, das man verleugnet hat?«
»Oder eine Sünde, Bourlin. Oder ein Mord. Was hätte deine brave Alice Gauthier denn für eine Untat begehen können?«
»›Brav‹ würde ich nicht sagen. Autoritäre Person, rigoroses, um nicht zu sagen tyrannisches Temperament. Nicht sehr sympathisch.«
»Hat sie Ärger mit ehemaligen Schülern gehabt? Mit dem Ministerium?«
»Sie genoss höchste Anerkennung, ist nie woandershin versetzt worden. Vierzig Jahre an derselben Schule, und das in einem Problembezirk. Aber laut ihren Kollegen wagten nicht mal die ausgekochtesten unter den Kids, in ihren Unterrichtsstunden eine Lippe zu riskieren. Bei ihr spurten sie. Da kannst du dir ja vorstellen, dass die Schulleiter an ihr hingen wie an einer heiligen Ikone. Sie brauchte sich bloß in einer Klassentür zu zeigen, und schon war Ruhe im Karton. Ihre Strafen waren gefürchtet.«
»Körperliche Züchtigungen etwa?«
»Offenbar nichts dergleichen.«
»Was sonst? Einen Satz dreihundert Mal abschreiben?«
»Auch nicht«, sagte Bourlin. »Die Strafe war, dass sie ihnen ihre Liebe entzog. Denn sie liebte ihre Schüler. Das war die Drohung: dass sie ihre Liebe verlieren könnten. Viele Kinder kamen nach dem Unterricht unter dem einen oder anderen Vorwand zu ihr. Und damit du begreifst, was diese Frau für eine Kraft hatte: Einmal hatte sie einen von diesen kleinen Rowdys, die andere Schüler ausrauben, zu sich bestellt, und binnen einer Stunde hatte er ihr die Namen aller seiner Gangmitglieder verraten. Keiner weiß, wie sie das gemacht hat. So eine Frau war das.«
»Sie hatte offenbar Schneid.«
»Denkst du schon wieder an deine Guillotine?«
»Nein, eigentlich denke ich an diesen verlorengegangenen Brief. An diesen unbekannten jungen Mann. Vielleicht war er einer ihrer ehemaligen Schüler.«
»In welchem Fall das Zeichen für den Schüler bestimmt gewesen wäre? Das Zeichen eines Clans? Einer Bande? Mach mich nicht wahnsinnig, Adamsberg, ich muss den Fall heute Abend noch abschließen.«
»Dann zögere es halt ein bisschen hinaus. Und sei es nur um einen Tag. Sag, dass du gerade an was Kyrillischem arbeitest. Und sag vor allem nicht, dass das von mir kommt.«
»Warum hinauszögern? Denkst du an etwas Bestimmtes?«
»Nein. Ich möchte nur ein bisschen nachdenken.«
Bourlin stieß einen resignierten Seufzer aus. Er kannte Adamsberg lange genug, um zu wissen, dass »nachdenken« in seinem Fall überhaupt nichts zu bedeuten hatte. Adamsberg dachte nicht nach, er setzte sich nicht mit einem Bleistift in der Hand an einen Tisch, schaute nicht konzentriert aus dem Fenster, rekapitulierte die Fakten nicht mit Pfeilen und Ziffern an einer Tafel, stützte nicht das Kinn in die Faust. Er pausierte, lief lautlos herum, schlingerte zwischen den Büros hin und her, kommentierte, durchmaß sein Terrain mit langsamen Schritten, aber noch nie hatte jemand ihn nachdenken sehen. Er schien im Wasser zu treiben wie ein Fisch. Nein, ein Fisch treibt nicht, ein Fisch verfolgt sein Ziel. Adamsberg glich eher einem Schwamm, der von der Strömung getragen wird. Aber was war das für eine Strömung? Manche Leute sagten übrigens von ihm, dass, wenn sein ohnehin schon verschwommener brauner Blick sich noch weiter im Unbestimmten verlor, es aussah, als hätte er Algen in den Augen. Er gehörte eher zum Meer als zum Land.
5
Marie-France zuckte zusammen, als sie die Seite mit den Traueranzeigen aufschlug. Sie war in Verzug, sie hatte mehrere Tage aufzuholen, würde folglich Dutzende und Aberdutzende von Toten Revue passieren lassen müssen. Nicht, dass dieses tägliche Ritual ihr irgendeine morbide Befriedigung verschafft hätte. Aber – und es war schrecklich, das zu sagen, dachte sie wieder einmal – sie lauerte auf das Ableben ihrer Cousine zweiten Grades, die früher einmal große Zuneigung für sie empfunden hatte. In jenem begüterten Teil der Familie pflegte man bei Todesfällen eine Anzeige in die Zeitung zu setzen. Auf diese Weise hatte sie vom Tod zweier weiterer Cousins erfahren und auch von dem des Ehemanns der Cousine. Die folglich Witwe war und sehr reich – kurioserweise hatte ihr Mann sein Vermögen mit dem Vertrieb von Luftballons verdient –, und Marie-France fragte sich unaufhörlich, ob das Manna der Cousine die Aussicht hatte, auf ihr Haupt herabzuregnen. Sie hatte Berechnungen über diesen Geldsegen angestellt. Auf wie viel mochte er sich belaufen? Fünfzigtausend? Eine Million? Mehr? Wie viel würde ihr nach Abzug der Steuern davon bleiben? Würde die Cousine überhaupt auf den Gedanken kommen, sie zu ihrer Erbin zu machen? Und wenn sie nun alles für den Schutz der Orang-Utans stiftete? Das war so ein Tick von ihr gewesen, die Orang-Utans, Marie-France konnte es sogar gut verstehen und war bereit, mit den armen Tieren zu teilen. Aber freu dich nicht zu früh, Kindchen, lies erst mal nur die Annoncen. Die Cousine ging auf die zweiundneunzig zu, da konnte es ja wohl kaum mehr lange dauern, nicht wahr? Obwohl es in der Familie haufenweise Hundertjährige gab, so wie in anderen Familien Kinder gezeugt wurden, zeugte man bei denen Alte. Allerdings hatten die auch nicht groß was zu tun im Leben, und das konservierte ihrer Meinung nach. Die Cousine aber war viel herumgekommen, auf Java, auf Borneo und allen diesen schrecklichen Inseln – wegen der Orang-Utans, natürlich –, und so was verbraucht den Menschen. Sie nahm ihre Lektüre in chronologischer Reihenfolge wieder auf.
IHRE COUSINS RÉGIS RÉMOND UND MARTIN DRUOTSOWIE IHRE FREUNDE UND KOLLEGENTEILEN IN TIEFER TRAUER MIT, DASS
ALICE CLARISSE HENRIETTE GAUTHIER, GEB. VERMOND
NACH LANGER KRANKHEIT IN IHREM SECHSUNDSECHZIGSTEN LEBENSJAHR DAHINGEGANGEN IST. DIE AUFBAHRUNG DER VERSTORBENEN IM HAUS NUMMER 33 A DER RUE …
In der 33 a. Sie hörte noch, wie die Pflegerin rief: »Madame Gauthier aus der 33 a …« Die arme Frau, da hatte sie ihr das Leben gerettet – indem sie verhindert hatte, dass ihr Kopf aufs Pflaster aufschlug, davon war sie jetzt überzeugt –, aber nicht für lange.
Es sei denn, dieser Brief … Dieser Brief, den sie beschlossen hatte in den Kasten zu werfen… Wenn das nun ein Fehler gewesen war? Wenn der kostbare Brief eine Katastrophe ausgelöst hatte? Wenn das der Grund war, warum die Pflegerin sich dem so heftig widersetzt hatte?
Aber er wäre ja in jedem Fall abgegangen, der Brief, tröstete sich Marie-France und goss sich eine zweite Tasse Tee ein. Das war Schicksal.
Nein, wäre er nicht. Der Brief war im Runterfallen weggeflogen. Denk nach, mein Kind, dreh den Gedanken sieben Mal herum. Und wenn Madame Gauthier im Grunde eine … – wie sagte er immer, der Chef in ihrer alten Firma? Er führte doch ständig dieses Wort im Munde – eine Fehlleistung begangen hätte? Also etwas, das man nicht tun will, aber dennoch tut, aus Gründen, die unter den Gründen verborgen sind? Wenn die Angst vor dem Absenden ihres Briefes diesen Schwindel bei ihr ausgelöst hätte? Und sie ihn in einer Fehlleistung hättefallen lassen, womit sie ihr Vorhaben aufgab, aufgrund der Gründe, die unter den Gründen verborgen lagen?
In diesem Fall war sie, Marie-France, das Schicksal. Sie hatte beschlossen, das Vorhaben der alten Frau zu Ende zu führen. Und dabei hatte sie ihren Gedanken weiß Gott herumgedreht, nicht zu wenig, nicht zu viel, bevor sie zum Briefkasten ging.
Vergiss es, du wirst es nie erfahren. Und es ist überhaupt nicht erwiesen, dass der Brief verhängnisvolle Folgen hatte. Du machst dich wegen rein gar nichts verrückt, mein Kind.
Aber mittags hatte Marie-France die Sache noch immer nicht vergessen; der Beweis dafür war, dass sie mit dem Studium der Traueranzeigen keinen Schritt weitergekommen war und folglich immer noch nicht wusste, ob die Cousine mit den Orang-Utans gestorben war oder nicht.
Sie machte sich auf den Weg zu dem Spielwarenladen, in dem sie halbtags arbeitete, im Kopf ganz wirr und mit schmerzendem Magen. Und das, mein Kind, bedeutet, dass du grübelst, und du weißt nur zu gut, was Papa dir diesbezüglich immer eingehämmert hat.
Nicht, dass sie das Kommissariat auf ihrem Weg nie bemerkt hätte – schließlich kam sie sechs Tage in der Woche daran vorbei –, aber dieses Mal erschien es ihr plötzlich wie ein Licht in der Finsternis, ein Leuchtturm in der Nacht. Ein Leuchtturm in der Nacht, auch das war von ihrem Vater. »Doch das Ärgerliche an einem Leuchtturm«, fügte er hinzu, »ist, dass er blinkt. Sodass deine Idee pausenlos kommt und geht. Und außerdem schaltet er sich aus, sobald es Tag wird.« Jetzt aber war Tag, und das Kommissariat strahlte trotzdem wie ein Leuchtturm in der Nacht. Womit bewiesen war, dass auch väterliche Bibelsätze überarbeitungsbedürftig waren, bei allem Respekt.
Zögernd trat sie ein, bemerkte die traurige Gestalt am Empfang und weiter hinten eine sehr große und sehr kräftige Frau, die ihr Angst machte, dann einen unscheinbaren kleinen Blonden, mit dem sie gar nichts anfangen konnte, weiterhin einen Glatzkopf, der Ähnlichkeit mit einem alten Vogel hatte, der auf seinem Nest hockt in Erwartung einer letzten Brut, die nie schlüpfen würde, schließlich einen Typen, der – sie hatte ein scharfes Auge – in einem Fachblatt über Fische las, einen dicken weißen Kater, der auf einem Kopiergerät schlief, und einen Hünen, der so aussah, als wollte er die ganze Welt auseinandernehmen. Sie war drauf und dran, wieder zu gehen, doch dann fasste sie sich wieder und sagte sich: Stimmt, ein Leuchtturm blinkt, und im Augenblick ist er eben erloschen. Da kam ein Typ mit Bauch hereingeschlurft, sehr elegant, wenn auch ohne schärfere Konturen, der ihr im Vorbeigehen einen eindringlichen blauen Blick zuwarf.
»Suchen Sie etwas?«, fragte er mit vollendeter Korrektheit. »Hier werden keine Anzeigen wegen Diebstahl, Überfällen oder anderem entgegengenommen, Madame. Sie sind bei der Brigade criminelle. Totschlag oder Mord.«
»Ist das ein Unterschied?«, fragte sie ängstlich.
»Ein sehr großer«, sagte der Mann, indem er sich ganz leicht verneigte, wie wenn man im vergangenen Jahrhundert einen Gruß andeutete. »Ein Mord ist eine vorbedachte Tötung. Ein Totschlag kann ungewollt sein.«
»Ja, also, ich komme wegen einem Vielleicht-Totschlag, einem ungewollten.«
»Sie möchten Anzeige erstatten, Madame?«
»Das heißt nein, denn vielleicht war ich es, die ihn ausgelöst hat, den Totschlag, meine ich. Ohne dass ich es wollte.«
»Gab es eine Schlägerei?«
»Nein, Kommissar.«
»Commandant, bitte. Commandant Adrien Danglard. Ich stehe ganz zu Ihrer Verfügung.«
Es war lange her, wenn es überhaupt je vorgekommen war, dass ihr jemand mit so viel Achtung und Höflichkeit begegnet war. Der Typ war keine Schönheit – irgendwie ausgerenkt, fand sie –, aber, mein Gott, seine hübschen Sätze machten alles wett. Der Leuchtturm ging wieder an.
»Commandant«, sagte sie mit festerer Stimme, »ich fürchte, ich habe einen Brief abgesandt, der einen Tod zur Folge hatte.«
»Einen Brief, der Drohungen enthielt? Wütende Ausfälle? Rachegedanken?«
»Darüber, Commandant«, sie mochte dieses Wort, das auch ihr Bedeutung zu geben schien, »darüber weiß ich nichts.«
»Was wissen Sie nicht, Madame?«
»Ich weiß nichts von dem, was darin stand.«
»Aber Sie sagten doch, Sie haben ihn abgeschickt.«
»Das ja, abgeschickt habe ich ihn. Und ich habe vorher gut überlegt. Weder zu wenig noch zu viel.«
»Und warum haben Sie ihn eingeworfen – das meinen Sie doch? –, wenn er nicht von Ihnen war?«
Der Leuchtturm erlosch.
»Weil ich ihn vom Boden aufgehoben habe und die Dame hinterher gestorben ist.«
»Sie haben also einer Freundin einen Gefallen getan und einen Brief für sie eingeworfen, war es so?«
»Überhaupt nicht, ich kannte diese Frau gar nicht. Ich hatte ihr gerade erst das Leben gerettet. Was ja immerhin nicht wenig ist.«
»Das ist unendlich viel«, bestätigte Danglard.
Hatte Bourlin nicht gesagt, Alice Gauthier sei aus dem Haus gegangen, um einen Brief einzuwerfen, der seitdem verschwunden war?
Er richtete sich zu seiner vollen Größe auf, so gut er konnte. In Wirklichkeit war der Commandant ein großer Mann, viel größer als der kleine Kommissar Adamsberg, was nur niemand wirklich wahrnahm.
»Ja, unendlich viel«, wiederholte er und beobachtete die Verwirrung der Frau im roten Mantel.
Der Leuchtturm ging wieder an.
»Aber später dann ist sie gestorben«, sagte sie. »Ich habe es heute Morgen in der Rubrik ›Todesfälle‹ gelesen. Die schau ich mir von Zeit zu Zeit an«, erklärte sie etwas hastig, »damit ich nicht irgendwann mal die Beerdigung eines nahen Verwandten oder eines alten Freundes verpasse, Sie verstehen?«
»Diese Aufmerksamkeit ehrt Sie.«
Und Marie-France fühlte sich gleich besser. Sie empfand eine Art Zuneigung für diesen Mann, der sie so gut verstand und sie so flugs von ihren Sünden reinwusch.
»Und da las ich auf einmal, dass Alice Gauthier aus der Nummer 33 a gestorben ist. Denn ihr Brief war es doch, den ich eingeworfen hatte. Um Gottes willen, Commandant, und wenn ich das nun alles ausgelöst hätte? Dabei hatte ich meinen Gedanken doch sieben Mal herumgedreht und nicht ein Mal mehr.«
Danglard erbebte bei dem Namen Alice Gauthier. In seinem Alter war Erbeben etwas so Seltenes geworden, und seine Neugier auf die kleinen Ereignisse des Lebens erschöpfte sich so schnell, dass er der Frau im roten Mantel geradezu dankbar war.
»An welchem Tag haben Sie den Brief eingeworfen?«
»Also, am Freitag vorher, als ihr auf der Straße schwindlig geworden war.«
Danglard machte eine heftige Bewegung.
»Kommen Sie, begleiten Sie mich zu Kommissar Adamsberg«, sagte er und legte den Arm um ihre Schultern, als fürchtete er, die unbekannten Dinge in ihrem Besitz könnten unterwegs verlorengehen wie bei einem Gefäß, das zerbricht und seinen Inhalt hergibt.
Widerstandslos ließ Marie-France sich führen. So ging es nun ins Büro des großen Chefs. Dessen Name ihr auch nicht unbekannt war.
Sie war enttäuscht, als der höfliche Commandant die Tür zum Direktorenzimmer öffnete. Dort döste ein Mensch in schwarzem Leinenjackett und schwarzem T-Shirt vor sich hin, die Füße auf dem Tisch; er hatte rein gar nichts von der Lebensart des Mannes an sich, der sie empfangen hatte.
Der Leuchtturm erlosch.
»Kommissar, Madame sagt, sie habe den letzten Brief von Alice Gauthier in den Kasten geworfen. Ich denke, Sie sollten sie anhören.«
Da schlug der Kommissar, von dem sie meinte, er sei am Einschlafen, sehr plötzlich die Augen auf und nahm seine sitzende Position wieder ein. Widerstrebend ging sie auf ihn zu, voller Bedauern, dass sie den liebenswürdigen Commandant gegen diesen schlaffen Typen eintauschen musste.
»Sie sind der Direktor?«, fragte sie verdrossen.
»Ich bin der Kommissar«, entgegnete Adamsberg lächelnd, der gleichermaßen an die häufig entgeisterten Blicke der Leute gewöhnt wie unbeeindruckt von ihnen war. Mit einer Handbewegung lud er sie ein, ihm gegenüber Platz zu nehmen.
»Glaube nie an die Autorität von Autoritäten«, hatte Papa gesagt, »das sind die Schlimmsten.«Tatsächlich hatte er noch hinzugefügt: »Alles Arschlöcher.« Marie-France verschloss sich. Adamsberg spürte diesen Rückzug und bedeutete Danglard, sich neben sie zu setzen. Und in der Tat, erst als der Commandantsie dazu aufforderte, entschloss sie sich zu reden.
»Ich war beim Zahnarzt gewesen. Das 15. ist nicht mein Viertel. Es passierte, wie es eben passierte, sie lief da mit ihrem Rollator, ihr wurde schlecht, und dann ist sie umgefallen. Ich habe sie gerade noch aufgefangen, bevor sie mit dem Kopf aufs Pflaster schlug.«
»Gute Reflexe«, bemerkte Adamsberg.
Nicht mal ein »Madame«, wie der Commandant gesagt hätte. Auch kein »unendlich viel«. Nur ein banales Bullenwort. Wie gesagt, sie mochte die Bullen nicht. Und wenn der andere ein Gentleman war, ein verirrter Gentleman allerdings, so war der hier, der Chef, einfach ein Bulle. Keine zwei Minuten, und der würde ihr was anhängen. Du gehst zu den Bullen, und hinterher bist du schuldig.
Der Leuchtturm blieb erloschen.
Adamsberg wechselte wieder einen Blick mit Danglard. Keine Frage, um ihren Ausweis durften sie sie nicht bitten, wie es sich für jede normale Aussage gehört hätte; dann hätten sie gleich verloren.
»Madame befand sich da wie durch ein Wunder«, betonte der Commandant, »sie hat die Frau vor einem Aufprall bewahrt, der fatal hätte sein können.«
»Das Schicksal hat Sie gleichsam in ihren Weg gestellt«, ergänzte Adamsberg.
Kein »Madame«, aber immerhin ein Kompliment. Marie-France wandte ihm ihr Anti-Bullen-Gesicht zur Hälfte zu.
»Wollen Sie einen Kaffee?«
Keine Antwort. Danglard stand auf, und hinter dem Rücken von Marie-France buchstabierte er für Adamsberg stumm ein »Ma-da-me« in drei sauberen Silben.
»Madame«, wiederholte Adamsberg, »möchten Sie einen Kaffee?«
Nach einem knapp zustimmenden Nicken der Frau in Rot stieg Danglard zum Kaffeeautomaten hinauf. Adamsberg schien begriffen zu haben. Man musste diese Frau beruhigen, ihr mit Respekt begegnen, ihr schwindendes Geltungsbedürfnis wiederbeleben. Man musste die allzu hemdsärmelige, allzu ungezwungene Ausdrucksweise des Kommissars kontrollieren. Aber ungezwungen war er nun mal, er war schon so geboren, er war direkt aus einem Baum entsprungen oder aus dem Wasser oder einem Felsen. Aus einem Berg in den Pyrenäen.
Nachdem der Kaffee serviert war – in Tassen und nicht in Plastikbechern –, übernahm der Commandant wieder die Führung des Gesprächs.
»Sie haben sie also aufgefangen, als sie stürzte«, sagte er.
»Ja, und da kam auch schon ihre Pflegerin angerannt. Sie schrie, sie schwor, dass Madame Gauthier es strikt abgelehnt hätte, von ihr begleitet zu werden. Dann hat die Apothekerin die Sache in die Hand genommen, und ich habe alle Sachen von der Erde aufgehoben, die aus ihrer Handtasche gefallen waren. An so was denken die vom Rettungsdienst nie. Wo wir doch unser ganzes Leben da drin haben, in unserer Tasche.«
»Stimmt«, ermunterte Adamsberg sie. »Männer stopfen das alles in ihre Jacken- oder Hosentaschen. Und dabei haben Sie also auch einen Brief aufgelesen?«
»Bestimmt hatte sie den in ihrer linken Hand gehalten, denn er war auf die andere Seite gefallen.«
»Sie sind eine gute Beobachterin, Madame«, meinte Adamsberg und lächelte ihr zu.
Dieses Lächeln gefiel ihr. Es war charmant. Und sie spürte, dass sie diesen Direktor interessierte.
»Ich habe es nur nicht gleich wahrgenommen. Erst später, als ich zur Metro ging, fand ich den Brief in meiner Manteltasche. Sie werden doch wohl nicht glauben, dass ich ihn geklaut habe?«
»So was passiert schon mal aus Versehen«, meinte Danglard.
»Aus Versehen, genau. Als ich den Namen auf dem Absender sah, Alice Gauthier, war mir klar, dass das ihr Brief war. Dann habe ich überlegt, sieben Mal und nicht ein Mal mehr.«
»Sieben Mal«, wiederholte Adamsberg.
Wie konnte man eigentlich die Anzahl seiner Gedanken feststellen?
»Und nicht fünf und nicht zwanzig. Mein Vater hat immer gesagt, man muss einen Gedanken sieben Mal im Kopf herumdrehen, bevor man handelt, nicht weniger, sonst macht man eine Dummheit, aber auch nicht öfter, das schon gar nicht, weil man sonst anfängt, sich im Kreis zu drehen. Und dass man sich durch ewiges Im-Kreis-Drehen in die Erde bohrt wie eine Schraube. Dann aber kommt man nie mehr heraus. Und so habe ich gedacht: Wenn die Dame allein aus dem Haus gehen wollte, um den Brief in den Kasten zu werfen, musste er ihr sehr wichtig sein, oder?«
»Sehr.«
»Genau das habe ich mir gedacht«, sagte Marie-France mit neugewonnener Selbstsicherheit. »Ich habe ihn mir noch mal angesehen, und ja, es war wirklich ihr Brief. Sie hatte ihren Namen sehr groß auf die Rückseite des Umschlags geschrieben. Zunächst habe ich überlegt, ihn ihr zurückzugeben, aber man hatte sie doch ins Krankenhaus gebracht, und in welches? Ich hatte keine Ahnung, die Feuerwehrleute haben ja nicht mal das Wort an mich gerichtet, sie haben mich weder gefragt, wie ich heiße, noch sonst irgendetwas. Also habe ich mir gesagt, vielleicht ist es das Beste, ich bringe ihn in die 33 a zurück, die Pflegerin hatte ja gesagt, wo die Frau wohnte. Da war ich erst bei meiner fünften Gedankenumdrehung. Bloß das nicht, habe ich mir dann aber gedacht, schließlich hatte die Dame es abgelehnt, sich von der Pflegerin begleiten zu lassen. Vielleicht misstraute sie ihr oder so. Bei der siebten Runde dann, ich hatte inzwischen alles reiflich durchdacht, habe ich beschlossen, zu Ende zu führen, was die arme alte Dame nicht mehr geschafft hatte. Und habe den Brief eingeworfen.«
»Und haben Sie zufällig auf die Adresse geachtet, Madame?«, fragte Adamsberg mit leiser Unruhe. Denn es war ja sehr gut möglich, dass diese Frau mit all ihren Bedenken und Gewissensqualen es sich aus Diskretion versagt hatte, den Namen des Empfängers zu lesen.
»Das musste ich ja, wo ich ihn mir so genau angesehen habe, diesen Brief, während ich nachdachte. Schließlich musste ich die Adresse ja auch wissen, um ihn in den richtigen Schlitz zu werfen: ›Paris‹, ›Banlieue‹, ›Provinz‹ oder ›Ausland‹. Irren darf man sich da wirklich nicht, sonst ist der Brief verloren. Ich habe draufgeschaut und noch mal draufgeschaut, es war die 78, das Departement Yvelines, und habe ihn eingeworfen. Aber seitdem ich erfahren habe, dass die arme Frau gestorben ist, fürchte ich, dass ich eine schreckliche Dummheit begangen habe. Im Fall, der Brief hat irgendwas ausgelöst. Irgendetwas, das sie umgebracht hat. Wäre das dann ein unfreiwilliger Totschlag? Wissen Sie denn, woran sie gestorben ist?«
»Dazu kommen wir noch, Madame«, sagte Danglard, »aber Ihre Hilfe ist sehr kostbar für uns. Jede andere als Sie hätte den Brief danach vielleicht vergessen und wäre nie zu uns gekommen. Doch haben Sie abgesehen von der Postleitzahl 78, den Yvelines, vielleicht auch noch den Namen des Empfängers gelesen? Und erinnern Sie sich wunderbarerweise an ihn?«
»Ein Wunder ist das nicht, ich habe einfach ein gutes Gedächtnis. Monsieur Amédée Masfauré, Le Haras de la Madeleine, Route de la Bigarde, 78491 Sombrevert. Da war der Schlitz ›Banlieue‹ doch richtig, oder?«
Adamsberg stand auf und streckte sich.
»Fantastisch«, sagte er, ging auf sie zu und packte sie etwas zu vertraulich an den Schultern und schüttelte sie leicht.
Sie verbuchte diese unpassende Geste auf das Konto seiner Zufriedenheit und war ebenfalls glücklich. Ein echt guter Tag, Kindchen.
»Aber eins möchte ich doch noch wissen«, sagte sie und wurde wieder ernst, »nämlich, ob meine Handlung den Tod der armen Dame ausgelöst hat, über einen nachträglichen Schock oder so was. Sie müssen schon verstehen, dass mich das nicht loslässt. Denn wenn die Polizei sich dafür interessiert, wird sie vermutlich nicht in ihrem Bett gestorben sein, oder irre ich mich?«
»Sie trifft überhaupt keine Schuld, Madame, darauf gebe ich Ihnen mein Wort. Der beste Beweis ist, dass der Brief am Montag, spätestens Dienstag seinen Empfänger erreicht hat und Madame Gauthier am Dienstagabend gestorben ist. Und in der Zwischenzeit hat sie keinerlei Post, keinen Besuch und auch keinen Anruf erhalten.«
Während Marie-France sehr erleichtert aufatmete, warf Adamsberg Danglard einen raschen Blick zu: Wir belügen sie jetzt. Wir sagen ihr nichts von dem Besucher am Montag und am Dienstag. Wir belügen sie, denn warum sollten wir ihr das Leben schwermachen?
»Also ist sie wirklich eines natürlichen Todes gestorben?«
»Nein, Madame.« Adamsberg zögerte. »Sie hat sich das Leben genommen.«
Marie-France schrie auf, sodass Adamsberg ihr eine diesmal tröstende Hand auf die Schulter legte.
»Wir vermuten, dass dieser Brief, den wir verloren glaubten, ihren Letzten Willen enthielt, den sie einem lieben Freund mitteilen wollte. Sie haben sich also nichts vorzuwerfen, ganz im Gegenteil.«
Adamsberg wartete nicht ab, bis Marie-France – von Danglard gebührend hinausgeleitet – die Brigade verlassen hatte, um das Kommissariat des 15. Arrondissements anzurufen.
»Bourlin? Ich habe deinen Mann. Den Empfänger des Briefes von Alice Gauthier. Ein Amédée Dingsbums, in den Yvelines, keine Sorge, ich habe die komplette Anschrift.«
Nein, er hatte entschieden kein Gedächtnis für Namen. In diesem Punkt war Marie-France ihm um hundert Nasenlängen voraus.
»Und wie hast du das geschafft?« Bourlin wurde wach.
»Ich habe gar nichts gemacht. Diese anonyme Frau, die Alice Gauthier bei ihrem Sturz aufgefangen hat, hat deren Sachen von der Straße aufgelesen, darunter den Brief, den sie sich in die Tasche gesteckt hat, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und das Beste ist: Nachdem sie lange überlegt hat – sieben Mal, um genau zu sein, ich erspare dir die Details –, hat sie ihn in den Kasten geworfen. Und das Allerbeste ist: Sie konnte sich an die vollständige Anschrift des Empfängers erinnern und hat sie mühelos abgespult, so wie du mir die Fabel Der Rabe und der Fuchs aufsagen würdest.«
»Und warum sollte ich dir die Fabel Der Rabe und der Fuchs aufsagen?«
»Kannst du sie denn nicht mehr?«
»Nein. Bis auf die Zeile ›Ihr seid der Phönix unter den Gästen dieses Waldes‹. Die habe ich nie verstanden. Was man nicht versteht, daran erinnert man sich letztlich am besten.«
»Vergiss jetzt mal den Raben, Bourlin.«
»Du hast doch davon angefangen.«
»Tut mir leid.«
»Also, gib mir die Adresse von dem Mann.«
»Ich lese sie dir vor: Amédée Masfauré, keine Ahnung, wie sich das ausspricht. M-A-S-F-A-U-R-É.«
»Amédée. Wie ›Dédé‹, der Name, den der Nachbar verstanden hat. Er ist also gleich nach Empfang des Briefes zu ihr gefahren. Lies weiter.«
»Le Haras de la Madeleine, Route de la Bigarde, 78491 Sombrevert. Passt es dir?«
»Es passt mir schon, nur dass ich den Fall wirklich noch heute Abend abschließen muss. Der Richter ist ausgerastet bei der Erwähnung des Kyrillischen, ich habe nur einen Tag herausschlagen können. Darum springe ich in mein Auto und suche diesen Amédée sofort auf.«
»Darf ich dich mit Danglard inkognito begleiten?«
»Wegen des Zeichens?«
»Ja.«
»Okay«, sagte Bourlin nach kurzem Schweigen. »Ich weiß, was es heißt, wenn man ein Puzzle begonnen hat und nicht mehr damit aufhören kann. Eine Frage: Warum ist diese Frau zu dir gekommen statt in mein Kommissariat?«
»Anziehungskraft, Bourlin.«
»Und im Ernst?«
»Im Ernst kommt sie jeden Tag an der Brigade vorbei. So ist sie eben reingegangen.«
»Und warum hast du sie nicht sofort an mich verwiesen?«
»Weil sie Danglards Charme erlegen ist.«
6
Kommissar Bourlin war sehr schnell gefahren, und nun wartete er seit fünfzehn Minuten auf seine Kollegen, indem er vor dem gewaltigen hölzernen Tor, das den Eingang zum Haras de la Madeleine verschloss, ungeduldig auf und ab ging. Im Gegensatz zu Adamsberg, der keine Ungeduld kannte, war Bourlin ein Heißsporn, der der Zeit immer um einiges voraus war.
»Mein Gott, was hast du bloß unterwegs gemacht?«
»Wir mussten zweimal anhalten«, erklärte Danglard. »Der Kommissar, um sich einen fast vollständigen Regenbogen anzusehen, und ich wegen einer beeindruckenden Scheune der Tempelritter.«
Aber Bourlin hörte schon nicht mehr hin, er hing an der Türglocke des Grundstücks.
»Carpe horam, carpe diem«, murmelte Danglard, der zwei Schritte hinter ihnen geblieben war. »›Ergreife die Stunde, ergreife den Tag‹«, ein alter Rat von Horaz.
»Ziemlich großes Anwesen«, bemerkte Adamsberg, der das Gut durch die jetzt im April etwas gelichtete Hecke betrachtete. »Das Gestüt liegt vermutlich dort ganz hinten rechts, bei den hölzernen Baracken. Das sieht hier echt nach Geld aus. Großkotziges Haus am Ende einer Kiesallee. Was halten Sie davon, Danglard?«
»Wahrscheinlich auf dem Fundament eines alten Schlosses erbaut. Die beiden Pavillons, die die Auffahrt flankieren, stammen aus dem 17. Jahrhundert. Müssen wohl einst Kavalierhäuser gewesen sein, die zu einem wesentlich prunkvolleren Hauptgebäude gehörten. Das vielleicht während der Revolution niedergerissen wurde. Bis auf den Turm, der erhalten blieb, dort hinten in dem Wäldchen. Sehen Sie ihn, er ragt ein bisschen darüber hinaus? Sicher ein Wachtturm, und der ist noch älter. Wenn wir mal hinübergingen, um ihn uns anzusehen, würden wir vielleicht auf Grundmauern aus dem 13. Jahrhundert stoßen.«
»Aber das werden wir nicht, Danglard.«
Eine Frau öffnete ihnen das Portal nach umständlichem Hantieren mit schweren Eisenketten. Sie war über fünfzig, klein und schmächtig, notierte Adamsberg innerlich, aber mit einem molligen Gesicht und vollen runden Backen, die nicht zu ihrem Körper zu passen schienen. Lustige Apfelbäckchen über einem kantigen Leib.
»Finden wir hier Monsieur Amédée Masfauré?«, fragte Bourlin.
»Er ist auf dem Gestüt, da müssen Sie nach 18 Uhr wiederkommen. Und wenn Sie wegen der Termiten hier sind, das ist schon erledigt.«
»Polizei, Madame«, sagte Bourlin und zog seinen Ausweis heraus.
»Polizei? Aber wir haben denen doch alles gesagt! Haben wir nicht schon Kummer genug? Sie werden doch nicht noch mal mit dem ganzen Theater anfangen?«
Bourlin wechselte einen verständnislosen Blick mit Adamsberg. Was hatte die Polizei hier schon zu suchen gehabt. Vor ihm?
»Wann waren die Polizisten hier, Madame?«
»Das ist schon fast eine Woche her! Stimmen Sie sich denn nicht untereinander ab? Am Donnerstagmorgen, eine Viertelstunde danach, waren die Gendarmen bereits hier. Und dann noch mal am nächsten Tag. Sie haben alle Leute befragt, alle mussten wir ran. Reicht Ihnen das nicht?«
»Eine Viertelstunde wonach, Madame?«
»Also, Sie stimmen sich ganz eindeutig nicht ab«, bemerkte die kleine Frau kopfschüttelnd und eher verärgert als aufgeregt. »Jedenfalls haben sie gesagt, dass sie nun fertig wären, und haben uns den Leichnam zurückgegeben. Tagelang haben sie ihn behalten. Vielleicht haben sie ihn sogar aufgemacht, ohne irgendwen zu fragen.«
»Wessen Leichnam, Madame?«
»Den vom Patron«, sagte sie und betonte die einzelnen Silben, als spräche sie zu einem Haufen Ignoranten. »Er hat sich umgebracht, der arme Mann.«
Adamsberg hatte sich ein wenig von der Gruppe entfernt und lief mit auf dem Rücken verschränkten Händen im Kreis herum, hin und wieder einen Kiesel vor sich herstoßend. Achtung, erinnerte er sich, wenn man zu viel im Kreis rennt, bohrt man sich in den Boden wie eine Schraube. Noch ein Selbstmörder, verdammt, genau einen Tag nach dem Tod von Alice Gauthier. Adamsberg verfolgte die schwierige Unterhaltung zwischen der dünnen Frau und dem dicken Kommissar. Henri Masfauré, der Vater von Amédée. Er hatte sich am Mittwochabend erschossen, aber sein Sohn hatte ihn erst am nächsten Morgen gefunden. Bourlin ließ nicht locker, mein Beileid, es tut mir unendlich leid, aber ich bin in einer ganz anderen Angelegenheit hier, nichts Ernstes, seien Sie unbesorgt. Welcher Angelegenheit? Einem Brief von Madame Gauthier, den Amédée Masfauré erhalten hat. Das heißt, die Frau ist inzwischen verstorben, und er sollte ihren Letzten Willen erfahren.
»Wir kennen keine Madame Gauthier.«
Adamsberg zog Bourlin drei Schritte zurück.
»Ich würde gern einen Blick in das Zimmer werfen, in dem der Vater sich umgebracht hat.«
»Ich will diesen Amédée sehen, Adamsberg. Nicht irgendein leeres Zimmer.«
»Beides, Bourlin. Und ruf die Gendarmen an, um rauszukriegen, was es mit diesem Selbstmord auf sich hat. Das wäre welche Gendarmerie, Danglard?«
»Hier zwischen Sombrevert und Malvoisine, denke ich, unterstehen sie Rambouillet. Capitaine Choiseul – wie der Staatsmann gleichen Namens unter Ludwig XV. – ist ein kompetenter Mann.«
»Mach das, Bourlin«, sagte Adamsberg mit Nachdruck.
Sein Ton hatte sich verändert, er war rigoroser, dringlicher geworden, und Bourlin willigte zähneknirschend ein.
Nach zehnminütiger, undurchschaubarer Unterhaltung mit Adamsberg machte die Frau das Tor schließlich ganz auf und ging ihnen auf dem Kiesweg voran, um sie zum Arbeitszimmer des Patrons zu führen, das im Obergeschoss lag. Ihre runden Wangen hatten partiell über ihren hageren Körper gesiegt. Dennoch sah sie nicht den geringsten Zusammenhang zwischen dem Büro des Chefs und dem Brief dieser Madame Gauthier, und es schien ihr, als sähe auch dieser Bulle, Adamsberg, ihn nicht. Er hatte sie nur eingewickelt, das war alles. Aber der Typ erinnerte sie mit seiner Stimme – oder war es sein Lächeln oder sonst was? – an ihren einstigen Lehrer. Der hätte einen dazu gebracht, das komplette Einmaleins an einem einzigen Abend zu lernen.
Adamsberg kannte inzwischen den Namen der Frau: Céleste Grignon. Sie war vor einundzwanzig Jahren ins Haus gekommen, als der Kleine sechs gewesen war. Der Kleine, das war Amédée Masfauré, er war sehr zart und sensibel, es ging ihm nicht gut, man durfte ihm kein Härchen krümmen.
»Hier ist es«, sagte sie, öffnete die Tür des Arbeitszimmers und bekreuzigte sich. »Auf diesem Stuhl vor seinem Schreibtisch hat Amédée ihn am Morgen gefunden. Das Gewehr stand noch zwischen seinen Füßen.«
Danglard lief durch den ganzen Raum, besah sich die mit Bücherregalen vollgestellten Wände, die Zeitschriften, die sich auf dem Boden stapelten.
»War er Lehrer?«, fragte er.
»Mehr als das, Monsieur, ein Gelehrter. Und mehr noch, ein Genie. Er widmete sich ganz dem Geist der Chemie.«
»Und was genau interessierte ihn am Geist der Chemie?«