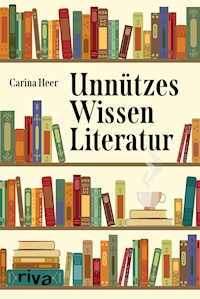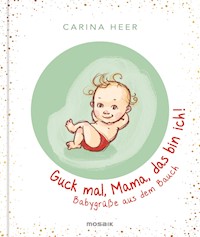10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gutkind Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Ein liebevolles Porträt Frankens« Süddeutsche Zeitung Ein Malzmord kommt selten allein So hat Evi Pflaum sich ihren ersten Arbeitstag in der alten Heimat nicht vorgestellt: Ihr Vorgesetzter ist im Dauerkrankenstand und der erste Mordfall landet direkt auf dem Schreibtisch der jungen Staatsanwältin. Rätselhafte Malzspuren an der Leiche führen in die Brauereien und Mälzereien der fränkischen Bierstadt. Hochmotiviert legt sich die chronisch unterzuckerte Evi nicht nur mit ihrem neuen Chef an und betrinkt sich mit ihrer besten Freundin auf der Kerwa – sie verliert sich auch in den grünen Augen von Gerichtsmediziner Dr. Niklas Rosenbeet. Aber dann taucht schon die nächste Leiche auf ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Das Buch
Zwischen Mastsau, Brotzeit und Gerichtssaal
So hat Evi Pflaum sich ihren ersten Arbeitstag in der alten Heimat am Rande des Steigerwalds nicht vorgestellt: Ihr Vorgesetzter ist im Dauerkrankenstand und der erste Mordfall landet direkt auf dem Schreibtisch der jungen Staatsanwältin. Rätselhafte Malzspuren an der Leiche führen in die Brauereien und Mälzereien der fränkischen Bierstadt.
Frisch getrennt legt sich die chronisch unterzuckerte Evi nicht nur mit ihrem neuen Chef an und betrinkt sich mit ihrer besten Freundin auf der Kerwa – sie verliert sich auch in den grünen Augen von Gerichtsmediziner Dr. Niklas Rosenbeet. Aber dann taucht schon die nächste Leiche auf …
Die Autorin
Carina Heer ist Autorin und Ghostwriterin. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin arbeitete zunächst als Lektorin, bevor sie – teilweise unter Pseudonym – zahlreiche Ratgeber, Spiele, Kinderbücher und Sachbücher veröffentlichte, die zu Bestsellern wurden. Von ihrer fränkischen Heimat kann sie bis heute nicht lassen: Carina Heer lebt und arbeitet bei Bamberg.
www.gutkind-verlag.de
ISBN978-3-98941-109-8
Copyright © 2025: Gutkind Verlag GmbH, Berlin
Wir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text- und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Illustration: © Ivan Alex Burchak/Shutterstock (Bläschen)
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München
Coverabbildungen: © alaver/Shutterstock (Dorf), © Yustus/Shutterstock (Bierkrug), © Ivan Alex Burchak/Shutterstock (Schaum und Bläschen)
Autorinnenfoto: © ifo-fotografie.de
E-Book: Sandra Hacke, Dachau
Alle Rechte vorbehalten.
Bei Fragen und Anmerkungen zum Produkt wenden Sie sich bitte an: [email protected]
Gutkind Verlag · Friedrichstraße 126 · 10117 Berlin
Inhalt
Über das Buch / Über die Autorin
Impressum
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Zu guter Letzt …
Navigationspunkte
Cover
Inhalt
Textbeginn
Carina Heer
Das Bierkomplott
Staatsanwältin Evi Pflaum ermittelt
Kriminalroman
Für meine Familie. Ihr seid noch besser, als ich es mir hätte ausdenken können.
Kapitel 1
Ich wache auf von einem Quieken, gefolgt von einem Knall – und plötzlicher Stille, von der ich genau weiß, was sie bedeutet: Rosi ist nicht mehr.
Rosi ist eine der letzten verbliebenen Säue auf dem Hof meiner Eltern. Und die Geräuschkulisse, wenn wieder einmal ein Kinderliebling den natürlichen Weg aller Mastsäue geht, ist mir wohlvertraut, seitdem meine Schwester und ich vor Jahrzehnten jeden Herbst wieder im Badezimmer kauerten, lauschten und mit wohligem Entsetzen durch die Rolloritzen beobachteten, was wir eigentlich nicht sehen durften, und dabei die Augen zusammenkniffen, weil wir es eigentlich auch gar nicht sehen wollten.
Während Rosi draußen mit dem Flammenwerfer abgeflammt wird, weil Borsten auf der Schweinebratenkruste einfach nur ekelhaft sind, starre ich an die Wand meines Kinderzimmers. Leonardo DiCaprio lächelt mir entgegen, aber der von damals, als er noch jung und schlank und süß war. Ich hadere mit meinem Schicksal.
Gibt es etwas Schlimmeres, als mit 32 Jahren im eigenen Kinderzimmer aufzuwachen? Nicht weil Weihnachten ist. Oder weil das Auto kaputt ist und man es am Abend nicht mehr nach Hause in die eigene, schöne, perfekt erwachsen eingerichtete Wohnung in München geschafft hat. Sondern weil man wieder zu Hause eingezogen ist, nachdem man sich von seinem erfolgreichen, superreichen (»250 000 im Jahr – Boni nicht eingerechnet, Süße!«), ursprünglich eigentlich ebenfalls aus Franken stammenden Staranwaltsfreund getrennt und wieder in die Heimat zurückgekehrt ist? Ohne Haus. Ohne Auto.
Wobei ich zu meiner Verteidigung sagen muss, dass ich das eigentlich anders geplant hatte. In die Heimat zurück wollte ich zwar schon seit Jahren, der Beschluss fiel aber relativ spontan erst vor drei Monaten – die Info, dass es wirklich klappt mit der Versetzung, die gab es sogar erst letzte Woche. Und in der Einliegerwohnung meiner Eltern wäre sicherlich genug Platz für mich gewesen – wäre darin noch Platz gewesen. Denn obwohl meine Mutter mit ihren nicht einmal sechzig Jahren durchaus nicht der Nachkriegsgeneration angehört, zeichnet sie sich aus durch erstens einen ausgeprägten Hang zum Hamstern – und zweitens ständige Gewichtsschwankungen, hervorgerufen durch mal mehr oder weniger erfolgreiche Diäten und dem damit verbundenen mal mehr oder weniger grausamen Jo-Jo-Effekt.
Eine verhängnisvolle Kombination, die dafür sorgt, dass sich dort, wo ich hoffte, zumindest provisorisch und ehrbewahrend meine Zelte aufstellen zu können, Kleiderstangen drängen mit Klamotten in den unterschiedlichsten Größen, für den Fall, dass meine Mutter doch mal wieder in Kleidergröße 36 passt. Und den Platz, der nicht mit den alten Klamotten meiner Mutter oder irgendwelchen anderen Kisten vollgestopft ist, nimmt ein ausrangiertes Solarium ein, das meine Eltern in den Neunzigern angeschafft haben, um sich dreimal die Woche zu grillen. Es verbreitet noch immer den penetranten Geruch von Ozon und steht rum für den Fall, dass hausgemachte Bräune wieder in Mode kommt.
Was nicht heißt, dass mein Kinderzimmer, in dem ich nun Obdach gefunden habe, verschont geblieben wäre vom Hamsterwahn meiner Mutter. Unter meinem Bett reihen sich Nudelpackungen aneinander, deren Ablaufdatum ich mir lieber nicht näher anschaue. In meinem Bücherregal stapeln sich neben TKKG und den drei ??? Gaskocher (»Die gab’s bei Aldi im Angebot – man weiß ja nie«). Wüsste man doch nur, wo die passenden Gaskartuschen hingekommen sind. Die gab’s nämlich auch dazu.
Rosis Todesschrei ist schon vor mindestens fünfzehn Minuten verklungen und ich bin noch immer nicht aufgestanden. Stattdessen zähle ich die in den zwei untersten Fächern des Regals aufgereihten Dosen mit Sauerkraut. Es sind 32 große und 7 kleine. Skorbut kriegt hier im Fall eines dritten Weltkriegs niemand.
Von draußen dringt Gelächter an mein Ohr. Die Nachbarn sind da. Schlachtschüssel zieht einfach immer. Die perfekte Gelegenheit, sich schon am Vormittag einen Schnaps zu genehmigen. Für die Verdauung. Is klar.
»Evi, bis du wach?«, gellt es von unten hoch zu mir. Die Einliegerwohnung hat sie für mich nicht ausgeräumt, aber in Sachen Menschenantreiben hat meine Mutter es sofort geschafft, wieder in den Mamamodus zu schalten. »Du kommst noch zu spät an deim ersten Tag!«
Ja. Mein erster Tag.
In meinem Traumjob.
***
Seit ich bei meiner Großmutter viel zu früh Ein Fall für zwei schauen durfte, träumte ich davon, entweder Privatdetektivin oder Rechtsanwältin zu werden. Ich wurde weder das eine noch das andere – stattdessen wurde ich Staatsanwältin. Weil aber mein fünfjähriges Ich – wie 90 Prozent der Menschheit – nie begriffen hat, was denn jetzt der Unterschied zwischen Rechtsanwalt und Staatsanwalt ist, wäre es vermutlich dennoch ziemlich zufrieden mit mir.
Staatsanwältin bin inzwischen seit etwa fünf Jahren – aber nachdem ich viel zu lange Zeit in München darauf gewartet habe, dass sich meine Studienliebe Ferdinand endlich dazu durchringt, mit mir wieder nach Franken, den wunderschönen Norden des Freistaats, zu ziehen, bin ich jetzt endlich da, wo ich hinwollte, wonach ich mich so lange gesehnt habe: bei der Justiz meiner Heimatstadt.
Und allein.
Doch keine Zeit, sentimentalen Gedanken nachzuhängen. Meine Mutter schreit. Schon wieder.
»Evi Pflaum!«
»Ich komme, Mama!«
Ich habe mich inzwischen aus dem Bett, ins Bad und in meine Klamotten gequält. Ich hüpfe die Treppe hinunter in die Küche. Mein Körpergedächtnis erinnert sich nur an die Kinderart, diese Treppe hinunterzugehen, und will sich so gar nicht auf ein resigniertes Erwachsene-Anfang-dreißig-Schlurfen einstellen.
Ich öffne den Kühlschrank. Bis auf einen Behälter mit selbst gemachtem Joghurt herrscht gähnende Leere. Ich öffne das Brotfach: nichts.
»Sag mal, habt ihr nichts zu essen hier?«
»Es ist noch Joghurt da!«, flötet meine Mutter, während sie in ihre Jacke schlüpft, um was weiß ich wohin zu fahren. Sie ist im Grunde immer im Stress. Was sie wirklich macht, weiß kein Mensch.
»Aber Joghurt allein macht doch nicht satt!«, halte ich verzweifelt dagegen.
»Du kannst dir ja noch ein paar Leinsamen drunterrühren!«, schlägt sie mir vor, und meine Gesichtszüge entgleisen.
»Mama, ich habe heute einen anstrengenden Arbeitstag vor mir. Ich muss was Richtiges essen.«
»Warte du nur mal, bis du sechzig bist, dann kannst du auch nur noch einmal täglich richtig essen«, gibt meine Mutter noch zurück, während sie die Tür hinter sich zuzieht. Na, Mahlzeit!
Dabei ist meine Mutter durchaus nicht richtig dick, wie man jetzt vielleicht meinen könnte. Sie wiegt einfach mal 10, mal 20 Kilo mehr als die 45 Kilo, die sie übrigens auch nach meiner Geburt wieder gewogen hat: »Eine Woche nach deiner Geburt bin ich hoch zur Waldkapelle gejoggt.« Zur Einordnung: Ich bin noch nie in meinem Leben irgendwohin gejoggt. Wenn meine Mutter gerade mal wieder unter 55 Kilo wiegt, nennt mein Vater, der alles essen kann, was er will, und trotzdem aussieht, als könnte er Werbung für die Welthungerhilfe machen, sie »knochig«. Das stört sie nicht: »Ich bin ja nicht für dich schön, sondern für mich.« Super emanzipiert eigentlich – wenn dadurch nur der Kühlschrank nicht so schrecklich leer wäre …
Mein Handy vibriert. Jana. Meine beste Freundin schon seit Kindertagen, selbstständige Friseurin und die einzige Person, die mir an diesem Morgen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann:
Alles Gute. Denk nicht an den Spacko Ferdinand und denk daran: Das heute ist dein Traumjob seit der Grundschule. Ich bin so froh, dass du wieder da bist und ich dich jetzt jeden Tag haben kann. Meinen Fängen entkommst du nicht.
Es piept erneut.
Der letzte Satz sollte keine Drohung sein.
Und ein weiteres Mal.
Oder vielleicht doch? Vergiss nicht: Morgen Kerwa!
Ich grinse. Wie könnte ich das vergessen? Schon seit zwei Wochen, als ich Jana unter Freudentränen mitgeteilt habe, dass es für mich wieder nach Hause geht, liegt sie mir in den Ohren, dass ich mir »den Kerwasdienstag unbedingt freihalten muss«. Ferdinand hatte die Erfüllung meiner Träume gar nicht mehr mitbekommen – er hatte schon auf die schiere Tatsache, dass ich vor einigen Monaten endlich Nägel mit Köpfen gemacht und die Kopie meines Versetzungsantrags auf seinem höhenverstellbaren Eiche-Titan-Schreibtisch deponiert hatte, nur mit den Worten »Du bildest dir aber nicht ein, dass wir eine Fernbeziehung führen?« kommentiert.
Auch eine Art, Schluss zu machen.
Geht klar. Wenn ich heute überlebe. Hab dich lieb!, texte ich zurück. Für mehr bleibt keine Zeit. Irgendetwas zum Frühstücken muss her. Ich spüre, wie ich in den Unterzucker falle. Das scheint so ein Familiending zu sein. Ich weiß nicht, wie oft ich meinen Vater schon kreidebleich Marmelade löffelnd in der Küche angetroffen habe. Der Arzt sagt übrigens, er ist kerngesund. Wahrscheinlich sind wir einfach total verfressen.
Wie gut, dass heute Schlachtschüssel ist. Da gibt es auf jeden Fall Brot. Und wenn ich Glück habe …
»Evi!«, schallt es mir entgegen, als ich über den Hof schlappe und mich durch die offen stehende Tür des Alten Stalls in den Kreis unserer Schlachtschüsselgäste geselle. »Du bist abber groß wordn!« Ich dachte ja, den Satz hätte ich auch langsam hinter mir gelassen. Aber vermutlich ist das nur die höfliche Variante von »Die Falten hattest du früher auch nicht«.
Alle sind sie da. Obwohl ich sie alle quasi seit meiner Geburt kenne, weiß ich nicht, wie sie wirklich heißen, sondern kenne sie nur unter ihren Hausnamen. Der Spicksn Alois, die Dümmers Sophie, der Bienakönigs Fritz. Die Hausnamen gehen meist auf irgendein Ereignis oder irgendeine Person in der Familiengeschichte zurück, an die niemand sich mehr erinnert. Die Namen aber sind geblieben. Und ich weiß ja nicht, wie unsere Nachbarn das hinkriegen, aber in Sachen Work-Life-Balance scheinen sie einiges richtig zu machen. Nicht mal neun Uhr und auf dem Tisch steht schon der Willi.
»Habt ihr keine Arbeit, oder wie?«, grinse ich.
»Mer lebbt net, bloß um zu ärbern!«, lautet die lapidare Begründung, und mehr der Worte braucht es nicht, als ich mich mit an den Tisch setze, der im alten Stall neben dem blubbernden Kessel steht.
Vielleicht aber sollte ich die Räumlichkeiten meines Elternhauses noch ein bisschen erklären. Beim Hof der Familie Pflaum handelt es sich um einen klassischen Dreiseitenhof mit Wohnhaus, Scheune, Kuhstall und Schweinestall. Einen Teil des Wohngebäudes bildet das alte Wohnhaus meiner Großeltern mit dem alten Stall, der nach dem Bau des neuen Stalls überflüssig war und in eine Art Mehrzweckraum zum Waschen, Schlachten, Gemüseputzen verwandelt wurde. Daran angebaut wurde vor der Heirat meiner Eltern – die übrigens verdächtig knapp gefolgt wurde von der Geburt meiner Schwester Sylvia – das Haus meiner Eltern.
In den letzten Jahren hat mein Vater alles ordentlich hergerichtet. Der Hof ist schön gepflastert, wilder Wein rankt sich am Fachwerk empor, der Misthaufen, in dem so viele meiner wenig erfolgversprechenden Fahrradfahrversuche ein jähes Ende gefunden haben, ist verkleinert und hinter einer malerischen kleinen Mauer versteckt worden, sodass alles sehr sauber und adrett aussieht, wenn nicht wie heute ein Rinnsal aus Blut und Wasser den Berg hinunterläuft und Robert, seines Zeichens Mann meiner Schwester und Leiter des örtlichen Schlachthofs, in den Misthaufen pinkelt.
»Tatar is noni fertich!«, ruft er mir durch die Tür des Alten Stalls zu, während er sich den Hosenstall wieder zuzieht. Mir entgleisen die Gesichtszüge. Muss ich tatsächlich mit einem Frühstück aus blankem Brot zu meinem ersten Arbeitstag? »Aber ich hab von gestern noch a bissla was mitgebracht«, fährt Robert fort, und ich beginne zu strahlen. Ich wusste es doch! Mein Schwager kennt einfach meine fleischlichen Gelüste.
»Setz dich her, ich bring der Omma noch schnell des Gehirn nei«, verzichtet mein Vater auf große Worte und macht sich auf in die Küche, wo unsere durch irgendwelche glücklichen Umstände oder schauspielerisches Talent auf Pflegegrad 3 eingestufte Oma an ihrem Tisch thront und die ganze Verwandtschaft nach ihrer Pfeife tanzen lässt. Zu ihr schau ich ein andermal rein. Bei ihrem ausgeprägten Redebedürfnis komm ich hier sonst nie mehr zu meinem Frühstück. Vor allem habe ich heute keine Lust darauf, wieder aufs Brot geschmiert zu bekommen, dass die Grafn Angela schon mit dem dritten Kind schwanger ist – »dabei hat sie doch zwa Jahr nach dir Kommunion ghabt«.
Mir läuft das Wasser im Mund zusammen, als Robert die Schüssel vor mich stellt und ich das rohe, gewürzte Fleisch zentimeterdick auf die knusprige Brotscheibe schmiere. Vielleicht ist an diesem Tag ja doch nicht alles schlecht.
Da kommt ein großer schwarzer Mercedesbus die Hofeinfahrt hinaufgeschossen und reißt mich aus meiner Fleischmeditation. Chromfelgen, 224PS. Der Motor heult, die Reifen quietschen, als eine zierliche blonde Frau die Handbremse anzieht und, noch während sie den Motor abwürgt, aus dem Monstrum springt und ihre dreijährige, ganz in Cord und Filz gekleidete Tochter Lotta-Luisa aus dem Kindersitz zerrt. Darf ich vorstellen: meine Schwester Sylvia. Mutter, Macherin und wie immer in Eile. Warum diesmal?
»Sorry, Papa. Der Georg-Linus hat gerade einen Riesenkacki in seine Windel gemacht. Gerade als wir loswollten. So ein Stress. Und der Gestank! Das macht die elende Fleischfresserei. Danke, dass du die Lotta-Luisa nimmst – das ist immer so ein Theater, wenn sie bei den Vorsorgeuntersuchungen dabei ist!« Kaum hat meine Schwester ihre Tochter auf den Boden gestellt, spratzelt Lotta-Luisa los, stolpert durch die Tür in den Alten Stall, umarmt kurz mein Bein und wuselt dann weiter in die Küche zur Oma. Mit kindlich sicherem Instinkt weiß sie, dass dort etwas ganz besonders Feines auf sie wartet. Sylvias Blick fällt auf mich – und das Tatar-Brot, das ich in der Hand halte. »Evi, spinnst du? Wie kannst du nur die Rosi essen?«
Sylvia hatte schon immer die unglückliche Neigung, ihr Herz allzu sehr an Tiere zu hängen, die bei uns auf dem Hof für den Verzehr bestimmt sind.
»Das ist doch nicht die Rosi, sondern irgendeine Nachbarssau. Und wenn ich sie nicht ess, isst sie ein anderer. Außerdem war’s doch dein Mann, der das arme Schwein ermordet hat«, grinse ich meine Schwester an, die als Kind gemeinsam mit der Oma in der Küche gesessen und ums Gehirn gestritten hat, jetzt aber Veganerin ist. »Aus Überzeugung«, wie sie sagt. Ich verrate Sylvia nicht, dass Lotta-Luisa in der Küche vermutlich schon mit der Oma an Rosis Gehirn nascht.
»Hör auf, Salz in meine Wunden zu streuen«, verdreht Sylvia die Augen. Meine Schwester hat wirklich das Talent zur Dramaqueen. Kein Krippenspiel um die Jahrtausendwende in Schweinsbrunn, in dem sie nicht die Hauptrolle innehatte. Egal ob Maria, Verkündigungsengel oder der Gelbe unter den Drei Königen – Sylvias Rolle machte aus jeder Rolle ihre Rolle. Doch bei aller Neigung zum Drama muss ich doch sagen: Dass ihr Mann gelernter Metzgermeister und Leiter des Schlachthofs ist und bei Hausschlachtungen gerne bis zu den Ellbogen in Presssackteig steckt, trägt Sylvia mit erstaunlicher Fassung. Ist doch schön, wenn die Liebe stärker ist als alle Ideale.
»Na, schon aufgeregt?«, streut sie jetzt Salz in meine Wunden. Rache ist Blutwurst. Sie kennt mich gut genug, um zu wissen, dass es mir schon seit Tagen vor Aufregung im Bauch herumgeht. »Was gäb ich darum, wieder zur Arbeit zu dürfen!«
Aufgepasst! Das ist eine rhetorische Falle, wie sie meine Schwester gerne für ihre arglosen Mitmenschen aufstellt. Wenn ich jetzt antworte: »Na ja, so schön ist Arbeit jetzt auch nicht«, wird sie mir mit wehleidigem Blick erklären: »Du weißt gar nicht, wie schön es ist, wenn man seinen Kopf ganz allein für sich und nicht ständig Kinder um sich kreischen hat!« Wenn ich aber sage, dass sie ja demnächst wieder anfangen kann zu arbeiten, dann erwartet mich ein Vortrag darüber, wie unverantwortlich es ist, Kinder in so einer wichtigen Phase der frühkindlichen Entwicklung fremdbetreuen zu lassen. »Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie da die Bindung drunter leidet! Und die Intelligenz sowieso!«
Also brumme und lächle ich nur mitfühlend, während ich mir das zweite Tatarbrot schmiere.
»Wann geht eigentlich dein Bus?« Babämm. Sylvia scheint heute wirklich glänzend gelaunt zu sein. Denn die Sache mit dem Auto ist eines der Dinge, die das Potenzial haben, mir den Tag zu versauen – und an die ich noch nicht gedacht habe. Also grundsätzlich schon. Aber heute noch nicht. Bis jetzt: Ich muss mit dem Bus zur Arbeit fahren.
»Um Viertel neun«, antworte ich zwischen zwei Bissen. Ich werde mir nicht anmerken lassen, wie wenig Bock ich darauf habe. Ja klar, Sprit sparen und so: Yeah! Aber mit dem Bus in die Stadt ist so was von 2008 – ich denke, damit ist meine Rückverwandlung in mein Teenager-Ich vollständig abgeschlossen.
Der Grund, weshalb ich kein Auto habe, bei an die 600 Personenkraftwagen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Deutschland – Kinder mit einberechnet? Die Antwort lautet wie so oft: München. Und mein Ex Ferdinand. Als es uns beide in die Landeshauptstadt zog, war ich stolze Besitzerin eines süßen kleinen Twingos mit Tieferlegung und weiß-blauer Sonderlackierung. Mein Vater – ein gelernter Automechaniker – hatte das Auto mit seinem Schwager und besten Freund aufgemotzt und mir zum Achtzehnten geschenkt.
Doch der Flitzer, für den mir beim Abi noch neidische Blicke zugeworfen worden waren und mit dem Ferdinand sich im Studium bereitwillig von mir hatte herumchauffieren lassen, war meinem Freund, der sich in München über Nacht in einen im P1 Fizz und Spritz süffelnden Großkanzleisnob verwandelt hatte, einfach nur peinlich. Wenn wir jetzt bei der Bodenwelle auf Höhe Holledau mit 180 Kilometern pro Stunde kurz aufsetzten, lachte er nicht mehr, sondern schimpfte auf meinen geliebten Twingi. Und als mein weiß-blauer Liebling von einem besoffenen SUV-Fahrer so angefahren wurde, dass er ein wirtschaftlicher Totalschaden war, machte Ferdinand drei Kreuze und gab meinen Liebling dem Schrotthändler mit. Fortan waren Carsharing und Mietwagen unsere Zauberwörter – und ich kann versichern: Ein Twingo war da nicht mehr darunter.
Mir brannte das Herz.
Wie auch jetzt bei dem Gedanken daran, mit dem Bus in die Stadt zu fahren.
Was nicht heißt, dass es bei uns auf dem Hof nicht genug fahrbare Untersätze gegeben hätte. Meine Mutter hat ihr eigenes Auto. »Aber das brauche ich, Evi, das verstehst du doch.« Zum Einkaufen. Oder einfach so in der Gegend Rumfahren. Ist ja klar. Mein Vater ist ein regelrechter Autonarr, der seine halbe Jugend auf der Gokart-Bahn verbracht hat und noch immer seine Runden dreht, wenn ihm mal nicht gerade wieder Hüfte, Schulter oder ein anderer Teil seines schlecht gepolsterten Fahrgestells wehtut. Deshalb hat er sogar zwei Autos: ein Liebhabercabrio, das er nur bei passender Stimmung und perfektem Wetter fährt – also nie. Und sein Dreckauto, bei dem er auf nichts achten muss und das so abgeranzt und dreckig aussieht, dass ich damit niemals an meinem ersten Tag zur Arbeit gefahren wäre. Davon, dass mein Vater es mir nie geliehen hätte, weil er es noch mehr liebt als sein Liebhaberauto, einmal ganz abgesehen.
Noch eine halbe Stunde bis zum Bus. Wenn ich das zweite schnell aufesse, ist doch locker noch ein drittes Brot …
Tutuuuu! In diesem Moment drängt ein weiteres Auto sich in unsere nicht schmale Einfahrt. Was ist denn hier los? Ein Verkehr wie am Stachus!
»Pflaum, du Pflaume! Wir müssen in einer halben Stund im Büro sei und du sitzt da und frisst.«
Was für eine Überraschung!
»Beder? Was machst du denn hier?«
Kapitel 2
Was Peter hier macht?
Absolut keine Ahnung.
Beginnen wir doch mit der viel einfacher zu beantwortenden Frage, wer Peter eigentlich ist.
Entgegen der klassischen Dramaturgie ist Peter nicht mein Ex-Liebhaber, mit dem ich mich, sobald die alte Leidenschaft in Kapitel 4 wieder aufgeflammt ist, spätestens ab Kapitel 12 durch die Kissen wühle. (Gab es in der Vergangenheit vielleicht ein Missverständnis, das ausgeräumt werden muss? Eine alte Wunde, die nur durch Liebe geheilt werden kann?)
Peters Mutter Maria ist die allerbeste Freundin meiner Mutter – weshalb sie für Sylvia und mich nicht etwa nur »Maria« heißt, sondern sogar den Ehrentitel »Tante Maria« bekommen hat. Peter und Sylvia wurden schon als Babys im Zwillingskinderwagen miteinander durch die Gegend gekarrt – wenig später schoben sie mich durch die Straßen und Gassen von Schweinsbrunn. Ich trug Peters Hosen auf, weil Sylvias Strumpfhosen zu sehr zwickten. Wir pinkelten gemeinsam im Kälberstall in den leeren Milupa-Eimer, wenn meine Mutter gerade aufwusch und wir nicht ins Haus durften. Wir stiegen ins leer stehende – und einsturzgefährdete – Dümmershaus ein und klauten, was nicht niet- und nagelfest war.
Diese Kinderfreundschaft fand ihr natürliches Ende, als Sylvia und Peter mit 15 beschlossen, »miteinander zu gehen«. Ich weiß nicht, ob echte Zuneigung oder ein Mangel an anderen potenziellen romantischen Alternativen der Grund für dieses plötzlich aufflammende Interesse war. Drei Monate ging das gut, dann traf Sylvia bei der 125-Jahr-Feier der Birnbacher Feuerwehr den feschen Robert, und Peter gehörte der Vergangenheit an.
Der trug es mit Fassung. Die alten Zeiten waren jedoch unwiederbringlich verloren. Ich ging ans katholische Mädchengymnasium, freundete mich mit Jana an, feierte bei ihr Übernachtungspartys und ging lieber in der Stadt in die Clubs und Discos und verwendete keinen großen Gedanken an Peter und Schweinsbrunn. Bis er mir nach einem exzellenten Abi (meinerseits – er war inzwischen einmal durchgefallen und nach verspätetem, aber erfolgreichem Abschluss zwei Jahre durch die Welt getingelt) in Erlangen im Studium wiederbegegnete, und es war, als hätte es all die Jahre dazwischen nicht gegeben.
Entgegen allen Erwartungen stellte Peter sich im Jurastudium gar nicht so dumm an. Ich wunderte mich nur kurz. Er hatte schon immer alles besser gewusst und Menschen auf ihre kleineren und größeren Vergehen hingewiesen. Wir verstanden uns sofort wieder hervorragend und pendelten am Wochenende gemeinsam nach Hause. Ich fand ihn sexistisch, klugscheißerisch bis fies und politisch nicht immer ganz korrekt, aber er war und ist wie das Auto, das noch immer mit laufendem Motor bei uns in der Hofeinfahrt steht: ein bisschen zu dick, ein bisschen zu aufgedreht und aufgemotzt, aber man sieht sofort, dass man sich damit wohlfühlen wird.
Doch ein zweites Mal machte uns die Liebe einen Strich durch die Rechnung. Gleich zu Beginn des Hauptstudiums setzte sich Ferdinand, groß, blond, blauäugig, in der ersten Vorlesung Öffentliches Recht in die Reihe hinter mich und verliebte sich im selben Augenblick (ich zitiere hier wortwörtlich, nicht dass es heißt, ich gebe an) »unsterblich« in mich. Das beeindruckte mich so nachhaltig, dass ich mich gar nicht lange querstellte, mich meinerseits in ihn verliebte, irgendwann alle Brücken hinter mir abbrach und nach dem Ersten Staatsexamen von ihm breitschlagen ließ, es doch mal in München zu versuchen. »Solche Noten muss man doch zu Geld machen«, stellte er als Sohn eines Raiffeisenbankvorstands fest und wurde Anwalt in einer Großkanzlei für Bank- und Kapitalmarktrecht.
Während ich dort fünf lange Jahre darauf hoffte, mit Ferdinand in die Heimat zurückzukehren, schrieb Peter Schneider in Erlangen Staatsnote (zwei Jahre nach mir; Peter war zwar gut, aber ich war besser!) und bekam in unserer Heimatstadt sofort eine Stelle bei der Staatsanwaltschaft – kurz »StA« genannt – mein Traumjob.
***
Damit wäre also die Frage geklärt, wer dieser Peter denn eigentlich ist, und wir nähern uns auch der Antwort auf die eigentlich gestellte Frage, was Peter denn nun hier macht. Klar habe ich damit gerechnet, ihn im Büro zu treffen, schließlich sind wir fortan Kollegen, aber hier?
»Was machst du hier?«
Peter reagiert nicht sofort auf meine Frage. Er ist genervt. Das merke ich nicht, weil ich ihn so gut kenne, sondern weil er ungeniert die Augen verdreht. Es ist Montagmorgen und die ganze Welt ist mal wieder viel dümmer als er.
»Wonach schaut’s denn aus, Pflaume? Ich hol dich ab!« Jetzt scheint mein Blick Bände zu sprechen, denn er fährt fort: »Ich hab doch die Omma gestern angerufen. Wir sollen um Viertel neun drin sein. Das schaffst du nie mit dem Bus.«
»Die Omma?«, verdreht Sylvia nun ihrerseits die Augen. »Die macht nur noch Sachen, die sie will. Und ganz sicher gibt sie keine Nachrichten weiter.«
»Dann muss das Evilein mal lernen, an ihr Handy zu gehen«, gibt Peter zurück und grinst mich jetzt an. »Und nicht nur damit Candy Crush zocken.«
»Halt einfach die Klappe!« Ich schnappe mir meine Tasche und nehme einen extra großen Bissen von meinem Tatarbrot, während ich mich auf den Beifahrersitz von Peters BMW gleiten lasse. Meine Füße sind noch nicht mal in das Meer aus Redbull-Dosen, das sich unter dem Beifahrersitz gebildet hat, eingetaucht, da drückt mich schon die Beschleunigung in den Sitz.
»Die Omma hat erzählt, du bist den Schnösel los.«
Habe ich schon erwähnt, dass Peter eine ziemliche Klatschtante sein kann? Wahrscheinlich hat er sich gefreut, als er mich am Handy nicht erreicht hat und stattdessen die Oma anrufen konnte. Diese etwas unmännliche Neigung zu Klatsch und Tratsch hat er von Tante Maria.
»War das eine Frage?«, gebe ich auf seine Bemerkung nur schnippisch zurück. Ich hasse Ferdinand auch, aber ich brauche niemanden, der mir unter die Nase reibt, was für eine schlechte Wahl ich getroffen habe. Peter macht es trotzdem.
»Du hast schon immer auf die geschniegelten Jungs gestanden. Lass die Finger davon. Die tun dir nicht gut.« Er grinst: »Und falls es dir mal nach ein bisschen Wärme und Nähe ist: Unter meiner Decke ist immer ein Plätzchen für dich frei!«
Ich verschlucke mich vor Lachen am Rest meines Tatarbrots. »Wir sind jetzt Kollegen«, ermahne ich ihn.
»Was in der Staatsanwaltschaft passiert, bleibt in der Staatsanwaltschaft«, gibt Peter mit anzüglich wackelnden Augenbrauen zurück.
Eine passende Antwort fällt mir darauf nicht ein. Selbst wenn ich wollte, könnte ich Peters Angebot nicht ernst nehmen. Sein strohiges Blond und der leichte Ansatz eines Doppelkinns sorgen in meinem Bauch für alles andere als Schmetterlingsgeflatter. Wobei wir wieder beim Thema wären.
»Parken wir direkt beim Gericht?«
»Du musst vor Aufregung aufs Klo, oder?«
Peter kennt mich seit meiner Kindheit. Ich hasse ihn!
»Ne, wir müssen uns einen Parkplatz suchen. Die paar freien sind um die Uhrzeit meistens voll. Nur die Cheffen bekommen feste Parkplätze.«
Inzwischen haben wir uns ins Stop and Go der ewigen Baustelle auf dem Ring eingereiht. Die kenne ich deshalb, weil sie schon da war, als ich noch in der Schule war. Wir sprechen hier von einem Zeitraum von über zehn Jahren.
»Wieso gibt es für meine Begrüßung eigentlich einen extra Termin?«
»Der LOStA will dich kennenlernen.«
Nein, Peter meint keinen Lobster, sondern den LOStA – den Leitenden Oberstaatsanwalt. Der ist so etwas wie der Chef der Staatsanwälte. Über ihm steht der »General« – also der Generalstaatsanwalt, die Schnittstelle zum Justizministerium – unter ihm die Abteilungsleiter. Und eigentlich hätte mich – wenn überhaupt – ein solcher begrüßen müssen.
»Gibt es irgendein Problem? Gibt’s keinen Abteilungsleiter, der zwischen Tür und Angel Hallo sagen kann?«
»Genau das ist das Problem«, gibt Peter zurück, und in meinem Bauch quakert es mit einem Mal noch viel mehr – dass Peter in diesem Moment eine Vollbremsung macht, hilft der Sache nicht. Er lässt das Fenster runter – auf der Beifahrerseite – und brüllt Spucke sprühend über mich hinweg: »Du blinder Spacko! Es gibt auch Radwege!«
Der Radfahrer zeigt uns nur den Mittelfinger und schlängelt sich weiter durch den nur zäh fließenden Verkehr. Und tatsächlich: Wo rechts immer lange Reihen von Autos parken durften, ist jetzt alles als Radweg ausgezeichnet.
»Ja, krass, wo sind denn die ganzen Parkplätze hin?«, entfährt es mir. »Wo parkt ihr jetzt?«
»Hier«, gibt Peter zurück, während er den BMW direkt auf dem Radweg abstellt und ein Schild aus dem Handschuhfach holt: Staatsanwaltschaft im Einsatz.
»Was schaust du so? Bin ich Staatsanwalt oder nicht? Bin ich im Einsatz oder nicht?« Er grinst. »Jetzt komm schon. Wird Zeit, dass du aufs Klo kommst.«
***
Ich schaffe es nicht mehr aufs Klo.
Es ist Punkt 8.15 Uhr, als Peter und ich die Etage der Staatsanwaltschaft erreichen. Ein Mann stapft mir entgegen. Er ist an die zwei Meter groß, gut gelaunt, Grinsen, Gönnermiene, Händeschütteln, jovial – ein Unsympath vor dem Herrn.
»Na, Herr Schneider, da haben Sie uns gar nicht verraten, was für eine besondere Schönheit die liebe Frau Pflaum ist.« Er lacht laut und dröhnend. Von Sexismus am Arbeitsplatz hat dieser Platzhirsch vermutlich auch noch nichts gehört. Er legt noch eins drauf. »Optisch eine große Bereicherung für die Abteilung!« Ich überlege, ob ich ihn gleich nach dem üblichen Gang einer Dienstaufsichtsbeschwerde fragen soll. Er beweist seinen Mangel an Feingefühl, indem er meine gerunzelte Stirn völlig falsch deutet: »Na, wer wird denn schüchtern sein. Komplimente muss man auch annehmen können!«
Und manche Sachen sollte man einfach für sich behalten.
Peter steht neben mir und grinst sich eins.
»Ich bin Helmut Söllner, der Leitende Oberstaatsanwalt, und darf Sie heute anstelle von Herrn Weidmann begrüßen. Er ist eigentlich Ihr Abteilungsleiter. Aber er ist heute krank.« Hinter dem Rücken von Söllner formt Peter mit seinen Fingern imaginäre Anführungsstriche beim Wort »krank«.
»Leider ist Herr Weidmann gesundheitlich sehr anfällig. Deshalb ist es umso besser, dass wir mit Ihnen eine in vielen Bereichen erfahrene Kraft aus München gewinnen konnten.«
Mein Bauch beginnt erneut zu quakern und ich bin so damit beschäftigt, einen Angstpups zu unterdrücken, dass ich die Gelegenheit verpasse, dem LOStA zu widersprechen. Ich bin sicherlich kein Neuling, ja – aber in München habe ich in erster Linie Verkehrsrecht gemacht. Von »in vielen Bereichen erfahren« kann also durchaus nicht die Rede sein. Doch zu spät. Söllner hat mein Schweigen ein weiteres Mal falsch interpretiert und als Zustimmung gedeutet. Er fährt fort. »Und weil Herr Weidmann heute nicht da ist, dürfen Sie sich auch gleich ins Gefecht stützen. Ich habe eine Liste mit den heutigen Verfahren und die zugehörigen Akten in Ihr Büro bringen lassen, dann haben Sie noch Zeit, sich einzulesen, bevor es«, Blick auf die sehr große, sehr silberne Armbanduhr an seinem haarigen Handgelenk, »in einer halben Stunde losgeht!«
Wie bitte?
Eine halbe Stunde?
Hinter Söllner steht Peter und grinst mich an – sein Gesichtsausdruck ist eine Mischung aus mitfühlend und schadenfroh. Er zuckt mit den Schultern. Das hab ich jetzt auch nicht geahnt, soll das wohl heißen. Danke schön. Davon kann ich mir jetzt auch nichts kaufen.
»Und nun zu Ihnen, Schneider«, wendet sich der LOStA so schnell um, dass Peter sich sehr beeilen muss, um sein Mienenspiel wieder in den Griff zu bekommen. Ganz schön schnell, der Söllner, für seine mindestens 130 Kilogramm Lebendgewicht. »Wir haben gestern wieder ein paar Störer aufgegriffen. Straßenblockaden, das Übliche. Der Ermittlungsrichter hat sie schon in U-Haft genommen. Da machen wir heute ein paar Schnellverfahren, um dem Gesindel einen Denkzettel zu verpassen.« Bei seinen letzten Worten hat er sich schon umgedreht und ist halb zur Tür hinaus. »Dann verabschiede ich mich mal! Termine! Termine!« In meinem Kopf dreht sich alles angesichts der Geschwindigkeit, mit der der LOStA unterwegs ist.
Der geht jetzt ratschen, formen Peters Lippen in meine Richtung, bevor er sich zu Söllner umdreht und ihm kriecherisch hinterherwinkt. »Alles klar, Chef! Einsperren und Schlüssel wegwerfen! Wird gemacht!«
»Störer? Ihr macht nicht im Ernst immer noch Schnellverfahren für die Klimakleber, oder?« Ich verdrehe die Augen. »Was war das in München jedes Mal für ein Heckmeck. So was darfst du nur machen, wenn du sicher sein kannst, dass der Sachverhalt feststeht und du keine querulatorischen Rechtsanwälte hast, die dir ans Bein pinkeln wollen.«
»Wieso sollte da der Sachverhalt nicht feststehen? Die Leute haben ganze Fahrbahnstücke an ihren Händen kleben.« Peter verschränkt die Arme und lehnt sich lässig gegen die kalkweiße Wand des Flurs.
»Ich weiß ja nicht, was die hier für Verteidiger haben. Aber bei uns wurden ständig Beweisanträge gestellt. Haben sie denn den Verkehr wirklich behindert? Und waren die behinderten Leute tatsächlich dagegen? Vielleicht haben sie sich ja gar nicht genötigt gefühlt? Und greift bei einem Notstand wie der Klimaerwärmung nicht das Widerstandsrecht? So trivial ist das nicht. Wir saßen bei meinem letzten ›Schnellverfahren‹ bis nachts um drei. Ich glaube einfach, es gibt geeignetere Sachen für Schnellverfahren. Und wie erklärst du der Öffentlichkeit, dass wir in solchen Verfahren mit so einer Härte vorgehen und andere Fälle jahrelang nicht vorankommen? Das lässt uns ziemlich parteiisch aussehen!«