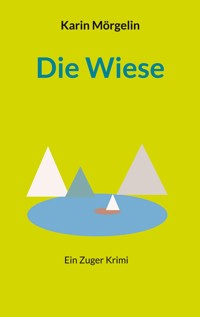Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zuger Krimi mit Tabea Stocker
- Sprache: Deutsch
Es ist Winter in Zug. Oben an der Lorzentobelbrücke steht ein Auto im Schnee. Die Kantonspolizei findet den Besitzer des Wagens tot im Tal der Lorze. Nur wenige Tage zuvor wird ein wertvolles Bild aus einer Villa gestohlen. Oberleutnant Tabea Stocker vermutet einen Zusammenhang. Ihre Ermittlungen führen sie in die Zuger Kunstszene.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 307
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
„Das Bild“ ist der zweite Band der Reihe „Zuger Krimi“.
Es ist Winter in Zug. Oben an der Lorzentobelbrücke steht ein Auto im Schnee. Die Kantonspolizei findet den Besitzer des Wagens tot im Tal der Lorze. Wenige Tage zuvor wird ein wertvolles Bild aus einer Villa gestohlen. Oberleutnant Tabea Stocker vermutet einen Zusammenhang. Ihre Ermittlungen führen sie in die Zuger Kunstszene.
Über die Autorin
Karin Mörgelin wurde 1956 in Weil am Rhein geboren.
Nach ihrem Studium der Germanistik und Anglistik lebte sie einige Jahre in England. Dort und später in Frankfurt am Main komponierte sie eine Vielzahl von Songs mit eigenen Texten, die sie mit ihren Bands auch in Funk und Fernsehen aufführte. Daneben schrieb und übersetzte sie Fachtexte und war Mitautorin eines Fachbuchs im Bereich der Pflege.
Sie arbeitete in England, Deutschland und in Zug (Schweiz) als Lehrerin.
Neben dem Kriminalroman „Die Wiese“ ist ihr Roman „Tareks Dilemma“ ebenfalls bei BoD erschienen.
Sie arbeitet als freie Schriftstellerin und lebt zusammen mit ihrem Mann wieder in Südbaden.
Wer viel erwartet, wird viel enttäuscht.Sprichwort
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 1
Der Zuger Bahnhof war nicht direkt der romantischste Ort für ein Tête-à-tête, aber für Amira und Simeon war er ideal. Die grosszügige Bahnhofshalle bot Schutz vor dem Wind, war einiger - massen warm und keiner zwang sie, etwas zu konsumieren. Es war schon nach 20 Uhr und nicht viel los. Sie sassen auf einer Bank und hielten sich an den Händen.
„Du siehst traurig aus, Simeon. Stimmt etwas nicht? Hast du Sorgen? Läuft etwas falsch zuhause in Eritrea?“, fragte Amira sanft. „Sag es mir. Vielleicht kann ich dir helfen. Oder in der Unterkunft? Blöde Kerle?“
„Nein, nein. Alles gut. Aber ich schon Problem hab.“ Simeon sprach leise und schaute sich ängstlich um.
Amira sah ihn fragend an. Sie ahnte, dass es nichts Gutes war. „Also, sag schon“, forderte sie ihn auf. „Es macht keinen Sinn, etwas vor sich herzuschieben.“
„Du weisst, Mirko? Der mich gebracht über Grenze nach Schweiz?“, begann Simeon zögernd.
Amira nickte. Simeon hatte ihr schon von seiner dramatischen Flucht aus Eritrea erzählt. Sein Ziel war die Schweiz. Hier hatte er Verwandte, die ihm Unterstützung versprachen. Nach einer katastrophalen Reise kam er völlig ausgezehrt in Italien an, wo er von einem Schleuser angesprochen worden war. Für eine nicht unerhebliche Summe versprach dieser, Simeon in die Schweiz zu bringen.
Dort würde er viel Geld verdienen und könnte das Geld in Raten zurückbezahlen. Simeon hatte zugestimmt und die erste Rate mit dem letzten Geld bezahlte, das ihm geblieben war. Eine weitere Rate konnte er mit Hilfe eines Cousins abstottern. Das war nun einen Monat her. Aber es kam dann alles etwas anders. Seine Verwandten wollten ihn nicht weiter unterstützen. Sie wären selbst knapp bei Kasse, meinten sie und Arbeit war in der Schweiz für ihn nicht möglich. Schliesslich wurde ihm ein Platz in einer Flüchtlingsunterkunft, dem alten Kantonsspital, zugewiesen. Amira konnte sich denken, um was es ging.
„Dieser Mirko“, fuhr Simeon fort. „Er will, dass ich machen soll Schlimmes. Er nicht will Geld. Er will Bild. Ein Bild aus dem Haus, wo du arbeiten.
Dann keine Schulden mehr. Aber ich ihm gleich sagen, dass ich nicht machen. Ich nicht dich mit reinziehen. Niemals!“
Damit hatte Amira nicht gerechnet. Sie liess seine Hände los und schaute ihn erschrocken an.
„Aber Mirko sagt, er dir sehr weh tut, wenn ich nicht mache. Und ich nie mehr haben werde Freude in mein Leben.“ Simeon liess verzweifelt den Kopf hängen und starrte auf einen dunklen Punkt am Boden, der ihm wie ein riesiges Loch erschien – ein Loch, in das er sich am liebsten hätte fallen lassen.
„Mein Gott, dieser dumme Mirko! Das war nie so abgemacht! Wie kann Mirko das wollen? Was für ein Mensch ist er nur?“ rief Amira verzweifelt aus.
Sie versuchte nachzudenken.
„Ich will meine Arbeit nicht verlieren. Aber ich will dir helfen“, sagte sie schliesslich.
Sie sassen eine Weile schweigend da. Jeder in seine Gedanken versunken.
Nachdem einige Minuten vergangen waren, fragte Amira: „Bis wann will er das Bild haben?“
„Eine Woche Zeit“, antwortete Simeon kurz.
Wieder entstand ein Schweigen.Verzweiflung und Angst breitete sich in ihren Gesichtern aus. Eine Passantin schaute die beiden kurz an, während sie mit ihrem Rollkoffer vorüberging. Eine Ansage der Bahn hallte durch den Raum.
„Frau Gautier hat viele Bilder im Haus. Vielleicht merkt sie gar nicht, wenn ein Bild nicht mehr da ist. Ich könnte einfach ein kleines Bild nehmen.“
„Nein, Amira! Du nicht Diebin! Ausserdem, er will bestimmtes Bild. Er mir Foto zeigen. Es ist klein. Es ist so.“ Simeon bedeutete mit den Händen die Dimensionen des Bildes.
„Hast du das Foto?“ Amira schien sich bereits auf die Vorstellung eines Diebstahls eingelassen zu haben.
„Amira, ich nicht will, dass du Bild klauen“, beteuerte Simeon mit ernstem Blick.
„Hast du eine bessere Idee?“ Amira schaute ihn fragend an. „Und ausserdem: Ich werde nicht klauen. Du klaust. Ich lasse nur die Tür auf. Vielleicht schaue ich, wo das Bild ist und zeig es dir.
Aber ich werde es nicht klauen.“
„Mir nicht gefallen. Aber ich auch keine Idee.“
Simeon schaute sie verzweifelt an.
„Zeig mir das Foto“, forderte Amira ihn auf.
Simeon holte sein verbeultes Handy aus der Jackentasche und suchte das Foto.
„Hier“, sagte er schliesslich und zeigte ihr das Bild.
„Hm, ja, ich hab es gesehen. Es ist nicht im Wohnzimmer. Es hängt in einem Erker, ein wenig wie versteckt. Ist bestimmt nicht wichtig für Madame. Ich schaue, wann es passt und sag dir dann Bescheid. Okay?“
Simeon nickte, aber man konnte es ihm deutlich ansehen, dass ihm die ganze Sache gar nicht gefiel.
Kapitel 2
Der See lag still da, eine glänzende Fläche, von der untergehenden Sonne in warmes Licht getaucht.
Madame Gautier stand vor dem Panoramafenster ihres Wohnzimmers und beobachtete, wie der orange-rote Ball langsam hinter dem Horizont verschwand. Welch Glück sie und ihr Mann vor fast fünfzig Jahren gehabt hatten, als sie diese schöne Villa am südlichen Ortsausgang von Zug, direkt am See gelegen, erwerben konnten. Und wie viele schöne Jahre sie zusammen hier verbringen durften. Georg war vor sechs Jahren von ihr gegangen. Zweimal die Woche besuchte sie ihn auf dem Friedhof und brachte ihm Blumen und liebevolle Gedanken mit. Manchmal erzählte sie ihm auch leise von dem neuesten Klatsch, den sie bei ihren Stiftungssitzungen im Kunsthaus erfuhr, und kicherte. Georg hätte das gefallen.
Es war kälter geworden. Der Gärtner hatte den Garten schon winterfest gemacht. Im Dämmerlicht schaute sie hinunter auf die letzten Rosenblüten, die bei der kleinen steinernen Treppe rankten, die hinunter zum See und zu einem alten Bootsanleger führte.
„Amira“, rief sie in den Raum, ohne sich umzudrehen. „Ich gehe gleich nach oben und mache mich fertig fürs Bett. Und wie gesagt, am Freitag fahre ich für eine Woche nach Carona. Ich muss mal wieder nach unserem Häuschen schauen. Du brauchst also die ganze Woche nicht zu kommen.“
„Ja, gut. Es ist auch mal schön, frei zu haben. Da kann ich meiner Mutter mit der Wohnung helfen.
Wir wollen ein wenig renovieren.“
„Na, dann passt das ja.“ Madame Gautier hatte sich mittlerweile umgedreht und schaute ihre junge Haushälterin an. Ein liebes Mädchen. So zart und doch so energisch und anpackend. „Wenn du nachher gehst, vergiss nicht, die Alarmanlage anzustellen und abzuschliessen.“
„Wie immer, Madame. Schlafen Sie gut. Ich bin auch gleich fertig in der Küche. Dann bis morgen.“
Madame Gautier drehte sich um und ging die Treppe hinauf ins obere Stockwerk, wo sich die Schlafzimmer befanden.
Am folgenden Tag, dem Donnerstag, beschäftigte sich Amira ungewöhnlich lange mit dem Abstauben im oberen Stockwerk, wo sich ein kleiner Erker befand, in dem das besagte Bild hing. Es hing dort zusammen mit drei anderen Bildern, die symmetrisch, zwei rechts und zwei links, zu dem kleinen Fenster angeordnet waren. Sie betrachtete es eine Weile. Nackte Menschen vor einem See oder Fluss, man konnte es nicht genau erkennen. Auch ob es nur Männer oder auch Frauen waren, war Amira nicht ersichtlich. Auf jeden Fall waren es mehrere, und sie waren in der freien Natur. Sie hatte das Bild schon immer abstossend gefunden.
Was wollte dieser Schleuser nur mit so einem Bild?
Was war er nur für ein merkwürdiger Mensch.
Und warum war es ihm 5'000 CHF wert? Woher wusste er überhaupt, dass Madame Gautier ein solches Bild besass? Sie schüttelte den Kopf. Das machte für sie alles keinen Sinn. Sie überlegte, ob sie das Bild morgen abhängen und in der Nähe der Kellertür platzieren sollte, damit Simeon nicht in den oberen Stock gehen musste und Gefahr laufen könnte, unnötig Spuren zu hinterlassen. Allerdings durfte das nicht zu früh passieren. Sie konnte nicht damit rechnen, dass Madame Gautier kurz vor ihrer Abfahrt nicht noch einmal nach oben ging, weil sie etwas vergessen hatte. Amira fühlte sich entmutigt. Am liebsten hätte sie gar nichts mit der Sache zu tun gehabt. Sie wollte ihre Madame Gautier nicht betrügen. Sie, die immer so nett und grosszügig ihr gegenüber war. Aber sie konnte Simeon doch nicht im Stich lassen, und dann waren ja auch noch die Drohungen gegen sie. Sie wandte sich von dem Bild ab und holte den Staubsauger aus dem Schrank neben der Treppe und begann den oberen Stock zu saugen.
Sie inspizierte dabei jeden Winkel, um sich zu versichern, dass keine versteckte Kamera oder ein Alarmsystem angebracht war. Sie nahm dafür das Bild sogar einmal kurz ab. „Lieber Gott, verzeih mir, aber ich muss das tun. Hilf mir, bitte, dass alles gut geht“, flehte sie leise dem wolkenverhangenen Himmel entgegen, der hinter dem Fensterchen zu sehen war.
Nachdem Madame Gautier und Amira das Mittagessen zu sich genommen hatten – es gab Hühnersuppe mit Nudeln, Gnocchi mit einer Sauce aus frischen Pilzen und etwas Rotkraut sowie ein von einer erstklassigen Confiserie gefertigtes Vermicelles zum Dessert – klingelte bei Madame Gautier das Telefon. Es war ihr Neffe. „Ich gehe in die Küche, grüssen Sie Ihren Neffen von mir.“ Amira räumte ab und liess ihre Arbeitgeberin im Esszimmer allein telefonieren. Das Geschirr war schnell in der Maschine verstaut und die Küche gereinigt.
Das Telefonat hielt noch immer an. Amira nutzte die Gelegenheit und ging in den Keller, um noch einmal genau zu überlegen, wie Simeon ungesehen in das Haus kommen könnte, wann und wo sie das Bild am besten platzieren würde, damit er es gleich sehen und sofort wieder damit verschwinden könnte. Madame Gautier nahm meistens den Zug nach Bellinzona um 16.30 Uhr. Eine halbe Stunde vorher würden sie sich verabschieden. Um keinen Verdacht zu erregen, musste alles sehr schnell gehen. Sie musste sich einen Vorwand überlegen, um noch kurz ein paar Minuten länger im Haus bleiben zu können. Aber wenn alles klappt, dann wäre eine ganze Woche gewonnen, bevor Madame Gautier den Diebstahl bemerken könnte. Jetzt oder nie, dachte sich Amira.
Kapitel 3
„Oh, Näi!“ Tabea Stocker schlug auf ihren Wecker ein, der unablässig klingelte. Erst als sie merkte, dass dieser nicht reagierte, wurde ihr klar, dass es ihr Handy war, das auf dem Nachttisch läutete. Missmutig griff sie danach.
„Tabea, mach dich auf die Socken, subito. Wir haben einen Toten an der Lorze unter der Lorzentobelbrücke. Die Spurensicherung ist schon unterwegs.“ Das war Hauptmann Nikolas Rogenmoser, ihr Chef bei der Zuger Polizei.
„Ja, ja, ich komme“, bestätigte sie kurz angebunden und legte auf. Was für ein Erwachen am Montagmorgen! Das Display auf ihrem Handy zeigte die Zeit an. Es war viertel nach fünf.
„Na super, können die Leute die Leichen nicht erst ab acht Uhr finden?“, nuschelte sie in die gemütlich warme Bettdecke. Ihr Blick fiel auf ihren Freund, Andreja, der neben ihr tief und fest schlief. Jö, wie süss, dachte sie. Im Schlaf wirkte er verletzlich wie ein Baby, wo er doch sonst mit seiner stattlichen Figur und den gut trainierten Muskeln einen starken Eindruck machte. Nur mit Mühe trennte sie sich von dem schönen Anblick.
Sie küsste ihn ganz vorsichtig auf die Stirn und stieg langsam aus dem Bett. „Subito, subito, nicht mit mir“, flüsterte sie vor sich hin. „Ich brauch meine Zeit, sonst läuft da gar nichts. Und überhaupt: Der Tote wird schon nicht weglaufen.“
Sie warf die Kaffeemaschine an und ging kurz unter die Dusche. Noch während sie sich abtrocknete, steckte sie ein Stück Toastbrot in den Toaster und schenkte sich eine Tasse Kaffee ein. Eine Viertelstunde später sass sie neben ihrem Kollegen Beat Iten, der geduldig im Polizeiwagen auf sie gewartet hatte.
„Guete Morge, Tabea. Au scho usgschlafe?“
Tabea Stocker meinte, einen ironischen Unterton gehört zu haben.
„Schneller isch es nöd gange. Jetzt fahr scho los.“
Obwohl es noch dunkel und sehr kalt war, wuselten schon eine ganze Menge Leute am Ufer der Lorze herum. Es hatte geschneit in der Nacht und es musste Mühe gemacht haben, das kleine Zelt aufzustellen, in dem sich schon ein paar Polizisten einen heissen Kaffee genehmigten. Auch eine Absperrung war bereits angebracht. Tabea Stocker konnte sich zwar nicht vorstellen, dass um diese Zeit und bei diesem Wetter irgendein Mensch hätte dort herumlaufen wollen, aber es war nun einmal eine Massnahme, die man nicht einfach auslassen durfte. Sie ging auf die Absperrung zu, hob das Polizeiband an und näherte sich der Leiche.
„Aha, Tabea! Wird aber auch Zeit.“ Ihre Kollegin Vivianne Betschart vom forensischen Team stand in ihrem weissen Schutzanzug neben der Leiche und schaute sie vorwurfsvoll an.
„Es ist saukalt, und ich bin schon seit einer halben Stunde fertig mit der vorläufigen Untersuchung der Leiche.“
„Und, was haben wir?“, wollte Tabea Stocker unbeeindruckt wissen.
„Eine männliche Leiche. Alter etwa 40 Jahre. Er ist wahrscheinlich die Böschung bei der Brücke oben heruntergestürzt. Er hat entsprechende Verletzungen. Sein Kopf ist auf der linken Seite verletzt und er hatte starke Blutungen. Wir haben den Felsbrocken schon entdeckt, wo er aufgeschlagen ist. Er ist entsprechend mit Blut verschmiert. Die genaue Todesursache kann ich erst feststellen, wenn wir ihn untersucht haben.“ Betschart machte eine kleine Pause. „So, und das möchte ich jetzt möglichst schnell tun, damit ich endlich hier aus der Kälte komme.“
Tabea Stocker kniete sich neben dem Toten nieder und schaute ihn sich unter dem Scheinwerferlicht, das die Kollegen installiert hatten, genau an. Der Kopf sah übel aus, aber es gab weder Stichwunden noch Schussverletzungen, und auch Hinweise auf eine Erdrosselung konnte man auf den ersten Blick nicht erkennen. Der Mann war in einen teuer aussehenden Wollmantel gekleidet, unter dem er einen ebenso teuren Anzug trug. An seinem zierlichen Handgelenk entdeckte Tabea Stocker eine goldene Uhr von IWC, und am Finger der anderen Hand glänzte ein breiter, silberner Ring.
Der Mann war mittelgross und schlank. Sie liess den Blick am Körper entlang nach unten gleiten, wo sie schwarze, handgenähte Winterschuhe erblickte.
„Weiss man denn schon etwas über seine Identität?“ Tabea Stocker blickte zu ihren Kollegen auf.
„Ja, er trug einen Ausweis, ein Handy und ein Portemonnaie bei sich,“ meinte ein junger Polizist, den Tabea Stocker nicht kannte. Sie schaute ihn fragend an.
„Er heisst Frederic Lüthy und wohnt hier in Zug, in der Fadenstrasse.“
„Gut, dann bringen Sie die Sachen in die forensische Abteilung. Gibt es sonst noch etwas? Habt ihr das Gebiet abgesucht?“ Tabea Stocker blickte in die Runde.
„Nach was sollten wir denn suchen?“, fragte eine Stimme aus dem Dunkeln, die ihr bekannt vorkam. Als er etwas vortrat, erkannte sie Lukas Möhlin, den Kollegen von Vivianne Betschart.
Möhlin war jünger als Tabea Stocker und manchmal ein wenig frech, fand sie.
Da sie nicht antwortete, fügte er hinzu:
„Das war ironisch, Tabea. Hier unten haben wir bisher nichts Auffälliges gefunden. Oben an der Brücke steht ein Wagen. Einem Frühaufsteher kam das seltsam vor, und er hat die Polizei alarmiert. Wir konnten an dem Wagen nichts Besonderes finden und sind dann erst einmal hierher gekommen. Es wäre nicht der erste Selbstmörder, der von da oben herunterspringt. Den Wagen werden wir jetzt nochmal genauer unter die Lupe nehmen.“
Stocker schaute nach oben. Sie konnte ein helles Auto sehen, das sehr nah am Abhang parkiert war.
„Super“, erwiderte sie. „Da gehe ich doch gleich mal mit. Habt ihr den Frühaufsteher schon in die Dienststelle bestellt?“
„Ja“, meinte ein anderer Kollege im Hintergrund.
„Der wartet dort schon eine Weile.“
Das klang wie ein Vorwurf an Stockers spätes Auftauchen. Sie ignorierte ihn.
„Vivianne, dann will ich dich mal nicht länger frieren lassen. Ihr könnt den Leichnam jetzt mitnehmen,“ meinte Stocker. Als Antwort hörte sie nur ein Grummeln von Vivianne Betschart.
Dann schaute sie sich nach Beat Iten um. Er stand hinten bei dem kleinen Zelt und hielt einen Becher Kaffee in der Hand.
„Beat, mach dich auf, wir fahren hoch auf die Lorzentobelbrücke.“
Nach einer erstaunlich umständlichen Fahrt erreichten sie schliesslich die Brücke und stellten den Polizeiwagen hinter das helle Auto. Von der Nähe aus betrachtet konnte man sehen, dass es ein silbergrauer Mercedes war. Spezialmodell. Zuger Kennzeichen. Kleine Nummer. Stocker und Iten zogen sich Gummihandschuhe an und gingen zu dem Wagen. Er war nicht abgeschlossen. Tabea Stocker, öffnete die Beifahrertüre und durchsuchte das Handschuhfach, während Beat Iten die Rücksitze inspizierte und anschliessend den Kofferraum.
„Ich kann nichts Auffälliges finden, nur Fahrzeugpapiere und so ein Mäppchen mit Informationen über das Auto“, rief Stocker ihrem Kollegen zu.
„Der Besitzer ist auf jeden Fall der Tote.“
„Ich habe auch nichts von Bedeutung. Alles leer ausser dem Notwendigen“, rief Beat Iten zurück.
Sie überliessen Lukas und seinen Leute das Feld.
Vielleicht würden die ja doch noch was Interessantes finden, hoffte Stocker.
„Wir fahren jetzt zurück in die Polizeidienststelle, damit der Frühaufsteher seine Aussage machen kann.“
Hinter dem Zugerberg deutete ein heller Streifen am Himmel an, dass es bald Tag werden würde.
Stocker und Iten fuhren zurück in die Stadt. Als Iten auf dem Parkplatz der Dienststelle hielt, sah er, dass Stocker eingenickt war.
„He, ufwache, mir sind da“, weckte er sie unsanft.
Sie gähnte einmal ordentlich und stieg dann aus.
Tabea Stocker war erst seit einem halben Jahr in Zug. Vorher arbeitete sie als Leutnant bei der Zürcher Polizei, wo man ihre Talente nicht würdigte und sie nur die unangenehmen Arbeiten machen liess. Mit vierzig Jahren war es höchste Zeit gewesen, sich nach etwas Besserem umzusehen. In Zug wurde sie fündig. Höherer Dienstgrad, besseres Gehalt, weniger Steuern und gleich zu Beginn ein Mordfall, den sie bravourös aufklärt hatte. Dazu mit Vivivanne Betschart eine sympathische Kollegin und mit Andreja Masi einen wunderbaren Mann an ihrer Seite. Das Glück hatte sie voll erwischt. Sie konnte es fast nicht glauben.
Als sie in den Eingangsbereich der Dienststelle kamen, sass bereits ein Mann auf einem der Besucherstühle. Ihr Chef, Hauptmann Rogenmoser, war ebenfalls schon da. Von seinem Büro aus winkte er durch die gläserne Trennscheibe Tabea Stocker zu und teilte ihr mit einem Kopfnicken mit, dass dies der Zeuge sei, den sie vernehmen sollte. Tabea Stocker ging auf den Frühaufsteher zu.
„Grüezi, ich bin Oberleutnant Stocker, zuständig für den Fall des Toten, dessen Auto heute Morgen aufgrund Ihres Anrufs am Lorze-Ufer gefunden wurde. Kommen Sie bitte mit. Wir gehen in den Besprechungsraum. Möchten Sie einen Kaffee?“
Noch bevor der Mann antworten konnte, ging Stocker bereits los. Zu Beat Iten sagte sie noch im Vorbeigehen:
„Mach'sch uns zwei Kaffi, bitte?“
Iten nickte und ging zu seinem Schreibtisch, um Jacke und Autoschlüssel abzulegen. Normalerweise machte seine Kollegin Sylvia Odermatt die Bewirtung, obwohl sie sich immer wieder dagegen wehrte: Nur weil sie eine Frau sei, müsse sie noch lange nicht immer Kaffee für andere bringen. Sie liess sich dann aber doch immer wieder breitschlagen.
Im Besprechungsraum legte jetzt auch Tabea Stocker Daunenjacke, Mütze und Handschuhe ab, wies dem Frühaufsteher einen Stuhl zu und setzte sich ihm gegenüber. Sie holte ihr Handy aus der Tasche und legte es auf den Tisch.
„Sind Sie einverstanden, wenn wir Ihre Aussage aufnehmen? Es macht es einfacher.“
Als der Mann zustimmend nickte, stellte Stocker das Handy auf Aufnahme und begann die Befragung.
„Sie heissen?“, fragte sie und blickte dem Mann ins Gesicht.
„Toni Rössler.“
„Und Sie wohnen wo?“
„Ich wohne in Menzingen, Staldenstrasse 5.“
„Und Sie waren auf dem Weg zur Arbeit? Wo arbeiten Sie?“
„Ja, ich arbeite beim Werkhof in Zug. Wir fangen um halb sechs an. Deshalb war ich so früh schon unterwegs.“
„Gut, dann erzählen Sie bitte, was genau Sie heute morgen gesehen haben.“
Beat Iten trat ein und stellte zwei Tassen Kaffee, etwas Rahm und Zucker auf den Tisch. Stocker nickte kurz ein Dankeschön.
„Wie, gesagt, ich kam aus Menzingen. Da konnte ich schon von oben, bevor ich auf die Kantonsstrasse abbog, sehen, dass da ein Auto bei der Lorzentobelbrücke rechts ganz dicht am Abhang parkiert stand. Das ist sehr ungewöhnlich und verboten. Da hat ein Auto nichts verloren.“
„Sie sind ja da vom Fach, Herr Rössler. Das war ein Glücksfall für uns. Ein anderer hätte das wahrscheinlich gar nicht gemeldet. Und was haben Sie dann gemacht?“
„Ich bin dann runter an die Stelle gefahren und habe mir das genauer angeschaut. So, wie es da stand, wurde das Auto wohl von der Kantonsstrasse aus direkt vor der Brücke auf ein Wiesengrundstück gefahren und kurz vor dem Abgrund angehalten.“
„Sie sind also nicht bis zum dem Wagen vorgegangen?“
„Nein,“ bestätigte Rössler. „Ich habe nur von Weitem in den Wagen rein geleuchtet und keine Insassen gesehen. Es liegt ja auch ziemlich viel Schnee dort. Ich wollte nicht mit nassen Schuhen und Socken zur Arbeit“, fügte er erklärend hinzu.
„Und sonst? Sind Ihnen irgendwelche Personen in der Nähe aufgefallen?“
„Nein, es war alles noch sehr ruhig und nur wenige Fahrzeuge unterwegs.“
„Sehr gut, Herr Rössler. Vielen Dank. Wenn Sie sich noch kurz gedulden könnten. Mein Kollege muss Ihre Aussage noch schriftlich festhalten.
Diese müssten Sie dann noch unterschreiben.“
„Na, hoffentlich tippt Ihr Kollege schnell. Ich habe schon jetzt sehr viel Zeit verloren. Die warten auf mich bei der Arbeit“, erwiderte Rössler genervt.
Tabea Stocker klopfte an die gläserne Bürotür von Hauptmann Rogenmoser.
„Komm rein“, erlaubte der Hauptmann Stocker den Zugang zu seinem Allerheiligsten.
„Du bist ja schon sehr früh bei der Arbeit, alle Achtung“, begrüsste Stocker ihren Chef grinsend und setzte sich ihm gegenüber auf einen der beiden Stühle.
„Ich musste ja meinen Oberleutnant aus den Federn holen“, grinste der zurück. „Und, was hast du bisher rausgekriegt?“
Stocker erstattete Bericht.
„Frederic Lüthy.“ Nikolas Rogenmoser fasste sich ans Kinn. „Sagt mir was. Aber ich komm nicht drauf. Auf jeden Fall kein Unbekannter.“
„Ich werde als Erstes etwas über den Toten herausfinden. Wir haben ja seine Papiere und sein Handy. Dürfte also nicht so schwierig werden.“
Stocker stand auf.
„Warte mal, Tabea. Ich möchte heute Nachmittag eine Besprechung anberaumen. Bis dahin werden Vivianne, Lukas und die IT-Forensik wohl schon einige Ergebnisse vorliegen haben. Da kannst du dann auch gleich deine Informationen über den Toten mitteilen und wir werden das weitere Vorgehen besprechen.“ Was Rogenmoser mit „besprechen“ meinte, konnte sich Tabea Stocker schon vorstellen. Er würde sagen, wie es weiterging und wer was zu tun hatte. Das hatte sich allerdings nicht immer als zielführend erwiesen, aber er war ja schliesslich der Chef. Abwarten.
Kapitel 4
Tabea Stocker sass im Polizeidienstwagen und schaute auf die Uhr. „Puh, scho bald halbi achti“, dachte sie laut und startete den Motor. Das Haus von Frederic Lüthy in der Fadenstrasse lag im unteren Wohnbereich des Zugerbergs. Immer mehr von den älteren Giebeldachhäusern waren grossen Betonkästen gewichen, die den Garten durch eine grossflächige Terrasse ersetzten. Auf der Bergseite passierte man Garageneinfahrten, die an einen Tunneleingang erinnerten. Aber etwas Charme war doch noch erhalten geblieben. Erstaunlicherweise war Lüthys Haus eines der älteren Häuser, das im Stil eines Chalets erbaut worden war. Tabea Stocker näherte sich der Eingangstür. Auf dem Klingelschild waren nur die Initialen F. L. zu lesen.
Sie klingelte. Keine Antwort. Sie klingelte nochmal. Nichts rührte sich im Inneren des Hauses.
„Der Herr Lüthy isch nöd da. Wenn's Auto nöd dastaht, isch er nöd dihei“, klang es vom Nachbargrundstück.
Erst bei genauerem Hinsehen konnte Stocker einen älteren Mann hinter einem Gebüsch erkennen.
„Guete Morge, ich bin Oberleutnant Stocker. Wohnt der Herr Lüthy alleine hier?“
„Ja, scho“, antwortete die Stimme aus dem Busch.
„Darf ich mal zu Ihnen herüberkommen?“
Als der Mann zustimmte, verliess Stocker das Grundstück von Lüthy und ging zu dem Nachbarn. Der zum Nachbargrundstück gehörende abschüssige Garten war jetzt im Winter von Schnee bedeckt. Der Mann war schon älter und stand nur im Pyjama und einem Morgenmantel gekleidet in einem Beet.
„Ist Ihnen nicht kalt?“, wollte Stocker besorgt wissen.
„Scho, aber ich muess doch das Büsi finde. Es isch hüt
Nacht nöd hei cho.“
Stocker tat der Mann leid.
„Chömmet Sie, mir gönd ine.“ Sie nahm den Mann am Arm und führte ihn zurück ins Haus.
Am Klingelschild konnte Stocker den Namen „Döbeli“ lesen. Auch dieser Mann schien hier alleine zu leben, was aber wohl nicht immer so gewesen war, wie Familienfotos an den Wänden und auf einem Regal erkennen liessen. Er schlurfte direkt in die Küche und kam kurz darauf mit einem Tablett, auf dem zwei Tassen Kaffee und zwei Gipfeli platziert waren, zurück ins Wohnzimmer. Stocker hatte sich bereits an den Esstisch gesetzt und bewunderte die Aussicht über Stadt und See.
„Schön händ Sie's da,“ lobte Stocker Döbelis Zuhause.
„Ja, scho, aber langsam wird's mir z'mühsam.“ Er stellte das Tablett auf den Tisch.
„Merci, vielmals.“ Fast gierig griff Stocker nach einem Gipfeli. Sie brauchte dringend etwas in den Magen.
Als Döbeli sich endlich gesetzt hatte, begann Stocker die Unterhaltung mit der schlimmen Nachricht.
„Also, Herr Döbeli, ich bin hier, weil wir den Herrn Lüthy heute früh tot aufgefunden haben.
Jetzt müssen wir natürlich herausfinden, was geschehen ist. Vielleicht könnten Sie mir ja dabei behilflich sein.“
„Oj je, oh je, das isch ja schrecklich“, antwortete Herr Döbeli entsetzt. “Er isch ja noch so jung gsi.
Was isch ihm denn passiert?“
„Das wissen wir noch nicht genau. Kannten Sie Herrn Lüthy gut?“
„Gut würde ich nicht sagen. Er ist so vor acht Jahren in das Haus seiner Eltern eingezogen, also in das Chalet nebenan. Seine Eltern sind irgendwo nach Südamerika ausgewandert. Er hat hier eine Arbeit gefunden, aber was genau, kann ich nicht sagen. Er hat mir mal was von Kunstobjekten erzählt. Na ja, in der Kunst ist ja alles möglich. Ich kenn mich da nicht aus.“ Döbeli schüttelte den Kopf.
Stocker holte ein Blöckchen und einen Stift aus ihrer Tasche und begann zu notieren.
„Hatte er denn manchmal Besuch? Ich meine regelmässig?“
„Ja, er hatte öfters Besuch. Am meisten ist mir eine Frau aufgefallen, die kam allein und relativ häufig.“
„Können Sie mir die Frau beschreiben?“
„Ich würde sagen, sie ist zwischen 40 und 50 Jahre alt, blond, elegant. Sie kam meistens mit einem schwarzen Mini. Den hat sie dann direkt in seiner Einfahrt parkiert. Ob das seine Freundin war, kann ich nicht sagen. Ich habe ihn nicht gefragt. Ist ja auch zu persönlich. Ich will nicht aufdringlich wirken, verstehen Sie? Aber sie müssen schon sehr vertraut gewesen sein. Sie hatte einen Schlüssel zu seiner Wohnung. Blumen giessen, wenn er mal länger weg war, nahm ich an. Sie ging nur mit dem Schlüssel rein, wenn er weg war. Sonst hat sie geklingelt. Das ist mir aufgefallen. Also, wahrscheinlich nicht seine Freundin.“
Tabea nickte. Der alte Herr hatte eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe.
„Ist Ihnen sonst etwas aufgefallen? Hat sich Herr Lüthy irgendwie anders verhalten? Kam er Ihnen angespannt vor oder krank?“
„Krank? Nein, der war nicht krank. Ich habe auch in letzter Zeit nicht gross mit ihm gesprochen.
Also, anders? Kann ich nicht sagen. Nur dass sein Auto heute Morgen nicht da war, das habe ich bemerkt, aber das passiert ja öfter mal.“
Tabea nickte wieder und leerte ihre Kaffeetasse.
„Ja, dann danke, Herr Döbeli. Das hat mir schon einmal weitergeholfen. Können Sie heute oder morgen in unserer Dienststelle An der Aa vorbeikommen und Ihre Aussage zu Protokoll geben?“
Döbeli schaute erschrocken auf.
„Ja, ist das denn ein Verhör gewesen? So richtig offiziell? Ja, wenn es denn sein muss, dann komme ich morgen vorbei. Da kommt meine Tochter und wir gehen dann immer in die Stadt. Sie kann mich begleiten.“
„Ja, das ist eine gute Idee. Dann sehen wir uns morgen. Ich muss jetzt wieder los. Ach, und dass Sie sich nicht wundern: Unter diesen Umständen müssen wir das Haus von Herrn Lüthy untersuchen. Es werden also heute noch Leute von uns kommen. Nur damit Sie informiert sind.“
Herr Döbeli nickte verständnisvoll mit dem Kopf, stand auf und begleitete Tabea Stocker zur Tür.
Sobald Stocker im Dienstwagen sass, kramte sie ihr Handy aus der Handtasche und tippte die Nummer der Spurensicherung ein. Sie bat Lukas Möhlin, eine Hausdurchsuchung bei Lüthy zu organisieren. Dann fuhr sie zurück zur Dienststelle.
Mittlerweile war auch Sylvia Odermatt eingetroffen. Stocker informierte sie darüber, dass morgen der Herr Döbeli für eine Aussage kommen würde und bat sie, seine Aussage aufzunehmen. Dann machte sie sich auf in die Pathologie, wo Vivianne Betschart über ein Mikroskop gebeugt war.
„Hoi, Vivianne“, begrüsste sie die Kollegin. Diese schaute, immer noch missmutig, auf.
„Es tut mir leid, dass ich heute Morgen so garstig war. So früh bin ich halt nicht gut drauf.“ Stocker schaute schuldbewusst und in der Hoffnung auf Vergebung.
„Kann ich dich zum Lunch einladen?“
„Hoi. Ja, mir ging es auch nicht viel besser. So früh und so kalt. Das mag ich auch nicht. Einen Lunch mag ich hingegen schon. Wo willst du hingehen?“
Das ging ja schnell mit der Vergebung, dachte sich Stocker und überlegte sich etwas Preiswerteres, als sie zunächst geplant hatte.
„Freiruum? Da brauchen wir nicht lange in der Kälte rumlaufen.“
„Street Food Häppchen? – da kommst du ja billig davon, aber von mir aus. Wann?“
„Gleich um halb zwölf? Ich muss mich nämlich noch für die Sitzung um zwei vorbereiten. Bist du auch schon informiert?“
„Ja, klar. Und wir haben wahrscheinlich auch eine interessante Entdeckung gemacht.“
„Ja, wirklich? Erzähl!“, forderte Stocker ihre Kollegin interessiert auf.
„Erst um zwei, sonst ist es ja keine Neuigkeit mehr.“
„Oh, du bist aber gemein.“ Stocker war inzwischen bis zur aufgebahrten Leiche von Frederic Lüthy gegangen und betrachtete den Toten aufmerksam.
„Da wirst du nichts Neues sehen, gib dir keine Mühe.“ Vivianne Betschart grinste.
„Na gut, dann warte ich eben bis nachher,“ antwortete Stocker resigniert. „Wir treffen uns um halb zwölf in der Eingangshalle.“
Als sie zurück in ihrer Abteilung war, wurde sie von Hauptmann Rogenmoser abgefangen und in sein Büro dirigiert.
„Nachdem du mir den Namen des Toten gesagt hast“, begann er, „hab ich mir mein Hirn zermartert und dann kam's mir: Der Frederic Lüthy hat irgendwas mit dem Kunsthaus zu tun. Oder mit der Stiftung der Freunde Kunsthaus Zug. Wir haben mal bei so einem Kollegentreffen das Kunsthaus besucht und dieser Lüthy hat die Führung gemacht.“ Rogenmoser schaute Tabea Stocker stolz an.
„Kunst,“, antwortete Stocker. „Das passt! Das habe ich vorhin von Lüthys Nachbar auch gehört.
Soll ich mal im Kunsthaus nachfragen oder willst du das tun?“
„Mach du das nur,“ meinte Rogenmoser. „Du hast da ja den Lead.“
Stocker schaute ihn fragend an.
„Ich will, dass alles in deiner Hand bleibt“, fügte er erklärend hinzu. „Und ausserdem muss ich noch zu einer Sitzung.“
Stocker konnte sich schon vorstellen, dass er damit ein etwas längeres Mittagessen meinte, aber ihr sollte es recht sein.
Nachdem sie zusammen mit Beat Iten alle bisher bekannten Fakten zusammengesammelt und auf einer Ermittlungstafel angeordnet hatte, fand sie, dass es jetzt auch für sie Zeit für ein Mittagessen wäre. Sie schaute auf die Uhr. Es war schon zwanzig nach elf. Zehn Minuten später wartete sie in der Eingangshalle auf Vivianne Betschart. Es dauerte eine Viertelstunde, bevor Betschart endlich auftauchte.
„Macht der Fall so viel Arbeit, dass du dich verspäten musst?“, fragte Stocker leicht angesäuert.
„In der Tat, meine Liebe. Wir haben noch Spuren aus dem Auto ausgewertet und bis alles festgehalten und geordnet ist, dauert das eben. Und wir sind noch nicht fertig.“
„Hat dich Moritz schon von der Hausdurchsuchung bei Lüthy unterrichtet?“ Vivianne Betschart zog sich eine Mütze auf den Kopf und nickte dann.
„Und wann soll es losgehen?“, wollte Stocker wissen.
„Heute Nachmittag, gleich nach dem Meeting.“
Mittlerweile waren die beiden auf den Vorhof getreten. Ein eiskalter Wind liess sie die Mützen tiefer in die Stirn und den Schal bis über die Nase ziehen. Schnell gingen sie die Strasse hinunter und über den Kreisverkehr zum Freiruum.
„Wow, das ist ja schaurig kalt heute.“ Stocker stellte ihr Essenstablett auf einen der Tische und setzte sich.
„Allerdings“, bestätigte diese. „Sag mal, hat der Andreja schon mit seinem Skilehrer-Job angefangen?“
„Mhm. Schon seit Anfang November. Aber es ist noch nicht viel los auf dem Stoos.“
Beide lachten über den zufälligen Reim.
„Na, da hat er ja noch ein wenig mehr Zeit für seine Kunst.“ spekulierte Betschart.
„Ja, schon, aber irgendwoher muss ja auch das Geld kommen.“
Vivianne Betschart nickte verständnisvoll. Mit einem Künstler liiert zu sein hat Vor- und Nachteile.
Da Tabea Stocker wusste, dass ihre Kollegin noch keine Informationen über Ergebnisse preisgeben wollte, assen sie beide zunächst schweigend ihre unterschiedlichen Speisen. Während Vivianne ein Sakura-Ramen vor sich hatte, war Tabea Stocker am Burgerstand fündig geworden.
„Ein paar mehr Röstzwiebeln hätten sie mir schon noch auf den Teller machen können“, beschwerte sich Tabea Stocker nach einer Weile.
„Was bist du denn heute so negativ, Tabea?“
„Zu früh aufgestanden, zu kalt, einen Toten und keine Spuren und jetzt krieg ich auch noch meine Tage. Das macht mir keine gute Laune. Sorry.“
„Ja, ja, verstehe. Was habt ihr denn bis jetzt?“
„Das einzige, was ich herausgefunden habe, ist, dass Frederic Lüthy was mit dem Kunsthaus zu tun hat. Das ist immerhin ein Ansatzpunkt. Ich werde da heute mal vorbeigehen.“
„Wie? Vorbeigehen? Heute ist Montag, da wirst du keinen antreffen. Da ist das Kunsthaus geschlossen.“
„Oha, lätz! Das habe ich ganz vergessen. Na, dann hoffe ich, wir finden bei der Hausdurchsuchung mehr Brauchbares. Wie geht es denn Mathias? Wir sollten mal wieder was zusammen unternehmen, was meinst du?“
„Ja, gern, das machen wir. Im Moment ist er beruflich in Genf, aber ich red mit ihm, wenn er zurück ist.“
„Mach das“, erwiderte Stocker lakonisch.
Kapitel 5
Um zwei Uhr nachmittags hatten sich schon alle Teilnehmer an dem von Hauptmann Rogenmoser angesetzten Meeting im Besprechungsraum der Dienststelle eingefunden. Alle - ausser Nikolas Rogenmoser.
Vivianne Betschart und Lukas Möhlin von der Forensik hefteten noch einige Informationen an die Tafel, die Iten im Zimmer aufgestellt hatte, Rudi von der Bereitschaftspolizei hatte sich schon an den Besprechungstisch gesetzt und schlürfte hörbar einen Kaffee, Sylvia Odermatt, Beat Iten und Tabea Stocker standen bei der Türe und tuschelten über den Verbleib ihres Chefs.
„Sicher hat er wieder z'viel Zmittag bestellt“, meinte Sylvia Odermatt und hob die Augenbrauen.
„Vielleicht ist ja auch sein schickes Auto stehengeblieben“, werweiste Beat Iten.
„Ich glaub eher, er lässt uns extra warten. Da mit zeigt er uns seine Autorität. Ihn kann ja keiner anscheissen.“
Die Stocker musste mal wieder psychologisieren.
Ihre Kollegen dachten sich jedoch ihren Teil, da Stockers Pünktlichkeit auch oft zu wünschen übrig liess.
Schliesslich setzten auch sie sich an den Tisch, gefolgt von Betschart und Möhlin. Um Viertel nach zwei trat der Hauptmann ein.
„Guten Tag, zusammen. Es tut mir leid, dass ich mich verspätet habe, aber dafür hab ich im fallinteressante Informationen mitgebracht“, begann Rogenmoser mit dem Meeting noch bevor er seinen Mantel auf dem freien Stuhl neben sich ablegte.
„Fangen wir doch von vorne an: Rudi, ihr habt doch den Anruf von Herrn Rössler entgegengenommen. Was genau hat er gesagt, und was habt ihr unternommen?“
Rudi legte beide Unterarme auf die Tischplatte und schaute in die Runde.
„Es war zwanzig vor fünf am Morgen. Ein Mann, also Herr Rössler, meldete, dass ein Fahrzeug verdächtig nahe am Abgrund bei der Lorzentobelbrücke parkiert