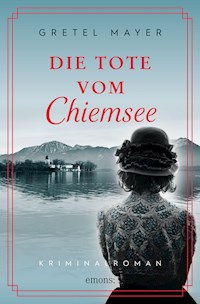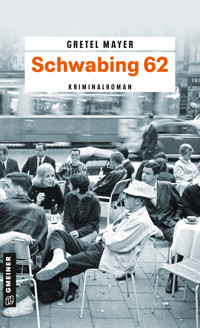Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
München und Oberbayern, Kindheits- und Lebenserinnerungen sowie einige bekannte Künstlerpersönlichkeiten, die stark mit dem bayerischen Raum verbunden sind, spielen in Gretel Mayers Erzählungen und Gedichten eine große Rolle. Alle Texte dieses Buches sind in den letzten beiden Jahren entstanden.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Kindheitskastanien
Sommermadl
Das Blau
Alpenblick
Die japanische Begegnung
Ende und Anfang, Anfang und Ende
So sagt uns Paul
Maikäfersiedlung
Frau Gegenfurtner
Chiemseekind
Nichts für ungut
Im Netz
Besser tot in Rom als halbtot in München
Meritatons Fuß
1968
Damals
Molto tempo fa – Vor langer Zeit
Wir Vernünftigen
The times they are a changin’
Dein weicher weißer Arm
Sakura (Kirschblüte)
Was sollen Worte?
Die Morgenröte
Klage
Die Erbgläser
Kindheitskastanien
In nicht zu ferner Zeit
werde ich sie
im Körbchen meiner
rollenden Gehhilfe
mühsam schleppenden
Schrittes vor mir
herschieben ….
die Kastanien meiner Kindheit,
den angstvollen Blick meiner Mutter,
das glitzernde Blau des Chiemsees,
die nichtgelebten Träume,
das Bild des fernen Vaters,
die Zärtlichkeit der Liebesnächte,
die Zufriedenheit und das Aufbegehren,
das Glück der Zweisamkeit,
die Tränen des Abschieds,
die Sehnsucht nach der Stadt im Süden,
den Stolz auf die Texte der späten Jahre,
die Angst vor dem Ende,
das Lärmen und Lachen
der Enkel.
All diese Stücke meines Lebens
und noch viele mehr
werde ich schwer atmend
dahinrollen, bis mein
letzter Atemzug sie leicht macht
und sie mit sich nimmt
in gnädige Bedeutungslosigkeit.
Ich danke
meinem Mann Franz für sein stetiges geduldiges Zuhören, seine verständnisvolle, aber auch äußerst kritische Begleitung meiner Texte, seinen Rat bei historischen Details und für seinen großen und zeitaufwändigen Einsatz bei den Korrekturen.
meinen Freundinnen Johanna und Sigrit für ihre Unterstützung und Ermutigung und meiner Hannoveraner Schreibfreundin Adelheid für ihre Geduld und ihre wiederholten Energieschübe.
meinem langjährigen Lehrer für Kreatives Schreiben, Reinhold Ziegler, für seine fundierte Kritik und seine zahlreichen Impulse und Ratschläge.
allen Kreativschreiben-Freunden im Raum Aschaffenburg, in München und an den verschiedensten Orten des Landes. Schön, dass es euch alle gibt!
Annika Ollmann von Books on Demand, die mich mit hanseatischer Fröhlichkeit äußerst kompetent durch mein Projekt begleitet hat.
Meine Erzählungen sind der Phantasie entsprungen und stellen nie in ihrer Gesamtheit wahre Begebenheiten dar. Lediglich verschiedene Personennamen, Schauplätze und vereinzelte Geschehnisse aus meinen Lebenserinnerungen sind in die Texte eingewoben.
Gretel Mayer, im April 2015
Sommermadl
»Du musst für ein paar Wochen nüber zur Kreszenz, die schafft des nimmer allein«, sagte die Mutter am Sonntagabend zu Maria, »pack dei Sach zamm, der Vater fahrt di morgen in der Früh.« Kreszenz war Marias ältere Schwester, die mit ihren fünfundzwanzig Jahren schon vier Kinder hatte. Vor drei Wochen war das vierte, der Xaverl, geboren worden und die Wöchnerin erholte sich diesmal nicht so schnell wie bei den letzten Geburten. Kreszenzs Mann Anton war ein wortkarger, tüchtiger Landwirt, der jedoch mit der Versorgung von drei Kleinkindern heillos überfordert war und es zudem nicht als seine Aufgabe sah, neben Feld und Stall sich auch noch um die Bälger zu kümmern.
Maria wusste, dass die nächsten Wochen viel Arbeit bringen würden, doch sie freute sich auf die ältere Schwester, auf die lebhaften Kinder, vor allem natürlich auf den Neugeborenen und sie war froh, den gestrengen, bitteren Augen der Mutter für einige Zeit entfliehen zu können. Ihre Sachen waren schnell gepackt; ein wenig zögerte sie, ob sie das Sonntagsdirndl mitnehmen sollte oder nicht, entschied sich dann doch dafür. Zuletzt legte sie das kleine zerschlissene Bändchen Gedichte von einem R.M. Rilke dazu, das ein Sommergast im letzten Jahr vergessen hatte und in dem sie immer wieder abends vor dem Einschlafen las. Sie verstand nur wenig von diesen Reimen und doch ging ein so starker Reiz von ihnen aus, dass sie diese ein ums andere mal wieder las und nicht satt davon wurde. Bis jetzt hatte sie das Büchlein vor der Mutter in der untersten Kommodenschublade verstecken können, denn sie wusste genau, was die Mutter dazu sagen würde: »Du sollst schlafen am Abend und ned so verrückts Zeugs lesen; in der Früh mußt zeitig raus!«
So war es auch am nächsten Tag; schon im Morgengrauen hatte der Vater angespannt und so fuhren sie nun durch den noch kühlen Frühsommermorgen hinüber nach Münsing. In den Waldlichtungen lag noch der Morgennebel, in der Ferne glitzerte ab und an der See durch die Bäume. Während der Fahrt wurden keine Worte gewechselt, so war es halt mit dem Vater, und als sie am Hof von Anton und Kreszenz ankamen, stellte er ihr Gepäck ab, sagte: »Pfiadi, i hol di dann in drei Wocha« und schwang sich wieder auf sein Fuhrwerk. Es kam ihm nicht in den Sinn, nach seiner älteren Tochter und den Kindern zu schauen, das war Frauensache und daheim wartete die Arbeit.
Maria ging auf das Haus ihrer Schwester zu, im Bauerngarten davor blühten die ersten Sommerblumen und die Johannisbeeren begannen bereits zu reifen. Im Haus hörte sie Kinderstimmen und das Weinen des Neugeborenen. Sie beschleunigte ihre Schritte und hatte fast schon die Haustür erreicht, als sie auf der Bank vor dem Austragshäusl – darin hatten Antons Eltern bis zu ihrem Tod gewohnt – einen Mann sitzen sah. Er trug ein zerschlissenes Unterhemd, eine abgewetzte Lederhose und war barfuss. Auf dem wackligen Tisch vor ihm lag ein Block, in den er mit raschen Bewegungen etwas skizzierte. Auch er hatte sie nun erblickt, stand auf und kam mit etwas linkischen Bewegungen auf sie zu. »Ich bin der Georg, ich wohn für ein paar Wochen hier im Häusl, die Kreszenz hats mir vermietet.« Seine blauen Augen musterten sie aufmerksam und prüfend durch die Nickelbrille. In diesem Augenblick öffnete sich die Türe und Kreszenzs Älteste, die fünfjährige Lisi sprang heraus. »Marie, Marie, wenn du die Wäsch gwaschen hast, derfst mit uns spielen, hat die Mutta gsagt.« Sie deutete auf Georg: »Der malt ganz bunte Bildln, der Schorschi, und sei Freund, der am Freitag kommt, is a Roter, hat der Vatta gsagt.«
Maria folgte der Kleinen ins Haus, begrüßte ihre Schwester, die blass und gekrümmt vor dem Herd stand, und sah gleich, wie nötig ihre Hilfe war. Den ganzen Tag verbrachte sie damit, die Wäsche zu waschen und im Garten hinter dem Haus aufzuhängen. Aus den Augenwinkeln sah sie immer wieder den Maler, der mittlerweile eine Staffelei aufgestellt hatte und auf seiner Palette Farben mischte. Die zwei größeren Kinder ihrer Schwester sprangen ab und zu zu ihm hin, betrachteten das Bild auf der Staffelei und durften ihre Finger in die Farbe stecken. Zu gerne hätte sie auch geschaut, doch sie wagte es nicht. Gegen Abend kam Anton von der Feldarbeit nachhause, begrüßte sie freundlich, aber einsilbig und warf einen abschätzigen Blick hinüber zum Maler vor dem Austragshäusl. So verwunderte es sie umso mehr, dass Georg auch am Abendessen teilnahm. Er war sehr zurückhaltend, nahm sich nur bescheiden von den angebotenen Kartoffeln und zwinkerte den Kindern zwischendurch zu. »Ich hab ihms Häusl mit Kost für den Sommer vermietet, aber er braucht fast nix«, erzählte ihre Schwester später, »sei Frau ist vor einem Jahr im Kindbett gestorben; er woant jede Nacht, man kanns oft hören. Am Wochenend kommt imma sei Freind aus München, der Oskar, da geht’s dann hoch her. Der is a Künstler und a Roter. Der Anton mogn ned.«
Die nächsten Tage vergingen mit Putzen, Waschen, Kochen und Gartenarbeit, die Schwester war dankbar für jede Stunde, in der sie sich etwas hinlegen konnte und die Kinder freuten sich, dass Marie zwischendurch noch die Zeit fand mit ihnen zu spielen. Der Sommer kam mit aller Macht und Marie stahl sich zweimal am Abend davon, um im See zu baden. Sie war stolz darauf schwimmen zu können, kein Bauernmadl in ihrer Umgebung konnte das; ihr Bruder Fritzl, der in den letzten Kriegstagen gefallen war, hatte es ihr beigebracht. Jedes Mal, wenn sie in das sanfte Nass des Starnberger Sees eintauchte, musste sie an ihn denken, an seine Fröhlichkeit, seine Unbekümmertheit, seine Späße. Seit er tot war, hatte die Mutter nicht mehr gelacht und der Vater ging noch öfter als früher ins Wirtshaus. Als Marie einmal bei schon einsetzender Dämmerung wieder zurück zum Hof ging, traf sie auf Georg, der auf der Bank unter dem Wegkreuz saß. Zuerst bemerkte er sie kaum, er hielt etwas in der Hand und blickte starr darauf. Beim Nähertreten erkannte sie, dass eine Fotografie war. »Meine Maria, sie ist tot.« sagte er und streckte ihr das Bild entgegen. Es zeigte eine schöne dunkelhaarige Frau, die versonnen in die Kamera blickte. Maria wusste nicht, was sie sagen sollte, doch sie setzte sich neben ihn. Die Nacht brach herein, ohne dass sie viele Worte gewechselt hatten und schließlich gingen sie gemeinsam zurück zum Hof.
Am Freitagmorgen waren die beiden älteren Kinder schon ganz aufgeregt. »Heute kommt der Oskar, der macht immer vui Späß und er hat a Motorradl, da derf ma mitfahrn.« Kreszenz hatte Maria erzählt, dass der Oskar hier aus der Gegend stammte, eigentlich ein Bäcker war, aber jetzt in München Bücher schrieb und ein Theater leitete. Außerdem war er ein Roter, der aufrührerische Sachen schrieb, der im Krieg nur kurz gedient hatte und stattdessen im Irrenhaus gewesen war. Mit dem Georg war er schon lang befreundet, sie waren zusammen durch die Welt gezogen und hatten einige Zeit in einer Gruppe sonderbarer Menschen gelebt, die nackt herumliefen und nur rohes Gemüse aßen.
Maria war schon sehr gespannt auf diesen Oskar, doch fürchtete sie sich auch ein wenig. So ein Gebildeter, der Bücher schrieb und nicht den Heldentod wie der Fritzl hatte sterben wollen, sondern gegen den Krieg gewesen war, so einer würde sie, ein achtzehnjähriges Bauernmadl, das noch nie in München gewesen war, wahrscheinlich gar nicht wahrnehmen. Als dann nachmittags das laute Knattern des Motorrads ertönte und die Kinder nach draußen stürzten, blieb sie in der Kuchl und blickte hinter dem Vorhang verborgen durchs Fenster. Der Georg und die Kinder begrüßten einen stämmigen, ziemlich grobschlächtigen Kerl in abgewetzten Lederhosen, der, nachdem er den Georg derb, aber liebevoll umarmt hatte, die Kinder sofort auf sein Motorrad sitzen ließ und sie durch den Vorgarten schob. Seine Stimme und sein Lachen waren laut und dröhnend und eh sie sich versah, stand er schon in der Küche vor ihr. »Die Schwester von der Kreszenz, ich habs schon ghört«, sagte er, machte einen angedeuteten Diener und beugte sich über ihre Hand. Maria spürte, wie ihre Wangen heiß wurden. Sie hatte einen Krug Bier, einen Kanten Brot und ein wenig Speck auf den Tisch gestellt und wollte sich zurückziehen. Doch Oskar ergriff einfach ihre Hand, rückte ihr einen Stuhl zurecht und sagte mit warmer Stimme: »Bleib doch da, Marie!« Von der nachfolgenden Unterhaltung verstand sie nicht alles, doch sie erfuhr, dass auch der Georg einmal Bäcker, ja Zuckerbäcker, gelernt hatte, dass der Oskar als Bub schon in der Bäckerei zuerst seines Vaters und dann seines cholerischen Bruders hatte arbeiten müssen und wegen dieses Bruders und der verhassten Arbeit nach München geflohen war. Sie erfuhr auch, dass sich der Georg sehr schwer tat, auch nur eins seiner Bilder zu verkaufen und dass der Oskar im vergangenen Jahr nach der Revolution in München kurz im Gefängnis gewesen war. Der Rilke hatte sich dafür eingesetzt, dass er wieder frei kam. Da horchte Maria auf, das war doch ihr Rilke, der, den sie jeden Abend las. Doch sie wagte nicht, davon zu erzählen. Nach einer guten Stunde brachen die Männer auf. »A kurzer Fußmarsch und a lange Einkehr«, sagte der Oskar lachend und verbeugte sich noch einmal vor ihr. Spät nachts hörte sie die beiden zurückkommen; sie spähte aus dem Fenster und sah sie durch die Vorgartenbeete und an den Johannisbeersträuchern vorbei torkeln, so wie der Vater eben, wenn er am Sonntag aus dem Wirtshaus kam.
So wunderte es sie nicht, dass die beiden am nächsten Tag erst gegen Mittag vor dem Häusl saßen. Der Georg war recht bleich und hob nur schwach die Hand zum Gruß, als sie den beiden Malzkaffee und Semmeln brachte. Der Oskar jedoch war schon wieder voller Tatendrang. »Heut Nachmittag mach ma a Ruderpartie, Marie, kommst mit?« Marie zögerte, die viele Arbeit, die Wäsche musste noch abgenommen werden und Marmelade wollte sie auch noch einkochen, doch Kreszenz, die hinzugekommen war, sagte nur: »Geh mit, Marie, des schaff i a allein.« So stand Marie vor dem fleckigen Spiegel ihrer Kammer, flocht ihr dunkles Haar, das sie sonst immer zum Kranz hochgesteckt trug, zu zwei dicken Zöpfen, die ihr voll über die Schultern fielen, und zog ihre weiße Leinenbluse und den blaugestöckelten Rock an. Kurz entschlossen legte sie noch das kleine Ketterl mit den Granatsteinen um ihren sommergebräunten Hals.
Die beiden Männer warteten bereits auf sie; Georg hatte einen ausgefransten breitkrempigen Sonnenhut auf und seinen Skizzenblock unterm Arm; Oskar trug tatsächlich seinen Trachtenhut mit Gamsbart. So wanderten sie in der Nachmittagshitze hinunter zum See; Kreszenz hatte ihnen einen Korb mit Getränken, Brot und Wurst mitgegeben. Georg nahm etwas gedankenverloren und abwesend am Bug des Kahns Platz und zückte sofort seinen Skizzenblock. Offensichtlich wollte er keine großen Gespräche und mit sich alleine sein, Oskar hingegen half Marie galant auf die Heckbank und setzte sich ganz selbstverständlich an die Ruder. Zügig und kraftvoll ruderte er und nachdem sie sich schnell ein Stück vom Ufer entfernt hatten, drehte er in südliche Richtung und sie fuhren ein gutes Stück die Seeleitn entlang. In der Ferne konnte man im Sommerdunst die Berge erahnen und auf dem See waren etliche Kähne und Segelboote, zumeist mit Sommerfrischlern, unterwegs. Weit draußen in Seemitte tuckerte der Raddampfer »Luitpold« dahin und vom Ufer hörte man das Geschrei badender Kinder.
Kurz vor Leoni steuerte Oskar das Ufer an. »Da is a schöns Platzl für die Brotzeit.« Er zog seine Schuhe aus und sprang ins seichte Wasser, um dann kraftvoll den Kahn an Land zu ziehen. Beim Aussteigen reichte er Marie die Hand, für einen kurzen Moment kam sie ihm ganz nahe und sie konnte seinen Atem an ihrem Hals spüren. Im Schatten alter Seeweiden nahmen sie Platz, Oskar scherzte und lachte und versuchte, auch Georg aus seiner Traurigkeit zu reißen, doch es gelang ihm nicht. Georg aß nur wenige Bissen und setzte sich dann, wieder vertieft in seinen Skizzenblock, in einiger Entfernung auf einen Stein. »Lass ma ihn gehn«, sagte Oskar und sie plauderten über das Sommerwetter, über die Kinder der Schwester und über die Johannisbeermarmelade, die Marie in den nächsten Tagen machen wollte. Marie fasste Mut: »Erzähl mir von dem Rilke, ich hab a Büchl von ihm, aber i versteh fast nix.« Oskar legte seine Hand ganz sacht auf ihre. »Da musst du nichts verstehen, des musst einfach fühlen«, sagte er. »Der Rilke selber ist ein schwieriger Mensch; er hat mir sehr geholfen, aber warm werden kann ich mit ihm nicht. Aber das Gedicht vom Panther hinter den Gitterstäben, das musst du lesen. Oft hab ich mich gefühlt wie der, so unfrei, so eingesperrt.«
Oskars Hand lag noch immer auf ihrer und Marie sagte: »Ja, das Gedicht kenn ich und sich so eingsperrt fühlen, das kenn ich auch. Aber was will man machen?« »Man soll des machen, was man will und was man kann.« antwortete Oskar und Marie erzählte ihm von den Träumen, die sie früher hatte; die Schule zu Ende zu machen und Krankenschwester oder Hebamme zu werden. Aber dann kam der Krieg, der Fritzl ist gefallen, die Kreszenz hat weggeheiratet und jede Arbeitskraft wurde gebraucht. Und außerdem sollte sie im nächsten Jahr den Ludwig vom Nachbarhof heiraten. »Damit as Sach zammkommt«, wie der Vater sagte. Oskar hob seine Hand und strich ganz sanft über ihre Wange. »Mach dein Weg, Marie. Du bist a starke und schöne Frau«.
Die Hitze war einer angenehmen Sommerabendwärme gewichen, als sie zurückruderten. Georg skizzierte noch immer, Oskar und Marie schwiegen und hingen ihren Gedanken nach. Als sie den Weg hinauf nach Münsing gingen, sagte Georg plötzlich: »Ich dank euch für den schönen Nachmittag, es war gut, nicht allein zu sein« und bog ab in Richtung Wegkreuz. So gingen Marie und Oskar alleine weiter, Oskar legte den Arm um Marie und kurz bevor sie in Sichtweite des Hauses kamen, zog er sie an sich und küsste sie zärtlich. Seine Lippen waren warm, sie schmeckten ein wenig nach Bier und Marie erwiderte seinen Kuss, ohne auch nur einen Gedanken an Unschicklichkeit oder gebotene Zurückhaltung zu verschwenden. Sie trennten sich und Oskar fragte abschließend: »Nächsten Samstag ist Tanz in Machtlfing. Gehst mit mir hin?« Marie sagte zu.
Die folgende Woche verging wieder mit viel Arbeit in Haus und Garten. Marie kochte wie versprochen das Johannisbeergelee, backte trotz der Sommerhitze Brot, putzte alle Fenster des Hauses, wusch Wäsche, besserte die Kleider der Kinder aus und stopfte Socken. Trotzdem fand sie noch die Zeit, zu ihrem Sonntagsdirndl eine neue Schürze zu nähen. Kreszenz hatte ihr den Stoff dazu überlassen, frisches, sommerblaues Leinen, das sehr schön zum dunklen Blau des Dirndls passte. Als sie am Freitagabend ihr Bad im See nahm, waren die üblichen Gedanken an Fritzl etwas verblasst und ihr Herz klopfte, wenn sie an Oskar und seine warmen Lippen dachte. Auf dem Rückweg vom See traf sie wieder auf Georg, der auf der Bank unter dem Wegkreuz saß. Er winkte ihr zu und ein leichtes Lächeln spielte um seine Lippen. Marie freute sich darüber und setzte sich zu ihm. »Gehst morgen mit nach Machtlfing zum Tanz?« fragte sie, doch Georg schüttelte den Kopf. »Das ist noch nichts für mich, da ists mir noch zu laut und zu lustig.«
Gegen Samstagmittag hörte Marie das Motorrad heranknattern und war etwas enttäuscht, dass Oskar nicht gleich bei ihr in der Kuchl auftauchte. Stattdessen verschwand er bei Georg im Häusl, und als sie im Garten Dillkraut holte, konnte sie die beiden durchs Fenster sehen. Sie saßen am Tisch, Oskar hatte einen Stoß Blätter vor sich liegen, las vor und Georg hörte ihm zu. Marie wurde plötzlich ein wenig weh ums Herz, womöglich hatte er ganz vergessen, dass er mit ihr zum Tanz gehen wollte. Doch am späten Nachmittag stand er plötzlich vor ihr, »Mach di fertig, du Schöne; in a Stund hol i di.« So trat sie eine Stunde später aus dem Haus, die neue Schürze über ihrem Sonntagsdirndl links gebunden, wie es sich für ein noch unverheiratetes Mädchen gehörte und Oskar überreichte ihr einen kleinen Strauß weißer Sommernelken, die er wohl am Gartenzaun gepflückt hatte. Marie machte noch einmal kehrt und steckte sich vor dem Spiegel in der Diele ein paar der Nelken in den Ausschnitt.
Sie saß hinter ihm auf dem Motorrad auf, er nahm ihre Arme und legte sie um seine Brust. »Halt di gut fest an mir«, sagte er und sie glaubte, sein Herzklopfen zu spüren, als sie ihn umschlang. Während der ganzen Fahrt durch den lauen Sommerabend wünschte sie, dass diese nie ein Ende nehmen sollte.
Als sie in Machtlfing ankamen, war es bereits dämmrig, die Musik hatte schon begonnen zu spielen und es roch nach Spanferkel, Bier und Würsten. Sie setzten sich an einen Tisch am Rande des Festplatzes, Oskar nahm neben ihr Platz, strich mit der Hand sanft über ihren Arm und zog sie an sich. Marie empfand plötzlich die Musik als viel zu laut, das Reden und Singen der Menschen um sie her dröhnte in ihren Ohren und sie wünschte sich mit Oskar auf die Bank am Wegkreuz, wo er sie in der Stille des Sommerabends mit seinen warmen Lippen ein ums andere Mal küssen würde.
Einige Tische weiter saß eine Gruppe junger Männer, alle in Lederhosen und weißen Hemden, die wohl schon einige Maß zu sich genommen hatten und durch besondere Lautstärke, grölenden Gesang und markige Sprüche auffielen. Wortfetzen wie »Judenbagage« und »Kommunistenschweine« drangen bis zu ihrem Tisch. »Das sind diese Schwachhirne von der neugegründeten Partei in München, der NSDAP«, sagte Oskar und sie sah eine Ader an seiner Schläfe pochen. »Komm, geh ma tanzen.« Er reichte ihr seinen Arm und sie gingen zum Tanzboden, auf dem sich schon viele Paare zum Klang der Musik drehten. Als sie am Tisch der jungen Männer vorbeikamen, erhob sich einer von ihnen und baute sich drohend vor Oskar auf. »Du traust dich hierher, du windiger Verserlschreiber, du Kommunistenbürscherl du!« sagte er und machte noch einen Schritt auf Oskar zu. Marie wollte ihn weiterziehen, doch Oskar ließ ihren Arm los und packte den Mann derb am Hemdkragen: »Laß mi in Rua, du Depp, du und dei ganzer schwachsinniger Verein da!« rief er und als der Mann die Faust zum Schlag erhob, versetzte ihm Oskar, der wesentlich schneller war als der andere, einen Schlag auf die Nase. Blut spritzte auf Oskars Hemd und Maries neue Schürze. Die anderen Männer am Tisch erhoben sich drohend, und hätte in diesem Moment nicht der Bürgermeister von Machtlfing, der am Nebentisch saß, eingegriffen, wäre es zu einer kräftigen Schlägerei gekommen. Marie nahm Oskar fest an der Hand. »I mog hoam«, sagte sie und wenig später saßen sie wieder auf dem Motorrad und fuhren durch die Nacht.
Ein Stück vor dem Hof stellte Oskar sein Gefährt ab und sie wanderten, als hätten sie es besprochen, den Weg zum See hinunter bis zur Bank unterm Wegkreuz. »Des tut mir leid, Marie«, sagte Oskar, »so gern hätt ich mit dir getanzt!« »Ach, ich finds net schlimm; es war eh so laut und hier ists viel schöner«, antwortete Marie und schlang ihre Arme um seinen Hals. Seine Lippen suchten die ihren und sie küssten sich, zärtlich zuerst, doch dann voller Leidenschaft. Oskar nahm behutsam die Nelken aus ihrem Mieder und begann es aufzuknöpfen. Marie verspürte ein Gefühl ähnlich wie beim Schwimmen im See, leicht, warm und lustvoll, doch um vieles stärker. Ein sanfter Nachtwind rauschte durch die Weiden unten am See.
Als Marie am nächsten Morgen vom Läuten der Sonntagsglocken erwachte, lag vor ihrer Kammertür ein kleiner blauer Umschlag. Sie öffnete ihn und faltete den Bogen Papier darin auseinander. Eine kleine weiße, gepresste Nelke fiel ihr entgegen.
Mein Sommermadl du
so nah bin ich noch bei dir
bei deinen sanften Lippen
bei deiner weißen Brust
bei deinem warmen Schoß,
so gern wär ich noch
lange Zeit bei dir daheim
behütet und geborgen,
doch die Unruh treibt mich
hinaus ins Weltgetümmel.
Ich dank dir tausendmal
Oskar
Ein Jahr später heiratete Marie den Ludwig Stiegler vom Nachbarhof. Zwei Monate später war sie Witwe; ihr Mann wurde beim Baumfällen von einem herunterfallenden starken Ast erschlagen. Trotz großer Einwände ihrer Eltern entschloss sich Marie nach angemessener Trauerzeit die Hebammenschule in München zu besuchen. Nach einigen Jahren kehrte sie zurück und war als kundige und beliebte Geburtshelferin jahrzehntelang in der Gegend um den Starnberger See tätig. Sie hat nicht mehr geheiratet und man erzählte sich, dass sie in ihrer wenigen freien Zeit Romane und Gedichte las.
Oskar Maria Graf, 1894 Berg/Starnberger See – 1967 New York. Graf wurde als siebtes von acht Kindern einer Bäckerfamilie geboren und erlernte das Bäckerhandwerk. Mit siebzehn lief er von zuhause fort, verdingte sich in München als Gelegenheitsarbeiter und fand Anschluß an Schwabinger Bohèmekreise. 1918/19 erlebte er die Revolution und die Räterepublik in München. Mit seinem Bekenntnisbuch »Wir sind Gefangene« gelang ihm in den Zwanziger Jahren der literarische Durchbruch. 1933 emigrierte er nach Wien, lebte dann im tschechischen Brünn und ab 1938 in New York. Dort verstarb er 1967. Die im Exil entstandenen Werke »Das Leben meiner Mutter«, »Der Abgrund« und »Unruhe um einen Friedfertigen« gehören zu seinen berühmtesten.
Georg Schrimpf, 1889 München – 1938 Berlin, war ein deutscher Maler und Grafiker und zählt zu den bedeutendsten Vertretern der Neuen Sachlichkeit. Mit dem Schriftsteller Oskar Maria Graf verband ihn eine lebenslange Freundschaft.
Das Blau
1961, Erster Weihnachtsfeiertag, Stettnerhof bei Murnau
Im sanften Licht des Morgens hatte das Bild immer schon am schönsten gewirkt. Gnadenlos helles Tageslicht, doch auch die Trübe grauer Regennachmittage oder gar das einsetzende Dämmerlicht des Abends hatten es immer etwas fahl und nichtssagend aussehen lassen. Jetzt fielen die ersten Strahlen der winterlichen Morgensonne durch das Fenster der Stube und ließen das kleine Gemälde mit den roten Dahlien und den weißen Löwenmäulchen, die etwas achtlos in einer schlanken Glasvase angeordnet waren, hell und strahlend aufleuchten. Selbst die graugrün karierte Tischdecke, auf der die Vase platziert war und der bläulichgraue Hintergrund wirkten fröhlich und farbenfroh. Erst Ende des letzten Jahrhunderts fand das Bild, das sich seit seiner Entstehung immer in Privatbesitz befunden hatte, seinen Platz in einem Münchner Museum und war zuweilen in Ausstellungen und Retrospektiven zu sehen. Doch blieb es immer eines unter vielen, wurde von den Besuchern zwar wohlwollend, doch nie sehr lange und gründlich betrachtet und entschwand sehr bald wieder aus deren Gedächtnis. In etlichen Katalogen wurde es mit dem Titel »Sommerblumen in Glasvase« abgebildet, doch gerade die Katalogdarstellungen unterstrichen noch mehr diese rätselhafte Oberflächlichkeit, ja Reizlosigkeit des handwerklich sicherlich perfekten Werkes.
Wenige Sonnenstrahlen des anbrechenden Wintermorgens fielen über den alten, rissigen Holzboden, auf dem sich achtlos einige Kleidungsstücke, ein paar Bücher und ein geöffnetes Tablettenröhrchen verteilten, auf das zerwühlte Bett mit der für das bayerische Voralpenland typischen blauweißkarierten Bettwäsche. Unter der dicken Bettdecke konnte man nur schwach die Umrisse eines weiblichen Körpers ausmachen. Wirres, verklebtes, dunkelblondes Haar lugte unter der Decke hervor und ein schmaler weißer Arm hing reglos auf der anderen Seite des Bettes herab. Daneben lag ein umgefallenes Wasserglas, aus dem sich die Reste einer weißlichtrüben Flüssigkeit auf den Holzboden ergossen hatten.
In der Stube nebenan stand auf einem kleinen Tischchen, über das provisorisch ein weißes Laken geworfen war, ein kleiner Christbaum. Er war karg und nur teilweise geschmückt, einige bunte Kugeln, ein paar Strohsterne und ein kleiner Engel aus Holz hingen an ihm, vor dem Baum stand eine große, graue Schachtel, die den restlichen Schmuck und rote Wachskerzen enthielt. Auf dem Tisch standen einige leere Flaschen Wein und eine Flasche Danziger Goldwasser, die zur Hälfte geleert war. Neben einem gefüllten Plätzchenteller, der unberührt wirkte, lag ein Brief mit verwischter Schrift, auf dem sich einige Flecken Wein und wohl auch vom Danziger Goldwasser befanden.
Fräulein Stettner,
lassen Sie sofort meinen Mann in Ruhe, ich muss sonst zur Polizei. Das Kind kann nicht vom Theo sein, das hat er mir geschworen und man weiß ja, dass so Bedienmädchen wie Sie gern ein loses Leben führen. Kommen sie ja nicht mehr nach Tölz, Sie falsche Schlange Sie.
Inge Aumüller
Am Vormittag, es hatte leicht zu schneien begonnen, klopfte es an der Tür. Als niemand öffnete, wurde das Klopfen energischer und eine brüchige Frauenstimme rief: »Fräulein Stettner, Luise, machen’s doch auf! Ich bin’s, die Nachbarin von oben! Wollen Sie nicht heut Mittag zum Essen kommen?« Noch ein-, zweimal klopfte es, dann entfernten sich die Schritte. Doch es vergingen nur ein paar Minuten, da hörte man wieder Schritte und mehrere Stimmen vor dem Haus, unter anderem die Stimme der alten Malerin, die oben im Russenhaus, wie die Murnauer es nannten, wohnte und die meinte, dass sie ein ungutes Gefühl habe. Kurz darauf erfolgte ein kräftiger Tritt gegen die Tür, die splitternd aufbrach und zwei Männer und die alte Frau betraten die Wohnung. Nach nicht einmal weiteren zehn Minuten flackerte das Blau des Krankenwagens durch die mittlerweile dicht fallenden Schneeflocken. »Sie lebt noch, vielleicht schafft sie es.« sagte einer der Sanitäter.
1931, im Russenhaus, Murnau
Erst einige Wochen nachdem sie das Haus wieder bezogen hatte, betrat sie das Atelier zum ersten Mal. Eine dichte Staubschicht hatte sich über den großen Tisch mit den Malutensilien und über die Staffelei gelegt, das große Dachfenster war trüb und verschmutzt und ließ das Tageslicht nur gedämpft hereinfallen, die Farben in den Tuben waren vertrocknet und ein säuerlich dumpfer Geruch hing in der Luft. Sie kippte die Fenster, fand aber nicht die Kraft, gründlich sauber zu machen. Sie nahm den Skizzenblock, der auf dem Tisch lag, stellte ihn auf die Staffelei und griff zum Stift. Die Hand bereits zum ersten Strich erhoben, hielt sie inne. Etwas sperrte sich in ihr und sie musste sich eingestehen, dass sie noch nicht bereit war für die Welt des Schaffens, dass die Freude, das Herzklopfen und das Glück, das sie früher jedes Mal beim Beginn eines neuen Werks empfunden hatte, sich nicht einstellen würden. Jeder Skizzenstrich, jede Nuancierung, jeder Farbauftrag würden die schmerzhafte, qualvolle Erinnerung an ihn zu ihr zurückbringen. Seit ihren Jungmädchentagen malte sie, doch erst seit er damals als ihr Lehrer und später als ihr Geliebter in ihr Leben getreten war, waren diese unbändige Lust am Malen, dieser vehemente Schaffensdrang, der sie nahezu ununterbrochen Bild für Bild hatte hervorbringen lassen, entstanden. Der Leben mit ihm, das wahrlich nicht immer einfach gewesen war, das auch Einengung und Unterwerfung für sie bedeutet hatte, hatte sie künstlerisch immer freier und gestaltungsreicher werden lassen.
Als sie vor einigen Tagen auf der Bank saß, die einen so friedvollen Ausblick auf das Moor und die dahinter sich sanft erhebenden Berge bot und wieder wie in früheren Zeiten die nur für diese Landschaft so typische milde Bläue wahrnahm, da hatte sie einen Moment gedacht, dass die Erinnerung und ihr Schmerz sich nun in diesem weichen, tröstenden Licht auflösen würden. Doch sie hatte sich getäuscht, immer und immer wieder stiegen Trauer, Bitterkeit und Wut in ihr auf. Wie oft war sie mit ihm allein oder zusammen mit Freunden und Malkollegen hier an diesem Aussichtspunkt gewesen, um sich von der friedlichen Voralpenlandschafft inspirieren zu lassen, die sich in den unterschiedlichsten Farbnuancen zeigte, jedoch immer, einmal mehr und ein andermal weniger, den charakteristischen Blauton aufwiesen. Das Blau war in jedes seiner und ihrer Bilder eingeflossen und schließlich zum Programm geworden für diese neue Form des Malens, die sie beide so leidenschaftlich weiterentwickelt hatten.
Sie legte den Stift zur Seite, verließ das Atelier und beschloss, in den Garten zu gehen. Natürlich würde er auch dort an ihrer Seite sein, in kurzen Lederhosen und mit derbem Schuhwerk angetan, würde er die Beete umstechen, in denen sie vorhatte, Gemüse, Stauden und Blumen zu pflanzen. Zwischendurch würde er sich auf die Bank neben der Haustür setzen, seine kurzsichtigen Augen hinter der Brille zusammenkneifen, schnell etwas auf den immer bereit liegenden Block skizzieren und die Katze streicheln, die sich schnurrend neben ihm niedergelassen hatte. Doch dort draußen in den Farben des aufkeimenden Sommers, mit dem Blau des Himmels über ihr, das so gänzlich anders war als das Blau des Landes rings umher, war es leichter zu ertragen. Sie war erstaunt, dass inmitten des von Unkraut überwucherten Blumenbeetes die hohe Staude mit den kleinen, leuchtend roten Knopfdahlien sich so prächtig entwickelt hatte. Auch die weißen und gelben Löwenmäulchen am Zaun, die sie in einem anderen, fernen Leben gepflanzt hatte, waren wiedergekommen und setzten weitere frische Farbpunkte in den verwilderten Garten.
Sie holte die Gartenschere, sah sie einen Moment ganz deutlich in seinen kräftigen, gebräunten Händen und begann einen Strauß aus dem Rot der Dahlien und dem Weiß der Löwenmäulchen zu schneiden. Für einen kurzen Moment flackerte so etwas wie Freude in ihr auf, doch dann erschrak sie über dieses Gefühl, das ihr nicht zustand und das sie nicht zulassen durfte und sie hielt inne, eine noch bescheidene Ausbeute der Blumenpracht in ihren Händen. Sie schloß die Augen und sah ihn am Fenster des Schlafzimmers im ersten Stock stehen, er hob die Hand und bedeutete ihr, zu ihm heraufzukommen. Zögernd stieg sie die Treppe hoch, sah nicht die bunten, fröhlichen, mittlerweile etwas verblassten Farben, mit denen das Geländer bemalt war, betrat das Zimmer und setzte sich auf das Bett. Den Strauß mit ihren erdbeschmutzten Händen in ihrem Schoß festhaltend, spürte sie ganz deutlich seine Nähe und wieder einmal, wie schon unzählige Male zuvor, keimte widersinnige Hoffnung in ihr auf. Eines Tages würde er wieder dort am Fenster stehen, sich nach ihr umwenden, ihr den Strauß aus den Händen nehmen und sie sanft an sich ziehen.
Später saß sie in der Küche, den Strauß in einer alten Vase aus mittlerweile schon leicht getrübtem Glas vor sich und trank den bitteren russischen Tee, den sie in der Anrichte gefunden hatte. Sie hatte nicht die Kraft, aufzustehen und sich etwas Zucker zu holen. 1936, Pirknerhof bei Murnau
Die Mutter hatte ihr am Sonntagmittag nach dem Kirchgang und dem Mittagsmahl einen Spaziergang mit Korbinian erlaubt. Nach anfänglichem Zögern hatte sie ja gesagt, denn eigentlich schickte es sich nicht, als junges, noch nicht einmal verlobtes Mädchen allein mit einem Mann spazieren zu gehen. Doch die Mutter war gut gestimmt, die schlimmen Zeiten nach dem schweren Unfall des Vaters, der beim Abladen von schweren Holzstämmen getroffen worden war und fast zwei Monate im Spital gelegen hatte, waren vorüber. Er war wieder zu Hause und konnte schon wieder leichtere Arbeiten verrichten. In ein, zwei Monaten würde er wieder der Alte sein, hatte der Doktor gemeint.
Korbinian Stettner und Agathe Pirkner kannten sich von klein auf, schließlich lagen ihre Höfe gerade einmal ein paar hundert Meter auseinander. Seit langem war es vereinbart, dass sie einmal heiraten würden und der Vater hatte nach seiner Rückkunft aus dem Krankenhaus gesagt, dass es doch an Weihnachten an der Zeit sei, Verlobung zu feiern. Der Stettnerhof, den Korbinian in einigen Jahren von seinem Vater übernehmen würde, war viel größer und stattlicher als der ihrer Familie, ein ansehnlicher Grund und ein umfangreicher Waldbesitz hinter Froschhausen gehörten dazu. Korbinian war, großgewachsen, kräftig und mit seinem dichten, schwarzen Haar eine gute Erscheinung, doch etwas Dunkles, Dumpfes, Wortkarges umgab ihn zuweilen, das ihr Angst machte. Agathe hatte sich vorgenommen, bei diesem Spaziergang, für den sie ihr schönstes Sonntagsdirndl anziehen wollte, etwas Fröhlichkeit und Lachen in sein oft so undurchdringlich starres Gesicht zu zaubern und, vor allem, wollte sie endlich von ihm geküsst werden.
Pünktlich nach dem Mittagessen stand Korbinian an der Gartentür und erwartete sie. Sie schlug ihm vor, hinunter zum Ramsachkircherl zu gehen, dann zur Kottmüllerallee hinaufzusteigen und auf der Aussichtsbank zu rasten. Dort, stellte sie sich vor, würde er sie dann in seine Arme nehmen und zärtlich küssen. Auf dem Weg zum Ramsachkircherl versuchte sie, ein Gespräch in Gang zu bringen. Sie fragte nach seiner Ausbildung in Weihenstephan, erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der alten Stettnerbäuerin, erzählte von den Hefenudeln, die sie letzte Woche gebacken hatte und die dem Vater so gut geschmeckt hatten, doch die Unterhaltung blieb einseitig. Korbinian nickte zwar freundlich, antwortete jedoch einsilbig mit kargen, kurzen Sätzen und verfiel dann wieder in Schweigen. Beim Hinaufsteigen zur Kottmüllerallee wollte sie bei den letzten Metern nach seiner Hand greifen, er jedoch zögerte und streckte ihr dann fast unwillig seine kühle Rechte, die sich in ihrer merkwürdig leblos anfühlte, entgegen. Oben auf der Allee begegneten sie einigen Spaziergängern, Korbinian lüpfte jedes Mal kurz seinen Hut und nickte, ohne dass auch nur ein Laut über seine Lippen gekommen wäre; sie grüßte freundlich und wechselte mit manchen das eine oder andere Wort.
Dann kam ihnen der junge Lehrer Liedmeier entgegen, der seit zwei Jahren an der Schule im Ort unterrichtete. Er war ein hübscher, blondgelockter junger Mann mit feinen Gesichtszügen, dem die eine oder andere Frau im Ort sehnsüchtig nachblickte. Korbinian blieb beim Anblick des Lehrers wie angewurzelt stehen und sie bemerkte, dass sein sonst so starres Gesicht von einer leichten Röte durchflutet wurde und seine Augen aufleuchteten. Auch der junge Liedmeier blieb stehen, er lächelte unbeholfen, streckte Korbinian seine Hand entgegen und einen Moment dachte sie, dass beide sich umarmen wollten. Doch sie schüttelten sich nur die Hände, und der junge Liedmeier sagte lediglich mit rauer Stimme: »Du, Korbinian?«, dann erst wandte er sich zu ihr, nickte kühl, zog seinen Hut und ging rasch weiter. Sie war höchst verwundert, kannte sie den jungen Lehrer sonst doch als überaus höfliche Person, doch sie verschwendete keine weiteren Gedanken daran.