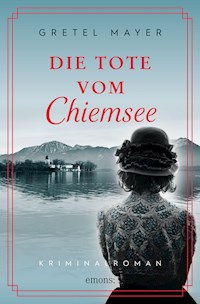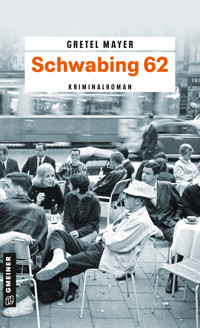Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Herbst 1925 wird Johann Reintaler im Murnauer Moos brutal ermordet aufgefunden und für Kommissar Heini Bieder beginnt eine schwierige Ermittlung. Hat der Wirt Sigi Kammleitner, bei dem Reintaler hohe Spielschulden hatte, etwas mit dem Mord zu tun oder gar die Schwester des Mordopfers, die dessen Gläubiger angeblich als »Pfand« angeboten wurde? Oder liegt der Schlüssel zum Verbrechen in den Ereignissen von 1909, als im Murnauer Russenhaus Gabriele Münter und Wassily Kandinsky künstlerische Meisterwerke des Blauen Landes schufen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 292
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gretel Mayer
Das Geheimnis von Murnau
Kriminalroman
Zum Buch
Mord im Murnauer Moos Im Herbst 1925 wird Johann Reintaler im Murnauer Moos ermordet aufgefunden. Der Murnauer Kommissar Heini Bieder, der kurz vor seiner Pensionierung steht und die Zeit bis dahin am liebsten ungestört absitzen möchte, steckt rasch inmitten komplizierter Ermittlungen. Wer könnte Johann Reintaler, der im Ort vor allem als gescheiterte Existenz, als Trinker und Spieler gilt, derart brutal erschlagen haben? War es der Wirt Sigi Kammleitner, bei dem das Mordopfer hohe Spielschulden hatte, oder hat die Schwester des Ermordeten etwas mit dem Mord zu tun, die Reintaler seinem Gläubiger zur Tilgung seiner Schulden als Bettgespielin angeboten haben soll? Und was hat es mit dem zerrissenen Rupfensack auf sich, der leer neben dem toten Reintaler lag? Seine Ermittlungen führen Kommissar Bieder zurück bis ins Jahr 1909, als Gabriele Münter das Russenhaus in Murnau erwarb und dort mit ihrem Lebensgefährten Wassily Kandinsky zahlreiche bedeutende Darstellungen des berühmten Blauen Landes schuf.
Gretel Mayer, geboren 1949 in München, war als Fremdsprachensekretärin, Übersetzerin und jahrelang als Buchhändlerin tätig, bevor sie ihre Leidenschaft fürs Schreiben entdeckte. Obwohl ihr Lebensmittelpunkt schon seit Jahrzehnten in Unterfranken liegt, schlägt ihr Herz noch immer für das Alpenvorland und ihre Geburtsstadt München.
Impressum
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Autoren- und Projektagentur Gerd F. Rumler (München)
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Max Stoess/1944
Mit freundlicher Erlaubnis der Familie Stoess
ISBN 978-3-7349-3412-4
Die Wirklichkeit ist überflüssig!
Was an der Wirklichkeit ausdrucksvoll ist,
hole ich heraus, stelle ich einfach dar,
ohne Umschweife, ohne Drum und Dran
Gabriele Münter
Blau ist die typisch himmlische Farbe.
Das helle Blau ist einer Flöte ähnlich, das dunkle
dem Cello, immer tiefer gehend den wunderbaren
Klängen der Bassgeige; in tiefer, feierlicher Form ist
der Klang des Blau dem der tiefen Orgel vergleichbar.
Wassily Kandinsky
Kapitel 1
Eine grausig zugerichtete Leiche im Moos – Heinrich Bieders letzter Fall vor dem Ruhestand – Liebe auf den ersten Blick auf dem Murnauer Markt – Besuch im Goldenen Hasen
Murnau 26. Oktober 1925
Xaver Kienlechner fluchte. Ein tobender Schmerz hämmerte hinter seinen Schläfen, ein bitterer galliger Geschmack hatte sich in seinem Mund breitgemacht und ließ ihn würgen, und seine Zunge klebte am Gaumen. Beim Schafkopfen, das sich in dem Boasl am Untermarkt bis in die Morgenstunden hingezogen hatte, hatte er einen Haufen Geld verloren. Er hatte einfach nicht aufhören können und bis weit nach Mitternacht geglaubt, dass sich das Blatt noch wenden würde. Doch daraus war nichts geworden, und der Sepp hatte ein ums andere Mal feixend und grinsend seinen Gewinn eingestrichen und war schließlich triumphierend abgezogen. Xaver musste dann wohl am Tisch über dem achten Bier eingeschlafen sein, bis der Wirt ihn unsanft weckte und hinausschmiss. Nach dem Bezahlen der ziemlich hohen Zeche klimperten jetzt nur noch wenige Münzen in Xaver Kienlechners Hosentasche.
Der Herbstmorgen graute schon, ein ganz feiner Nieselregen fiel, und die Berge zu seiner Linken waren von grauen Wolken nahezu verhüllt. Zu seinem Häusl etwas außerhalb von Murnau war es nicht weit, und wie gewohnt nahm Xaver die Abkürzung am Rand des Murnauer Moos entlang, aus dem gespenstisch dicke Nebelschwaden aufstiegen. Für die Einwohner des Marktfleckens Murnau gehörte das Moos einfach ganz so selbstverständlich dazu wie eben auch die Mariensäule auf dem Marktplatz, das Schloss, das Griesbräu und das Angerbräu oder die repräsentative Seidl-Villa oberhalb des Staffelsees. Das Moos war eines der größten Moorgebiete nicht nur in Bayern und war vor Tausenden von Jahren durch Verlandung eines großen Gletschers südlich des Marktes Murnau entstanden. Seine wirtschaftliche Nutzung stand lange im Vordergrund, bis es auch durch die immer zahlreicher werdenden Sommerfrischler und durch die vielen Künstler, nicht nur des berühmten Blauen Reiters, die Murnau besuchten, entdeckt wurde. Wegen seiner ständig wechselnden Blauschattierungen wurde die Gegend um Murnau gerne das »Blaue Land« genannt.
Blau flimmert der Staffelsee in der Mittagssonne, die Berge dahinter in lichterem Blau. In der Abenddämmerung schimmern Berge und See in einem durchscheinenden dunklen Grünblau….
Zweimal wäre Xaver fast gestürzt, denn der Weg war rutschig und sein Schritt unsicher.
»So a Scheiß, so a verfluchta! Ois is noos und neblig und grau!«, schimpfte Xaver. »Blaues Land, dass i ned lach. Die blädn Künstler damois ham doch gschbonna!«
Nur einen kurzen Augenblick achtete er nicht auf den Weg vor sich, da stürzte er auch schon über ein großes dunkles Bündel, das da mitten auf dem Weg lag. Sein Kopf prallte auf etliche Steine, die auf dem nassen Weg lagen, und er hatte das Gefühl, schlagartig nüchtern zu werden. Als er versuchte, sich mit beiden Händen aufzustützen, um wieder hochzukommen, griff seine Rechte in etwas Weiches, Feuchtes, Schleimiges. Xaver schrie auf, als er in der aufkommenden Morgendämmerung erkannte, dass er mitten in ein entstelltes, zertrümmertes menschliches Gesicht gegriffen hatte. Aus der nahezu gespaltenen Stirn war Gehirnmasse ausgetreten, ein Augapfel hing weitab von der Stelle, an der er eigentlich hätte sein sollen auf der ebenfalls zerschmetterten Wange; das andere Auge starrte Xaver blicklos und doch irgendwie vorwurfsvoll an. Der Mund war weit aufgerissen, so als hätte diese geschundene Kreatur, die da vor Xaver lag, noch einen letzten schrecklichen Schrei von sich gegeben. Das Haar des Toten – und tot war dieser Mensch fraglos – war blutgetränkt, und auf einer der blutigen Strähnen saß eine einsame Nacktschnecke. Xaver Kienlechner schaffte es gerade noch zum Wegesrand, bevor er dort würgend und stöhnend das Bier, die unzähligen Obstler und den Leberkäs erbrach.
Für einige Augenblicke schien er bewusstlos gewesen zu sein, doch dann kam gleichzeitig mit dem zunehmenden Tageslicht wieder etwas Leben in ihn, und er wagte noch einmal einen kurzen Blick auf den Toten, der da entstellt und verkrümmt vor ihm lag und seltsamerweise von nassen groben Fetzen, die möglicherweise von einem Rupfensack stammen konnten, umgeben war.
»Verdammt no amoi«, schrie Xaver Kienlechner, »wenn mi ned ois deischt, is des doch da Johann!«
»Zwiebeln können nie genug im Wurstsalat sein, Hilde. Das hast du schon richtig gemacht«, lobte Kriminalkommissar Heinrich Bieder seine Ehefrau, die sich darüber beklagt hatte, dass die vielen Zwiebeln des Nachts den Atem ihres Ehemanns verpestet und auch zu so einigen Darmgeräuschen geführt hatten.
»Du übertreibst es halt immer, Heini«, meinte Hilde Bieder und schenkte ihrem Mann den Frühstückskaffee ein. »Wenn du in Pension bist, dann wird endlich gesünder gelebt! Das kannst du mir glauben!«
»Jaja, Hildemausi«, antwortete Heini, goss tüchtig Rahm in seinen Kaffee, behäufte seine Frühstückssemmel mit Schinken und köpfte genüsslich sein Ei.
In diesem Moment klingelte das Telefon, und wie jedes Mal zuckten Heini und Hilde bei diesem schrillen Geräusch zusammen. Das Telefon war erst vor wenigen Monaten installiert worden, weil man der Ansicht gewesen war, dass ein Kriminalkommissar auch privat immer erreichbar zu sein hatte.
Hilde Bieder hob den klobigen schwarzen Telefonhörer an ihr Ohr und meldete sich. Nach einiger Zeit reichte sie diesen kopfschüttelnd ihrem Mann.
»Das ist die Elfriede, die Frau vom Xaver … Kienlechner, du weißt schon. Die ist ganz durcheinander, ich hab nichts verstanden.«
Heini Bieder legte seufzend seine Schinkensemmel zur Seite.
»Elfriede, was ist los? … Was? … Wo? … kannst mir mal den Xaver geben? … Ah so, der is am Abort. … Ja, ich komm gleich.«
Heini Bieder legte seine Schinkensemmel zur Seite.
»Ich muss hinunter ans Moos unterhalb vom Ähndl. Der Xaver Kienlechner hat da einen Toten gefunden. Ein scheußlicher Anblick muss das sein, drum speibt er sich jetzt gerade die Seele aus dem Leib. Er meint, dass es der Johann Reintaler ist.«
Zehn Minuten später war Heinrich Bieder auf dem Weg hinunter zum Moos; das Angebot seiner Frau, die Schinkensemmel mitzunehmen, hatte er vorsichtshalber abgelehnt.
»So eine Sauerei«, knurrte er vor sich hin. »Sechs Wochen vorm Ruhestand! Das hab ich nicht verdient!«
So schön hatte er es sich vorgestellt, noch bis Weihnachten eine ruhige Kugel im Amt zu schieben; immer frühzeitig nach Hause zu gehen um dort endlich Ordnung in seine umfangreiche Briefmarkensammlung zu bringen und sich dabei aufs deftige Abendessen seiner Hilde zu freuen.
Am Eingang zum Moos kam ihm schon der kleine Pfleiderer, Murnauer Ortspolizist seit Jahrzehnten, entgegen. Der Pfleiderer, ein kleingewachsenes dünnes Männlein, an dem die Dienstuniform grundsätzlich schlotterte, genoss trotz seiner überhaupt nicht imposanten Erscheinung großen Respekt bei den Murnauer Bürgern.
Pfleiderer schüttelte Bieder mit einem sehr kräftigen Händedruck, den man ihm gar nicht zugetraut hätte, die Rechte.
»Es is da Reintaler, eindeutig«, erklärte er. »Hast hoffentlich no ned g’frühstückt! A große Sauerei is des!«
Mittlerweile war es Tag geworden, und zwischen den grauen schnell dahintreibenden Herbstwolken blitzte zwischendurch eine noch recht schwache Morgensonne hindurch. Heini Bieder zückte sein frisch gestärktes hellblaues Taschentuch, das er vor dem Verlassen des Hauses rasch noch mit etwas Eau de Cologne beträufelt hatte, und hielt es sich unter die Nase. Dabei war der Geruch, der vom toten Johann Reintaler ausging, hier in der frischen würzigen Morgenluft noch einigermaßen auszuhalten; es war der Anblick desselben, der Heini Bieder den Atem raubte und ihn ein Würgen krampfhaft unterdrücken ließ. Trotzdem zwang er sich, den Toten genau anzuschauen und dieses Bild ähnlich einer Fotografie ganz exakt in sich aufzunehmen. Er hatte die Mordfälle in seiner Laufbahn nicht gezählt, doch er wusste aus Erfahrung, dass dieser erste Eindruck äußerst wichtig war.
»Wer hat dich denn so zugerichtet, Johann?«, sprach er ganz leise zu dem Toten. »Wie viel Hass und Gewalt waren denn da im Spiel? Was ist passiert? Wo wolltest du hin des Nachts am Eingang zum Moos? Wen hast du getroffen? Was hast du da in dem Rupfensack transportiert?«
Natürlich gab ihm Johann Reintaler keine Antwort, doch diese klaren, einfachen Fragen halfen Heini Bieder immer, sich schon ein kleines hilfreiches Gerüst für seine zukünftigen Ermittlungen zurechtzubauen. Nach seiner Zwiesprache mit dem Toten wandte er sich den beiden bleichen jungen Hilfspolizisten zu, die der Pfleiderer mitgebracht hatte, und wies sie an, schon mal den Tatort zu sichern, bevor die Spurensicherung, der Fotograf und der Arzt eintreffen würden.
»Der Doktor kommt, so schnell er kann«, erklärte Pfleiderer. »Der braucht aba no a weng, der war no im Bett.«
Bis die Spurensicherung und der Fotograf aus Penzberg eintreffen würden, würde eh noch einige Zeit vergehen. Pfleiderer breitete behutsam ein dünnes Laken über den Toten und bekreuzigte sich, und die beiden jungen Polizisten taten es ihm nach. Bieder steckte sich stattdessen genüsslich ein Zigarillo an; schon lange hatte er aufgrund der vielen schrecklichen Dinge, die er im Laufe seines langen Berufslebens schon gesehen hatte, den Glauben an einen lieben Gott da oben so gut wie verloren und ging nur seiner Hilde zuliebe an Ostern und Weihnachten in die Kirche.
Auf dem Weg zurück ins Amt überlegte Heinrich Bieder, wann er denn den Johann Reintaler das letzte Mal gesehen hatte, und nach einigem Überlegen fiel ihm ein, dass das wohl irgendwann im Sommer hinten am Riegsee gewesen war. Da war ihm und der Hilde beim Verlassen einer Gaststätte der Johann entgegengekommen, und sie hatten beide festgestellt, dass er noch heruntergekommener und schäbiger aussah als beim letzten Zusammentreffen. Außerdem war er stark angetrunken, und obwohl er vor vielen Jahren die ganze neue Schlafzimmereinrichtung für das junge Ehepaar Bieder geschreinert und aus diesem Grund bei ihnen eine Zeit lang ein- und ausgegangen war, hatte er sie nicht erkannt und war grußlos an ihnen vorbeigewankt.
»Was war das für ein gut aussehender schöner Mann früher«, hatte die Hilde geseufzt, »und was für ein ausgezeichneter Schreiner. Aber seit er aus dem Krieg gekommen ist, ist’s abwärts mit ihm gegangen … nein, eigentlich schon seit der unglücklichen Liebesgeschichte mit der Margarete!«
Damals, auf dem schönen abendlichen Heimweg vom Riegsee, hatte Heini Bieder nichts mehr von unglücklicher Liebe – ein Spezialthema seiner Frau – hören wollen, jetzt bedauerte er dies und nahm sich vor, sie gleich am Abend dazu zu befragen.
Was er bis jetzt wusste, war, dass der Johann Reintaler 46 Jahre alt war, bei seiner Schwester Gundl in Ohlstadt lebte und seit Jahren kaum mehr einer Arbeit nachgegangen war. Allen war bekannt, dass er unverhältnismäßig viel trank und in den letzten Jahren auch dem Glücksspiel verfallen war. Seine Teilnahme am Krieg hatte ihm sozusagen das Genick gebrochen. Im letzten Kriegsjahr in Frankreich war er schwer verwundet worden, und nach einigen Monaten im Lazarett im Elsass hatte sich herausgestellt, dass seine rechte Hand nie wieder einsatzfähig sein würde. Das hatte das Aus für seinen Beruf als Schreiner bedeutet.
Schon ein sehr hartes Schicksal, das den armen Xaver da ereilt hat, dachte sich Heinrich Bieder. Er selbst wurde seinerzeit wegen seiner äußerst wichtigen Tätigkeit bei der Kriminalpolizei zuerst vom Dienst an der Waffe befreit und dann im letzten Kriegsjahr wegen einer schweren Rippenfellentzündung nicht mehr eingezogen. Das hat mir vielleicht das Leben gerettet damals, dachte er sich oft und hätte eigentlich dafür nur dankbar sein müssen, doch oft fühlte er sich ob dieser Tatsache schlecht und wie ein mieser Versager.
Als er die Treppe zu seinem Amtszimmer hinaufstieg, hämmerte sein Herz stark gegen die Rippen, und er atmete schwer. Doch er wusste, dass der Grund dafür nicht nur sein Übergewicht und auch nicht nur der neue Fall waren. Die schöne Gundl Reintaler, die Schwester des Toten, war ihm wieder in den Sinn gekommen. Ihr musste er ja wohl in den nächsten Stunden die Todesnachricht überbringen, und er fühlte, wie ihm schon beim bloßen Gedanken daran der Schweiß ausbrach.
Es war beim Ohlstädter Maitanz vor mehr als 30 Jahren gewesen, als er, Hilde war damals hochschwanger mit dem zweiten Kind daheim geblieben, ganz zufällig neben der Gundl zu sitzen kam. Er kannte sie nicht und wusste auch nichts über sie. Die Gundl war damals noch keine 20, und ihre Schönheit, ihre Anmut, ihr fröhliches Wesen und ihr helles Lachen schlugen ihn sofort in Bann. Bei ihrem Anblick konnte er nicht anders als sofort an das Schneewittchen aus dem Grimm’schen Märchen zu denken. Weiß wie Schnee war ihre makellose Haut, die nur auf der hübschen Nase einige Sommersprossen aufwies; rot wie Blut ihre vollen, ganz leicht spöttisch geschwungenen Lippen, die er nur kurz ansehen musste, bis auf der Stelle Hitze und Leidenschaft in ihm, dem sonst so nüchternen und sachlichen Mann, mit aller Gewalt aufstiegen. Schwarz wie Ebenholz war tatsächlich ihr volles welliges Haar, das sie locker hochgesteckt trug und damit auch noch ihren schönen weißen schmalen Nacken zeigte, den er ebenfalls kaum anzuschauen wagte. Inmitten seiner sich zuprostenden schon leicht betrunkenen Amtskollegen saß er und brannte lichterloh. Seine hochschwangere Frau und die ewig quengelnde und zahnende zweijährige Tochter zu Hause waren vollkommen in einem Nebel des Vergessens verschwunden. Was er damals im Einzelnen mit der Gundl geredet hatte, wusste er nicht mehr; doch ganz deutlich erinnerte er sich noch an das brennende Verlangen, sie im Arm zu halten, sie zu küssen und noch viel, viel mehr. So kam es, dass er nach zwei etwas hastig getrunkenen Maß Bier sie zum Tanz aufforderte. Kaum hatte er seine Bitte ausgesprochen, da stieß ihn sein Ohlstädter Kollege recht derb mit dem Ellbogen in die Seite, doch Bieder verstand nicht. Dann sah er das Flackern in Gundl dunklen Augen und glaubte plötzlich, Schmerz und Trauer in ihrem schönen Gesicht zu erkennen. Sie beugte sich hinab und zog ihren Dirndlrock etwas hoch.
»Da schau her«, sagte sie mit rauer Stimme und wies auf ihr rechtes Bein, das unsagbar dünn wie ein von Haut umspannter Knochen in einer Schiene und in einem klobigen orthopädischen Schuh steckte.
»Kinderlähmung mit sechs Jahr … fünf Zentimeter kürzer als das andere!«
Heinrich Bieder verschlug es die Sprache; hilflos stammelte er ein paar dürre Entschuldigungsworte und versuchte krampfhaft, wieder eine Unterhaltung mit Gundl zu führen. Doch das brennende Verlangen war erloschen, und es war nur noch Scham, die da in ihm brannte. Die Gundl ging kurz darauf, und er wagte es nicht, ihrer hochgewachsenen schlanken, aber stark hinkenden Gestalt nachzublicken.
»Du Depp, du bläda!«, meinte sein Kollege.
In Heinrich Bieders Erinnerungen schrillte das Amtstelefon hinein, und wieder zuckte er zusammen. Es war der aus dem warmen Bett gerufene Arzt Bernhard Vollmuth, dessen Stimme immer noch etwas verschlafen klang.
»Schauderhaft!«, waren seine ersten Worte, dann erläuterte er die einzelnen äußerst massiven Schädelverletzungen des Toten, den Bruch von vier Rippen, wovon eine womöglich die Lunge durchdrungen hatte, und zudem den Bruch von mehreren Fingern der linken und der rechten und zudem des Handgelenks der rechten Hand.
»Der muss sich heftigst gewehrt haben, was man auch an den Druckstellen und Abschürfungen an den Armen sehen kann«, erklärte Doktor Vollmuth.
»Der muss in die Gerichtsmedizin nach München; ich hab schon alles veranlasst. Wir zwei sehen uns spätestens auf der Weihnachtsfeier und bei deiner Verabschiedung, Heini! Was lasst denn da auffahren?«, fragte er abschließend.
Heinrich Bieder tat, als hätte er den letzten Satz überhört, bedankte und verabschiedete sich freundlichst.
»Auffahren«, brummelte er. »Was soll ich denn schon auffahren? Was stellt sich der denn überhaupt vor? Weißwürscht gibt’s und a Bier, Schluss und aus!« Und er wunderte sich über die leichte Melancholie, die da plötzlich in ihm aufstieg.
Eine halbe Stunde später stand er vor dem Reintalerschen Häuschen am Rande von Ohlstadt. Mittlerweile war die Sonne herausgekommen und versprach einen womöglich letzten goldenen Herbsttag. Zwischen den alten Apfelbäumen im nicht sehr gepflegten kleinen Garten der Reintalers konnte man nun deutlich in der Ferne das Ettaler Mandl und ein Stück des Wettersteingebirges sehen. Der frische Herbstwind hatte tatsächlich alle dunklen Wolken weggeblasen. Neben der Tür hing ein recht verwittertes altes Messingschild mit der Aufschrift »Schreinerei Reintaler«, dessen Buchstaben schon ziemlich verblichen waren. Auf sein Klingeln hin öffnete sich sofort die Tür, und die Gundl stand vor ihm.
Sie ist immer noch schön, dachte Heini Bieder und erschrak, als er tatsächlich wieder eine Spur des brennenden Verlangens von damals in sich aufsteigen fühlte.
»Komm rein«, sagte Gundl. »Ich weiß es schon, Die Elfriede Kienlechner hat mich angerufen.«
»Ich möchte Ihnen hiermit …«, stammelte Bieder und kam sich saudumm und absolut unbeholfen vor.
»Ist schon gut«, antwortete Gundl mit demselben leicht spöttischen Lächeln wie vor 30 Jahren. »Wir waren doch einmal beim Du wir zwei, oder?«
Kurze Zeit später saßen sie sich in der blitzblanken, aber deutlich ärmlichen Küche der Reintalers gegenüber.
»Dass er einmal keines natürlichen Todes stirbt, hab ich immer befürchtet«, sagte Gundl. »Aber derart grausam, das hat er nicht verdient.«
»Haben Sie … hast du … vielleicht eine Vermutung, wer das getan hat?«, wollte Bieder wissen. »Hatte er Feinde?«
Gundl streckte seufzend ihr rechtes geschientes Bein mit dem klobigen Schuh unter dem Küchentisch zurecht, ganz offensichtlich hatte sie Schmerzen.
»Feinde?«, überlegte sie. »Von Feinden kann man da wohl nicht so ganz sprechen. Er hat sich mit vielen angelegt im Suff – und besoffen war er ja meistens – aber keiner hat ihn mehr so ganz ernst genommen. Schulden hat er halt eine Menge gehabt fürs Bier, den Schnaps und durch die Spielerei. Ich hab ja manches ausgleichen können, aber alles? Nein, das konnte und wollte ich nicht. Er hat mir’s ja auch selten gedankt. Bös und ungerecht ist er geworden vor allem in der letzten Zeit. Auch zu mir!« Und Bieder sah, wie ihr Tränen in die Augen stiegen.
Abrupt erhob Gundl sich, stammelte eine Entschuldigung und humpelte aus der Küche. Bieder hörte, wie sich draußen würgend erbrach und überlegte, ob er ihr wohl zu Hilfe kommen sollte. Doch da saß sie schon wieder vor ihm, und er erschrak, wie bleich sie war und welch dunkle Schatten sie unter ihren immer noch schönen Augen hatte.
»Der Magen«, erklärte sie kurz. »Ist alles ein wenig zu viel gerade. Wann kann ich ihn beerdigen?«
Bieder versprach, ihr Bescheid zu geben, und erwähnte in diesem Zusammenhang nicht, dass der Johann Reintaler wohl bald in München auf dem Seziertisch liegen würde.
Er wollte gerade gehen, da sagte sie: »Die Liebe damals, die hat ihn zerbrochen. Davor war er ein ganz anderer Mensch.«
Schon an der Tür legte sie kurz ihre Hand auf seinen Arm und lächelte ihn an. »Wenn’s gegangen wäre, hätte ich gern getanzt mit dir damals!«
Später wusste Heini Bieder nicht mehr recht, wie er wieder zurück ins Amt nach Murnau gekommen war. Da war ein Zittern in seinem Inneren, wie er es schon jahrelang nicht mehr verspürt hatte, und irgendwie schwebte er die Treppe zu seinem Amtszimmer hinauf, ohne so heftig zu schnaufen wie sonst.
Doch dann wurde er wieder von diesem verdammten Telefon aus seinen Träumereien gerissen. Es war die Spurensicherung aus Penzberg, die die restlichen Teile eines Rupfensacks, in dem für gewöhnlich Kartoffeln, Zwiebeln, Gemüse oder manchmal auch Kohlen transportiert wurden, sichergestellt hatte. Vom Regen durchweicht und stark verschmutzt war mit diesen nicht mehr viel anzufangen.
»Außerdem hamma no a boa Holzstückl g’funden, die von am größeren kräftigen Ast stamma kanntn … vielleicht war dea die Tatwaffe. Den hamma aba leida ned sicherstelln kenna!«
Bieder dankte, erbat sich einen detaillierten Bericht und beschloss dann heimzugehen. Sonst fand er fast täglich Zeit, mit seiner Hilde zu telefonieren und zu erfragen, was es denn zum Abendessen geben würde; das hatte er heute tatsächlich völlig vergessen. Eine Überraschung ist doch auch einmal was Gutes, dachte er sich; das bringt Schwung ins Eheleben!
Es gab Tellerfleisch mit Meerrettich, eine seiner Lieblingsspeisen. Und als das Ehepaar Bieder später gesättigt und zufrieden unter seinem wärmenden Federbett lag, kuschelte sich Hilde an ihren Heini und begann ihm die Geschichte von der Liebe zwischen dem Johann und der Margarete zu erzählen. Ganz zu Ende kam sie mit ihrer Erzählung nicht, denn nach einer Viertelstunde schnarchte ihr Heini bereits selig vor sich hin.
Murnau 1909
Murnau, zwischen Weilheim und Mittenwald an der sogenannten Rottstraße gelegen, war von jeher ein äußerst wichtiger und immer gut besuchter Marktort. So waren auch im August 1909 trotz eines sehr heißen Sommertags viele Einwohner Murnaus und Besucher von auswärts auf dem Markt unterwegs. Der junge Schreiner Johann Reintaler hatte seinem Freund Max versprochen, frühzeitig da zu sein, um ihm beim Aufbau seines Marktstands zu helfen. Max war der Sohn einer alteingesessenen Gärtnerfamilie und wollte Blumen, Gartenpflanzen, Stauden und allerlei Sämereien auf dem Markt anbieten. Eine kleine Ecke seines Standls war allerdings etwas ganz anderem vorbehalten, nämlich der Hinterglasmalerei. Sowohl der Urgroßvater als auch der Großvater von Max waren passionierte Hinterglasmaler, ein volkstümliches Kunsthandwerk, das besonders in Murnau und im Staffelseegebiet von jeher sehr gepflegt wurde. Während in früheren Zeiten Klöster und Fürsten Abnehmer dieser meist religiösen Motive waren, sorgte eine günstigere Glaserzeugung bald dafür, dass auch das Kleinbürgertum, ländliche Kreise und seit geraumer Zeit auch die immer zahlreicher werdenden Sommerfrischler gute Abnehmer wurden.
So saß der Großvater vom Max krumm und gebeugt, aber mit sehr wachen Augen umgeben von seinen Kunstwerken auf einem wackligen Schemelchen und bot seine Werke an.
»Schaugn S’ doch amoi, gnädigs Fräulein, do hob i den heilign Georg mitm Drachn! Oder woin S’ liaba d’ Maria mitm Jesuskind? A scheens Blumabuidl hob i a no!«
Während Johann noch die letzten Nägel in die Rückwand des Standes schlug und Max die letzten Pflanzen aufstellte, war der Großvater, der zwischendurch immer einen kräftigen Schluck aus seinem Dünnbierkrug nahm, schon voll in seinem Element.
»Ich hab nicht so viel Geld, dass ich dir was abkaufen kann. Ich brauch nur ein paar Sämereien und vielleicht noch die zwei Töpferl mit Löwenmäulchen«, antwortete das angesprochene Fräulein mit einer sehr klaren und hellen Stimme. Da Max noch dabei war, die letzten Stauden von seinem Fuhrwerk zu holen, trat Johann zu der jungen Frau, um ihr möglicherweiseweiterhelfen zu können.
Eine kleine, sehr zierliche junge Frau in einem schlichten dunkelblauen Dirndl stand ihm gegenüber. Ihre blonden Locken waren zu einem dicken Zopf geflochten, der ihr schwer über die schmale Schulter fiel. Sie blickte ihn mit ihren grauen Augen an, und er sah, dass eine leichte Röte in ihre Wangen stieg. Schnell schlug sie die Augen nieder; doch dieser eine kurze Moment hatte sein Herz schon zum Klopfen gebracht.
»Was brauchst? Ich bin der Johann«, stellte er sich etwas ungelenk vor und spürte nun seinerseits, dass er rot wurde.
»Ich bin die Margarete«, antwortete sie schlicht. »Ich bräuchte Samen für einen Feldsalat und ….«, sie verstummte und blickte ihn wieder an, »… .und …. ach ja, die Löwenmäulchen da!«
»Hast du nur einen kleinen Garten daheim?«, fragte er, nur um überhaupt irgendwie mit ihr im Gespräch zu bleiben.
Sie schüttelte den Kopf. »Das ist nicht für mich, sondern für die Herrschaften da oben im Häusl an der Kottmüllerallee. Ich helf da ein wenig aus.«
Als Ohlstädter hatte Johann keine Ahnung, wo das war; es erfüllte ihn aber mit großer Erleichterung, dass er nun wusste, wo er nach ihr suchen konnte. Denn dass er sie wiedersehen wollte, war für ihn schon jetzt sonnenklar.
»A, as Haus, des da Xaver Streibl baut hod«, rief der Großvater dazwischen. »des hod a scheene Lagn do obn, aba koan Abort und koa Elektrisches, hob i g’hört!«
Margarete lachte. »Ja, das stimmt, aber schön ist’s da oben; die Frau Münter und ihr Mann richten das wunderbar her!«
Inzwischen war der Max dazugekommen und händigte Margarete die Sämerei und die Löwenmäulchen aus. Beim Bezahlen warf sie einen kurzen Blick in Johanns Richtung, sagte »Pfiadi« und wandte sich dann sehr rasch zum Gehen.
»Des wissts fei scho, dass des a Russ is, der da oben mit der jungen Malerin wohnt … und verheirat san die zwoa a ned!«, berichtete der Großvater, bevor er sich wieder einer frischen Brezn und seinem Bier zuwandte.
»Das war die Tochter vom Sonnbichlerbauern, die Margarete. Die hat dir gefallen, gell?«, neckte der Max seinen Freund Johann später. Der Sonnbichlerhof war eines der größten und reichsten Anwesen in der Gegend.
Ja, die Margarete hatte Johann Reintaler ausgesprochen gut gefallen, und wenn er am Abend nach harter Arbeit in der väterlichen Schreinerei müde in seinem Bett lag, konnte er trotz dieser Müdigkeit lange nicht einschlafen, weil er immer die Margarete mit ihrem feinen Lächeln und ihrem dicken blondenZopf vor Augen hatte. Wie sollte er es anstellen, sie wiederzusehen?
»Überleg nicht so viel, geh einfach mal hinauf zu dem Haus, wo die Künstler wohnen, und schau, ob s’ da ist«, empfahl ihm seine Schwester Gundl, der er sich anvertraut hatte.
So nahm der Johann unter dem Vorwand, dass er seinem Freund Max noch einmal helfen müsse, sich eines Nachmittags etwas früher frei und fuhr mit seinem Motorrad hinüber nach Murnau, überquerte südlich des Orts die Bahnlinie und tuckerte hinauf zur Kottmüllerallee.
Die Mutter vom Max, die als Geschäftsfrau immer auf dem neuesten Stand war, hatte ihm erzählt, dass das Fräulein Münter, eine Malerin aus München, gerade dabei war, das Haus zu kaufen.
»Die hat anscheinend das Geld! Ihr Liebhaber, der Russe mit der Brille, bei dem man an der Sprache schon noch merkt, woher er kommt, hat sie angeblich überredet, dass sie’s kauft. Der war früher schon öfter hier in Murnau mit zwei andere Künstler. Ja, was macht eine Frau nicht alles aus Liebe!«
Nun stand Max vor dem dreigeschossigen Haus mit dem Walmdach, das ein wenig an ein altbayerisches Gebirgshaus erinnerte, und blickte sich um.
Von Margarete war weit und breit nichts zu sehen, und er hatte etwas Scheu, dort einfach an die Tür zu klopfen. Wie redete man denn mit Künstlern ausMünchen, die sicher sehr gescheit und vielleicht auch noch dazu etwas verrückt waren? In diesem Moment trat eine junge Frau aus dem Haus und rief nach oben in den ersten Stock, wo ein Fenster weit geöffnet stand:
»Wassja, ich säe jetzt schnell den Feldsalat aus, dann komme ich wieder zu dir hoch.«
Ein bärtiger Mann mit Nickelbrille erschien am Fenster und winkte ihr zu.
»Ist gut, Ella!«
Nun hatte die junge Frau Johann entdeckt. Sie schirmte mit der Rechten ihr Gesicht gegen die Sonne ab und trat auf ihn zu.
»Ich bin die Gabriele Münter. Grüß Gott. Sie kommen sicher wegen dem Fußboden in der Küche?«
Johann hatte sich eine Malerin ganz anders vorgestellt als diese schlicht gekleidete Frau, die ein ähnliches Dirndl wie die Margarete trug, Erde an den Händen hatte und ihr Haar etwas wirr und lose zurückgesteckt trug.
»Nein, nein, nicht wegen der Küche«, stammelte Johann. »Ist die Margarete da?«
»Margarete, Besuch für dich«, rief die Malerin, und dann stand sie in der Tür, seine Margarete, und lachte ihn an.
»Ich hab mir schon gedacht, dass du kommst.«
Nachdem Margarete den Abwasch in der Küche erledigt und der Frau Münter noch ein paar Ratschlägewegen des Feldsalats gegeben hatte, saß sie so selbstverständlich hinten auf Johanns Motorrad auf, als hätte sie das schon ganz oft in ihrem Leben gemacht, und sie fuhren zum See, über Seehausen ganz hinunter bis zur Seespitze. Von dort aus hatte man einen schönen Blick hinüber zur kleinsten der sieben Inseln des Staffelsees, der Jakobsinsel. Nach einem wiederum sehr heißen Augusttag kamen nun langsam etwas Abendkühle und ein leichter Wind auf, und Johann breitete seine Motorradjacke aus, damit Margarete nicht auf dem schon etwas feuchten Gras sitzen musste. Sie unterhielten sich über dies und das, und das Gespräch floss so locker und leicht dahin, als würden sie sich schon lange kennen. Johann erzählte von seiner Arbeit in der Schreinerei, wie stolz er auf sein Motorrad sei, auf das er so lange gespart hatte, und schließlich noch von seiner Schwester Gundl, die mit sechs Jahren Kinderlähmung gehabt und seitdem eine Schiene und einen orthopädischen Schuh tragen musste und oft große Schmerzen hatte. Margarete erzählte vom Hof daheim, von der Strenge des Vaters, dem man ganz selten etwas recht machen konnte, und von der Mutter, die sie unterstützt hatte, als sie den Wunsch geäußert hatte, auch einmal woanders zu arbeiten als immer nur daheim auf dem Hof.
»Eigentlich wollte die Mama, dass ich oben in der Seidl-Villa arbeite, damit ich das herrschaftliche Leben kennenlerne, aber dann ist die Frau Münter gekommen und war so hartnäckig, dass der Mama nichts mehr anderes übrig geblieben ist«, erzählte sie.
Aus der Abenddämmerung wurde langsam eine der letzten lauen Sommernächte, und schließlich legte Johann seinen Arm um Margarete, zog sie an sich und küsste sie. Sie erwiderte seinen Kuss, dann jedoch sprang sie rasch auf und rief erschrocken: »Ich muss heim, ich bin ja schon viel zu spät dran!«
Murnau 27. Oktober 1925
Als Heinrich Bieder am nächsten Morgen wieder an seinem Schreibtisch saß, dachte er bei sich, dass diese ganze traurige Liebesgeschichte, die ihm seine Hilde am gestrigen Abend erzählt hatte, zwar recht interessant, aber für seine Ermittlungen eigentlich nicht von Belang war. Es war für ihn kein Zusammenhang herzustellen zwischen dieser Liebe damals und dem Mord von gestern.
Nachdem er sich aus seiner Thermoskanne noch eine Tasse brühend heißen sehr starken Kaffee eingeschenkt hatte und diesen zusammen mit einem Rosinenweckerl genossen hatte, rief er in derGerichtsmedizin in München an.
»Ja, was glauben denn Sie«, schnauzte ihn der dortige Professor Doktor Doktor, dessen Namen Bieder sich nie merken konnte, an.
»Wir sind doch schließlich keine Nachtarbeiter. Der Herr Reintaler liegt in der Kühlung und ist heute Nachmittag dran. Ich melde mich, guter Mann!«
Etwas ratlos lehnte sich Bieder zurück und ließ seine Gedanken weg vom Fall zur schönen Gundl Reintaler und zum heutigen Abendessen – Bratwürstl mit Kraut – schweifen, als der kleine Pfleiderer die Amtsstube betrat.
»I hätt da einen Hinweis für di«, meinte er.
»I hab g’hört, dass der Reintaler beim Sigi Kammleitner hohe Schulden hod. Spielschulden! Schafkopf! Es soll um mehr als 500 gehn! Du woaßt scho, wen i mein, den Sigi Kammleitner vom Goldenen Hasen. Die zwoa solln erst letzte Woch schwer mitananda g’stritten und sogar g’rauft habn.«
Der Goldene Hase, ein ziemlich heruntergekommenes Gasthaus zwischen Ohlstadt und Murnau, war bekannt als Treffpunkt der im Leben Gescheiterten, der Säufer und der dem Spiel Verfallenen. Sigi Kammleitner, der Wirt dieses Boasls, hatte vor Jahrzehnten mit großen Plänen den Hasen eröffnet und edle Wildgerichte und exquisite Weine angeboten. Dann war seine Frau mit einem durchreisendenItaliener durchgebrannt, und innerhalb nur weniger Jahre war die gehobene Gastwirtschaft zum Boasl verkommen. Jetzt gab es nur noch Bier, Klaren, die Kehle verätzenden Obstler und, falls wirklich mal einer Hunger hatte, Würstl mit Senf.
»Da fahren wir jetzt hin!«, beschloss Bieder, und nachdem der kleine Pfleiderer noch einen großen Schluck von Hildes Kaffee aus der Thermoskanne zu sich genommen hatte, machten sie sich auf den Weg.
»Aber i glaub, dass der no schlaft«, gab Pfleiderer im Auto zu bedenken. »Es is ja erst später Vormittag!«
»Umso besser!«, meinte Bieder, in dem mittlerweile große Hoffnung aufgestiegen war, dass der Kammleitner so ohne Frühstück und unausgeschlafen auf der Stelle den Mord an seinem Schuldner gestehen würde. Wäre das schön, dachte Bieder, und in Gedanken begann er schon seine Briefmarken zu sortieren.
Doch der kleine Pfleiderer hatte sich getäuscht. Ein offensichtlich gut ausgeschlafener Kammleitner, der überhaupt einen erstaunlich gepflegten und gestriegelten Eindruck machte, empfing sie. Nur die dicke rot geäderte Knollennase und der immens aufgetriebene Bauch deuteten darauf hin, dass der Sigi Kammleitner sich hauptsächlich von Bier und Härterem ernährte.
»Meine Herren«, empfing er sie leutselig, »wie kann ich helfen? Ich hab bereits von dem großen Unglückgehört, das den Reintaler ereilt hat, und hab mir schon gedacht, dass Sie kommen. Aber ich sag’s Ihnen gleich, ich hab mit der Sache nichts zu tun. Er wollte mir nämlich die Schulden in den nächsten Tagen zurückzahlen, das hat er versprochen. Ich hab auch gar nicht viel Zeit für Sie, ich hab gleich einen wichtigen Termin in Murnau!«
»Soso, einen Termin«, meinte Bieder ein wenig lakonisch. »Und nichts haben Sie zu tun damit? Aber uns ist berichtet worden, dass ihr zwei heftigen Streit und sogar eine körperliche Auseinandersetzung gehabt habt.«
Sigi Kammleitner lächelte. »D’ Leut übertreiben halt gern, wissen S’! Der Johann war eine arme Sau, ein Krüppel mit seiner kaputten Hand, dem das viele Bier das Gehirn vernebelt hat. Der hat sich beim Kartenspiel nicht mehr in der Hand gehabt und sich total überschätzt. Ein, zwei Mal hat er ja wirklich gewonnen am Anfang, und ab da hat er sich halt gedacht, dass er der große Maxe ist. Ständig hat er das falsche Blatt gespielt und dann auch noch behauptet, dass die anderen bescheißen. Lang hab ich ihm seine Schulden gestundet, aber irgendwann hat’s halt dann gereicht trotz all dem Mitleid, das ich mit ihm und seiner armen Schwester hab.«
Und er erhob sich, griff nach seiner Trachtenjoppe und wandte sich zum Gehen.
»Ich hab jetzt ein ganz wichtiges Treffen in Murnau, Sie entschuldigen mich!«
»Was is denn des für a wichtiges Treffen?«, wollte der kleine Pfleiderer nun wissen.
Sigi Kammleitner lächelte dem Pfleiderer frech ins Gesicht.