
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Unwillig schlenkert Friedemops mit den Beinen, dort oben auf dem Milchbock, von wo er den Ferienbus als Erster sehen kann. Wenn erst der Borstel, dieser fremde Lümmel, und die Mädchenzicke da sind, dann bin ich Nebensache bei Tante Doris, eine Null, abgemeldet, ausgebootet. Aber die … die sind obenauf! Mir hat sie noch nie eine Torte gebacken, und denen gleich so ein Riesendingsbums, mit Aufschrift aus Marzipan! Aber die sollen mich kennenlernen, diese … diese Tante-Doris-Klauer ... Und schon stehen alle Segel auf Sturm, obwohl die Ferien doch gerade erst begonnen haben. Verfolgungsjagden sind unvermeidlich, glitzergrüne Gespenster geistern herum, und Friedemops wird sogar vom Erdboden verschluckt. Doch sehr bald erweisen sich die vermeintlichen Gegner Borstel und das Pferdemädchen Evelyn — die wir ja bereits aus den „Sommerkindern von Ralswiek“ kennen — als ebenso tolle Ferienfreunde wie die wirblige Katharina und der staksbeinige Eckart aus „Brücke, Boot und Bienenhaus“. In dieser neuen Abenteuergeschichte führt Gerhard Dallmann die unternehmungslustigen Jungen und Mädchen zusammen, lässt sie kräftig aneinandergeraten und sich schließlich gegenseitig schätzenlernen. Wen kann es da noch wundern, dass eine modrige Höhle eine wichtige Rolle spielt oder eine Torte zum Fußball wird? Ja, sogar ein echtes Schiffswrack wird entdeckt. Die prallen Sommererlebnisse der fünf finden in einer Zirkusvorstellung ihren Abschluss mit einer richtigen Sinfonie, der Blechpottsinfonie in Blech-Moll: Töpfe, Tiegel und Deckel aller Größen, geordnet, wie es die Partitur vorschreibt, nämlich Klimperdeckel rechterhand, zwei Fünf- und Zehnlitertöpfe in der Mitte und links die hölzerne Waschbütte und die beiden neuen Mülltonnen, dazu Tante Doris’ Waschbrett. Dann pingelt es und schetterengt, dann dröhnt es und kollert. Und aus allem hervor erhebt sich eine Melodie, das Lied von einem ganzen Sommer voller Abenteuer.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Impressum
Gerhard Dallmann
Das Blechpottorchester
Eine Feriengeschichte
ISBN 978-3-95655-019-5 (E-Book)
Die Druckausgabe erschien erstmals 1988 in der Evangelischen Verlagsanstalt GmbH, Berlin
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
© 2014 EDITION digital®Pekrul & Sohn GbR Godern
Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.ddrautoren.de
1. Kapitel
Als Friedemops den von niedrigem Buchsbaum eingefassten Gartenweg entlanghüpfte, raschelte es plötzlich neben ihm auf. Eine Schlange? Ein Junghase? Lauschend blieb er stehen. Er hielt den Atem an. War da nicht etwas unter der Buchenhecke? Ja doch! Wieder raschelte es. Halt! Pssst!
Der Junge hockte sich nieder. Gespannt bohrten sich seine Augen und Ohren in das Gesträuch. Was kann das nur sein? Vielleicht ein Igel? I wo, Igel wuseln abends und nachts herum, aber nicht jetzt, am Vormittag. Oder ein Eichhörnchen? Nein, das wäre längst auf und davon. Was kann das nur sein? Alle Möglichkeiten buchstabierte er durch. Vorsichtig bog er die Hecke auseinander, an deren Zweigen noch jetzt im vorgeschrittenen Frühling braunbleiches Laub vom Vorjahr klebte. Aufmerksam spähte er in das schattige Gewühl von Zweigen und Blättern. Hallo! Da saß es ja, nur zwei Armlängen entfernt: ein flusiger, verplusterter Jungvogel mit himmelblau leuchtenden Augen.
Oh! durchfuhr es den Jungen. Denn er befürchtete, der Vogel würde gleich das Weite suchen. Einen Augenblick überlegte er, wie er ihn am besten greifen könnte. Schon hob er die Hände. Da klappte der kleine Vogel seinen Schnabel auf, sperrangelweit, einen Schnabel, der größer zu sein schien als der ganze Vogelkopf. Eidottergelbe Ränder hatte dieser aufgerissene Schnabel.
Verwundert sah Friedemops auf das hilflose Geschöpf. Da geschah etwas Ungeahntes: Raschel-raschel ... der Vogel tappelte aus seinem Versteck heraus und machte: „Tschaik.“
Friedemops kniete nieder und hielt dem Vogel seine Hände wie offene Schalen entgegen und flüsterte dabei:
„Peity, kleiner Kerl! Dich nehme ich mit. Ja, ich sage Peity zu dir. Ich finde, der Name passt. Meinst du nicht auch? Komm, hab keine Angst.“ Und in der Stimme des Jungen lag dessen ganzes Herz.
Behutsam griff er nach dem kleinen Tier. Und das ließ sich gefallen, dass Kinderhände seinen dünnen Daunenmantel umschlossen, es aus der schattigen Kühle heraushoben und davontrugen.
In diesem Augenblick hatte Peity einen Freund für sein ganzes kleines Vogelleben gewonnen.
In Friedemops sprang das Herz auf.
„Eine Jungdohle“, jubelte er, „aus dem Nest gefallen, noch nicht flügge, gelbe Schnabelkehlen, noch kein ausgebildetes Federkleid. Das Dingelchen behalte ich!“
„Mein Peity, mein kleiner Peity“, flüsterte er immer wieder und drückte das weiche Etwas gegen seine Wange, mal links, mal rechts. Als er ihm aus Spaß gegen den Schnabel tippte, klappte der Vogel diesen auf wie einen Krokodilsrachen und schrie erbärmlich: „Tschaik, tschaik!“
Da steckte der Junge seinen Kleinfinger tief hinein in die aufgeklappte Gusche und ließ den Vogel daran zutschen.
„Ist das ein Gefühl!“, lachte er. „Wie das killert! Peity, du bist ein ganz Lieber.“
Doch nur einen Augenblick trieb er dieses Spiel. Dann begriff er: Dieser Vogel ist kein Spielzeug. Dieser Vogel braucht meine Hilfe und meinen Schutz. Unbedingt! Denn nur so konnte das jammervolle Tschaik-tschaik verstanden werden. Friedemops war ein verständiger Junge. Rasch lief er zurück ins Haus, während er das kleine Wesen schützend an seiner Brust barg. Mit dem Ellbogen drückte er die Klinken, mit dem Fuß stieß er die Türen auf, mit dem Hintern schob er sie zu. Er setzte das zarte Stückchen Leben auf Mutters Küchentisch ab und überlegte: Was kann ich für meinen kleinen Freund stibitzen? Der will doch tüchtig fressen.
Brot? Nein. Vielleicht aufgeweicht? Nein, Brot bläht. Ein bisschen vom Gehackten? Ist zu fett. Im Garten Goldrandkäfer fangen und vorkauen? Äksebäkse! Zuletzt fiel ihm das Weckglas ein mit den Regenwürmern für Herrn Dorémis Angel. Ja, Regenwürmer, die sind gut. Aber vorkauen? Wie eine Vogelmutter es getan hätte? liii, nee!
Mit schräg gelegtem Kopf betrachtete er seinen Schützling. Etwas ratlos blickte er drein, die Unterlippe vorgeschoben, wollte er doch helfen, unbedingt helfen.
„Was kann ich dir nur geben, Peitylein. Sag’s doch selber!“, bettelte er.
Der Vogel aber gab keine Antwort. Er bewegte sich auch nicht mehr, ein jämmerlicher Anblick. Seine schönen Augen blickten nur noch traurig, bitter traurig. Entkräftet kauerte er auf Mutters geblümter Wachstuchdecke. Oh, hätten seine Augen weinen können, sie hätten’s getan. Bestimmt. Friedemops betrachtete ihn mit wachsender Angst. Plötzlich riss es ihn hoch:
„Peity, bleib brav sitzen, ja? Ich will was holen. Ich will, dass du durchkommst.“
Flugs sprang er hinaus und brachte das Glas mit Piratzen. Er fischte eine der kleinsten heraus, ein kringelndes, rosarotes Würmchen, und hielt es dem Vogel vor die Nase. „Tschaiktschaik-tschaihaik!“, wurde das Vögelchen da lebendig. Aufgeregt versuchte es ein paar tollpatschige Schritte und schlug mit den Flügelstummeln, aus deren Spulen die ersten blauschwarzen Flaumwimpern herausstießen. Der Vogel war Hunger und Fressgier in einem. Rasch, und wenn es ihm noch so gottlästerlich vorkam, riss Friedemops den Wurm in kleine Stücke und stopfte diese, eins nach dem andern, dem Peity in den Schnabel, tief hinein in den nimmersatten Schlund. Und manchmal schob er noch mit dem Kleinfinger nach.
„Mann, bist du verfressen!“, jauchzte der Junge auf. „Warte, kriegst Nachschub!“ Und ein zweites, dickes, fettes Würmchen wanderte auf die gleiche Weise in den Vogel hinein. Es war einfach nicht zu glauben, was der kleine Vogelmagen fassen konnte.
Endlich hatte Peity genug. Mit wohligem Tschai-gollgoll, halb gegurgelt, halb verschluckt, schloss er die Augen. Und zum Zeichen dafür, dass er satt war, legte er ein Fätzelchen weißkalkigen Brei unter sich auf den Tisch.
„Ei, Peity, hast geschietert! Prima. Lass man, ich wische das gleich ab. Üst nücht schlümm, üst doch alles mönschlich“, tröstete er und zerwischte mit Mutters Küchenhandtuch, was nicht auf den Tisch gehörte.
„Und jetzt kriegst du dein Nest. Warte hier, ich komme gleich wieder. Und fall mir nicht vom Tisch!“
Diese fürsorgliche Ermahnung hätte Friedemops nicht zu geben brauchen. Der kleine Vogel war viel zu müde, um sich zu bewegen. Die Schlafhaut überzog schon seine Äugchen. Indes sprang Friedemops in den Garten hinunter, rupfte vom Rasen frisches Gras, drückte es in einen Schuhkarton weich und mollig, und wieder oben angelangt, setzte er Peity hinein und sagte:
„So, und jetzt gehörst du zu mir.“
Es war beschlossene Sache. Noch einmal strich er dem Tierchen sacht über den kleinen Vogelkopf, ganz, ganz zart, hob den Schnabel vorsichtig in die Höhe und redete ihm gut zu. Schließlich trug er den Schuhkarton in sein Zimmer hinauf und suchte einen geeigneten Platz aus, der so sicher war wie ein Vogelnest.
Friedemops entschloss sich rasch. Er fand, auf dem Nachttisch stehe Peity am besten. Da hatte er ihn nachts in greifbarer Nähe, falls ihm etwas ankomme. Ein paar Wochen wird er brauchen, um fliegen zu können. Das wusste der Junge. Bis dahin hatte er sich um ihn zu kümmern. Dann aber wird er ihn loslassen, hinaus aus der Enge, hinein in Gottes große Freiheit. Dorthin gehörte er ja. Einsperren? Nein, das gibt’s nicht. Bei aller Liebe.
Damit ließ er den Vogel allein, der, satt und müde, bereits eingeschlafen war.
Friedemops, der zehnjährige, gewitzte junge, lief wieder hinunter in den Garten, den buchsbaumumstandenen Steig entlang, über die Straße, durch die Ahornallee, hin zur Wiese, vorbei an der Grünfläche mit dem Fußballtor und hinein in den Wald, auf dessen Baumkronen die Kormorane horsten. Er hatte vor, an seiner Laubhöhle weiterzubauen. An einer Höhle aus Riesenmengen von Buchenlaub und Kirschenblättern. Die hatten Winter, Regen und Schnee zu dicken Fladen zusammengeballt. Und so gaben sie nun, feucht und modrig, ein vorzügliches Baumaterial ab. Hellauf jauchzte der Junge an diesem herrlichen Morgen. Der zum Himmel steigende Vogelsang aus viel Hundert Kehlen und die Sonne am wolkenlosen Himmel dazu und alles und noch viel mehr füllten seine Brust und ließen ihn singen:
„Ich habe einen Freund, Ich habe einen Vogelfreund. Peity heißt er. Vielleicht beißt er.“
Und musste über sich selbst lachen und über seinen Reim. Mit Riesensprüngen, flink wie eine Gazelle, setzte er in den Wald, den im Süden die Wiesen der LPG begrenzten, im Norden aber das „große Wasser“, wo das Schilf rauscht und wo im Röhricht die Stockenten schnaken und sich ducken, wenn über ihnen die Kormorane wie Geistervögel zu ihren Horsten streichen, zu den toten Buchen des Uferwalds.
An dieser Höhle hatte der Junge nun schon viele Tage gebaut, gearbeitet, schwer gearbeitet mit einem Eifer, der kaum zu übertreffen war. Schubkarre um Schubkarre voller Laub hatte er zusammengefahren, mit der Forke gehäuft, mit seinem Körpergewicht unter Hopsen und Springen und Stampfen zusammengepresst und zuletzt einen Raum darin geschaffen, sozusagen eine Stube, wie Maulwürfe sie haben, nur viel, viel größer. Damit Gang und Stube aber nicht zusammenbrechen konnten, hatte er alles fein sorgsam mit Stämmchen und Ästen abgestützt.
Von hier aus wollte er die Kormorane - seine Kormorane - beobachten. Im Mai, wenn sie die Jungen füttern.
Inzwischen war der Sommer ins Land gezogen. Lange schon standen die Bäume in vollstem Grün, im Schilf fiepten lustig die Entenjungen, und in Sand und Gras und im Unterholz wimmelte es nur so von verborgenem Leben, von Würmern und Käfern und all dem Kribbelkrabbelzeug, das man erst entdeckt, wenn man sich auf die Erde packt und genauer hinsieht. Vergessen war die Zeit der Anemonen und des blühenden Sauerklees. Gekommen war der Sommer und für Friedemops die Zeit, das Leben im Wald und am Ufer des „großen Wassers“ mit seinem ganzen Reichtum aufzunehmen.
Nun, da die Höhle fertig war, bezog er sie zusammen mit seinem Freund Peity und nannte die Höhle Midigonda. Midigonda, das durfte alles sein, was es auf der Welt gab. Alles. So wollte es der Junge. Der blau leuchtende Federspiegel des Eichelhähers durfte es sein wie der trockene Trompetenstoß des wachsamen Bleßhuhns, die erste Kirsche am Baum ebenso wie eine Flötenstunde bei Herrn Dorémi. Alles durfte Midigonda sein.
Als seine Eltern es spitzkriegten, dass Midigonda nichts und alles bedeutete, wollten sie sich das erklären lassen. „Denn“, sagte die Mutter, „ein Ding kann doch nur immer ein Ding sein und eine Sache nur immer eine Sache.“ Und wie waren die Eltern verblüfft, als er ihnen antwortete:
„Midigonda ist alles, was man lieb haben kann. Ich habe eben alles lieb.“
Darum war auch Friedemopsens Höhle Midigonda.
Friedemops hatte seine Midigonda-Höhle so vorzüglich getarnt, dass kein Mensch, und stünde er nur eine Armlänge von ihr entfernt, ihrer gewahr werden konnte. Nur ein winziges Schlupfloch hatte er gelassen, für das Hinein und Hinaus. War er drinnen, stopfte er den Zugang hinter sich zu, wie eine Biene ihre Wabe zudeckelt. Ja, manchmal rätselte er selbst, wo der Eingang überhaupt war, obwohl er davorstand. Dann war er auf sein Werk besonders stolz. Wusste er doch, nur auf diese Weise blieb seine Höhle unentdeckt. Denn es führte nur wenige Meter neben dem Eingang der Trampelpfad zum Ufer vorbei.
Von klein auf musste sich Friedemops allein beschäftigen, denn er wuchs ohne Geschwister auf. Doch da er immer etwas vorhatte, las, bastelte oder auf seiner Flöte übte, kannte er keine Langeweile. Nun teilte er seine Tage mit seinem Peityfreund. Oh, mit dem ging es lustig zu, denn der kleine Vogel zeigte alle Kaspereien, wozu ein Vogelkasper überhaupt nur fähig ist. Kaum, dass er über den Kartonrand schauen konnte, ging es los. Und eines schönen Tages fand er seinen Weg über seine Schuhkartonwiege hinaus. Da lag eine weite, weite Welt für ihn offen da, sie lag sozusagen zu seinen Füßen. Da gab es Friedemopsens Bett. Wie herrlich ließ es sich an den Kissenfusseln zupfen und lange Fäden ziehen. Oder den Fußboden mit Teppich und Bettvorleger, einem wunderbar molligen Lammfell, weiß und kuschlig. Da gab es allerlei zu zerren und zu rackern. Und wenn er sich mit den Krallchen in dem Wollgezunzel verhedderte, geriet er erst richtig in Fahrt. Hei, war das schön. Schließlich gewann er das ganze Kinderzimmer für sich und nannte es fortan sein eigen. So konnte er seinen Unfug treiben nach Herzenslust. Wenn Friedemops ihn ausschimpfte, legte er seine Federn an und schämte sich.
„Muss so ein dummer kleiner Vogel Friedemopsens Waschtoilette aufräumen? Muss so ein dummer kleiner Vogel Zahnpastatuben aufhacken? Muss so ein dummer kleiner Vogel Bürstenborsten abknabbern und in die Seife Zacken hämmern?“
Und vieles andere gab von einem jugendlichen Überschwang Zeugnis, wie die zahlreichen hier und da liegenden weißen Kalkhäufchen bewiesen, überall dort, wo man sie am wenigsten wünschte, auf einer Stuhllehne, auf einem handgeknüpften Kissenbezug, auf dem eben gewaschenen Sonntagshemd, auf dem geliehenen Lesebuch aus der Schulbücherei ... O Peity!
Doch seinen Mopsfreund störte das kaum. Der sagte zu allem nur: Peity macht Midigonda. Eines Tages hatte Friedemops eigens für Peity eine Fliegenzuchtanstalt angelegt. Und die funktionierte vortrefflich. Seinem Freund und Lehrer, dem Herrn Dorémi, erzählte er davon:
„Fliegen muss man züchten. Sonst hat keiner was davon. Da habe ich neulich einen dicken Brummmer und ein Pärchen eingefangen. Und das Pärchen habe ich zu dem dicken Brummer gesetzt. Jetzt stecken sie in einem Glas, das halb voll Erde ist. Damit sie sich wohlfühlen, habe ich ihnen eine Löwenzahnpflanze dazugesteckt. Füttern tue ich sie mit Wurscht. Vati hat mir geraten, faules Fleisch rein zu tun, damit sie ihre Eier da ablegen können. Der dicke Brummer hat gleich einen ganzen Haufen produziert, immer hinten raus - pft - pft - pft.
Jetzt kriege ich Fliegenjunge. Und die brauche ich für Peity, fett und rund. Und die ich nicht brauche, lasse ich frei. Das ist meine Fliegenzuchtanstalt.“
Peity speiste auch dann und wann mit zu Tisch. Hier bekam er sein Fleischchen, seinen Rotkohl, seine Kartoffeln. Und hier patschte er in die Soßenschüssel. Die Eltern machten große Augen dazu, und Mutter musste mehrmals nachwischen. Erfreut war sie darüber zwar nicht gerade, von Zeit zu Zeit zeigte sie ihren Unwillen über Peitys Tischmanieren auch recht deutlich. Andererseits wollte sie ihrem Jungen dieses Vergnügen doch nicht nehmen, darum ließ sie es schließlich mit Stirnrunzeln zu.
Feity verstand es auch, auf dem Notenständer zu hocken. Und wenn ihm die Flötenmusik seines Mopsfreundes durch die zarten Vogelnerven sägte, zerfledderte er die Notenränder. Eifrig half er Friedemops beim Lösen der Schulaufgaben. Dazu biss er in den Schreiber, zerpickte die Hefte, zerhackte Buchrücken und sagte am Ende: „Tschaik.“ Manchmal balgte er sich auch mit dem Razzifummel herum, dem ekelhaften, zähen und unnachgiebigen Vieh. Er hämmerte auf ihm herum, ohne auch nur ein einziges Fluderchen ausbeißen zu können. Dann wuchs seine Wut, und ärgerlich stob er mit gesträubtem Gefieder davon.
Als Peity eines Tages aufräumte, fand er eine bunte Blechschachtel, klein und zierlich. „Tschaik“, machte er neugierig und versuchte sie zu öffnen. Als aber nach längerem Bemühen der Deckel noch immer nicht aufspringen wollte, verpasste er ihr einen so kräftigen Vogelkrallentritt, dass sie zu Boden fiel. Pelleng-pelleng. Hopp, schepperte der Blechdeckel ab. Was kullerte da heraus? Lauter kleine, weiße Porzellansteinchen: Friedemopsens fleißig und vollzählig gesammelte Milchzähne rollten und klapperten über die Dielenbretter und blieben schließlich verstreut liegen. Vom ersten bis zum letzten waren sie in dieser Blechschachtel aufbewahrt worden.
„Tschaik“, rief Peity erschrocken und pickte sie rasch auf, einen wie den anderen schluckte er in seinen Kropf und flüchtete mit seiner Beute aufs Fensterbrett. Aber als sie ihn gar so sehr drückte, spuck-spuck-stips, gab er sie wieder von sich, der Reihe nach, in langer Kette sorgfältig aufgezogen und miteinander verbunden durch einen glänzenden sabbersilbrigen Spuckfaden.
„Tschaik!“
Am liebsten aber jagte er seinen Fliegen nach, den dicken, fetten Fliegen aus Friedemopsens Superfliegenzuchtanstalt. Und im Jagen konnte er so wunderbar Blumenvasen umstoßen und Zahnputzbecher zerknallen. Das war Peity.
So hatte Friedemops einen Freund gefunden, mit dem er viele Stunden des Tages fröhlich teilte. Peity durfte ihn begleiten, wo immer es möglich war. Kehrte Friedemops mit dem Rad aus der Schule zurück, wartete Peity bereits auf der Höhe eines Lichtmastes auf ihn. Dann jagte er seinem Freund im Sturzflug entgegen, krallte sich an dessen Schulter fest und ließ sich mit Juchhe und Getschaike durch Feld und Wald kutschieren, dass es einfach eine Lust war. Einfach so. Und für den Jungen waren das Zeiten unendlicher Glückseligkeit. Was sie sich in die Ohren tuschelten, wird ein Geheimnis bleiben. Peity vielleicht von fetten Regenwürmern und Friedemops von einem Deutschaufsatz. Wer weiß. Aber eines war gewiss: Sie verstanden sich. Einmal wurde Friedemops von seiner Mutter gefragt:
„Sag mal, ist dein Peity eigentlich ein Er oder eine Sie?“
„Alles kann der oder die sein“, gab der Junge darauf zur Antwort. „Nur Peity nicht und Midigonda. Die beiden sind einfach sie selber.“
„Aha“, sagte die Mutter. Nun, sie wusste auch jetzt nicht mehr als vorher. „Aber wen du lieber hast, deine Dohle oder deine Höhle, das kannst du mir doch sagen.“
„Mamchen“, antwortete er, „die Höhle habe ich gemacht. Peity aber hat mir der liebe Gott geschenkt. Nun weißt du, was mir lieber ist.“
Selbstverständlich bewohnten die Freunde die Höhle Midigonda gemeinsam. Vor dem ersten Einzug wurde eine Ordnung festgelegt, nach der Peity sich zu richten hatte. Dazu gehörte auch das Einsteigen. Das geschah so: Friedemops schaufelte mit den Händen den Eingang frei, sodass ein kleines Loch im Laub entstand, groß genug, um in die Höhle schlüpfen zu können. Zuerst steckte er Kopf und Schultern hinein, zog den Körper unter Strampeln und Hampeln nach, bis er schließlich mit Bauch und Hintern und Beinen völlig drin war. Hier drehte er sich um und konnte nun hinausblicken. Peity hatte so lange still auf einem nahen Ast zu warten und durfte sich erst bewegen, wenn Friedemops nach ihm rief: „Peity, komm!“ Dann aber schoss er heran, ein kleiner, schwarzer Teufel, um - husch - in dem Laubloch zu verschwinden. Friedemops scharrte darauf den Durchschlupf wieder zu bis auf einen winzigen Durchguck, der für Licht und Luft notwendig war und zum Beobachten der Kormorane ... und der Feinde, wenn sich welche nähern sollten.
Nun also - der Sommer war ins Land gezogen und mit ihm die lang ersehnten Schulferien. Heute war ein Ferientag, wie man ihn sich nur wünschen konnte. Wohlig wärmend lachte die liebe Sonne vom Himmel herab. Weiße, bauschige Wolkenschiffe standen über der Welt und schauten träumend auf die Erde. Sie mochten nicht mehr weitersegeln. Selbst der Wind hatte zu blasen vergessen oder war außer Landes gezogen. Kein Hauch. Mittagsstille. Eingeschlafen waren auch die Segelboote auf dem „großen Wasser“. Kormorane dösten auf den Köpfen der Reusenstangen und ließen mit gespreizten Schwingen ihr Gefieder trocknen. Glänzend wie ein Fotobild gab der breite Strom die Ufer wieder. Alles schlief. Nur im Wald webte ein bisschen Leben. Der tinktinkende Buchfink übte sich an einem neuen Endschluchzer mit Überschlagtriller, der Zilpzalpzalpzilp mühte sich vergebens, seine beiden Namenssilben gesellschaftsfähig zu ordnen, das Schnarren der Saatkrähen irgendwo hoch oben, im Uferschlamm ein Frosch ... quark-bräkäkäk ... War das ein Sommertag! War das ein Ferientag! Heia!
Friedemops plagten keine Pflichten mehr. Die Schule lag hinter ihm. Der Tag gehörte ihm ganz, vom frühen Morgen bis zum späten Abend.
Aber, aber ... So schön dieser Tag auch war, es trübte ihn doch der Schatten eines großen Kummers. An diesem Tag wurden die neuen Feriengäste erwartet. Gleich nach dem Mittagessen würden sie mit einem Sonderbus anreisen. Friedemops war zum Heim hinübergegangen. Er wollte sich die beiden Kinder ansehen, von denen Tante Doris seit Tagen, ja seit Wochen unentwegt sprach. Den Jungen, der Borstel heißen sollte, und das Mädchen Evelyn. Um auf sie heimlich zu lauern, war er auf den Milchbock geklettert, der vor dem Eingang des Ferienheims stand.
Da hockte er nun mit tieftraurigem Gesicht und hängenden Schultern. Was hatte ihm diesen herrlichen Sommersonnentag so versauern können?
Tante Doris, seine Tante Doris ... Obwohl sie erst seit wenigen Monaten - nach dem Tod ihrer alten Mutter - hier im Heim beschäftigt war, war sie doch seine Tante Doris. Schon vom ersten Tag an hatte Friedemops in ihr eine liebevolle Freundin gefunden. Hatte sie nicht selber gesagt: Friedemopsichen, du bist mein kleiner Spatz und Küchenfreund, So hatte sie gesagt, jawohl, und manche Leckerei dazugesetzt. Ein Wurstzipfelchen, ein Puddingrestchen oder ihm den Napf mit dem Streuselgekrümel zum Ausnaschen in die Hand gedrückt. Von jenem ersten Tag an hatte er oft bei ihr gesessen und, wenn es draußen regnete, etwas auf der Flöte vorgespielt. Und sie hatte ihm von dem Wald erzählt, in dem sie früher gewohnt hatte, und von dem großen Schloss Ralswiek und von Riesenfledermäusen, die sie selber gesehen hatte, und von ihrer verstorbenen Mutter und - ja, und von ihrem Neffen Borstel. Immer war es bei Tante Doris gemütlich gewesen, in ihrer Heimküche auf dem weißen Hocker. Aber nun war alles vorbei. Alles. Denn seit gestern hatte Tante Doris nur noch von Borstel gesprochen, kein anderes Wort mehr, nur noch Borstel hier, Borstel da. Nur noch von Borstel, der zusammen mit Evelyn, die außerdem noch seine Freundin war, anreisen würde. Immer wieder sprach sie davon, wie sie sich auf die beiden freue, wie verrückt sie sich auf die beiden freue und wie schön es sei, wenn sie dann abends zusammensäßen und Evelyn auf ihrer Gitarre spiele, denn sie spiele sehr, sehr schön. Und heute - und das war das Schlimmste von allem - kam sie mit einer dicken, wagenradgroßen Torte an, die sie für die beiden gebacken hatte. Die hatte sie ihm auch noch unter die Nase gehalten, diese prächtige Torte, diese Staatstorte, dieses Meisterstück von Torte, und hatte dazu gesagt:
„Sieh sie dir an, Friedemops. Ist sie nicht wundervoll? Meine beiden lieben Kinderchen sollen sie haben, die Evelyn und mein kleiner Borstelneffe. Schmecken wird sie ihnen, denn was da alles drin verbacken ist ... t-t-t.“ Sie stupste dem Jungen in die Seite.
Friedemops zog einen Flunsch und kniff die Augen zu.
„Sie werden dir davon abgeben. Borstel ist ein guter Junge.“
„Mag nicht“, nuschelte er vor sich hin und wandte sich ab. „Lies mir doch mal vor, was ich in Marzipan draufgeschrieben habe!“
„Will nicht. Kann nicht lesen.“ Aber für sich hatte er schon längst gelesen: WILLKOMMEN - FROHE FERIEN.
Tante Doris sah in aufmerksam an: „Du und nicht lesen? Oder - ist dir was, Junge?“
„Bauchschmerzen“, flauste er und drückte sich fort. Sie rief ihm noch nach: „Soll ich dir Tee kochen, Fencheltee?“ Friedemops aber war schon zur Tür hinaus.
Daran musste er jetzt denken, als er mit Peity auf dem Milchbock hockte. Unwillig schlenkerte er mit den Beinen, und seine geknickte Jungenseele klagte: Wenn die da sind, habe ich bei Tante Doris nichts mehr zu melden. Mir hat sie noch nie eine Torte gebacken, und dann gleich so ein Riesendingsbums, mit Aufschrift aus Marzipan. Wenn der Borstel, dieser fremde Lümmel, und diese Mädchenzicke da sind, dann bin ich Nebensache, eine Null, abgemeldet, ausgebootet.
Aber die ... die sind obenauf.
Gekränkter Stolz und Wehmut mischten sich in dem Jungenherzen und wühlten so lange, bis er zu einem Entschluss kam. Dieser Entschluss hieß: Hier bin ich zu Hause, ich, Friedemops, und kein anderer. Die andern sind bloß Gäste, Urlauber, Fremde, sind Zugereiste. Von denen lass ich mich nicht verdrängen. Hier ist mein Revier. Das ist klar wie dicke Tinte.
„Peity, was meinst du dazu?“
„Tschaik!“, meinte Peity.
„Gut, Peity, gut. Aber lass jetzt das verflixte Knispeln am Ohr, du killerst mich, ich werde noch wahnsinnig.“
„Tschaik.“ Peity hüpfte auf einen der Plastkästen und putzte sich die Federn. Entschlossen schob Friedemops die Unterlippe vor, und seine Hacken droschen energisch gegen den Milchbock, dass die leeren Flaschen im Gestell nur so klapperten und klimperten. „Hier werde ich warten, bis der Bus kommt“, sagte er und ballte die Fäuste. „Dann werden wir weitersehen.“
Der Bus kam nach schier endlos langer Zeit. Schon von Weitem konnte man ihn hören. Nun, da er wirklich kam, spannte sich Friedemopsens Herz in Beklemmung und Abwehr. Er wusste, seine Widersacher würden drin sein. Wie werden sie aussehen? Sicher schick angezogen und eingebildet, wie alle Stadtkinder.
Jetzt kurvte das graue, plumpe Fahrzeug auf den Vorplatz. Da verkroch sich Friedemops hinter den Kästen, wollte er doch um keinen Preis in der Welt gesehen werden. Mitkriegen aber, mitkriegen wollte er alles. Alles. Ihm durfte nichts entgehen.
Der kleine Wachhund neben dem Eingang rackelte an seiner Kette und kläffte laut und unanständig. Da war also der Bus. Und mit ihm kamen viele fremde Leute. Endlich hatte das tatenlose Warten ein Ende. Was Friedemops von nun an beobachtete, hielt ihn in ständig wachsender Spannung:
Die Haustür flog auf, Tante Doris fegte heran, nahm mit hurtigen Tritten die Stufen zum Hof, rauschte am Kläffköter vorbei und schoss dem Bus mit ausgebreiteten Armen entgegen:
„Hallo, hallo!“, rief sie, reckte den Hals und zog weite Kreise um das Fahrzeug, um ihren Lieblingen zuzuwinken.
Jetzt trat auch der Heimleiter aus dem Haus, aber der blieb in einiger Entfernung stehen. Eigentlich wollte er als Erster seinen Gästen nach ihrer langen Reise ein herzliches Willkommen entbieten. Das tat er stets, um den Neulingen vom ersten Augenblick an das Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln. Tante Doris geriet ihm heute dauernd dazwischen. Sie schob ihn ein paarmal regelrecht von der Tür fort und drängelte sich den Aussteigenden entgegen:
„Weg da, weg da, ich muss da rein!“
Doch wie sie auch schob und quetschte, die hinausquellende Menge lufthungriger Menschen überschwemmte sie einfach. So blieb ihr nichts anderes übrig, als hübsch draußen zu bleiben, auch wenn es ihr noch so schwerfiel vor Tanten- und Erwartungsglück.
Die Ankömmlinge rekelten und reckten sich, warfen die Arme wie Windmühlenflügel und riefen einander zu: „Frische Luft! Haaach! Riecht sie nur! Waaald, Waaasser …!“
Indes kauerte Friedemops hinter seinen Milchkästen und erlauschte und beobachtete alles. Eine lange Reise mussten die hinter sich haben. Die Stadt, aus der der Bus gekommen war, lag weit unten im Süden.
Jetzt verfolgte der Junge, wie der Heimleiter die Neulinge begrüßte, jeden einzeln und mit herzlichem Händeschütteln.
„Willkommen, willkommen in Niederhof. Haben Sie eine gute Reise gehabt? Schön, dass Sie gekommen sind ...“ Und was er sonst noch alles sagte.
Immer mehr Leute spie der Bus aus. Tante Doris trat schon ungeduldig von einem Bein aufs andere. Sie verdrehte ihren Hals und reckte sich auf die Zehenspitzen, um durch die verstaubten Scheiben zu schauen. Jetzt aber! Jetzt riss sie erneut die Arme auseinander, weit wie ein Scheunentor und - ein bunt gekleidetes Mädchen flog ihr vom Trittbrett aus direkt hinein, so stürmisch, dass die Tante gleich ein paar Schritte zurücktaumelte. Jemand reichte eine Gitarre nach.
Das also ist das Mädchen! dachte Friedemops. Und noch immer knutscht sie die Tante ab. So eine!
Da stolperte auch der Junge heraus, der Borstel, oder wie er hieß. Kleiner war er als das Mädchen. Hoho! Der hing sich der Tante auch gleich an den Hals, fast hätte er sie umgerissen. Auch so einer!
„Was meinst du, Peity, spielt der verrückt?“
Peity meinte nichts. Er machte Midigonda auf dem Milchbock und fuhr sich mit der Kralle durch den Flügel.
So also sahen die beiden aus. Das war’s, was Friedemops wissen wollte. Am liebsten hätte er sich nun in seiner Höhle vergraben, um zu sterben, oder wenigstens traurige Lieder zu dichten.
Welch eine Menge Menschen standen plötzlich auf dem Vorplatz herum! Dicke, dünne, große, kleine, alte, junge. Ein Mann mit einem Hut fiel besonders auf und eine Frau mit hoher Frisur und einem Schnirksfirks oben drauf, alles sehr blond. Die Frau redete unaufhörlich. Und … Friedemops sah genauer hin, da standen noch ein junge und ein Mädchen. Der Junge in schicker langer Hose und das Mädchen mit einer Brille und blonden Lausbubenhaaren. Die beiden standen beieinander und hielten sich zu dem Mann mit Hut.
Jetzt scharten sich alle um den Heimleiter und redeten durcheinander wie eine Horde Schnattergänse. Friedemops konnte kein einziges Wort mehr verstehen. „Schnaakschnaakschnaak“, äffte er sie nach und steckte ihnen die Zunge heraus. Sie sahen es ja nicht.
Peity gurgelte: „Tschaik!“
Hatte das Mädchen, das die Gitarre trug, Peitys Stimme vernommen? Jedenfalls stieß sie den Jungen an:
„Borstel! Schau, da sitzt eine Krähe!“
Peity schüttelte beleidigt sein Gefieder.
„Krähe!“, zischte Friedemops. „Dir werd ich helfen. Bist selber ’ne Krähe!“ In dem Jungen wühlte etwas, ein Gefühl, das er noch nicht gekannt hatte. Bisher waren ihm alle Menschen gut gewesen. Alle. Und er ihnen auch. Doch diesmal war es anders, gegen diese beiden hatte er etwas. Und das hing mit Tante Doris zusammen, mit seiner Tante Doris! Jetzt legte sie sogar noch die Arme um die fremden Kinder, um alle beide, und drückte sie an sich! Oh, war das gemein! Das wurmte ihn mächtig.
„Jetzt macht Tante Doris Midigonda!“, fauchte er und ballte seine Fäuste. Das klang wie eine Kampfansage, und das war es wohl auch. Nein, er wird sich nicht abdrängeln lassen, er wird sein Revier verteidigen wie ein Hirsch, der sich seinem Gegner stellt. Er wird es verteidigen gegen jeden Eindringling wie ein kapitaler Sechzehnender.
Unruhe im Hintern und Kribbeln im Bauch, so rutschte er, entschlossen zum Äußersten, auf seinem Holzgestell herum und folgte mit verbissener Miene dem Geschehen auf dem Platz.
Jetzt sah er, wie der Heimleiter seine Arme hob und um Ruhe bat. „Meine Damen und ...“
„Pssst“, ging es durch die Reihen, und das Geschnatter verebbte.
„Meine Damen und Herren, liebe, verehrte Gäste unseres Ferienheims! Noch einmal heiße ich Sie herzlich willkommen. Die Zeit auszuspannen und zu faulenzen ist für Sie angebrochen. Sie brauchen nichts zu überstürzen. Im Büro bei unserer Sekretärin - da steht sie in der Tür - bekommen Sie Ihre Zimmernummern. Die Schlüssel stecken in den Türen. Ich selber bin der Heimleiter. Meinen Namen kennen Sie ja, denn ich habe ja bereits an Sie geschrieben. Doch, ehe ich’s vergesse, im Büro liegt ein Telegramm für Herrn ...“ „Rrrau-wauwau!“ Das Hofhündchen kläffte dazwischen. Friedemops hätte den Namen zu gern verstanden. Er sah nämlich, wie der Herr mit dem Hut erschrak, dem Langehosenjungen und dem Brillenmädchen einen Wink gab und sich entfernte. Indessen sprach der Heimleiter seine Begrüßungsrede zu Ende. Indem er noch redete, fasste er die eine Hand von Tante Doris und hob diese für alle sichtbar hoch:
„Und diese Frau“, hörte Friedemops ihn sagen, „ist unsere Doris Stirnbach, ist unser Goldstaub im Haus. Ihr allein werden Sie es zu verdanken haben, wenn das Essen schmeckt.“
„Und wenn es nicht schmeckt?“, rief die Frau mit dem blonden Haargefrumse dazwischen. Einige lachten über diesen Zwischenruf, andere drehten sich missbilligend um.
„Sie werden es erleben“, winkte der Heimleiter ab. Da klatschten alle Leute Tante Doris zu, die einen tomatenroten Kopf bekam. Auch Friedemops zuckte es in den Händen, auch er hätte gern geklatscht. Aber nun gerade nicht. Nicht jetzt. Denn Friedemops hatte gemerkt, wie stürmisch Borstel und die Krähenzicke ihren Beifall spendeten.
Nachdem es wieder still geworden war, sprach der Heimleiter weiter:
„Ich habe nicht vor, Ihnen jetzt einen langen Vortrag zu halten. Nur eins, verehrte Gäste, sollten Sie gleich wissen, damit Sie sich freuen können. Wir haben hier gute, einfache Bademöglichkeit ...“
Alle Köpfe wandten sich zum Ufer.
„Boot fahren können Sie auch, rudern ...“
„Ah!“
„... hinten im Wald liegt die berühmte, ja weltberühmte Kormorankolonie.“
„Oh!“
„… und dieses alles hier ist Naturschutzgebiet. Bitte rauchen Sie nicht im Wald ...“
„Selbstverständlich ...“, raunte es in der Masse.
„… und ein Letztes: Das Haus, in dem Sie wohnen werden, ist dermaleinst ein wunderschönes, schlossartiges Gebäude gewesen, das ...“
„Spukt es etwa darin? Huhuhu ...“, fuhr ihm die Blonde mit dem Dutt auf dem Kopf vorwitzig dazwischen.
„Natürlich spukt es darin, wie es in jedem anständigen Schloss spukt“, lachte der Heimleiter. „Aber ich denke, Sie werden darum um so besser schlafen können.“ Und alle lachten kräftig mit.
In diesem Augenblick gab es in Friedemopsens Hirn einen Funken sprühenden Kurzschluss. Ein Gedanke, mit keinem anderen zu vergleichen, flitzte in seinem Kopf herum, ein Gedanke, den nichts mehr löschen konnte. „Ja, es wird spuken. Das schwöre ich. Es wird spuken. Die sollen sich in die Hosen machen, die beiden. Peity, was meinst du dazu? Machen wir Midigonda?“
„Tschaik!“
Inzwischen hatte sich der Mann mit dem Hut ins Büro begeben. Nun stand er, ein Telegramm in zitternden Händen, vor dem Schreibtisch der Sekretärin. Die schaute zur Seite, um ihn nicht ansehen zu müssen, indessen der Mann unverwandt auf das Papier starrte, als hätte er Mühe zu lesen.
„Ich hab’s geahnt“, flüsterte er, „ich hab’s geahnt.“
Er atmete schwer, denn ihm war bange im Herzen. Er suchte die Augen der Sekretärin, aber die hatte ihren Blick abgewandt. Die Gedanken wogen so schwer, dass er kaum spürte, wie sich das Blatt aus seinen Fingern löste und zu Boden segelte. Die Sekretärin bückte sich danach und reichte es ihm hin. Nun las er es noch einmal, als hätte er seinen Inhalt noch immer nicht verstanden.
Der Heimleiter trat ein und sah ihn voller Mitgefühl an. „Das ist enttäuschend, nicht wahr?“, fragte er leise.
Der Mann nickte: „Der Kleine musste in die Klinik. Eine Operation war unumgänglich.“
„Ich weiß“, sagte der Heimleiter. „Die Post gab vorhin den Text telefonisch durch. Es tut mir sehr leid.“
Der Mann nahm seinen Hut vom Kopf, flüsterte verlegen „Entschuldigen Sie“ und legte ihn auf einen Sessel. „Aber ... seit gestern bin ich mit den beiden Kindern unterwegs ... ein bisschen durcheinander.“
Die Sekretärin ließ ihren Kugelschreiber zwischen den Fingern wippen. Als sie aufsah, bemerkte sie, wie die beiden Männer sich mehrere Atemzüge lang in die Augen blickten. Teilnahmsvoll sagte sie: „Kranke Kinder geben eben einfach keine Ruhe, tjajajaja. Und wenn man noch so weit weg ist. Lässt sich da kein Weg finden, Chef?“
Der Heimleiter nickte stumm: „Sie werden Erholung nötig haben. Man sieht’s Ihnen an.“
„Erholung - ich? Und meine Frau? Zu Hause? Mit dem kranken Jungen? Wie wird sie das durchstehen ...? Nein, das passt nicht zusammen.“
„Ich verstehe das gut. Sie wollen also zurück?“
„Ich wollte erst gar nicht kommen - nur meine Frau hatte mich gedrängt. Sie sagte immer wieder: Tu’s doch und fahre, um der Kinder willen. Aber nun ...“ Er schwieg.
„Sie wollen also wirklich zurück? Es muss sein, ja?“
„Wir wollen nicht, wir müssen.“
„Wir? Wieso wir!“ Der Heimleiter war überrascht. „Die Kinder auch? Die bleiben nicht hier? Die sollen doch nicht etwa ...“
„Neineinein!“ Der Mann machte eine abwehrende Handbewegung. „Ich kann doch nicht ohne ... das ist doch unmöglich ...“
Die Sekretärin stieß heftig den Stuhl zurück und kam hinter dem Schreibtisch hervorgesprungen: „Das können Sie den Kindern doch nicht antun. Die haben sich auf diese Ferien gefreut. Ich kenn das auch. Wollen Sie ihnen diese Freude verderben? ... Nix da! Wir übernehmen das. Darauf sind wir schon eingerichtet.“
„Ja, aber ...“, stammelte der Mann.
Zart legte sie ihm die Hand auf den Arm: „Nun lassen Sie man gut sein. Wir werden die beiden Goldspatzen ... wie heißen sie doch noch?“
„Eckart ist mein Sohn und Katharina - mein Sohn hatte sie im vergangenen Jahr kennengelernt - eine eigenartige Geschichte - sie ist unser kleiner Ferienbesuch - sie ist uns sehr lieb.“
„Also Ecki und Kathi. Gut. Wir werden uns um sie kümmern, nicht wahr, Chef?“
Die Augen des sorgenvollen Mannes bekamen einen freudigen Glanz: „Na ja ...“
„Nun“, nahm der Heimleiter das Wort. „Überlassen Sie die Kinder getrost uns. Wichtig ist vielmehr, dass Sie zu Ihrer Frau und dem kranken Kind zurückkehren und dass vor allem ihr Junge auf den Weg der Besserung gerät.“
Der Mann nickte und rieb sich das Kinn. „Und wie komme ich hier weg?“
„Meine Mitarbeiterin bestellt Ihnen ein Taxi. Das bringt Sie an den nächsten Zug.“ Und zur Sekretärin gewandt: „Nun pfeife die beiden Goldspatzen herbei. Wir wollen uns ihnen als Vizeeltern vorstellen.“
Die Sekretärin drehte die Wählerscheibe, gab den Auftrag durch und sagte: „In einer Viertelstunde könnte der Wagen hier sein. Da erreichen Sie noch den Zug in Stralsund.“
„Oh, so schnell, so schnell“, flüsterte der Mann, nahm seinen Hut vom Stuhl und setzte sich. Kurz darauf stupste die Sekretärin Marianne die beiden Kinder vor sich her ins Büro. Etwas eingeschüchtert bauten sie sich vor dem Heimleiter auf. Eckart, erschrocken über das ernste Gesicht seines Vaters, ahnte nur zu gut, worum es ging. Verlegen wischte er sich über die Hose. Aber auch Katharina dachte sich ihr Teil. Sie schüttelte ihre blonde Lausbubenmähne zurecht. Ihre Augen wirkten hinter der Brille auffallend groß und schienen zu fragen: Was wird mit uns?
Eckarts Vater erklärte kurz: „Fidi musste in die Klinik. Mama hat telegrafiert. Meine Befürchtungen haben sich bestätigt, und ich muss zurückfahren. Es geht nicht anders. Ihr aber, ihr dürft hierbleiben. Der freundliche Heimleiter“, er wies mit der Hand zu ihm hin, „und die Dame dort“, er nickte der Sekretärin zu, „werden alles für euch regeln.“
Die beiden Kinder suchten in den Augen der beiden so etwas wie Bestätigung. Was sie aber erkannten, war mehr als nur Zustimmung. Das war reine, echte Wärme.
Die Sekretärin Marianne nickte eifrig: „Ja, ja, ja! Stimmt, was Vater sagt.“
„Gut also.“ Der Heimleiter sprach den Schlusssatz. „Es ist abgemacht. Sie fahren - die Kinder bleiben. Wenn das Auto abgedampft ist, übernehmen wir alles weitere. Bis dahin haben Sie noch Zeit füreinander. Sollten sich irgendwelche Probleme ergeben, wir sind jederzeit telefonisch zu erreichen. jetzt aber muss ich mich um meine anderen Gäste kümmern.“ Herzhaft drückte er dem Mann die Schulter, schob ihn zur Tür und geleitete ihn hinaus. Die Kinder folgten.
„Schade, Papa“, maulte Eckart draußen. „Ohne dich wird’s hier ganz schön langweilig. Was ist denn mit Fidi wirklich?“
„Appendicitis - zu deutsch Blinddarmentzündung.“
„Ist das nicht eine harmlose Sache? Die kriegt doch bald jeder Dritte.“
„An und für sich schon, aber in Ausnahmefällen kann das arg kompliziert werden, besonders wenn es nicht rechtzeitig erkannt wird. Und das ist wohl bei deinem Bruder der Fall. Dann aber muss auf dem schnellsten Weg operiert werden. Ihr versteht nun, dass ich nach Hause muss, nicht wahr?“
Eckart nickte: „Dochdoch.“
Katharina aber formte ihr Kinn zu einem richtigen Kugelball und klagte leise vor sich hin: „Muss das sein?“ Und ihre Klage kam tief aus einem enttäuschten Herzen.
Schon drängten die Gäste ins Haus. Jeder wollte sein Zimmer besichtigen. War das ein gewaltiger Trupp, der sich die Treppe hinaufschob. Koffer und Taschen, Rucksäcke und anderes Gebamsel, sogar ein dicker gelber Wasserball, wanderten, von schnaufenden Männlein und Weiblein geschoben, ins Haus. Eine sich windende Schlange, lustig anzusehen. Übrig blieb auf dem Vorplatz ein hochgewachsener Mann, ein aufgeschossener Junge, ein Mädchen mit blonder Lausbubenmähne, dazu einiges Gepäck. Als nachher auch das Taxi abgefahren war und mit ihm der Mann, drückte Katharina dem Freund den Arm: „Schiet! Was machen wir jetzt?“
„Abwarten. Der Büroboss will uns sprechen. Sicher gibt’s Notquartiere in einer Badewanne.“
„Ob man uns das Baden erlaubt?“
Eckart zuckte die Schultern.
„So viel Erwachsene, Mannomann. Keinen kennt man.“ Eckart machte hilflose Bewegungen.
„Die lassen uns bestimmt nicht baden, Ecki.“
„Wir müssen eben etwas erfinden.“
„Kapito. Erfinden wir was.“
Abwartend schlenderten sie auf den kleinen Hund zu, der an seiner Kette rackelte. Katharina trat auf ihn zu, sagte „t-t-t-t“ und „Peppi, sei liiiepp.“ Doch das Köterchen dachte gar nicht daran, lieb zu sein. Es bleckte die Zähne und wurde um so wilder, je zärtlicher das Mädchen sich ihm näherte. Da gab sie es auf: „Bist ja doof.“
„Lass ihn, Fratzi“, sagte Eckart. „Der heißt nie und nimmer Peppi. Um ein Hund wie Peppi zu sein, darf man nicht an der Kette liegen.“
Als sie nach einer Weile unschlüssig ins Haus traten, warteten bereits die beiden andern Kinder auf dem Flur, der Tür mit der Aufschrift BÜRO gegenüber, der Strubbelkopfjunge und das Gitarrenmädchen. Kurz musterten sie sich.
Als sich die Haustür endlich hinter den vielen Leuten geschlossen, nachdem das Haus sie alle, alle aufgeschluckt hatte, rappelte sich Friedemops aus seinem Versteck hervor und hopste zur Erde.
„Peity, komm!“
„Tschaik!“ Ein schwarzer Schatten - flatterflatter - wogte durch die Luft und ließ sich auf der Hand des Freundes nieder.
„Hör zu, Peity!“
„Tschaik!“
„Jetzt weiß ich, wie wir denen beikommen.“
„Tschaik!“
Und Friedemops schnipste entschlossen mit den Fingern.
2. Kapitel
Da standen sie sich nun gegenüber, die zwei ungleichen Paare. Musterten sich, schätzten sich ab, schwiegen sich an, höchstens dass dieser oder jener seinem Nachbarn einen hingeworfenen Gedankenfetzen flüsternd offenbarte. Wie bestellt und nicht abgeholt, so sagt man wohl. Evelyn blähte Luft in den Backen auf und ließ sie hörbar auszischen, während Borstel mehr als sonst mit der Nase schniefelte. Eckart indes gab sich redlich Mühe, seine langen Beinstelzen stillzuhalten, fuhr sich mit einem blauen Kamm überflüssigerweise durch den vollen Haarschopf, stülpte schließlich seine geliebte Kapitänsmütze drauf und spielte an der Hosennaht Klavier. Katharina fuhr sich über den Rock und suchte Fusseln, wo keine waren.
„Mannomann, ist das langweilig“, schnaufte sie. Und die anderen gaben ihr recht.
Als sich dann aber doch eilige Schritte näherten, ordneten sie ihre Gesichter so artig, wie Kinder, die einen guten Eindruck machen wollen, und schauten zur Treppe. Denn von dort kam er, der Chef des Hauses, der Ehrfurcht gebietende Heimleiter. In wehendem, weißen Kittel, mit Schwung und ausgebreiteten Armen eilte er herbei und rief ihnen zu: „Hallo, Leute, rasch. Nehmt eure Taschen und kommt mit. Ich zeige euch, wo ihr eure müden Knochen ausstrecken könnt.“
Ja, er trug jetzt einen weißen Kittel - knallweiß -, der ihm ein amtliches Heimleiteraussehen verlieh. Ein paar hastige Vogelflügelflatterbewegungen mit den Armen - macht schnell, Kinder -, und ab ging’s. Die Kinder konnten ihre Siebensachen gar nicht so fix zusammenraffen, so eilig hatte es der Mann.
Er führte sie ins Obergeschoss hinauf. Die alten Treppenstufen knarrten und knackten und quietschten unter ihren Tritten. Hier kann keiner nachts entwischen, bei dem Krawall, dachte Borstel, oder man müsste fliegen. Nur Vögel können fliegen, ich wollte, nachts wäre ich ein Vogel. Wird dies hier unser Gefängnis werden?
Eckart dagegen bestaunte den fein gearbeiteten Handlauf des Geländers. An den Treppenwindungen fuhr der in kunstvollen Formen aus und war so musterhaft geschnitzt, als bestünde er aus einem einzigen Stück. Getragen wurde er durch handgeschmiedetes Gitterwerk und verzierte Stützen. So machte das hohl hallende Treppenhaus einen supervornehmen Eindruck. Er sog die Luft ein und dachte: Hier riecht es nach Küche.
Die Mädchen wollten von all dem nichts bemerken. Unter Ächzen und Pusten schleiften sie ihre Gepäckstücke treppauf. Für Feinheiten hatten sie jetzt weder Auge noch Ohr. Oben angelangt, sortierte der Heimleiter die vier nach Röcken und Hosen, trennte sie voneinander, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, öffnete zwei mit vorsintflutlichen Kastenschlössern versehene Kammertüren und zupfte die Mädchen am Ärmel:
„Die Frauenzimmerchen, bittschön, hier hereinspaziert.“
Den Jungen klappste er auf die Schultern und machte eine kurze Daumenbewegung, ging voran und sagte: „Und ihr hier.“ Drinnen aber nahm seine Stimme eine dunklere Färbung an: „An der Ordnung in diesem Raum wird nichts geändert. Lampen, Betten, Türen, Fenster bleiben heil, klar? Und da ist euer Schrank. Ha, die Tür geht ja schon von selber auf. Also, rein mit den Klamotten.“
Damit ließ er sie allein und ging zu den Mädchen hinüber. Bei ihnen sagte er ziemlich dasselbe, nur in milderem Ton. Katharina sah sich ungeniert um und nahm Kurs aufs Fenster:
„Das sieht genau aus wie bei uns im Gasthaus.“ Und sie erkundete mit raschem, prüfendem Blick die Höhe vom Fenster zur Erde und ob ein Baum in der Nähe mit herabhängendem Ast vielleicht ... oder ein Blitzableiter ... oder ob man ein Seil irgendwo anknüppern ...
„Ist ein bisschen weit bis nach unten, was?“, hörte sie eine Männerstimme hinter sich und fühlte ihre heimlichen Gedanken erraten.
„Ach ... ach nee, ich hab nur so ... ich hab nur runtergeguckt.“
„Nun, ist guuut.“ Der Chef des Hauses sah mit wachen Augen, dass dem Mädchen ein verräterisches Rot in die Wangen geschossen war. Darum zog er auch das Wort auffallend in die Länge. Das hieß wohl: Hütet euch, macht mir keinen Ärger! Dann trat er zur Tür:
„Verpasst die Mahlzeiten nicht. Wer zu spät kommt, darf sich zu den Hühnern hocken und aus einem Blechnapf seine Mahlzeit picken. Also!“
Er ließ diese Ermahnung im Raum stehen wie etwas Unumstößliches und ging. Das Knarren der Treppe war noch ein Weilchen zu hören.
Die beiden Kammern im Obergeschoss galten seit Langem als Notbehelf für unerwartete Gäste, bescheiden eingerichtet, aber sauber, mit Möbeln einfacher Art. Die Betten, irgendwann mal weiß überlackierte Gasrohrgestelle, gegenüber an den Wänden, ein Tisch in Zimmermitte, bei den Jungen zwei Stühle, bei den Mädchen zwei Hocker, Schränke, an denen die Farbe abplarsterte, mit Fächern für Wäsche und anderem Kleinkram, das hatte zu genügen. Der Schrank in der Jungenkammer wippte sogar freundlich und grüßte jeden, der an ihm vorüberkam, indem er seine Tür ganz von selber öffnete. Wie einladend!
Dafür knickte bei den Mädchen an einem der Hocker ein lockeres Bein zur Seite, falls man sich ungeschickt auf ihm herumflegelte. Darum saß man sicherer und auch weicher auf der Bettkante. Das hatten die Mädchen bald heraus.
Nun war es wohl an der Zeit, die Kinder miteinander bekannt zu machen. Eckart, als der Größere, machte den Anfang. Er reichte dem Kleinen seine Hand und nannte seinen vollen Namen.
„Und du?“
„Borstel“, erwiderte der und grinste.
„Borstel? Und weiter?“
„Nichts weiter. Welches Bett nimmst du?“
Eckart zeigte auf das nächststehende. „Ist Borstel Vor- oder Nachname?“
„Ist mein Name. Nichts weiter. Schnarchst du nachts?“
„Nee. Du?“
„Weiß nicht.“
„Wäschst du dich abends?“
„Nur wenn’s nötig ist.“
„Wer entscheidet das?“
„Ich selber natürlich.“
„Also wäschst du dich abends nicht!“
Eckart fuhr sich mit dem Kamm durch die Haare. „Hilfst du mir die Koje beziehen? Zu Hause macht das mein eifriges Muttchen.“
Borstel half. Und während er half, sagte er wie beiläufig: „Bei uns mache das entweder ich oder mein Vater.“
Eckart strich das Betttuch glatt. Er blickte nicht auf, als er fragte: „Und deine Mutter? Geschieden?“
Aber darüber wollte Borstel nicht sprechen. Lieber beförderte er, und zwar mit gezieltem Fußtritt, Campingbeutel und Tragetasche unters Bett. Rrrrums!
„So! Aufgeräumt! Nun kann die Kontrolle kommen.“
„Ich bin für Ordnung“, betonte Eckart und schob sein Zeugs auf den Schrank, wobei sich die Tür öffnete. Ein Druck mit dem Knie - rrrums -, und die Ordnung war auch hier hergestellt.
„Nachtpötte gibt’s wohl nicht“, prüfte Borstel und liegestützte vor seinem Bett, als forsche er nach einem verlorenen Groschen.
„Klos sind unten, ganz unten. Steht dran. So ’ne Art Männeken.“
„Piktografie“, belehrte ihn Borstel. „Gehn wir mal rum? Nach nebenan?“
„Ins Frauenzimmer? Dürfen wir das?“
„Dürfen, fragst du? Wir müssen doch rekognoszieren.“
„Nachher gibt’s Ärger.“
„Der Heimleiter ist in Ordnung, bestimmt. Aber über so was hat er kein Verfügungsrecht.“
Verfügungsrecht, das Wort gefiel Eckart. Darum wiederholte er es. „Verfügungsrecht über so was hat er nicht. Ist richtig.“ Einen Finger am Kinn überlegte er: „Mal sehen, wo Fratz pennt.“
Borstel wollte schon los, als er ihn zurückhielt.
„Erst umziehen! Feriendress. Nicht in Reiseklamotten.“ Borstel grinste, als er sah, wie Eckart frische Wäsche auspackte. Als der nun aus seiner langen Hose stieg und diese sorgfältig über den Kleiderbügel zog, konnte Borstel, der ihn betrachtete, nicht an sich halten.
„Mann, hast du lange Stelzen!“ Und verglich seine eigenen kurzen Stampfer mit den Rennpferdbeinen Eckarts. Doch gutmütig, wie er war, ließ er es sich gefallen, dass Eckart ihn einen lütten Dackel nannte.
„Länge macht’s nicht, du. Meine Flitzer können allerlei hergeben, wenn sie sollen!“
Eckart stieg in eine helle, kurze Hose um, warf sich ein brandrot kariertes Hemd über und entnahm seiner Tasche ein paar prächtig weiße Segelschuhe. Dagegen bemühte sich Borstel gar nicht erst, sich aufzuhübschen. Ihm war’s egal, wie er aussah. Feine Sachen hielt er für bewegungshemmend. Aber Laufschuhe zog auch er an, geschmeidige Treter aus weichem Leder. Als die beiden dann zur Tür hinausdrängten, öffnete sich der Kleiderschrank hinter ihnen, und die Tür wippte ein Aufwiedersehen.
Bei den Mädchen dauerte das Sachenauspacken und Sachenumpacken und Sacheneinpacken bedeutend länger. Sie hatten dabei programmgemäß zu stöhnen, denn Bettenbeziehen ist Arbeit, und nach Arbeit stand ihnen jetzt nicht der Sinn. Und wer sich fortwährend mit Ach und Weh über die Stirn fahren musste, kann kein Bett beziehen.
Als erstes hatten sie sich natürlich artig ihre Namen genannt und den Ort, aus dem sie kamen. Evelyns Sprechweise wies deutlich in eine südlich gelegene Stadt. Katharina dagegen waren Haff und Möwen und Binseninseln anzuhören. Als sie sich auf diese Weise bekannt gemacht hatten, begutachteten sie ihre Frisuren, ihre Ohrklips und Spangen und tauschten Zu- und Abneigung gegen gewisse Schulfächer aus, berochen einer des anderen Cremedöschen und erzählten sich schließlich Teufelsgeschichten von Mucki und Hampi, dem Meerschweinchen und Goldhamster, und ihren anderen Lieblingen. Als sie dann wirklich die Betten fertig bezogen hatten, warf sich Katharina längelang auf die geblümte Decke, reckte die Arme und stöhnte wohlig auf:
„Haaach! Probeschlafen in der Koje!“
„Koje?“, fragte Evelyn.
„Eckart sagt immer Koje zum Bett. Er ist nämlich Segler. Und was für einer. Ein ganz großer!“
„Ist er - dein Freund?“
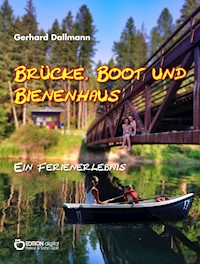














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













