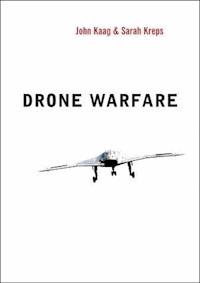10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Dieses Buch kann Ihr Leben verändern!«, Wall Street Journal.
Als der junge Philosophieprofessor John Kaag im Hinterland von New Hampshire die vergessene Bibliothek von William Ernest Hocking, einem der letzten großen amerikanischen Denker entdeckt, traut er seinen Augen kaum. Unter den halb verfallenen und vermoderten Bänden findet er zahlreiche Schätze: handgeschriebene Notizen von Walt Whitman, annotierte Bücher aus dem Besitz von Robert Frost, zahllose Briefe von Pearl S. Buck – und sogar dutzende Erstausgaben der Werke europäischer Geistesgrößen. Er beschließt, die Bücher zu restaurieren und begibt sich damit auf eine intellektuelle Reise durch die Geistesgeschichte Amerikas und seiner europäischen Grundlagen. Bald schon merkt er, dass die großen, lebensbejahenden Ideen in diesen Büchern auch ganz praktisch zu Werkzeugen für das Umkrempeln seines eigenen Lebens verwendet werden können. Ganz besonders, als sich ihm eine brillante Kollegin anschließt und ihm bei der Arbeit am Bücherhaus hilft...
Dieses faszinierende Buch beinhaltet sowohl eine profunde Ideengeschichte Nordamerikas, als auch die mitreißende wahre Geschichte hinter der Entdeckung einer verschollenen Bibliothek. Eine bestens lesbare Autobiografie, die sich um die großen Fragen des Lebens dreht: Liebe, Freiheit, und welche Rolle das Denken spielen kann, wenn man sich selbst neu erfinden möchte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
Als der junge Philosophieprofessor John Kaag im Hinterland von New Hampshire die vergessene Bibliothek von William Ernest Hocking, einem der letzten großen amerikanischen Denker, entdeckt, traut er seinen Augen kaum. Unter den halb verfallenen und vermoderten Bänden findet er zahlreiche Schätze: handgeschriebene Notizen von Walt Whitman, annotierte Bücher aus dem Besitz von Robert Frost, zahllose Briefe von Pearl S. Buck – und sogar Dutzende Erstausgaben der Werke europäischer Geistesgrößen. Er beschließt, die Bücher zu restaurieren, und begibt sich damit auf eine intellektuelle Reise durch die Geistesgeschichte Amerikas und ihrer europäischen Grundlagen. Bald schon merkt er, dass die großen, lebensbejahenden Ideen in diesen Büchern auch ganz praktisch zu Werkzeugen für das Umkrempeln seines eigenen Lebens verwendet werden können. Ganz besonders, als sich ihm eine brillante junge Kollegin anschließt und ihm bei der Arbeit am Bücherhaus hilft …
Dieses faszinierende Buch beinhaltet sowohl eine profunde Ideengeschichte Nordamerikas als auch die mitreißende wahre Geschichte hinter der Entdeckung einer verschollenen Bibliothek. Eine bestens lesbare Autobiografie, die sich um die großen Fragen des Lebens dreht: Liebe, Freiheit und welche Rolle das Denken spielen kann, wenn man sich selbst neu erfinden möchte.
Zur Autorin
JOHN KAAG, Jahrgang 1981, ist Professor für Philosophie an der University of Massachusetts, Lowell. Er gilt als einer der spannendsten jungen Philosophen der USA und schreibt regelmäßig Artikel für Fachzeitschriften, aber auch für die »New York Times«, »Harper’s Magazine« und viele weitere Magazine und Zeitungen. »American Philosophy. A Love Story« wurde 2016 u. a. vom National Public Radio zum Besten Buch des Jahres gekürt. John Kaag lebt mit seiner Familie in der Nähe von Boston.
JOHN KAAG
DAS BÜCHERHAUS
EINE PHILOSOPHISCHE LIEBESGESCHICHTE
Aus dem Amerikanischen von Martin Ruben Becker
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »AMERICAN PHILOSOPHY: A Love Story«im Verlag Farrar, Straus and Giroux, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe November 2019
Copyright der Originalausgabe © 2016 by John Kaag
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2019 by btb Verlag
in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Published by arrangement with Farrar, Straus and Giroux, LLC, New York.
Umschlaggestaltung: semper smile, München, nach einem Entwurf von Na Kim
Umschlagmotiv: The White Mountains (oil on canvas), by William Holt Yates (1858–1930), © Bridgeman Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
JT · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-21039-7V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Carol
Die Bibliothek ist eine Wildnis der Bücher
Henry David Thoreau, Tagebuch, 16. März 1852
Inhalt
PROLOG: VIELLEICHT
TEIL I HÖLLE
IN EINEM DUNKLEN WALD, EINE BIBLIOTHEK
WIE ICH WEST WIND FAND
»BLÄTTERSCHAREN, STERBEBLEICH«
TÄUSCHUNG UND SELBSTSTÄNDIGKEIT
WALDEN UND VEREISTE SEEN
TEIL II FEGEFEUER
DIE AUFGABE DER ERLÖSUNG
GÖTTLICHER WAHNSINN
AUF DEM BERG
DER WILLE ZUM GLAUBEN
EVOLUTIONÄRE LIEBE
TEIL III ERLÖSUNG
EINE PHILOSOPHIE DER LOYALITÄT
AUF DER TREPPE
FRAUEN AUF DEM DACHBODEN
ICH KANNTE EINEN PHÖNIX
EAST WIND
DAS GEHEIMNIS DES SEINS
EPILOG: DER TOTENKULT
AUSGEWÄHLTE BIBLIOGRAPHIE UND LEKTÜREEMPFEHLUNGEN
DANKSAGUNG
SACH- UND PERSONENREGISTER
PROLOG: VIELLEICHT
Die Holden Chapel der Harvard Universität erschien mir immer als ein besonders passender Ort zum Sterben. Das kleine Backsteingebäude, das drittälteste der Universität, hat keine Fenster in der Fassade. Über seinem Eingang befinden sich vier steinerne Bukranien, Schmuckreliefs von Rinderschädeln mit Gehörn, von der Sorte, wie sie die Heiden einst an ihren Tempelfassaden anbrachten, um böse Geister fernzuhalten. Als William James am 15. April 1895 gebeten wurde, vor einem Publikum von jungen Männern in der Georgianischen Kapelle zu sprechen, war sie bereits mehr als hundertfünfzig Jahre alt, der passende Rahmen für den dreiundfünfzigjährigen amerikanischen Philosophen, um über die Frage nachzudenken, die er inzwischen für die tiefgründigste hielt: »Ist das Leben lebenswert?«
Sowohl mit dem Ort als auch mit der Frage wurde ich im Frühjahr 2008 immer vertrauter. Ich hatte Monate damit verbracht, Harvard auf der Suche nach den Ursprüngen der amerikanischen Philosophie zu durchstreifen. Ich war, ausgestattet mit einem Postdoktoranden-Stipendium der American Academy of Arts and Sciences, in Harvard – eine befristete Atempause von der anhaltenden Arbeitslosigkeit, die mir in den Augen meiner liebevollen, aber sehr praktisch veranlagten Familie nach dem Abschluss meiner Promotion in Philosophie sicher bevorstand –, und ich wollte diese unerwartete Gelegenheit, ihnen das Gegenteil zu beweisen, auf keinen Fall leichtfertig vergeben. Die Korridore in der Widener Library, nur ein paar Schritte von der Holden Chapel entfernt, sind insgesamt achtzig Kilometer lang. Im Herbst jenes Jahres legte ich die gesamte Strecke zurück. Als ich schließlich mit leeren Händen herauskam, trabte ich über den Yard zur Houghton Library, in der sich seltene Bücher und Manuskripte befinden, und durchforstete die persönlichen Unterlagen von Ralph Waldo Emerson und Charles Sanders Peirce. Immer noch nichts. Es war doch erst November, sagte ich mir: früh genug. Forschungsstipendien dienen der Forschung – und man forscht und forscht. Ich hockte mich in meine Arbeitskabine in der Widener Library und versuchte, mir das Manuskript aus den Rippen zu schneiden, das ich über die Verschmelzung des deutschen Idealismus des achtzehnten Jahrhunderts mit dem amerikanischen Pragmatismus schreiben sollte. Die Dinge gingen voran, wenn auch sehr langsam.
Aber dann, an einem Abend im Frühjahr 2008, gab ich auf. Die Forschungen aufzugeben hatte nichts mit dieser Arbeit selbst zu tun, sondern alles mit dem Gefühl, dass sie, wie alles andere in meinem Leben, wirklich keine Bedeutung hatten. Für den Rest dieses Jahres in Harvard mied ich gewissenhaft seine Bibliotheken. Ich mied meine Frau, meine Familie, meine Freunde. Wenn ich überhaupt den Campus betrat, dann nur, um zur Holden Chapel zu gehen. Ich ging an ihr vorbei, setzte mich neben sie, las, an sie gelehnt, aß in ihrer Nähe mein Mittagessen, schlüpfte hinein, wenn ich konnte – sie wurde zu meiner Obsession. William James hatte, soweit ich es sah, die einzige Frage gestellt, die überhaupt von Bedeutung war. Ist das Leben lebenswert? Ich konnte sie nicht abschütteln, und ich konnte sie nicht beantworten.
Jahrhundertelang hatten Philosophen und religiöse Denker, vom Rabbi Maimonides aus dem zwölften Jahrhundert bis zum Engländer John Locke aus dem siebzehnten Jahrhundert, ungerührt den Glauben zum Ausdruck gebracht, dass das Leben, aus allen möglichen unwiderlegbaren Gründen, lebenswert sei. Im dreizehnten Jahrhundert hatte der Dominikanermönch Thomas von Aquin argumentiert, dass alle Wesen – ob nun Amöben oder menschliche Wesen – einen natürlichen Lebenszyklus besitzen, den ein höheres Wesen für sie vorgesehen hat. Keiner einzigen von Gottes Kreaturen stünde es zu, diesen zu unterbrechen. Immanuel Kants Argument, fünfhundert Jahre später, war weniger theologisch spekulativ. Vernunftwesen, sagte er, haben die Pflicht, ihre eigenen Vernunftkapazitäten nicht zu zerstören. In Kants Worten: »Der Suizid ist nicht deswegen abscheulich, weil ihn Gott verboten hat; im Gegenteil, Gott hat ihn verboten, weil er abscheulich ist.«
William James hatte über dieses Abscheuliche schon nachgedacht, seit er mindestens Anfang zwanzig war. Vielen Berichten zufolge hatte er 1871, im Alter von neunundzwanzig, den absoluten Tiefpunkt erreicht. Als ich 2008 draußen vor Holden Chapel auf dem immer noch gefrorenen Boden saß, musste ich ihm zustimmen – Schlimmeres als mein eigenes neunundzwanzigstes Lebensjahr war überhaupt nicht mehr vorstellbar. Einer der Skizzenblöcke, die ich in der Houghton Library gefunden hatte, enthielt ein Selbstportrait, das James mit roter Kreide gezeichnet hatte – ein junger Mann, sitzend, vornübergebeugt, und über der Gestalt eine Inschrift: HIERSITZENDIETRAUERUNDICH. Die meisten der Gründe, die seine philosophischen Vorgänger propagiert hatten, um am Leben zu bleiben, langweilten William James zu Tode. Für ihn waren sie wenig mehr als klischeehafte Maximen, ohne jede Relevanz für die Besonderheiten einer Depression oder Krise. Andererseits war ihm völlig klar, dass solche Argumente unzähligen Menschen als existenzieller Halt für ein glückliches Leben gedient hatten. Während seines Vortrags in der Holden Chapel beobachtete er in der Tat, dass sein Publikum, eine Gruppe der Young Men’s Christian Association Harvards, vor etwas, das er oft »geistige Gesundheit« nannte, geradezu strotzte, eine psychologisch-moralische Haltung, die die Schlussfolgerungen von Thomas von Aquin und Kant in der Praxis bestätigte.
Die YMCA Harvards war 1886 als eine evangelikale Gesellschaft gegründet worden. Die meisten Mitglieder von James’ Publikum glaubten, die Bibel sei das Wort Gottes und Jesus der Herr und Erlöser. Die Frage nach dem Wert des Lebens war für diese tiefreligiösen Männer bereits vor dem Anhören eines jeglichen Vortrags hinreichend beantwortet. Den Wert des menschlichen Lebens zu leugnen, war Blasphemie und die ultimative Form dieser Leugnung – der Selbstmord – eine unaussprechliche Sünde. Aber James empfand, dass diese Affirmation des menschlichen Lebens, so emphatisch wie universell sie auch war, die Erfahrung einer wachsenden Zahl von Menschen einfach ignorierte, die sich des Werts ihres eigenen Lebens nicht mehr ganz so sicher waren.
William James, als Vater der amerikanischen Psychologie und Philosophie zu diesem Zeitpunkt schon recht berühmt, war einer dieser Menschen – »mit einer kranken Seele«, wie er es nannte. Meine eigene Seele, beginnend mit meiner Adoleszenz, war nie besonders robust gewesen, und in jenem verregneten Frühjahr hatte sich das noch verschlimmert. James wusste etwas, das die Frommen oft vergessen: dass an den Wert des Lebens zu glauben, für viele Menschen ein ständiger Kampf ist. Er hatte in den 1870er-Jahren eine Überdosis von Chloralhydrat genommen, »nur so aus Spaß«, wie er seinem Bruder Henry schrieb, um zu sehen, wie nah er der Morgue, der Leichenhalle, kommen konnte, ohne tatsächlich dort zu landen. James war mit seiner Neugierde nicht allein. Ein Jahrzehnt später ging sein Kollege Edmund Gurney, Begründer der Society for Psychical Research, beim Experiment mit Leben und Tod zu weit und erprobte eine, wie sich dann herausstellte, tödliche Dosis von Chloroform. Als Reaktion auf Gurneys Tod schrieb James wieder einmal an seinen Bruder. »[Dieser Tod] lässt, was hier verbleibt, merkwürdig unbedeutend und vergänglich erscheinen, als ob das Gewicht der Dinge, so wie ihre Anzahl, ganz auf der anderen Seite läge.«
Die andere Seite. So wie: Nein. Das Leben ist nicht lebenswert.
Nein ist, wie sich herausstellt, eine Antwort, die an einem Ort wie der Holden Chapel viel für sich hat. Seit der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts fanden dort keine Gottesdienste mehr statt, und die nächsten hundert Jahre diente sie als Chemielabor und Seminarraum für die aufkeimende Harvard Medical School, wo man Leichname sezierte. Die Klinik Gross, ein Gemälde von Thomas Eakins von 1875, gibt uns einen Eindruck davon, wie man sich die Chirurgie zu dieser Zeit vorstellen muss. Darauf sind mehrere Ärzte zu sehen, die ein Kind oder einen jungen Mann operieren und ohne Handschuhe arbeiten, während aus dem Inneren der schwärenden Wunde am Oberschenkel ihres Patienten Eiter nach außen dringt. Die Mutter des Patienten sitzt entsetzt daneben und bedeckt ihr Gesicht beim vergeblichen Versuch, dem zu entgehen, was James nur allzu deutlich begriff: Am Ende unseres Lebens sind wir alle bloß ein Haufen stinkender Kadaver. James war die blutige medizinische Vergangenheit der Kapelle sicher bewusst, als er gemeinsam mit der YMCA über den Wert des Lebens nachdachte.
Am 11. März 2008 sah ich zu, wie mein Vater starb. Seine Leber war in einem schlechten Zustand. Seine Speiseröhre war völlig zerstört. Zu sagen, dass man ein Plattenepithelkarzinom der Speiseröhre hat, ist oft ein sehr umständlicher Weg zu sagen, dass man zu viel getrunken hat, was mein Vater getan hatte. Am Ende konnte er tragischer- und zugleich ironischerweise nicht einmal mehr schlucken. Dasselbe, was seine Leber und Kehle zerfraß, zerstörte auch seine Familie. Ich mochte ihn nicht allzu sehr. Und so überraschte ich mich selbst, als ich die Einladung meiner Stiefmutter annahm, ihm an einem verschneiten Abend in einem Krankenhaus in Buffalo, New York, beim Sterben zuzusehen. Aber da lag er, mit geschwollenen Händen, aufgequollenem Gesicht, ohne Atem – jemand aus Dr. Gross’ Klinik. Das alles kam mir wie ein grausamer Scherz vor. Vielleicht war das Leben lebenswert. Aber vielleicht lebte man bloß, um am Ende, umgeben von seiner verstörten zweiten Frau und seinen entfremdeten Söhnen, deren Augen völlig trocken waren, zu sterben.
Die Wahrheit ist, dass ich mir schon oft das Ableben meines Vaters vorgestellt – und gelegentlich sogar ausgemalt – hatte. In meinen Träumen, am Rande des Todes, würde er schließlich erkennen, wie kurz das Leben tatsächlich war, dass man es durchaus auch komplett versauen und die Gelegenheit verpassen konnte, tiefe und unwiderrufliche Verantwortung zu übernehmen. Der Schatten des Todes hatte diese Macht, wie ich glaubte. Und so, ganz am Ende, würde er mit mir reden, wie ein liebender Vater es mit seinem Sohn täte. Er würde mich überzeugen, dass unsere kurze Zeit zusammen nicht ein hohles, schmerzliches Versäumnis gewesen war. Er würde mir erzählen, wie man kein Trinker wurde oder kein Versager als Ehemann oder kein Ehemann, der sich aus dem Staub machte.
Natürlich geschah nichts dergleichen. Als ich ins Krankenhaus kam, war er schon weitgehend weggetreten, so still und bewusstlos, wie er die meiste Zeit in meinem Leben gewesen war. Es gab da nicht den großen Augenblick eines Finales, den Moment einer letzten Lektion. Bloß die schmerzhafte Bestätigung all meiner Ahnungen, dass das Leben ziemlich bedeutungslos war.
William James behandelte diese düstere Möglichkeit durchaus ernsthaft. Wenn wir mit rücksichtslosen Härten konfrontiert sind, erzählte er seinem Publikum in der Holden Chapel, neigen wir nicht dazu, an »die alte heimelige Vorstellung eines den Menschen liebenden Gottes« zu glauben, sondern »an eine furchtbare Macht, die weder liebt noch hasst, sondern alles ohne Sinn und Verstand auf den unvermeidlichen Untergang zusteuern lässt.« Nicht einmal die schützenden Bukranien können uns retten. »Dies«, fuhr er fort, »ist ein beklemmender, finsterer, albtraumhafter Blick auf das Leben. Seine eigentliche Unheimlichkeit [im Original deutsch, A. d. Ü.] oder Giftigkeit liegt darin, dass wir hier zwei Dinge zusammenbringen, die unmöglich zusammenstimmen können.« Auf der einen Seite klammern wir uns an die Hoffnung, dass unsere Welt sowohl vernünftig als auch bedeutsam ist; auf der anderen Seite kommen wir vielleicht zu der Einsicht, dass sie weder das eine noch das andere ist. Wir haben große Erwartungen, was unser Leben anbelangt, aber wir sterben in dem winterlichen Höllenloch von Buffalo oder werden auf OP-Tischen in der Holden Chapel aufgeschlitzt.
James hätte seinem Publikum dort erzählen können, dass das Leben einer Vorsehung gehorche und eine bleibende, existenzielle Bedeutung durch einen gütigen und allwissenden Gott garantiert werde; dass, wie Leibniz im siebzehnten Jahrhundert dargelegt hatte, wir in der besten aller möglichen Welten leben; oder dass wir die moralische Pflicht haben weiterzumachen, selbst wenn es sich herausstellt, dass diese Welt an ihrer Wurzel böse sei. Er hätte versuchen können, meine Reise nach Buffalo schönzureden, mir entgegen allem Anschein erzählen können, dass das Leben notwendigerweise bedeutungsvoll sei. Mit anderen Worten, er hätte lügen können. Aber das tat er nicht. Stattdessen beantwortete er die schwierigste Frage des Lebens auf die ehrlichste mögliche Weise: »Vielleicht«, sagte James.
»Es hängt alles«, erklärt James, »von der Leber ab.« Die Leber, drei Pfund rotbraunes Fleisch, eingeklemmt unterhalb des Zwerchfells, wurde einmal als Quelle des Blutes und daher als Sitz des Lebens selbst betrachtet. Damals, zu Zeiten der Bukranien, schlachteten die Menschen ein Tier, nur um einen guten Blick auf eine Leber werfen zu können. Die Leber war unverzichtbar für viele antike Formen der Wahrsagerei. Seher von Babylon bis Rom untersuchten das Organ – so wie Phrenologen später die Form eines Schädels studieren würden –, um eine Zukunft vorhersagen zu können, die gerade noch für den Einzelnen kontrollierbar war. Die Leber bot, den Alten zufolge, eine Möglichkeit, die Launen des Schicksals zu ergründen. Ich habe mich manchmal gefragt, ob die Leber meines Vaters mir, hätte ich, als ich jung war, einen Blick auf sie werfen können, alles Mögliche hätte erzählen können: dass er versuchen würde, mir dabei zu helfen, meine Angst vor der Dunkelheit zu überwinden, indem er in der Garage alle Lichter löschte und mich darin einsperrte, dass sich meine Mutter nie wieder verlieben würde, dass es die größte Angst in meinem Leben sein würde, so zu werden wie er.
In den Jahren, die auf den Tod meines Vaters gefolgt sind, habe ich allmählich angefangen zu denken, dass die Dinge vielleicht nicht so dunkel und unausweichlich sind wie das hier. Ich habe allmählich verstanden, wie bestätigend James’ »Vielleicht« auch sein kann. Ich musste ein Buch darüber schreiben – dieses Buch –, damit mir das wirklich klar wurde. Für amerikanische Philosophen wie William James ist es in einem ganz realen Sinne tatsächlich unsere Aufgabe, den Wert des Lebens zu bestimmen. Unser Wille bleibt der entscheidende Faktor dabei, in einer Welt einen Sinn zu finden, die diesen permanent zu vernichten droht. Unsere Vergangenheit muss keine Macht über uns haben. Das Risiko, dass das Leben vollkommen bedeutungslos ist, ist real, aber genauso auch der Lohn: die allgegenwärtige Chance, weitgehend für seinen Wert selbst verantwortlich zu sein. Die angemessene Reaktion auf unsere existenzielle Situation ist nicht, zumindest für James, absolute Verzweiflung oder Selbstmord, sondern der immer neue brennende, sehnsuchtsvolle Versuch, etwas Gutes aus den gefährlichen Optionen des Lebens zu machen. Und diese Optionen gibt es dort draußen, oft an den unwahrscheinlichsten Orten.
TEIL I HÖLLE
IN EINEM DUNKLEN WALD, EINE BIBLIOTHEK
Meinen Frühling in der Holden Chapel verbrachte ich mit William James. Dann fielen die Touristen im Harvard Yard ein – gaffende, knipsende, plappernde, lächerliche Touristen. Im Nachhinein weiß ich, dass sie nicht lächerlicher sind als ein ängstlicher Philosoph, der auf einer Decke im begrünten Innenhof sitzt und über den elenden Zustand der Leber seines Vaters sinniert. Aber damals wurde mein Drang, sie alle umbringen zu wollen, nur noch von dem Drang übertroffen, mich selbst umzubringen. Und so floh ich an einem warmen Nachmittag im Juni aus Cambridge und begab mich auf eine letzte, verzweifelte Mission, die Väter der amerikanischen Philosophie zurückzugewinnen und James’ Frage ein für alle Mal zu beantworten. Meine eintägige philosophische Pilgerreise begann mit einer Fahrt zu dem weiß verkleideten Haus mit Schindeldach in Concord, das Ralph Waldo Emerson einmal sein Zuhause genannt hatte, und ich verbrachte den folgenden Nachmittag damit, die drei Kilometer um den Walden Pond herumzuwandern. Ich kehrte erst zum Harvard Yard zurück, als die Dämmerung einsetzte und meine touristischen Plagegeister allmählich verschwanden. Im Dämmerlicht las ich Emersons Ansprache »Der amerikanische Gelehrte«, vermutlich an genau der Stelle, an der er diese Vorlesung 1837 gehalten hatte. Oliver Wendell Holmes hatte sie die »intellektuelle amerikanische Unabhängigkeitserklärung« genannt, den Aufruf an amerikanische Denker, ihr intellektuelles Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Nachdem ich die Rede gelesen hatte, legte ich einen Halt am Kirkland Place ein, an dem Haus, in dem Charles Sanders Peirce aufgewachsen war. Peirce hatte Emersons Appell ernst genommen und die erste wahrhaft amerikanische Philosophie entworfen und dabei ein umfangreiches Werk geschaffen, das gleichzeitig wissenschaftlich streng und unerwartet spirituell war. Dann stellte ich meinen Wagen in einem Parkhaus in der Innenstadt von Boston ab, bevor ich den Rest der Strecke zur Durgin-Park Oyster Bar im North End zu Fuß ging. Dort hatte der in Harvard lehrende Idealismus-Philosoph Josiah Royce seine Studenten in den 1890er-Jahren getroffen, um über Erlösung und Unsterblichkeit zu diskutieren, bevor er am Charles River entlang zu seinem Haus in Cambridge zurückschlenderte. Von Erlösung und Unsterblichkeit am Durgin-Park hielt ich nichts, sondern entschied mich dafür, mich um meinen Verstand zu trinken. Am Ende der Nacht stolperte ich nach Hause und versuchte meine Frau davon zu überzeugen, dass ich nicht betrunken war.
Ich suchte nach Hilfe an all den üblichen Orten, an all den falschen Orten. Thoreau zufolge geben wir uns nicht wenig Mühe dabei, »die Möglichkeit einer Veränderung [zu] leugnen. ›Nur so geht es‹, sagen wir. Es geht aber«, versichert er uns, »auf so vielerlei Weise, als wir Radien von einem Zentrum ziehen können.« Ist das Leben lebenswert? James hatte seine Antwort in der Holden Chapel gefunden, aber ich musste Harvard und Boston ganz und gar hinter mir lassen. Nur den Weg hatte ich praktisch vergessen. Ich bin so dankbar, dass ich ihn schließlich doch gefunden habe.
Wenn man von Boston aus in Richtung Norden fährt, nachdem man die 495 verlassen und die Interstate 95 erreicht hat, rauscht alles ziemlich schnell an einem vorbei, und man erreicht New Hampshire, bevor man es gemerkt hat. Aber dann werden die Dinge langsamer. Die Route 16 in die White Mountains hinein ist eine seltsame, kleine Strecke, die Art von Straße, die sich nicht entscheiden kann, ob sie nun eigentlich für Autos geeignet sein will oder für Einspänner oder doch besser als Zugtrasse. Sie ist zwischen zwei Zeitaltern steckengeblieben, so wie die Kleinstädte, die sie durchquert. Sie wurde zu einer Zeit gebaut, als die sogenannten Brahmanen von Boston, die vornehmsten Familien der Stadt, zu denen viele der Cambridge-Intellektuellen gehörten, nach Norden zogen, um der Sommerhitze zu entgehen. Die Zeichen ihrer Wanderung sind immer noch zu sehen: Viktorianische Villen oben auf idyllischen Steilufern, eindrucksvolle Bahnstrecken – inzwischen sind sie stillgelegt – und Pfosten zum Anbinden von Pferden neben verrammelten 7-Elevens. Die 7-Elevens sind wiederum ein anderes Zeichen – sie weisen darauf hin, dass diese Migration vorüber ist.
Wenn man die Route 113 erreicht und nach rechts abbiegt, kommt man der Sache schon näher. Wenn man durch die winzige New-Hampshire-Stadt Chocorua durchfährt und William James’ Sommerhaus passiert, weiß man, dass man zu weit gefahren ist. James hat das Haus 1886 gekauft, als er schließlich als Philosoph in Harvard genügend Geld verdient hatte, um sich einen solchen Rückzugsort leisten zu können. Aber das ist nicht das, wonach Sie suchen. Legen Sie den Rückwärtsgang ein und fahren Sie die 113 weiter bis zu dem Dorf Madison. Sie kommen an einer Reihe von Läden vorbei, in denen Antiquitäten verkauft werden, traurige, kleine Läden, die dazu dienen, Leuten zu helfen sich in der Gegenwart über Wasser zu halten, indem sie ihre Vergangenheit verkaufen und ihre Erinnerungen Fremden anvertrauen.
Nach einer Weile krümmt sich die Route 113 nach links und führt an der Borough Hall vorbei. An dieser Stelle wachsen Tannen und Fichten bis an den Seitenstreifen heran, was es unmöglich macht, mehr als hundert Meter voraus- oder zurücksehen zu können. Dieser geschützte Wald ist eine willkommene Mahnung daran, dass nicht alle alten Dinge den Bach runtergehen. Biegen Sie links auf die Mooney Hill Road und fahren Sie den Hügel hoch. Dies ist die weniger befahrene Straße der amerikanischen Philosophie. Tatsächlich wirkt sie so, als wäre sie überhaupt nicht befahren worden, jedenfalls nicht von irgendjemandem ohne Allradantrieb. Fahren Sie weiter. Sie denken vielleicht, Sie hätten sich verfahren. Und in gewisser Weise stimmt das auch – das Gebiet der Philosophie, dem Sie sich nähern, ist seit mehr als einem Jahrhundert weitgehend unerforscht geblieben.
Bei jeder Weggabelung der Straße nehmen Sie den Abzweig nach links. Ein paar Kilometer auf einer verlassenen Schotterstraße können wie eine Ewigkeit wirken, und so werden Sie erleichtert sein, wenn Sie ein kleines Schulhaus mit nur einem Klassenzimmer vor sich auftauchen sehen. Jetzt biegen Sie rechts auf die Janus Road und nehmen die letzte Steigung. Wenn Sie nach rechts schauen, werden Sie einen klaren Ausblick auf die Sandwich Range der White Mountains haben, wobei Mount Washington rechts hinter Ihnen liegt. Wenn Sie nach links schauen, sehen Sie zunächst nichts als weiße Kiefern, aber dann werden Ihnen zwei Steingebäude im georgianischen Stil ins Auge fallen. Eins davon ist ein sehr großes Haus. Das andere liegt im Wald, einen kurzen Fußweg von der Villa entfernt. Es hat lauter Fenster und hat nichts mit der Holden Chapel gemein. Das ist die Hocking-Bibliothek. Sie haben West Wind erreicht.
»Reisen ist das Paradies der Narren«, sagte Emerson einst, »[denn] mein Riese folgt mir, wohin ich auch gehe.« Das stimmt ganz allgemein, aber wenn ich an bestimmte Orte reise, lässt mich mein Riese lang genug allein, damit ich nachdenken kann. William Ernest Hocking fand – oder besser schuf – mit West Wind einen dieser seltenen Orte.
Wie viele amerikanische Philosophen hatte Hocking ursprünglich gar nicht vor, einer zu werden. Er wurde 1873 in Cleveland geboren und verbrachte seine Jugendjahre in Joliet, Illinois. Seine Mutter stammte aus der Pratt-Familie aus Southbridge, Massachusetts, die davor aus der Plymouth Colony gekommen war und noch davor von der Mayflower. Sein Vater, ein Kanadier, studierte Medizin in New York und Maryland, bevor er Anfang der 1870er-Jahre mit der Familie gen Westen zog. William Hocking, das erste von fünf Kindern, wuchs in einer Familie von überzeugten Methodisten auf und erlebte, was er später eine »Konversionserfahrung« nannte, die seinen jugendlichen Glauben an den Allmächtigen untermauerte. Nachdem er die Highschool 1889 abgeschlossen hatte, arbeitete er vier Jahre lang als Aufseher und Kartenmacher und versuchte, genug Geld zu sparen, damit er an der Universität von Chicago studieren konnte. Die Finanzkrise von 1893 machte diese Pläne jedoch zunichte, und er entschied sich stattdessen für das Iowa State College of Agriculture and Mechanic Arts (heute die Iowa State University).
Hocking hatte Architekt oder Ingenieur werden wollen – zumindest war das der Plan, bis er im dritten Highschooljahr im zarten Alter von vierzehn Herbert Spencers »Die ersten Prinzipien der Philosophie« las. Den größten Teil seiner Laufbahn verbrachte Spencer damit, Darwins Evolutionstheorie zu verbreiten, eine Theorie, die im kommenden Jahrhundert die amerikanische Philosophie radikal beeinflussen sollte und bis heute den religiösen Glauben fundamental in Frage stellt. Als Hockings Vater entdeckte, dass sich sein Sohn in die »Ersten Prinzipien« vertiefte, tat er, was jeder vernünftige Methodist tun würde: Er bestand darauf, dass sein Sohn das Buch wieder in die Bücherei zurückbrachte. Aber Hockings Vater hatte nicht gesagt, dass er es nicht erneut ausleihen dürfte. Also tat er genau das in der nächsten Woche. Und diesmal versteckte er seinen Spencer auf dem Heuboden der Scheune und verlor prompt seinen Glauben. Diese Glaubenskrise war Hockings erster Vorstoß in das metaphysische Denken. Seine Lektüre von William James’ »Die Prinzipien der Psychologie« Anfang der 1890er-Jahre war sein zweiter.
Als der jugendliche Hocking die »Psychologie« las, war James schon auf einem guten Weg eine Schule des Denkens zu begründen, die als amerikanischer Pragmatismus bekannt geworden ist. Dieser Pragmatismus meint, dass Wahrheit auf der Grundlage ihrer praktischen Konsequenzen zu beurteilen ist, ihrer Fähigkeit, die menschliche Erfahrung zu bewältigen und zu bereichern. James’ Pragmatismus war gerade so gut begründet und praktisch genug, dass er einen Beinahe-Ingenieur davon überzeugen konnte, dass Philosophie keine komplette Zeitverschwendung war.
Auf dem Weg zur Philosophie spielte Hocking mit der Idee, nur Religion zu studieren. Er war einer der jüngsten Besucher des »Weltparlaments der Religionen« in Chicago 1893, das gleichzeitig mit der »Kolumbianischen Weltausstellung« abgehalten wurde. Niemand weiß das so genau, aber es ist gut möglich, dass er dort seinen zukünftigen Lehrern Josiah Royce und George Herbert Palmer bei den Veranstaltungen begegnet ist, denn beide hielten dort Vorträge. Was wir aber wissen, ist, dass Hocking 1899 nach Cambridge kam, um in Harvard Philosophie zu studieren, und zwei Jahre später seinen Bachelor machte.
Er war einer der letzten Studenten, der mit den »Philosophischen Vier« arbeitete: James, Royce, Palmer und George Santayana. Hocking, damals sechsundzwanzig, verpasste diese Gelegenheit nicht. Auf seine Studentenjahre zurückblickend, schrieb Hocking: »Ich hielt sie und halte sie für die stärkste philosophische Fakultät der Welt … sie war stark, weil die einzelnen Männer stark waren, und doch unterschiedlich genug, sodass die meisten Studenten in dem einen oder anderen der Zentralgruppe jemanden entdecken konnten, der seine Probleme direkt ansprach.«
Hockings Spencer-Lektüre hatte ihn von der Vorstellung eines gütigen und allmächtigen Gottes abgebracht, und er suchte verzweifelt nach einem intellektuell vertretbaren Ersatz. Er war gekommen, um bei James zu lernen, aber der berühmte Psychologe und Philosoph war gerade in Europa, als Hocking zu studieren begann. Während er darauf wartete, dass James zurückkehrte, lernte Hocking Deutsch und Französisch, setzte sein Studium der Mathematik und der Naturwissenschaften fort und besuchte Seminare über Metaphysik und Ästhetik bei Royce und Santayana. »Ich arbeitete gierig und glücklich«, schrieb er später, »und litt bloß, weil ich nur sechs Seminare zur gleichen Zeit besuchen durfte.«
Hocking war allerdings nicht der typische Bücherwurm. Im Frühjahr 1900 plante er seine erste Reise nach Europa, um die Internationale Weltausstellung in Paris zu sehen. Er war pleite – »mittellos«, um seinen Ausdruck zu verwenden –, sodass er und sieben andere Harvard-Studenten um die Hilfe eines Mr Buffum ersuchten. Buffum war, wie Hocking ausführte, »ein nicht allzu seriöser Viehtreiber-Vermittler … am Kai von Boston«, der Studenten als Viehtreiber für die SSAnglican anheuerte. Sie reisten am 14. Juni von Charleston ab, dem wichtigsten Hafen Bostons. »Wir wurden zusammengewürfelt«, schrieb Hocking, »mit acht erfahrenen Viehtreibern, sodass wir vier Teams aus jeweils vier Mann bildeten, und jedem Team wurden 125 texanische Rinder zugewiesen.« Die Reise dauerte zwölf Tage, und sie kamen am Victoria Dock in London an. Den Studenten wurde dann für sieben Wochen Urlaub gewährt, um das Beste der europäischen Kultur kennenzulernen. Die Verbindung von echtem Leben mit Hochkultur verkörperte einen wichtigen Strang der amerikanischen Philosophie, den Hocking sich für den Rest seines Lebens bewahren wollte.
Kurz nach Hockings Rückkehr nach Harvard im Herbst 1900 kehrte auch William James zurück. James hatte an dem Manuskript über »Die Vielfalt religiöser Erfahrung« gearbeitet, einem Buch, das den Versuch unternahm, einen Raum für religiöse Erfahrung in einer Welt zu bewahren, die zunehmend von der Wissenschaft dominiert wurde. Als Student im Grundstudium besuchte Hocking die Seminare, die James abhielt, während er an der »Vielfalt« feilte. Eines Abends wandte sich der auf die sechzig zugehende James, nachdem er seinen Studenten einen Teil des Manuskripts vorgelesen hatte, an Hocking: »Hocking, warum haben Sie mit einem ständigen Stirnrunzeln auf Ihrem Gesicht dagesessen?« Hocking gab später zu, dass er dieses Stirnrunzeln überhaupt nicht bemerkt hatte – er war nur sehr konzentriert gewesen, oder noch besser, »begeistert«. Nachdem er 1904 sein Studium in Harvard mit einem Doktortitel abgeschlossen und zwei Jahre am Andover Theological Seminary unterrichtet hatte, zog Hocking nach Kalifornien, um Mitglied der Fakultät in Berkeley zu werden. Aber statt sich ganz der Philosophie zu widmen, verbrachte er die meiste Zeit in San Francisco und half beim Wiederaufbau nach dem großen Erdbeben von 1906 und verfeinerte seine Fähigkeiten als Architekt, die er brauchte, um in den White Mountains ein Anwesen entwerfen und aufbauen zu können. 1908 erhielt er einen Ruf nach Yale, um zu unterrichten, und als sein Mentor Josiah Royce 1916 starb, übernahm er Royces philosophischen Lehrstuhl in Harvard, der weit und breit als die prominenteste Position in diesem Feld angesehen wurde. Am Ende seiner vierzigjährigen Karriere in Harvard war Hocking eine der Ikonen der amerikanischen Philosophie geworden. 1944 wurde er der sechste Amerikaner, der die berühmten Gifford Lectures in Schottland abhielt, nachdem vor ihm nur Josiah Royce, William James, John Dewey, Alfred North Whitehead und Reinhold Niebuhr diese Ehre zuteilgeworden war.
Bei meiner ersten Fahrt zum Hocking-Anwesen wusste ich viel mehr über seine Lehrer als über Hocking selbst. Ich war nach Chocorua gefahren, um eine Konferenz über Leben und Werk von William James organisieren zu helfen. Heutzutage werden die meisten philosophischen Kongresse in riesigen, unscheinbaren Hotels in riesigen, unscheinbaren Städten abgehalten, sodass diese kleine Versammlung von Philosophen in der Chocorua Public Library mein Interesse weckte. Ich wusste, dass die Konferenz gut sein würde, aber nicht gut genug, um meine dauernden Ängste beschwichtigen zu können, dass Philosophie selbst eigentlich nicht von Bedeutung war. Also fand ich mich selbst erneut woanders wieder – diesmal bedachte ich die geschmacklichen Vorzüge von »Schnecken« in einer deutschen Bäckerei an der Kreuzung der Routes 16 und 113. Der Laden hatte nicht einmal einen Namen, nur ein Schild draußen, auf dem COFFEETOGO stand.
Hier stieß ich auf Bunn Nickerson. Bunn war einer dieser Typen, von denen man hofft, dass man selbst so ist, wenn man dreiundneunzig wird. Er war scharfsinnig und sehnig und nicht vergleichbar mit den meisten Philosophen, die ich kennengelernt hatte. Er ging langsam, wie die meisten alten Philosophen, obwohl sein Humpeln nicht eine Folge von ewig langer Inaktivität war, sondern von bäuerlicher Arbeit und dem Skifahren rührte.
Ich weiß nicht mehr, warum ich mit Bunn ins Gespräch kam (in meiner Profession lernt man, vorsichtig zu sein). Ich weiß noch, dass ich peinlich berührt war, als er mich fragte, was ich für meinen Lebensunterhalt tat.
»Ich lehre Philosophie«, sagte ich und wappnete mich für das beklommene Schweigen, das normalerweise auf dieses Geständnis folgte.
Es stellte sich heraus, dass Bunn mit Philosophen aufgewachsen war oder, genauer gesagt, in einem kleinen Haus am Rande des Grundstücks eines Philosophen, also auf »Dr. Hockings« Land. Heutzutage haben Philosophen ihre Theorien und den einen oder anderen Studenten. Die meisten von ihnen haben kein »Land«. Bei Bunn klang es wie das Reich eines Philosophenkönigs, und das war gar nicht so weit von der Wahrheit entfernt: Die Hocking-Farm umfasste, wie ich dann herausfand, ein Herrenhaus aus Stein, sechs kleine Sommerhäuschen, zwei große Scheunen und einen Fischteich mit drei Biberbauten, alles auf vierhundert Hektar Feld und Wald gelegen. Und eine Bibliothek. Bunn musste gesehen haben, wie mein Gesicht aufleuchtete, als er das Wort aussprach. In einem Akt der Großzügigkeit, den ich nie verstanden habe, bot er an, mich dorthin zu fahren. Sie sehen zu können, kam mir wie ein sehr guter Grund vor, den Rest der Konferenzplanung zu schwänzen, also kletterte ich in den blauen Dodge-Pick-up des alten Mannes, und wir rumpelten den Hügel hoch Richtung »Dr. Hockings Land« – oder, wie Bunn es nannte, »West Wind«.
WIE ICH WEST WIND FAND
Heutzutage haben die meisten Akademiker keine eigene Bibliothek mehr, die der Rede wert wäre, und so meiden sie ein Problem, dem sich viele Intellektuelle im neunzehnten Jahrhundert in der Dämmerung ihres Lebens stellen mussten – was machte man mit einem intellektuellen Zuhause, nachdem es dauerhaft verlassen worden war? Natürlich können die Bücher einer größeren Universitätsbibliothek gespendet werden. Die Widener Library steht voller Exemplare, die einmal berühmten Ehemaligen Harvards gehört haben. Wenn dies allerdings geschieht, sind die Bücher zwischen Millionen anderer in den Magazinen verloren, werden durch die standardisierte Katalogisierung der Library of Congress voneinander getrennt. Die Bücher sind streng geordnet, und die einmalige Geschlossenheit der ursprünglichen Sammlung ist verloren. Um dieses Schicksal zu vermeiden, gaben Schriftsteller zu Hockings Zeiten oft ihre Bibliotheken an ähnlich gesonnene Freunde und Studenten weiter.
Als Bunn und ich West Wind erreichten, wirkte die Hocking-Bibliothek verlassen. An den Bäumen um die Gebäude herum hingen Schilder BETRETENVERBOTEN, aber Bunn schien das nicht zu stören. Er erklärte, dass die Mitglieder der Hocking-Familie immer noch Zeit auf diesen Ländereien verbrachten, besonders in den Sommermonaten, aber an jenem frischen Herbsttag war niemand da. Bunn stieg aus seinem Pick-up, trabte von mir weg den Hügel herunter, um seine alten Lieblingsorte aufzusuchen, und lud mich, während er in Richtung Bibliothek winkte, dazu ein, »mich umzusehen«. Das Gebäude war aus grobem Granit in verschiedenen Schattierungen errichtet worden, so stabil (und beinahe so groß) wie ein Haus. Von außen konnte ich nicht erkennen, ob es wirklich zweistöckig war, aber ich konnte die Oberlichter im Dach ausmachen, die vermutlich den Raum mit einem prächtigen Leselicht erfüllten. Die Bibliothek war auf jeden Fall groß genug, um nahezulegen, dass ihr Besitzer nie die Vorstellung gehegt hatte, sie könnte verlassen werden. In die Fassade waren große Bogenfenster und jeweils drei Fenstertüren eingelassen. Ich spähte hinein und wurde an William James’ Liebe zu Goethes »Faust« erinnert. In der Eröffnungsszene klagt Faust, umgeben von zerlesenen Folianten, über die Hinfälligkeit menschlichen Wissens:
Habe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh’ ich nun, ich armer Tor,
Und bin so klug als wie zuvor!
James hatte in seiner Jugend über Goethe gebrütet; er besaß Fausts vielseitige Fähigkeiten – er hätte Maler werden können, Biologe, amtlicher Inspektor, Romancier, Theologe –, aber James empfand ebenso wie Faust, dass die menschlichen Fähigkeiten, selbst wenn sie eindrucksvoll waren, dennoch bedauerlich begrenzt blieben. »Alle natürlichen Güter verfallen«, schrieb James. »Reichtümer sind flüchtig; Ruhm ist ein Hauch; Liebe ein Betrug; Jugend und Gesundheit und Vergnügen vergehen.« Als ich das erste Mal in die Hocking-Bibliothek spähte, dachte ich, dass dies wahrscheinlich ein Ort war, an dem »alle natürlichen Güter verfallen«. Selbstverständlich sehnte ich mich danach hineinzugehen. Ich nahm an, dass ich wohl warten sollte, bis eines der Familienmitglieder mich hineinließ, aber ich begann mich zu fragen, ob die Familie je zurückkäme. Vielleicht interessierten sie sich einfach nicht für alte Bücher. Ich konnte nicht bis zum Sommer warten, um mir die Bücher anzusehen. Vielleicht war dies jetzt meine einzige Chance. »Wer darauf verzichtet, eine sich darbietende einzige Gelegenheit zu ergreifen«, schrieb James, »verliert den Preis ebenso sicher, als wenn er den Versuch machte und keinen Erfolg hätte.«
Dann entdeckte ich durch das Fenster auf einem Regal die Bände des »Century Dictionary«. Es war 1891 zuerst erschienen und ein Meisterwerk lexikografischen Details, hatte mehr als siebentausend große Quartoseiten und besaß zehntausend Holzstichillustrationen. Als dieses Lexikon ein Jahr später im »American Anthropologist« besprochen wurde, stimmte der Kritiker dem wachsenden Empfinden jener Zeit zu – als er sagte, es sei »das bemerkenswerteste literarische Denkmal des 19. Jahrhunderts«. Einige der besten Köpfe Amerikas hatten jahrelang an dieser ersten Ausgabe mitgearbeitet, einschließlich eines der Begründer der amerikanischen Philosophie, Charles Sanders Peirce. Ich hatte schon immer eine seltsame Faszination für Peirce gehegt – die Art von Faszination, die einen dazu bringt, eine Dissertation zu schreiben. Nachdem die Dissertation fertig war, beschloss ich, ein Buch über ihn zu schreiben. Peirce war zwanghaft, brillant und nur ein wenig verrückt. Er war der Sohn des Harvard-Mathematikers Benjamin Peirce und schnappte sich das Exemplar von Whatelys »Elemente der Logik«, das seinem Bruder gehörte, als er vierzehn war, und las es in einem Rutsch durch. Obwohl er eine Ausbildung als Chemiker und Geodät hatte, betrachtete Peirce eigentlich Logik und Metaphysik als seine lebenslange Berufung. Er blieb immer ein Außenseiter für die Mainstreamphilosophie, eine seltsame Rolle für den vielleicht originellsten Philosophen des neunzehnten Jahrhunderts. Sein Werk zur Logik und Mathematik nimmt das von Gödel und Russell vorweg. Seine Schriften über Wissenschaftstheorie nehmen es leicht mit denen von Popper und Kuhn auf. Und seine Aufsätze im Journal of Speculative Philosophy Ende 1860 schaffen die Grundlagen für drei Jahrzehnte des amerikanischen Pragmatismus. James und Royce sahen zu ihm auf, um Inspiration und Anleitung zu finden. Im Februar 1903 versuchte William James den Präsidenten Harvards, Charles Eliot, davon zu überzeugen, dass Peirce aufblühen würde, wenn er eine feste Stelle in der philosophischen Fakultät erhielte: »Er ist einer von unseren drei oder vier herausragenden, amerikanischen Philosophen«, brachte er vor, »und es scheint mir, dass sein Genie eine offizielle Anerkennung verdient.« Eliot war nicht überzeugt – Peirces Ruf als Unruhestifter eilte ihm voraus. Seinen Leistungen zum Trotz gehörte Peirce nie irgendwo dazu – er mischte sich, oft sehr effektiv, andauernd in die Forschungen anderer Leute ein. Er zerlegte die sorgfältig gedrechselten Argumentationsketten seiner Kollegen mit der nervtötenden Leichtigkeit des Junggenies. Im Laufe seines Lebens perfektionierte er die Kunst der Selbstdemontage und vereitelte die anhaltenden Versuche seiner Freunde, ihm eine feste Stellung und ein sicheres Einkommen zu verschaffen. Also fand er eine Teilzeitbeschäftigung, die besser zu seinem Genie passte, indem er Einträge für das »Century Dictionary« zu einigen Forschungsgebieten schrieb: zur Logik, Metaphysik, Mathematik, Mechanik, Astronomie, Gewichten und Maßen. Als ich diese verstaubte Ausgabe entdeckte, musste ich sie durchblättern, obwohl ich mich ein wenig so fühlte, als würde ich einen Hausfriedensbruch begehen. Aber dies war kein unbefugtes Eindringen, dachte ich. Wenn die Türen unverschlossen sind, handelt es sich lediglich um Eindringen. Ich würde einen kurzen Blick hineinwerfen und die Dinge so lassen, wie ich sie vorgefunden hatte.
Wenn ich darüber nachdenke, weiß ich, dass dies lauter Ausreden für ein ziemlich schlechtes Benehmen sind. Aber es hätte viel schlimmer ausgehen können. Im vorigen Jahr hatte ein Verwandter Hockings die leere Bibliothek ohne Erlaubnis der Familie durchforstet. Nur dass dieser Typ im Heroinrausch war. Und er machte sich daran, vierhundert seltene Bücher zu stehlen – unter ihnen eine Erstausgabe von Thomas Hobbes’ »Leviathan«, 1651 erschienen – und sie zu seinem Haus in Berkeley, Kalifornien zu transportieren. Im Eingang der Bibliothek, neben dem Lexikon, lag ein brauner Briefumschlag mit der Aufschrift INVENTAR. Ich überflog es schnell und entdeckte eine Reihe sehr teurer Bücher:
René Descartes. Discourse on the Method (Erste Englische Ausgabe 1649). – (Vom FBI zurückgegeben)
John Locke. Two Treatises of Government (1690). – (Vom FBI zurückgegeben)
Immanuel Kant. Kritik der reinen Vernunft (Riga: 1781). – (Vom FBI zurückgegeben)
Dies waren Erstausgaben – Hunderte von ihnen –, geschrieben von den europäischen Philosophen, die solche amerikanischen Intellektuellen wie William James erst inspiriert und dann frustriert hatten. Hocking sammelte sie aus einem Grund: Er suchte nach den Ursprüngen der amerikanischen Philosophie. Zu der Zeit wusste ich nicht, was das FBI mit philosophischen Klassikern zu tun hatte, aber es stellte sich heraus, dass die Bundesregierung überraschend gut darin ist, gestohlene Bücher über die Staatsgrenzen hinweg aufzuspüren. Anscheinend gingen die Hockings zur Polizei von Madison, die sich an das FBI wandte, das eine beträchtliche Anzahl der teuren Bände wieder auftrieb. Einige sind allerdings nach wie vor verschollen. Als der Dieb festgenommen und ein Jahr später vor Gericht gestellt wurde, heißt es in den Gerichtsakten, er habe »ausgesagt, dass er mehrere Versuche unternommen habe, die Hocking-Familie davon zu überzeugen, dass sie besser auf die Bücher aufpassen müsste, aber die Familie habe sich geweigert, dem nachzukommen … Der Beklagte behauptete, dass er die Bücher nur an sich genommen habe, um sie zu schützen, und keine Pläne gehabt hätte, sie für Geld zu veräußern.« Gleichwohl nahm er Bücher im Wert von mehr als einer Viertelmillion Dollar an sich und verkaufte einige von ihnen. Ich legte die Inventarliste vorsichtig zurück an ihren Platz und wandte mich dem Lexikon zu. Es hatte noch den ursprünglichen Einband, braunes Leder, das nach mehr als hundert Jahren des Gebrauchs eine dunkle Patina angenommen hatte. Die Seiten waren überraschend brüchig für ein Buch, das noch relativ jung war, eine Zerbrechlichkeit, die dem Schimmel geschuldet war und den vielen kalten Jahreszeiten, denen wärmere Perioden gefolgt waren.
Ich schaute mir nach dem Zufallsprinzip einige der Einträge an – »Mädchen-Blässe«, »Dienstmädchen«, »maieutisch« –, gerade genug, um zu begreifen, dass das, was Eingang in die Lexika fand, sich seit den Zeiten von Peirce und James radikal verändert hatte. Es gab eine Zeit, da konnten Philosophen wie Peirce die Sprache, die wir benutzen, ganz genau bestimmen. Sie hatten die Macht, die Realität zu definieren. Aber sie hatten sie nicht mehr, und dies war, zumindest für mich, keine kleine Tragödie. Während des letzten Jahrhunderts hatte sich die Mainstreamphilosophie in die oberen Stockwerke des Elfenbeinturms zurückgezogen, und während sie sich spezialisierte und professionalisierte, verlor sie zu einem großen Teil den Kontakt mit den existenziellen Fragen, die James und Peirce bewegt hatten. Über dem Lexikon, auf einem unbehandelten Eichenregal, stand eine Reihe in Leder eingebundener Bände: Das Journal of Speculative Philosophy, in dem Peirceseine Spuren hinterlassen hatte.Es war derErstdruck der ersten vollständigen Ausgabe von 1867 bis 1893, alle fünfundzwanzig Bände. Ich wollte nur einen Blick darauf werfen, und dann würde ich wirklich wieder gehen. Ich wollte Hockings Signatur sehen, und so zog ich vorsichtig den ersten Band aus dem Regal.
Hockings Name stand nicht auf der ersten Seite des Buches. Stattdessen stand dort »Charles S. Peirce« in kleiner, neurotischer Handschrift. Der Band glitt mir aus den Händen. Als professioneller Philosoph fange ich sehr selten an zu hyperventilieren, während ich meine Forschung betreibe, aber Peirce war ein berüchtigter Einsiedler gewesen. Die meisten seiner Bücher waren verkauft oder am Ende seines Lebens nach Harvard gebracht worden, aber irgendwie war dieser kleine Schatz – Peirces eigenes Exemplar seiner ersten und berühmtesten Veröffentlichung – hierher gelangt.
Die letzten Jahrzehnte des neunzehnten Jahrhunderts werden oft als das Goldene Zeitalter der amerikanischen Philosophie betrachtet. Diese Ära fiel mit einem ähnlich aufregenden Übergang in der europäischen Philosophie zusammen, der von der Geburt der Phänomenologie geprägt ist, einer Schule des Denkens, die, nicht unähnlich der amerikanischen Philosophie, meinte, dass philosophische Fragen sich aus der Erfahrung heraus stellen müssen und dass ihre Antworten danach beurteilt werden müssen, ob sie in der Lage sind, andere Leben zu bereichern. Aus der Phänomenologie entwickelten sich allmählich der Existenzialismus und die postmoderne Philosophie. Alle goldenen Zeitalter vergehen allerdings irgendwann – in diesem Falle mit dem Tod einer Anzahl großer amerikanischer Denker. William James starb 1910, Charles Sanders Peirce 1914, Josiah Royce 1916, George Herbert Palmer 1933, Edmund Husserl, der deutsche Vater der Phänomenologie, 1938. Und so nahm sich William Ernest Hocking, der bei ihnen studiert und sie alle überlebt hatte, ihrer Bücher an.
Viele Bände in dieser Bibliothek stammten aus dem siebzehnten und dem achtzehnten Jahrhundert und waren sehr kostbar, aber noch viel mehr enthielten die Randnotizen ihrer ursprünglichen Besitzer, und diese waren absolut unbezahlbar. Als Hocking 1966 starb, wurde sein Sohn Richard – auch ein Philosoph – der Verwalter der Sammlung. Er hatte mehrfach versucht, die ganze Sammlung Harvard zu vermachen, aber ohne viel Glück. Harvard – wie der Verwandte aus Berkeley – hätte sich das Beste herausgepickt, hegte aber keinerlei Absicht, die Bibliothek insgesamt zu erhalten. Aber gerade ihre Einheit machte diese Sammlung, laut Richard, so besonders. Als Richard 2001 starb, blieben die Bücher einfach im dunklen Wald am Ende der Janus Road in New Hampshire. Richards drei Töchter versuchten tapfer, sich um die Sammlung zu kümmern, aber sie lebten über ganz Nordamerika verstreut und mussten sich um den gesamten Landbesitz sorgen, ganz zu schweigen von ihren eigenen Leben.
Bücher bestehen bloß aus Papier, zerstampftem und getrocknetem Holzstoff. Im Reich der Nager und Termiten sind sie recht wertvoll: Sie sind schmackhaft, und wenn man sie in kleine Stücke zerfetzt, werden aus ihren Seiten gemütliche, kleine Nester. Ein Jahrzehnt lang wurde die Hocking-Bibliothek eifrig benutzt – allerdings nicht von Menschen. Stachelschweine und Käfer hatten sich angesiedelt und sorgten dafür, dass diese große Menge Papier nicht völlig verdarb. »WERAUCHIMMER auf die Welt der Insekten schaut«, schrieb Emerson in »Zitat und Originalität«, »auf Fliegen, Aphiden, Stechmücken und unzählige Parasiten … muss die extreme Befriedigung bemerkt haben, die sie durch das Saugen erlangen, was die hauptsächliche Tätigkeit in ihrem Leben zu sein scheint. Wenn wir in eine Bibliothek oder eine Nachrichtenredaktion gehen, sehen wir dieselbe Funktion auf einer höheren Ebene, die mit einer Art Inbrunst ausgeübt wird, mit derselben Ungeduld angesichts von Unterbrechungen, was darauf verweist, wie süß diese Handlungen sind.« Hungrig blickte ich ein letztes Mal auf das Inventar und dann wieder in das Journal of Speculative Philosophy. Der »Leviathan« von 1651 war selten. Die »Two Treatises of Government« von 1690, eine anonym geschriebene erste Ausgabe, die als Grundlage für die amerikanische politische Freiheit gedient hatte, war noch seltener. Im letzten Jahr waren Erstausgaben beider Werke verauktioniert worden. Hobbes’ Meisterwerk hatte $ 32 000 eingebracht; Lockes Traktat wurde von einem Antiquar in Dallas für $ 41 000 verkauft. Als Student hatte ich diese Auktionen aus der Ferne beobachtet und im Internet herumgeschnüffelt, um zu sehen, was Philosophie tatsächlich wert sein konnte. Die Bücher im Inventar in West Wind, die Klassiker der modernen Philosophie, hätten in der British Library oder in Yale oder in der Huntington Library in San Marino, Kalifornien, unter Glas liegen können. Aber es gab, meinte ich, nur eine Ausgabe des Journal of Speculative Philosophy, in dem der Name von C. S. Peirce stand. Es war unersetzlich. Und es lag unter einer dünnen Staubschicht in der Hocking-Bibliothek. Bald würden sich die Termiten darüber hermachen.
Als Kind vergrub ich Dinge im Garten, damit ich sie Jahre später wieder ausgraben konnte. Die Hocking-Bibliothek stellte sich als die größte Zeitkapsel heraus, die ich jemals geöffnet hatte. Es war ein großer Raum, der durch Zwischenwände aus Walnussholz in verschiedene Arbeitsnischen eingeteilt war. In Wahrheit gab es keine echten Wände. Nur Bücherregale und Fenster. Ich schätzte den Bestand auf ungefähr zehntausend Bücher. Zu meiner Rechten und Linken an entgegengesetzten Enden des Gebäudes befanden sich zwei große Marmorkamine, groß genug, sodass ich in ihnen hätte stehen können, ohne mich allzu sehr bücken zu müssen, und solide genug, dass sie das ganze Gebäude mindestens bis Oktober oder November hätten warmhalten können. Orientteppiche, die nicht zueinanderpassten und schon ganz verschlissen waren, bedeckten die breiten Eichendielen der Bibliothek. Die Schaukelstühle aus der ersten Generation von Stickley – mit ihren robusten Walnussleisten und den Sitzen aus muffigem Pferdehaar – sahen so aus, als hätten sie seit vielen Jahren keinen Besucher mehr beherbergt. Eine enge Wendeltreppe – eher eine Leiter, wenn ich es recht bedenke – führte zu einem Loft darüber.
An gegenüberliegenden Wänden hingen zwei riesige Porträts – eins von Hocking, dessen kantiges, markantes Kinn gerade so gereckt war, dass man begriff, es ging ihm ums Geschäft, um das intellektuelle und sonst auch, das andere von seiner Frau Agnes. Sie blickten auf mich hinunter mit einem Ausdruck, den ich mir nur als stille Missbilligung erklären konnte. Hocking hatte Agnes O’Reilly 1905 geheiratet. Sie war die Tochter des gefeierten Dichters und Journalisten John Boyle O’Reilly, der Ende des neunzehnten Jahrhunderts Redakteur von Bostons irischer Zeitung The Pilot