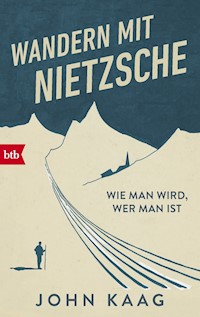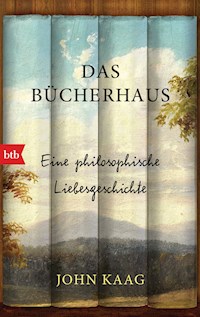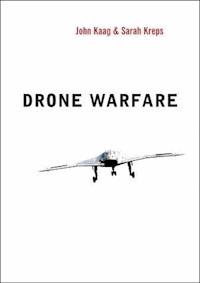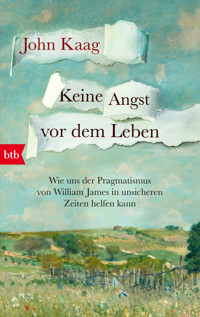
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Warum der Begründer des Pragmatismus und der empirischen Psychologie auch heute noch jeden erreicht, der darum kämpft, sein Leben lebenswert zu gestalten.
Im Jahr 1895 hielt William James, der Vater der amerikanischen Philosophie, einen Vortrag mit dem Titel »Ist das Leben lebenswert?«. Für James, der ein Vierteljahrhundert zuvor als junger Mann in einer existenziellen Krise über Selbstmord nachgedacht hatte, war dies bei Weitem keine theoretische Frage. Wie John Kaag schreibt, war James' gesamter philosophischer Ansatz von Anfang bis Ende darauf ausgerichtet, Leben zu retten.
Eloquent, inspirierend und voller Erkenntnisse ist »Keine Angst vor dem Leben« vielleicht das klügste und wichtigste Selbsthilfebuch, das Sie je lesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Im Jahr 1895 hielt William James, der Vater der amerikanischen Philosophie, einen Vortrag mit dem Titel »Ist das Leben lebenswert?«. Für ihn, der ein Vierteljahrhundert zuvor als junger Mann in einer existenziellen Krise über Selbstmord nachgedacht hatte, war dies bei Weitem keine theoretische Frage. Wie John Kaag zeigt, war James’ gesamter philosophischer Ansatz von Anfang bis Ende darauf ausgerichtet, Leben zu retten.
Eloquent, inspirierend und voller Erkenntnisse ist »Keine Angst vor dem Leben« vielleicht das klügste und wichtigste Selbsthilfebuch, das Sie je lesen werden.
Autor
John Kaag, Jahrgang 1981, ist Professor für Philosophie an der University of Massachusetts Lowell. Er gilt als einer der spannendsten jungen Philosophen der USA und schreibt regelmäßig Artikel für Fachzeitschriften, aber auch für die New York Times, Harper’s Magazine und viele weitere Magazine und Zeitungen. Er lebt in der Nähe von Boston.
JOHNKAAGBEIBTB
Das BücherhausWandern mit Nietzsche
John Kaag
Keine Angst vor dem Leben
Wie uns der Pragmatismus von William James in unsicheren Zeiten helfen kann
Aus dem Amerikanischen von Martin Ruben Becker
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Sick Souls, Healthy Minds. How William James Can Save Your Life« im Verlag Princeton University Press, Princeton, NJ.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Deutsche Erstausgabe März 2025
btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright © der Originalausgabe 2020 by John Kaag
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2025 by btb Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe [email protected]
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: ©bridgeman images; ©plainpicture/Benjamin Harte
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
JT · Herstellung: han
ISBN 978-3-641-28093-2V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/penguinbuecher
Für Doug Anderson und für Kathy
Inhalt
Prolog »Ein Ekel vor dem Leben«
1 Determinismus und Verzweiflung
2 Freiheit und Leben
3 Psychologie und gesunder Geist
4 Bewusstsein und Transzendenz
5 Wahrheit und Konsequenzen
6 Wunder und Hoffnung
Danksagung
Lektüreempfehlungen
Register
Anmerkungen
Prolog »EIN EKEL VOR DEM LEBEN«
Aber nimm den glücklichsten Menschen, den, der von der Welt am meisten beneidet wird, und in neun Fällen von zehn ist sein innerstes Gefühl ein Bewußtsein des Versagens.
– William James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung, 1903
»Ich bin ein elendes Wrack. Ich bin in den letzten drei Monaten von einem solchen Ekel vor dem Leben erfasst worden, dass mir das Briefeschreiben beinahe unmöglich geworden ist.« William James war an der Schwelle zum Erwachsenenalter und stand zugleich, wie er 1869 seinem Freund Henry Bowditch verriet, kurz vor einem Nervenzusammenbruch. In den nächsten zwei Jahrzehnten sollte James unaufhörlich schreiben – Briefe, Essays, Bücher –, als hinge sein Leben davon ab. Er würde zum Vater der amerikanischen Philosophie und Psychologie werden, aber als er an Bowditch schrieb, ahnte er noch nichts davon. Er musste im Gegenteil darum kämpfen, auch nur den nächsten Tag zu erleben.[1]
James war gerade, nach einem achtzehn Monate langen Aufenthalt in Berlin, in sein Elternhaus nach Cambridge, Massachusetts, zurückgekehrt. Diese Reise, eine Mission auf der Suche nach körperlicher und geistiger Gesundheit, war zu einem Misserfolg geworden. Besser gesagt, sie hatte sich sogar als ausgesprochen kontraproduktiv erwiesen. Die Aussicht, nun, da er zurück in New England war, sein Medizinstudium abzuschließen, bereitete James wenig Freude. Er war nicht mit dem Herzen dabei, ja, er war bei gar nichts mit dem Herzen dabei. In Wahrheit war er es vielleicht bei zu vielen Dingen gleichzeitig.
James’ Begabung als Universalgelehrter war zu einem Teil verantwortlich für sein geteiltes Selbst – er war teils Dichter, teils Biologe, teils Künstler, teils Mystiker. Es zog ihn in zu viele Richtungen gleichzeitig, wie einen Menschen auf einer Streckbank, und deshalb konnte er sich eine Zeit lang gar nicht rühren, ging es bei ihm weder vor noch zurück. Er war ein Mensch voller disparater Neigungen, und in seinen Anfangsjahren gelang es ihm beinahe nicht, sich zusammenzuhalten. Aber da war noch etwas anderes. James steckte auch philosophisch fest, hatte sich in Gedanken verrannt, die schon zahllose Denker vor ihm geplagt hatten: Vielleicht werden die Menschen von Kräften beherrscht, die außerhalb ihrer Kontrolle liegen; vielleicht sind ihre Leben von Anfang an determiniert, dazu bestimmt, in tragischer Bedeutungslosigkeit zu enden; vielleicht können sich die Menschen, sosehr sie sich auch mühen, gar nicht selbst helfen, als freie und vor Lebendigkeit pulsierende Wesen; vielleicht sind sie nichts anderes als bloße Zahnräder in einer unselig konstruierten Maschine.
Die Sinnlosigkeit war das Problem, James’ Problem, und dieses Problem trieb ihn fast in den Selbstmord. Ende der 1860er-Jahre griff er nach einem roten Kreidestift, um ein Porträt in ein Skizzenbuch zu zeichnen: Ein junger Mann, der mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf allein dasitzt. Über diese Gestalt schrieb James: »HIERSITZENICHUNDMEINETRAUER.« Aber wenn man genau hinsieht, ganz genau, entdeckt man eine kleine, schwer erkennbare Änderung, die den Unterschied ums Ganze macht. Dann heißt es: »HIERBINICHTRAUER.« Es war ein Selbstporträt.[2]
In seinem späteren Leben beschrieb James einmal eine Person, einen Typus, den man um Harvard herum allzu häufig antrifft und der von Geburt an unter psychischen Problemen leidet: »Es gibt Menschen, deren Existenz einem Zickzack-Kurs gleicht, wobei abwechselnd diese, dann jene Tendenz die Oberhand gewinnt. Ihr Geist führt Krieg gegen ihr Fleisch. Sie wollen vereinbaren, was nicht vereinbar ist, ihre wohlüberlegten Pläne werden von launischen Einfällen unterbrochen, und ihr Leben ist ein langes Drama des Bereuens und angestrengter Versuche, ihr Fehlverhalten und ihre Irrtümer wiedergutzumachen.«[3] Dies sind, in James’ Worten, die »kranken Seelen«, jene, die ebenso gut an einer Eliteuniversität einen Abschluss machen wie im McLean Asylum Selbstmord begehen können, einen Steinwurf vom Harvard Yard entfernt. Seit mehr als einem Jahrhundert gibt es Gerüchte, dass James selbst einen Abstecher in die Anstalt hinter sich gebracht hat, aber in den hundert Jahren seit seinem Tod sind sie verstummt. Heute wird James gewöhnlich als ein Mensch beschrieben, der sich seinem psychischen Leiden ohne Hilfe von Ärzten gestellt hat.
Das stimmt aber nicht ganz: Er selbst war der Arzt. William James’ ganze Philosophie, von Anfang bis Ende, zielte darauf, ein Leben zu retten, sein Leben.[4] Philosophie war nie nur eine abgehobene intellektuelle Praxis oder eine bloße Wortklauberei. Sie war überhaupt kein Spiel, oder wenn sie das war, dann war es das ernsteste Spiel der Welt. Sie handelte davon, wie man bedacht und zugleich intensiv leben könnte. Ich möchte den Lesern gern James’ existenzielles Lebensrettungsprogramm vorstellen. Natürlich ist das Leben letztendlich eine letale Angelegenheit. Niemand kommt lebend davon. Aber einige Autoren – und ganz besonders James – können uns helfen, sozusagen am Leben zu bleiben, indem sie bewahren und weitergeben, was das Wichtigste am Menschsein ist, bevor wir wieder sterben. James entwickelte ein Denken, das er eine Philosophie der geistigen Gesundheit nannte. Das ist vielleicht kein echtes Medikament gegen die kranke Seele, aber ich stelle mir diese Philosophie gern als ein wirkungsvolles Hausmittel vor.
Solch eine Philosophie wäre vollkommen unnötig, wenn es nicht Tatsache wäre, dass so viele von uns am Rande des Abgrunds taumeln. 2010 war ich selbst so weit. Ich war dreißig, steckte mitten in einer Scheidung, und hatte gerade mitansehen müssen, wie mein uns fremd gewordener, alkoholkranker Vater starb. Und ich war mit einem Postdoktorandenstipendium in Harvard und schrieb über – Sie haben es erraten – William James. Ich sollte eine Monografie über sein Verständnis von Kreativität abschließen, ein erbauliches Buch über die erlösende Wirkung seiner Philosophie, die allgemein als Pragmatismus bekannt ist. Der Pragmatismus, informierte James seine Leser im Jahr 1900, geht davon aus, dass Wahrheit an ihren praktischen Folgen gemessen werden sollte, daran, wie sie das Leben beeinflusst. Es ist ein schöner Gedanke, außer wenn einem das Leben selbst ziemlich sinnlos erscheint. James wusste das und entwickelte eine Philosophie, die sich dieser schmerzlichen Einsicht widmen sollte. Ich brauchte mehrere unglückliche Jahre, um sie zu verstehen.
Ich glaube, dass mir William James’ Philosophie das Leben gerettet hat. Oder, genauer gesagt, sie ermutigte mich, keine Angst mehr vor dem Leben zu haben. Damit will ich aber nicht sagen, dass sie bei jedem so funktioniert. Verdammt, ich kann nicht einmal garantieren, dass sie bei mir auch morgen noch so funktioniert. Oder dass sie immer funktioniert. Aber damals tat sie es, zumindest einmal, und das genügte mir, ihr ewig dafür dankbar zu sein und mehr als nur geringe Hoffnungen zu hegen, was die Aussichten für dieses Buch anbelangt. James schrieb für unser Zeitalter: eins, das Tradition und Aberglauben scheut, aber verzweifelt nach existenziellem Sinn sucht; eins, das von Überfluss gekennzeichnet ist, aber auch von Depression und akuter Angst; eins, das Ikonen verehrt, die beschließen, dass ewiger Ruhm eher verlangt, das Leben vorzeitig zu beenden. Einer solchen Kultur hält James sanft, aber nachdrücklich vor: »Habt keine Angst vor dem Leben! Glaubt daran, dass das Leben lebenswert ist, dann wird euer Glaube dabei helfen, seine eigene Verwirklichung hervorzubringen.«[5] An guten Tagen, wenn meine eigene kranke Seele sich nur leise meldet, funktioniert James’ nachdrückliche Aufforderung sehr gut. An schlechten Tagen hilft sie mir durchzuhalten. Während ich selbst James’ Philosophie immer mehr als lebensrettend bewundere und schätze, stoße ich gleichzeitig umso häufiger auf Freunde, Nachbarn und Studierende, die vollkommen und anhaltend ins Straucheln geraten sind.
Im Jahr 2014 fuhr ich mit dem Fahrrad zur Harvard University, zur Widener Library, um endlich das erbauliche Buch über James’ Pragmatismus abzuschließen. Es ging mir besser – das Buch zu schreiben schien jetzt nicht nur möglich, sondern sogar realistisch zu sein. Es war ein kalter, verschneiter Februarmorgen. Ich weiß nicht, was mich dazu trieb, mit dem Fahrrad zu fahren, aber genau das tat ich und bahnte mir meinen wackeligen und rutschigen Weg von Charlestown nach Cambridge. Die letzte Strecke führte mich über die Kirkland Avenue, an der William James Hall entlang, aber an jenem Tag war die Straße vor diesem mächtigen Gebäude durch gelbes Absperrband der Polizei abgeriegelt.
Die William James Hall lässt die umliegenden Gebäude wie Miniaturhäuser erscheinen. Harvard war größtenteils mit einem Sinn für puritanischen Anstand errichtet und im Einklang mit dem Glauben, dass der Himmel einzig Gott vorbehalten bleiben sollte, sozusagen horizontal angelegt worden. Dieses Gebäude war allerdings nicht im Geiste der Demut errichtet worden. Dieser Wolkenkratzer, 1963 von Minoru Yamasaki gebaut – dem Architekten des World Trade Center –, in dem sich heute der Fachbereich Psychologie befindet, ist dezidiert modern. Monumental und humorlos erhebt er sich als ernster Tribut an einen Mann, der wohl der größte von Harvards großen Geistern war.
Wenn man vom Dach der William James Hall einen Stein wirft, kann man damit fast James’ einstiges Haus in der Irving Street 95 treffen. Als es 1889 erbaut wurde, nannte James sein Haus »Elysium«: Der Himmel war ein zweistöckiges, neoklassizistisches Haus mit Mansardendach, mit einer ausgedehnten Bibliothek im Erdgeschoss und einem gemütlichen Arbeitszimmer im ersten Stock. Wirft man einen Stein von der William James Hall in die entgegengesetzte Richtung, verpasst man nur knapp die Emerson Hall am Harvard Yard, wo James in den ersten Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts eine durch und durch amerikanische Form der Philosophie begründete. Ralph Waldo Emerson, James’ intellektueller Pate, hatte 1837 in »Der amerikanische Gelehrte« die Ankunft eines neuen Denkertypus verkündet, der in der Folge die amerikanische Nation auf die intellektuelle Landkarte setzen würde. Als James 1910 mit achtundsechzig Jahren starb, hatte er sein Bestes getan, um Emersons Prophezeiung zu erfüllen.
Der fünfzehnte Stock der William James Hall gehört zu dem Wenigen, was dieses monströse Gebäude retten kann. In seinem zentralen Seminarraum hängt ein Porträt von James in Dreiviertelansicht, er sieht aus dem Fenster, seine tief liegenden, stechenden Augen blicken über den Rand der Leinwand hinaus und hinunter auf den Campus der Universität, der er zu ihrem Ruhm verhalf. Der Ausblick vom fünfzehnten Stock aus ist spektakulär und der Balkon bietet in über fünfzig Metern Höhe eine erfrischende Aussicht auf James’ Umgebung.
Aus fünfzig Metern Höhe braucht ein menschlicher Körper weniger als vier Sekunden, um mit einer Geschwindigkeit von hundertzehn Stundenkilometern auf dem Boden aufzuschlagen. Das letzte Mal geschah dies am eiskalten Morgen des 6. Februar 2014. Steven Rose, ein neunundzwanzigjähriger Harvard-Absolvent, nahm sich das Leben, indem er vom Dach der William James Hall sprang, und gesellte sich damit zu den mehr als vierzigtausend Menschen, die sich in dem Jahr in den USA das Leben nahmen. Ein Professor, der in dem Gebäude arbeitete, gab zu Protokoll, dass »wir es äußerst schwierig fanden, unserer täglichen Arbeit nachzugehen«.[6]
Der Professor hatte recht. Ich bin an dem Morgen nicht »meiner täglichen Arbeit« nachgegangen. In Wahrheit bin ich ziemlich sicher, dass Ereignisse wie diese unsere tägliche Arbeit sogar unterbrechen sollten. Im Polizeiprotokoll wurde Roses Sturz am nächsten Tag als »ein unbegleiteter Todesfall« beschrieben, aber ich kann Ihnen versichern, dass dies nicht ganz stimmt. Ich stieg vom Fahrrad und stellte mich zu den mehreren Dutzend Schaulustigen am Rande der abgesperrten Zone an der Kirkland Avenue, um zu ermessen, was geschehen war. Nachdem wir eine halbe Stunde lang in der Kälte gestanden hatten, beschlossen die meisten von uns, dass die passende Frage nicht »Was ist geschehen?« lauten sollte, sondern »Warum ist es geschehen?«.
Das ist immer noch eine sehr gute Frage, eine, die einer bloß allgemeinen oder Allerweltsantwort trotzt. Bis zu dem Zeitpunkt hatte ich oft gedacht, dass ich in meinem nächsten Leben gern als Harvard-Erstsemester zurückkäme. Diese Chance und das Privileg – die schiere Freiheit dieser Erfahrung – sind unvergleichlich und wirken von außen wie ein unbezweifelbares Gut. Natürlich würde Steven Rose mir wahrscheinlich sagen, dass ich dumm und unsensibel sei. Und William James auch. So etwas wie ein unbezweifelbares Gut gibt es nicht. Der Anschein kann trügerisch sein. Freiheit ist auch mit Ängsten verbunden. Privilegien können zu einer unverrückbaren Last werden. Und eine Chance ist schnell vertan. Es hängt alles von dem jeweiligen Leben ab, das man gerade führt.
»Ist das Leben lebenswert?« 1895, fünfundzwanzig Jahre nachdem er den Selbstmord in Erwägung gezogen hatte, rang James immer noch mit dieser Frage. James zufolge gab es nur eine Antwort, die der Realität von Roses Tod gerecht werden würde, aber auch vielleicht sein Leben gerettet haben könnte: »Vielleicht.« Vielleicht ist das Leben lebenswert – »es hängt von der Leber ab.«[7] Vielleicht sind manche Leben so unlebbar oder unerträglich, dass man sie besser beenden sollte. Vielleicht war das von Steven Rose so ein Leben. Vielleicht aber auch nicht, würde James sagen. Manchmal gab es immer noch genug Zeit, etwas wahrzumachen, was den Sinn des Lebens betraf, etwas von Wert zu finden oder, besser gesagt, zu machen, bevor es zu spät war.
Nach einer Stunde im Schnee löste sich die Menge auf und am späten Nachmittag wurde das Absperrband vor der William James Hall entfernt. Ich bin an jenem Tag nicht mehr meiner üblichen Arbeit nachgegangen; stattdessen beschloss ich, ein Buch zu schreiben, das James vielleicht für Männer und Frauen wie Steven Rose geschrieben hätte, ein Buch, das jenes »Vielleicht« des Lebenssinns genauer betrachtet und einstweilen zum Schluss kommt, dass das Leben hinreichend lebenswert ist.
Dies ist ein Versuch, James’ Weisheit weiterzugeben, seine Idee weiterzugeben, dass das Leben wirklich Möglichkeiten bietet, die man in aller Freiheit und Ernsthaftigkeit erkunden kann, allerdings nur auf sein eigenes Risiko. James war als junger Mann nahe daran, sich all dieser Möglichkeiten zu berauben. Am Ende meinte er allerdings – in vielen verschiedenen Tonlagen –, dass dies dezidiert der falsche Weg sei, sein Leben zu beenden. Wir alle werden früh genug das Zeitliche segnen. Die Aufgabe ist, in der Zwischenzeit einen Weg zu finden, wie man leben kann, wahrhaft leben. William James kann den Menschen dabei helfen, diesen Weg zu finden.
1 Determinismus und Verzweiflung
Zum normalen Lauf des Lebens gehören Momente der Art, wie sie in der melancholischen Geistesgestörtheit zuhauf vorkommen, Momente, in denen das Böse radikal zuschlägt. Die Schreckensvisionen des Wahnsinns entnehmen ihren Stoff alle der alltäglichen Wirklichkeit.
– William James, Die Vielfalt religiöser Erfahrung, 1903
In gewisser Weise sind unser Weg ins Leben und unser Lebensweg ohne unsere ausdrückliche Einwilligung vorentschieden worden. Niemand fragt uns, ob wir geboren werden wollen oder ob wir lieber in dieser Familie als in jener aufwachsen wollen. Unsere Hautfarbe, das Geschlecht, unsere sozioökonomische Lage und die Gesundheit sind weitestgehend zufällige Faktoren. Wir sind in den Worten des deutschen Philosophen Martin Heidegger »in die Welt geworfen«, wir sind ausgesetzt und in unserem Leben, bis weit in die Adoleszenz hinein, Kräften ausgeliefert, die jenseits unserer Kontrolle liegen.
Bei vielen Menschen befreit sie auch das Erwachsenenalter nicht von diesen Umständen. »Trotz der vorgefassten Meinung, dass Suizide sich häufiger in Ländern mit hohen Einkommen ereignen«, erklärt die Weltgesundheitsorganisation, »ereignen sich tatsächlich 75 Prozent der Selbstmorde weltweit in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen.« Die Zahlen in dieser Statistik sind, nehme ich an, Ausdruck einer unerträglichen Situation und auch der Weigerung, sie zu tolerieren. Natürlich, wenn das Schicksal uns wohlgesinnt ist, sind auch die Kräfte, denen wir unterliegen, wohlmeinend und wir werden nicht in erbärmliche Armut hineingeboren, aber sogar die uns wohlgesinntesten Kräfte können dazu führen, dass wir den Boden unter den Füßen verlieren.[8]
William James war offenkundig einer von den sehr vom Schicksal Begünstigten. James, der 1842 in New York City geboren wurde, wuchs in einer Familie auf, die von altem Geld profitierte – von sehr viel altem Geld –, und mit einem Vater, Henry James senior, der seine Kinder abgöttisch liebte. James wurde verwöhnt, aber nicht auf die Art, wie wir es normalerweise erwarten würden.
1832 hatte Henry James senior von seinem Vater, der einen Banken- und Immobilienkonzern im Staat New York geleitet hatte, fast eine Million Dollar geerbt, in jenen Tagen eine gewaltige Summe. Henry James senior hatte allerdings nicht vor, in das Familienunternehmen in Albany einzusteigen. Nicht einmal ansatzweise. Nun, da er unabhängig und wohlhabend war, wandte sich Henry von weltlichen Belangen ganz ab und widmete sich dem Studium der Religion, der Philosophie und der Naturwissenschaften.
Als sein ältester Sohn William geboren wurde, war Henry James senior gerade dabei, seinen endgültigen Bruch mit der modernen materialistischen Tretmühle zu vollziehen, aber auch mit dem strikten Calvinismus seines Vaters, der alles in rasender Bewegung gehalten hatte. Der Calvinismus, wissen Sie, ist eine Religion des Gehorsams und der absoluten Kontrolle, Gottes Kontrolle. Die Menschen sind entweder gesegnet und deshalb dazu »erwählt«, in den Himmel zu kommen, oder verflucht und daher zur Hölle verdammt. Aber es gibt keinen bewährten Weg, um herauszufinden, welcher Typ Mensch man ist. Nur eins ist ganz sicher: Man hat sein Schicksal nicht selbst in der Hand. 1844, als William zwei Jahre alt war, erklärte Henry senior:
Ich hatte […] mir angewöhnt, dem Schöpfer, was mein Leben und meine Handlungen anbelangte, ein äußerst strenges Urteil und eine geradezu neidische Prüfung von außen zuzuschreiben, und hatte dementsprechend dem Gottesdienst und seiner Anbetung die allergrößte Aufmerksamkeit zukommen lassen, bis mein Wille, wie du gesehen hast – vollständig gerädert, wie er war, durch die trockene, endlose und herzlose Aufgabe, eine Gottheit mit einem steinernen Herzen zu besänftigen – regelrecht zusammenbrach.[9]
Aus James’ des Älteren Sicht stellte einem der Calvinismus eine unmögliche Aufgabe: den menschlichen Willen frei und sinnvoll auszuüben, um einen Gott zufriedenzustellen, der gleichzeitig allmächtig und unendlich fern war. Dieser Aufgabe nachzukommen, trieb Henry James senior in etwas hinein, das er später »eine Verwüstung« (»vastation«) nannte, abgeleitet vom lateinischen Wort vastare, was »in Schutt und Asche legen« bedeutet – ein Zustand völliger spiritueller und persönlicher Vernichtung. Man sollte sich so verhalten, als ob die eigenen Handlungen in einem moralischen und existenziellen Sinne eine Bedeutung hätten, aber die Bedingungen von Gottes göttlichem Heilsplan legten eigentlich nahe, dass diese Handlungen im Grunde erbärmlich wenig zählten. Gott mochte einen Plan haben, aber die Übel der menschlichen Existenz verblieben nichtsdestotrotz.
Henry entkam seiner »Verwüstung« schließlich durch das mystische Training eines lutherischen Mystikers namens Emanuel Swedenborg. Indem er Swedenborg las, erreichte Henry einen »erhobenen Zustand« und sein Geist wurde »durch ein plötzliches Wunder in eine gefühlte Harmonie mit dem Universum […] und dem unzerstörbaren Leben versetzt«.[10] Die religiöse Krise, die Henry James Anfang der 1840er-Jahre erlebte, prägte die Erziehungsregeln in dem Zuhause, in dem William James aufwuchs. Freiheit: Das war nun der immerwährende Prüfstein, das Kriterium, das das Familienleben leitete. William wurde, zusammen mit seinen frühreifen Geschwistern Henry und Alice, völlig freie Hand gelassen, zu spielen, zu lernen, zu lesen, zu reisen – was immer er tun wollte und wie es ihm gefiel. Das Einzige, was nicht erlaubt war, war, den Möglichkeiten dieser begabten Kinder Grenzen zu setzen. Selbst Wilkinson und Robertson, die beiden James-Brüder, die ihr Vater nicht zu geistiger Größe bestimmte, wurde eine großzügige Erziehung zuteil.
Hinter dem Wahnsinn des Vaters lag eine gewisse Überzeugung, eine Methode, sogar eine sehr schöne. Er glaubte, dass der Sinn des Lebens nicht einfach darin lag, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, eine eng umschriebene Aufgabe zu übernehmen und sie Tag für Tag zu wiederholen. Es ging nicht ums Geldverdienen oder darum, die Stechuhr zu betätigen. Stattdessen lag das Ziel der menschlichen Existenz darin, einen guten Charakter zu entwickeln. »Und insofern«, schrieb Henry James senior über die Erziehung seines Sohnes, »als ich weiß, dass ihm dieser Charakter nicht mit Gewalt aufgezwungen, sondern er nur aus freien Stücken angenommen werden kann, umgebe ich ihn, so weit wie möglich, mit einer Atmosphäre der Freiheit.«[11]
William James wuchs, wie man es vielleicht von einem Jungen erwarten würde, dem die Aufgabe übertragen worden ist, frei zu sein, an wechselnden Wohnorten auf: schon mit zwei Jahren in Paris, Rouen, Kent und London, in Albany mit vier und in New York mit fünf Jahren. 1855 kam sein Vater zum Schluss, dass das Erziehungssystem der New Yorker Elite für einen Zehnjährigen viel zu einschränkend sei, also zog die Familie wieder um: zurück nach Paris, dann nach Lyon, nach Genf und schließlich nach Boulogne-sur-Mer auf der französischen Seite des Ärmelkanals.
Ralph Waldo Emerson, einer der engsten Freunde Henry James’ senior, meinte zwar, dass »Reisen eine Illusion« sei, aber bei der Erziehung von William James funktionierte es ziemlich gut, zumindest eine Zeit lang. Sein Vater hoffte, dass seine Kinder einfach »irgendwo sein konnten – letztlich könnte es beinahe überall sein – und irgendwie einen prägenden Eindruck gewinnen oder einen Zuwachs erlangen, eine Beziehung oder eine Schwingung fühlen«.[12] Das musste genügen. James’ formaler Unterricht war überhaupt nicht förmlich, sondern ein Nebenprodukt von Zufällen und glücklichen Umständen oder, besser gesagt, dem Ausgesetztsein – James war der Welt ausgesetzt, wurde häufig ermutigt, ihre Reichtümer zu erleben und gelegentlich auch ihre Mängel und mit ihren natürlichen und kulturellen Gaben zu experimentieren. In Wahrheit hoffte sein Vater, dass sein Sohn mit sich selbst experimentieren würde – Hypothesen zu bilden, zu prüfen und zu beobachten, was aus einem jungen Mann vielleicht werden könnte.
Als sich der Teenager William James speziell für ein Experiment entschied und damit andere ausschloss, warnte ihn sein Vater umgehend davor, allzu früh seinen Spielraum einzuengen. Das scheint 1860 der Fall gewesen zu sein, als die Familie James wieder einmal entwurzelt wurde und nach Newport, Rhode Island, umzog, damit William James Malerei bei William Hunt studieren konnte, wahrscheinlich dem talentiertesten amerikanischen Porträtmaler seiner Zeit. Henry James senior unterstützte zunächst den Enthusiasmus seines Sohnes, erinnerte ihn dann aber daran, dass diese Berufung, selbst eine so dezidiert unkonventionelle, den Effekt haben könnte, seine persönliche Weiterentwicklung abzuwürgen. Trotz der lockeren Atmosphäre seiner Kindheit hatte es Williams Vater bislang immer noch stets am besten gewusst, aber bei dieser Gelegenheit stieß er auf Widerstand: »Ich sehe nicht, warum die geistige Kultur des Menschen«, schrieb William im August 1860 an seinen Vater, »sich nicht unabhängig von seinen künstlerischen Aktivitäten weiterentwickeln sollte, warum die Kraft, die ein Künstler in sich verspürt, ihn dazu verführen sollte, zu vergessen, was er ist, ebenso wenig wie die Kraft, die ein Cuvier oder Fourier verspürten, sie auf gleiche Weise zu Selbstvergessenheit verleiten könnte.«[13]
Trotz dieses Protests dauerte James’ Ausflug in die professionelle Malerei nur ein Jahr. Hatte er erkannt, dass sein Sinn für Perfektionismus seine technischen Fähigkeiten überstieg? Wahrscheinlich. Zermürbte die Missbilligung seines Vaters außerdem seine Entschlossenheit? Bestimmt. Wie dem auch sei, James verließ 1861 Newport und nahm eine intellektuelle Haltung an, die er mehr oder weniger für den Rest seines Lebens bewahren sollte: William James fühlte sich der Wissenschaft verpflichtet. Sein Kommentar in Bezug auf Cuvier und Fourier – der Biologe und der Physiker par excellence – war ein Vorbote seines anhaltenden Versuchs, sich zu Asa Gray, Louis Agassiz und Benjamin Peirce als ein amerikanischer Mann der Wissenschaften hinzuzugesellen. Henry James senior war über diese Entwicklung der Dinge wesentlich zufriedener. Scientia – Wissen – würde seinen Sohn befreien.
Wenn dies so klingt wie die Anfangsseiten einer Geschichte über einen armen kleinen reichen Jungen, dann weil sie das auch ist. Zumindest in Teilen. James wurde jede nur erdenkliche Möglichkeit gewährt, sich zu entfalten und sich vor den härteren Lebensrealitäten auf der Welt abzuschirmen. Er war, einfach gesagt, verwöhnt.
Es gibt allerdings auch Gründe, sich diese Geschichte zu verkneifen. James’ verzogene Adoleszenz und die darauffolgende Desillusionierung spiegeln mit verstörender Folgerichtigkeit die psychischen Verletzungen wider, die viele aus der privilegierten Klasse der Gegenwart erfahren. Ich rede nicht bloß von den Kate Spades, Margot Kidders und Anthony Bourdains dieser Welt – obwohl ihre Selbstmorde besonders dramatische und tragische Fälle der jüngsten Vergangenheit sind –, sondern von jedem, der jemals genug freie Zeit hatte, um die Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, dass das Leben womöglich vollkommen sinnlos sein könnte. Thomas Hobbes hat vielleicht darin recht, zu behaupten, dass Müßiggang die Mutter der Philosophie sei, aber Müßiggang ist für viele Menschen auch eine Quelle grauenhafter Depressionen. Erst wenn jemand einmal wirklich alles bekommen hat, kann derjenige auch begreifen, dass all das vielleicht nie ausreichen wird, um wirklich dauerhaft Sinn zu stiften. Es bedarf nur einer minimalen Irritation in einem komfortablen Alltag – nur einer anhaltenden Störung in einer sonst perfekten Existenz –, um diese dunkle Einsicht zutage zu fördern. An diesem Punkt, um es mit den Worten von Albert Camus zu sagen, »stürzen manchmal die Kulissen ein«.[14] Für William James setzte das im Frühjahr 1862 ein.
Dies war das Jahr, in dem William Morris Hunt, James’ einstiger Malereilehrer, seinen Drummer Boy malte. Vor einem sich verdunkelnden Himmel steht ein kleiner Junge, vielleicht zehn Jahre alt, allein auf einem Piedestal, allein, bis auf die mächtige Marschtrommel, die er umgeschnallt hat, sein Arm ist in den wolkigen Himmel erhoben, damit er den Ruf zu den Waffen intonieren kann. Auf dem Piedestal steht nur in einfachen Worten, als Befehl an alle wehrtüchtigen Männer: »U.S. Freiwillige«.
Mit der Wahl von Abraham Lincoln hatten sich die Südstaaten abgespalten und der Bürgerkrieg nahm an Intensität zu.
Garth Wilkinson »Wilkie« James reagierte sofort auf den Aufruf des Drummer Boy und meldete sich 1862 mit siebzehn Jahren freiwillig zum Kriegseinsatz. »Als ich in den Krieg eintrat, war ich ein Junge von siebzehn Jahren, der Sohn von Eltern, die der Sache der Union und der Abschaffung der Sklaverei ergeben waren«, erinnerte sich Wilkinson später. »Ich war im Glauben erzogen worden, dass die Sklaverei ein monströses Unrecht sei und ihre Abschaffung aller Mühen wert, sogar der Opferung des eigenen Lebens.«[15] Er musste 1863 in der Schlacht um Fort Wagner beinahe sein eigenes Leben opfern, wo er sich schwere Verletzungen zuzog, von denen er sich nie wieder vollständig erholen sollte. Robertson James betrachtete die Verwundung seines Bruders als einen Grund mehr, um sich den Kämpfen im Februar 1864 anzuschließen.
Aber wo war William James? Er war im einsatzfähigen Alter, als die Kämpfe ausbrachen, älter als beide seiner Brüder. Er wuchs ja ebenfalls in diesem Haushalt auf, der die Sklaverei verabscheute und das Recht auf Freiheit fest verankert hatte. Auch er hätte willens sein sollen, das ultimative Opfer für die Sache der Union zu erbringen. Er war wohl auch willens. Aber war er auch dazu fähig? James meldete sich nie freiwillig. Er war der erwählte Sohn seines Vaters, aber auch ein eher kränklicher junger Mann mit schlechten Augen. Er stand am Rande, während seine jüngeren Brüder zu echten Helden wurden, oder, in den Augen der Nation, zu echten Männern. Ralph Barton Perry, Student von James und sein menschenfreundlichster Biograf, kommt zum Schluss: »Ich kann bei William James nichts entdecken, was darauf verweist, dass er in den 1860er-Jahren zum Manne gereift ist.«[16]
Louis Menand führt aus, dass der Bürgerkrieg den Kontext für James’ philosophische Arbeiten bildete: Die Zerstörungen durch einen Konflikt, der von großen ideologischen Visionen motiviert war, überzeugten James und seine pragmatistischen Kollegen davon, eine Philosophie der gemäßigten und ständig überprüfbaren Vorstellungen und Ziele zu entwickeln.[17] Ich neige zu der Annahme, dass der Bürgerkrieg James’ Perspektive auf eine unmittelbarere und irritierendere Weise beeinflusste. Relativ hilflos dabei zusehen zu müssen, wie geliebte Menschen in den Krieg ziehen, Zeuge der unausweichlichen Zerbrechlichkeit der menschlichen Existenz zu werden, Ohnmacht und unterdrückte Ambitionen erleben zu müssen – dies war der erste Wink an James, dass er, ebenso wie der Rest des Universums, nicht frei, sondern vom Schicksal determiniert war.
Wenn man die Beinahebesessenheit der Familie James von der Freiheit bedenkt, war William jetzt beinahe dazu verdammt, das Gefühl entwickeln zu müssen, letztlich vollkommen festzustecken. Das ganze bisherige Leben des jungen Mannes hatte unter dem Vorzeichen gestanden, dass er jederzeit seinen freien Willen ausüben könne. Es war nur eine Frage der Zeit, bis er entdeckte,